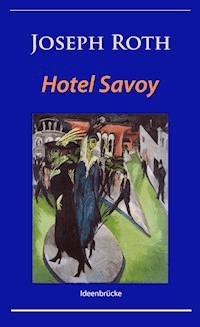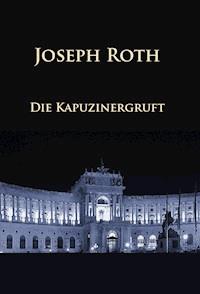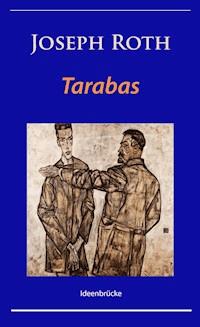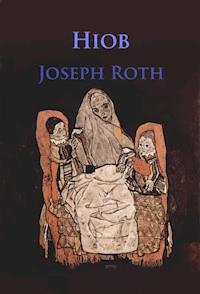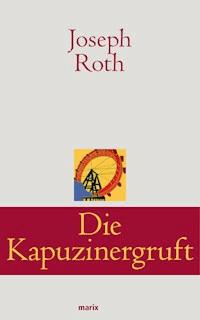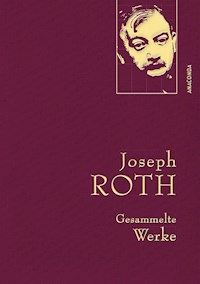Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Vermessung der Welt des Kinos mit den Mitteln des Feuilletons. Joseph Roth zählte in der Weimarer Republik zu den angesehensten Feuilletonisten im deutschen Sprachraum. Neben seinen Reportagen, Reiseberichten, Buchrezensionen und Theaterkritiken, die er für die wichtigsten deutschsprachigen Blätter schrieb, etablierte er sich auch als Filmkritiker. In den knapp hundert, teilweise erstmals in Buchform veröffentlichten Texten dieses Bandes findet sich eine Fülle sehr unterschiedlicher Blicke auf das Phänomen Kino: Roth schreibt über Filmpremieren, setzt sich mit der »Kinodramatik" auseinander, besucht Drehorte und berichtet über die Filmbranche und den neu entstehenden Starkult. Die cineastische Tagesware der Weimarer Zeit wird ebenso kritisch durchleuchtet wie spätere Klassiker des Genres Stummfilm, etwa »Der letzte Mann" von Alfred Murnau oder Fritz Langs »Nibelungen" - Momentaufnahmen aus der Frühzeit des Mediums Film, entstanden in der Übergangszeit vom Stumm- zum Tonfilm, dem Roth keine große Zukunft prophezeite. Ergänzt wird der Band durch drei Filmentwürfe, mit denen sich Roth im Exil allein bzw. in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Leo Mittler in dieser Branche versuchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Roth
Drei Sensationen undzwei Katastrophen
Feuilletons zur Welt des Kinos
Herausgegeben und kommentiertvon Helmut Peschinaund Rainer-Joachim Siegel
Inhalt
Feuilletons zur Welt des Kinos
1919
1920
1921
1922
1924
1925
1926
1929
1930
1931
1934
1935
Treatments
Kinder des Bösen
Der letzte Karneval von Wien
[Die Eiffel ist eine sehr entlegene …]
Anhang
Editorische Notiz
Abgekürzt zitierte Literatur
Anmerkungen
Nachwort
Dank
Register
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
Film im Freistaat
Ein bekannter Kinoschriftsteller erzählt in einem Buche über Films einige echte Zensorenstückchen und gibt Kinoschriftstellern folgenden guten Rat: »Politische Beziehungen sind stets zu vermeiden. Die Bezeichnung »Fürst« ist verpönt, hierfür ist »Prinz« zu gebrauchen …«
Die Allgewalt des Rotstiftes erstreckte sich nämlich nicht nur auf Zeitungen, Bücher, Broschüren. Auch die Flimmerwelt des Kinos wurde vom Vormärzgespenst der Zensur beherrscht. Die Wirkung des Kinos auf das Volk, die ja bei weitem unmittelbarer und stärker ist als die Wirkung von Zeitungen, wurde von den Vertretern des alten Regimes voll gewertet und richtig eingeschätzt. Auch hinter den Kulissen des Kinos stand Tartüffe mit drohendem Zeigefinger. Ein Kuß konnte unter Umständen einen g’schamigen Zensor wütend machen. Ein Ehebruch erschien dem Rotstifte zuweilen als eine ungeheure Gefahr für die Moral des Publikums. Die Darstellung eines allerhöchsten Lebens gar bedeutet ein Rütteln an den Grundfesten des Staates. »Die Bezeichnung »Fürst« ist verpönt …« Aber dafür durfte man »Prinz« schreiben, um die Illusion des Märchens zu wahren, als geschähe die Begebenheit im Lande Nirgendswo. Die Wirkung war ja dieselbe, manchmal sogar noch stärker. Denn, wie der Dramatiker, so wurde auch der Kinoschriftsteller von der Zensorenkraft, die stets das Böse wollte, aber fast stets das Gute schuf, zu Spitzfindigkeiten angeregt, die es ermöglichten, dem Publikum alles verständlich zu machen und dem Zensor hinter dessen Rücken einen Schabernack zu spielen.
Heute ist natürlich auch der Kinodramatiker frei. Er darf von »Fürsten« schreiben, soviel ihm behagt, ohne von »Prinzen« sprechen zu müssen. Er darf allerhöchste Ehebrüche darstellen, ohne daß der Staat in Brüche ginge. Die ganze verlogene Kinokultur ist zu Ende. Die Gebärde des »Schulter an Schulter« und »wir halten fest und treu zusammen« ist ausgespielt. Ein Erzherzog im Schützengraben läßt den Zuschauer heute gleichgültig. Eine hohe Frau, die gelangweilt in Kriegsspitälern wandelt, ist unmodern. Und so ist mit Kaiser und Hofstaat auch eine Anzahl von Films unbrauchbar geworden. Der Film muß Schritt halten mit dem Galopp der Weltgeschichte. So dürfte heute keiner mehr das Kinodrama als »rührend« empfinden, in dem ein Prinz einem Mädchen aus dem Volke einen Heiratsantrag macht. Vielmehr wird heute der Umstand, daß dieses Mädchen den Heiratsantrag annimmt, rühren. Ein Zeitalter, in dem Soldatenräte eine Hofburg durchsuchen, hat kein Interesse mehr an den Bewohnern eines Schlosses. In Zukunft haben Bolschewike und Spartakist die Rolle des unvermeidlichen »Grafen« und »Barons« übernommen. Die Revolution ist die künftige Beherrscherin der Kinowelt. Wie die Phrase aus Zeitungen, so wird die verlogene Gebärde aus dem Kino verbannt. Es ist zu erhoffen, daß die Natürlichkeit auch auf der Leinwand zur Geltung kommt. Byzantinismus und Tartüfferie sind gegangen. Ihre Stelle nehmen ein: Vernunft und Sittlichkeit.
So wird auch der Film im Freistaate eine Entwicklung nach aufwärts nehmen. Auch er wird eine neue Zeit im wahrsten Sinne des Wortes »anschaulich machen«. Die Zeitgeschichte bietet Stoff genug. Revolutionen und Putschversuche häufen sich wie die Wiener Straßenbahnunfälle. Könige gehen, wie vormals Minister. (Ein Glück, daß sie nicht die Fähigkeit haben, wie diese wiederzukommen.) Mit einer Schnelligkeit hetzen einander die Ereignisse, als wäre die Geschichte der Gegenwart selbst eine Kinovorstellung. Und genau, wie im Kino, wechselt tiefste Tragik ab mit urkomischer Heiterkeit. Das Leben erfindet Verwicklungen, Höhepunkte, Peripetien und Katastrophen, wie sie die kühnste Phantasie eines Filmdramatikers nicht ausdenkt … Film im Freistaat? Vielleicht: Der Freistaat – ein Film?!…
Die Typen des Detektivdramas.
Der Detektiv:
Die besten Einfälle und die scharfsinnigsten Gedanken saugt er aus seiner kurzen, englischen Pfeife. Ohne diese Pfeife müßte er rein seinen Beruf wechseln. Er könnte dann z.B. jugendlicher Liebhaber werden, denn dazu braucht er keine Gedanken.
Das hervorspringendste Merkmal an ihm ist die Nase, die symbolisch seinen Spürsinn andeutet. Seine Blicke durchdringen alles, sogar seine englische Sportkappe, die er gewöhnlich bis über die Augen herabgezogen hat. Sein Kinn ist energisch. Charakteristisch für ihn ist noch, daß er nie einen Schnurrbart trägt, warum, weiß man nicht. Vielleicht hat er keine Zeit, sich einen solchen wachsen zu lassen, denn er ist immer beschäftigt. Auch wenn man meint, daß er nichts tut, jagt er im Geiste einem Verbrecher nach, und mancher Detektiv soll sich bei dieser Gelegenheit schon eine Lungenentzündung geholt haben.
Die Hände hat er gewöhnlich tief in den Manteltaschen vergraben, wenn er nicht gerade zufällig, was ja öfter vorkommt, einen Verbrecher ergreift. Vor zirka zwei Jahren soll es aber einen Detektiv gegeben haben, der die Gewohnheit hatte, die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Was ihn dazu bewogen hat, ist bis heute noch unaufgeklärt.
Eine der wichtigsten Extremitäten seines Körpers ist der Revolver. Derselbe ist zwar immer blind geladen, aber nichtsdestoweniger bricht der Verfolgte meistens zusammen, wenn der Detektiv auf ihn schießt.
Ansonsten wäre von ihm noch zu sagen, daß er selbst kugelfest ist und einen dehnbaren, aalglatten Körper besitzt, mit dem er sich durch jede Verwicklung hindurchwindet.
Der Verbrecher:
Man unterscheidet zwei Arten von Verbrechern und zwar solche, die etwas verbrechen, um einen Vorteil dabei zu erlangen, das sind: gewöhnliche Einbrecher, die materiellen Gewinn suchen, Professoren, die ihre geistigen, Liebhaber, die ihre körperlichen Nebenbuhler ermorden, u.s.w., und solche, die aus Liebe zu ihren Beruf morden. Beide Spezies erkennt man an ihrem dämonischen Gesichtsausdruck und an ihren abstehenden Ohren. Allerdings gibt es noch Verbrecher »aus verlorener Ehre« und Verbrecher, die zufällig, ohne Absicht ein Verbrechen begehen, diese aber sind harmloserer Natur und kommen für das Kinodrama nur selten in Betracht.
Der Verbrecher führt seine Taten mit dem erstaunlichsten Raffinement und den unglaublichsten Mitteln aus. Der Kinoeinbrecher sprengt eine Tischlade prinzipiell nicht mit der Messerklinge auf, sondern er verwendet dazu immer einen Sauerstoffapparat. Der Mörder mordet nur mit vergifteten Haarnadeln, narkotischen Zigaretten, indischen Zaubertränken u.s.w. Der Revolver gilt als veraltet. Wenn er seine Tat vollbracht hat, sorgt er dafür, daß ein womöglich genauer Fingerabdruck von ihm auf dem Tatorte zurückbleibt, dann sucht er das Weite. Hierzu benützt er meistens ein Automobil, er springt aber auch mit Vorliebe von Brücken auf fahrende Eisenbahnzüge herab.
Der Verbrecher hat kein Gewissen, denn er ist ein Verbrecher. Nur eine halbe Stunde vor seinem Tode verspürt er gewöhnlich Gewissensbisse und bereut seine Taten. Dann stirbt er.
Der Ermordete:
Dieser lebt gewöhnlich nur bis zu seiner Ermordung und kommt daher meistens nur im ersten Akt vor. Nach seiner Ermordung hat er die Aufgabe, seinem Mörder in Visionen zu erscheinen.
Die Hinterbliebenen:
Die männlichen Hinterbliebenen tragen Zilinderhüte und fahren sich von Zeit zu Zeit mit dem Handrücken über die Augen. Die weiblichen Hinterbliebenen dagegen tragen Trauerkleider und haben gut entwickelte Tränendrüsen, die sich öfters entleeren.
Der Tendenzfilm.
Lehrmeister und Tugendbläser sind unsterblich. Da es heutzutage nicht mehr angeht, das Bühnendrama mit dem Lesebuch für Volksschulen zu verwechseln und in jenem die Moral zu predigen, die für dieses vorgeschrieben ist, wurde das Kinodrama zur praktischen Pädagogik ernannt, und der Tendenzfilm war da. Das Kino wird als moralische Schaubühne betrachtet und ist ein Requisit der Volkserziehung, wie Rohrstab und Einmaleins. Es ist sehr lehrreich, auch an Vergnügungsstätten die bösen Folgen einer Teufelssünde an der Haut eines anderen zu erleben, aber eine etwas unangenehme Überraschung ist es, wenn ich zwanzig Jahre nach der Absolvierung der Volksschule mich in’s Kino unterhalten gehe und dort die Fortsetzung des Lesebuches in Illustrationen erlebe. Daß der Säufer in’s Unglück gerät, seine Familie zerstört, der Verbrecher erwischt wird, der Hinterlistige selbst in die Grube hineinfällt, der Geizhals verhungert, der Verschwender sich aufknüpft u.s.w. sind so allgemein bekannte Tatsachen, trotzdem sie so selten vorkommen, daß ihre Darstellung im Film zu lehrreichen Zwecken vollkommen verfehlt erscheint. Wenn mich alle die zuckersüßen Geschichten des Schullesebuches schon genügend überzeugt haben, daß ihr Inhalt keineswegs den Tatsachen des Lebens entspricht, so wird eine glatte und plumpe Illustrierung dieser Geschichten überflüssig. Kein erwachsener Mensch wird glauben, daß in dieser besten aller Welten, Edelmut und Güte belohnt werden. Aber selbst auf die Gefahr hin, die Sittenpolizei an die Filmleinwand zu malen, behaupte ich, daß ein Kinostück, das höheren Aufgaben, als einer Pseudoerziehung gerecht zu werden versucht, eine viel sittlichere Wirkung übt, denn ein tendenziöses Machwerk mit durchscheinender Philistermoral. Es gilt vor allem, die Klasse des Volkes ästhetisch zu erziehen, und das heißt zugleich: moralisch. Jener süßlich-fade Gefühlskitsch mit dem Sittensprüchlein als Höhepunkt des »Dramas« und Gipfel der »Kunst«, jener bekannte Ansichtskartenkitsch mit der goldenen Inschrift: »Ewig Dein!« und dem schmachtenden Augenaufschlag einer sentimentalen Gartenlaubenhäuslichkeit muß verschwinden. Das Kino muß sich in den Dienst einer vernünftigen Volksaufklärung stellen, die nicht mit einem lächerlichen »Kinderschreck« vor die Massen tritt, sondern mit Mitteln arbeitet, die auf reife Menschen unmittelbare Wirkung ausüben. Wenn zu Beginn und während des Krieges die Kinodramen vor Vaterlandsliebe und Kaisertreue überflossen, so war das nicht weniger bewußte Volksverführung, als die hochpatriotischen Leitartikel alldeutscher Blätter. Überhaupt ist die Ausmünzung des Kinowertes in Politik oder Parteipolitik Unfug und Unsinn. Es wird kein Zuschauer bekehrt und keiner gebessert. Er soll vor allem aufgeklärt werden. Und das nur mit Hilfe eines Films, der das Leben weder verzuckert noch verfolgt, sondern es getreu in einer wenigstens halbwegs künstlerischen Fassung wiedergibt. Erst dann, wenn der Film nur die Tendenz enthält, die auch das Leben hat, wird jenes Ziel erreicht werden, das mit dem sogenannten »Tendenzfilm« nur verfehlt wurde und wird. Erziehung, meine Herren Filmautoren, nicht Moralpauke und – wenn möglich – Kunst statt Kitsch! –
Knigge im Film.
Weltentrückt liegt das kleine deutsch-mährische Städtchen, in das mich vor wenigen Monaten ein unerbittliches Schicksal und eine lokale Schneckenbahn entführt hatten. Das alte Rathaus mit dem etwas verunglückt aussehenden gotischen Turm, ein biederes Gasthaus mit breitem Eichenbett aus guter, alter Zeit, ein behäbiges Kaffeehaus mit althergebrachten Stammtischen, die Wände mit wohlmeinenden Sprüchlein tapeziert – das alles bereitete mich auf ein gemächliches, wenn nicht spießbürgerlich-solides Stadtleben vor, das ich einem unerforschlichen Ratschluß rücksichtslos konsequenter Götter zufolge einige Wochen lang führen sollte. Allein schon der nächste Morgen brachte eine Überraschung. Es gab einen regelrechten Vormittagskorso auf dem rechteckigen Rathausplatz, den eine bunte Menge bevölkerte. Junge Damen in modernsten Gewändern, Herren und Herrchen in Kleidern nobelster Fasson und großstädtischen Zuschnitts und selbst ein Herr mit einem Monokel. Man denke: ein Monokel! Auch benahm sich die Jugend auf Straßen und in öffentlichen Lokalen durchaus nicht kleinbürgerlich-manierlich, sondern mit Schwung und einer geradezu akkuratessen Eleganz. Lange dachte ich über die Gründe dieser Sittenfeinheit in S. nach. Bis mich ein regnerischer Sonntagnachmittag in’s Kino und damit auf die Lösung des Rätsels brachte. Ich sah dichtgefüllte Reihen, und aufgeregte Premierenstimmung beim Publikum. Junge Mädchen mit glühenden Blicken. Gymnasiasten mit würdevollem Ernst, gespannt den Ereignissen des Dramas folgend. Jede Handbewegung, jeder Augenaufschlag des Helden oder der Heldin wurde von der zuschauenden Jugend geradezu verschlungen. Und ich verstand den erzieherischen Einfluß des Kino’s auf die Jugend dieser Kleinstadt. Plötzlich war ich sehend geworden: daher hatten die Frauen dieses kokette Mienenspiel, jenes hoheitsvoll-herablassende Kopfnicken, wenn man sie grüßte. Das kleine Laufmädel benahm sich wie eine Dame. Die blonde Verkäuferin des Papiergeschäftes in der Ecke mimte eine Prinzessin. Der Alltag war Film geworden. Das nüchterne kleine Ereignis – Szene. Und sie selbst, all diese kleinen Männlein und Weiblein waren Helden und Heldinnen. Asta Nielsen und Henny Porten, Harry Walden und Psylander in zehntausend Auflagen. – In tausenden solcher abseits liegenden Städtchen mag wohl das Kino die Rolle einer Erziehungsanstalt spielen. Eine künstliche Fata morgana, spiegelt es dem nach der »großen Welt« dürstenden kleinstädtischen Lehrmädel das »Leben« vor, jenes Leben, das ihm vielleicht immer unerreichbar bleiben wird. Aber aus schattenhaften Gestalten und Geschicken, Szenen und Handlungen in der Filmwelt der Leinwand baut sich der kleine Mensch ein zweites zivilisierteres manchmal sogar kultivierteres »Ich«, in dem er aufzugehen sich bemüht und manchmal sogar aufgeht. Was im Jahrhundert des Buches, wie R.M.Meyer das 19. Jahrhundert nannte, das Werk der gelesensten Modebücher vollbrachte, im Jahrhundert der Technik vollbringt es das Kino. Kürzer und oft anschaulicher. Das Kino als anschaulich gemachter Knigge. Oder ein Knigge mit Kinoillustration. – Wie soll ich mich benehmen? – Ich werd’ mir die Henny Porten anschau’n! ..
Dialoge
Du schreibst »Streiflichter« in der »Filmwelt?« – Ja.
Fürchtest du dich denn nicht? Wovor denn? Nun, Streiflichter beleuchten fatale Situationen und könnten dich selbst einmal treffen, wenn du gerade in einer fatalen Situation bist.
Das kann niemals sein! Meine Streiflichter beleuchten nur die Andern. Bin ich selbst in einer fatalen Situation, so schreib ich nicht
Dann schreibst du nicht?
Nein! Dann bin ich eben – anderwärts beschäftigt …
Du hast ja ein furchtbar unmoralisches Kinolustspiel geschrieben!
Ja, und zwar, um die Moral des Kinopublikums zu heben.
Wieso? Durch ein unmoralisches Stück? – Ja, eben! Die Zuschauer sind gezwungen, über die Unsittlichkeiten des Stückes zu lachen und vergessen darüber, selbst welche im Halbdunkel des Raumes zu begehen. Das heißt man: ridendo castigare mores: Durch Lachen die Sitten verbessern …
In jedem Kino steht ein Feuerwehrmann hinter den Logen. Kann der Apparat wirklich so leicht Feuer fangen? – Der Apparat nicht, aber die Zuschauer …
Es ist merkwürdig, daß ich im Kino sooft Verhältnisse anknüpfe. Und bin doch sonst so spröde! Kannst du mir sagen, weshalb ich mich dort so leicht verliebe?
Ja, weil die Liebe blind ist: Im Kino sieht sie wenig – aber umsomehr – fühlt sie …
Kann man in einem Kinodrama einen Helden einen Monolog sprechen lassen?
Gewiß!
Man hört aber doch nicht!
Aber man sieht ihn! Im Kinodrama wird ein Monolog – mit den Händen – gesprochen …
Schrecklich! Ich soll ein Kinodrama schreiben, und mir fällt gar nichts ein!
Nun, ich bin häufig in der Lage!
Was tust du dann?
Ich schreib’ – eine Operette …
Die Diva
Sie ist sozusagen die Achse, um die sich eine ganze kleine große Welt von Filmkunst- und Kitsch, von Kinodramaturgie und Regie, von Klatsch und Intrige, Kabale und Liebe dreht. Sie ist Ruhepunkt in der kreisenden Bewegung der Nervosität und Überspanntheit, Ursache und Endzweck von spannenden Romanen und Schlagern der Saison, Film- und Fixstern in Einem. Sie ist groß oder mittelgroß, blond, braun oder schwarz, sehr schön oder nur hübsch, aber immer reizend, mit dem Schleier der Anmut um Elfenbeinhüften, die sie leider niemals im Film zeigt, sondern stets nur in Zimmern der Verschwiegenheit, deren Wände nicht einmal Ohren haben dürfen.
Nicht mehr von ihrem Privatleben. In der Kunst geht sie natürlich nicht nach Brot, sondern nach Riesengagen, das heißt: besagte Gagen gehen eigentlich nach ihr, oder ihr nach. Sie läßt sich »nichts gefallen«, im Gegenteil: ihr gefällt nichts, am wenigsten der Regisseur. Sie wählt sich ihre Rollen selbst, die ihr extra auf den Leib geschrieben werden, ohne daß der bedauernswerte Autor auch nur einen Schimmer von demselben erblickt hätte. Sie tyrannisiert Kollegen, Kolleginnen, Autoren, Operateure und keiner wagt, ihr zu widerstehen, weil sie aus mehr als einem Grunde, eben – unwiderstehlich ist. Sie hat Glück im Großen, wie im Kleinen. Neben ihr verblaßt die Konkurrenz. Sie braucht bloß einen Schritt nach vorn zu tun und ihre mitagierende Kollegin steht im Schatten. Denn das Licht eines weiblichen Filmsterns hat die sonderbare Eigenschaft, nur sich selbst zu beleuchten und andere zu beschatten.
Sie ist unzuverlässig, wie ihre Taschenuhr. Ihrer Launen wegen müssen zehn Proben abgesetzt werden und die elfte kommt nur dann zustande, wenn die Diva sich vergißt und zufällig rechtzeitig erscheint. Ein Auto steht ihr natürlich jederzeit zur Verfügung. Begleitung ebenso, doch soll sie manchmal auf die letztere verzichten und mit dem Chauffeur vorlieb nehmen. Doch das ist unkontrollierbar. Man beginnt überhaupt sehr leicht in Klatsch zu verfallen, wenn man von einer Kinodiva spricht. Weshalb ich aufhöre. Nach dem berühmten Grundsatz: Wenn’s am besten schmeckt …
Der Regisseur.
Der Regisseur ist ein Mann von vielen Gaben, auch Morgengaben, die er in der Nacht ausgibt. Er ist glattrasiert wie ein Schauspieler, manchmal ist er es auch wirklich, meist tut er nur so. Er ist ein Maler, der nicht malt, ein Komponist, der nicht komponiert, ein Musiker, der nicht spielt, ein Priester, der nicht predigt, ein Sänger, der nicht singt. In der Hauptsache aber ist er Kritiker, der stets und aus Prinzip kritisiert. Er versteht die Seele des Publikums, liest die Gedanken sogar derjenigen, die nicht denken, was er dafür selbst sehr ausgiebig besorgt. Er kümmert sich um jeden Schmarrn, den er dem Publikum gewissermaßen mundgerecht macht, und das ist viel! … Er hat ein scharfes Auge, das alles sieht, selbst das, was verborgen bleibt, und sein Ohr vernimmt den Kulissentratsch, auch wo dieser nicht hinter Kulissen seine Blüten treibt. Der Regisseur ist ein Soll im Reiche der Filmkunst, allwissend, allsehend, allmächtig, nur leider nicht auch allgütig und allgerecht. Denn das Menschliche, Allzumenschliche ist auch seine Achillesferse und das Ewig-Weibliche zieht ihn häufig in jene Gegenden hinan, die außer Jupiter kein anderer Gott je betrat …
Dialoge
Denk’ dir nur, nach zwei Jahren war ich gestern wieder einmal mit Frida im Kino!
Nach zwei Jahren? Das ist eine lange Zeit! Hast Du gefunden, daß sich das Kino entwickelt hat?
Das Kino nicht – aber – Frida! …
Diese Kinozeitschriften schießen jetzt wie Pilze aus dem Boden. Jetzt haben wir eine »Kinorundschau«, eine »Kinowoche«, eine »Filmwelt«; wodurch unterscheiden sich denn jene Zeitschriften voneinander?
Sie unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Aber manchmal kann es passieren, daß man in einer Kinowoche eine ganze Filmwelt zu sehen bekommt.
Kannst Du mir sagen, wie man eigentlich ein Kinodrama schreibt?
Oh, nichts leichter! Man nimmt Papier, Bleistift oder Tinte und Feder und –
Denkt nach?
Gott bewahre! Nur das nicht! Man schreibt!
Hat das Kino Deiner Ansicht nach eigentlich eine Zukunft?
Ich glaube ja! Denn es dient ja hauptsächlich dazu, die Gegenwart zu vertreiben.
Warum dürfen eigentlich Kinder unter 16 Jahren nicht in gewisse Kinovorstellungen?
Das ist auch in Ordnung! Bis zum 16. Lebensjahre sollen sie Kinodramen erleben! Nach dem 16. Lebensjahre können sie sich ihre Vergangenheit anschaun, um sich zu überzeugen, daß es schöner war, als sie noch nicht hineindurften …
Du schreibst so viel für Kinozeitungen! Sag’, hast Du eigentlich Liebe zum Kino?
Wenig!
Oder materielle und geistige Interessen?
Noch weniger!
Aber Du mußt dich doch in Deiner Materie auskennen! Bist Du halbwegs ein Fachmann?
Am wenigsten!–
Noch eine Episode
Unlängst treffe ich eine alte Freundin, die ich lange nicht gesehen habe. Wie meine Hosentaschen habe ich sie seinerzeit gekannt. Um diese alte Bekanntschaft wieder aufzufrischen sind wir zusammen ins Kino gegangen. Begreiflich! Als Kinobesucher zweiter Kategorie nach P. O. Filmplausch Nr. 7 habe ich nun bald festgestellt, daß meine Freundin noch immer eine entzückende Person ist, von bestrickenden Lebensformen und entgegenkommendem Benehmen. Wie ich mich also intensiv mit der Konstatierung ihres Charakters befasse, werfe ich zufälligerweise einmal einen Blick auf die Leinwand. Was sehe ich?? Ist’s möglich? – Wenn ich nicht noch im letzten Moment auf die Seite gesprungen wäre, hätte mich der Schlag getroffen. Ist’s Täuschung, ist es Wahrheit? Ist’s Zufall, ist’s Bestimmung? Ist es eine Mahnung des Schicksals?? Ich sehe in einer Straßenszene im Gedränge meine Frau ..! Meine Frau, wie sie leibt und lebt und mir einen Blick zuwirft … einen Blick!! Ob dieses Blickes errötet meine rechte Wange (meine Frau ist linkshändig) und meine Rippen ziehen sich schmerzlich zusammen. Und ich fühle in meinem Innern ein sehnsüchtig Beben, ein mächtiges Streben, ein furchtbar Erleben, eine Ahnung von kommenden Dingen durchzieht meine armen Gebeine und
vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe,
der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang,
und mit des Geschickes Mächten
ist kein ew’ger Bund zu flechten ..
Das ist der Eumeniden Macht,
die richtend im Verborg’nen wacht …
Zufälle
Daß ein schlechter Schauspieler, daß verschwommene Aufnahmen oder daß irgend welche Mängel anderer Art ein sonst gutes Kinodrama beeinträchtigen können, ist ja selbstverständlich. Wie sehr aber der Erfolg eines Stückes auch von äußeren Zufälligkeiten abhängt, mögen nachfolgende Fälle beweisen:
In einem der ersten Wiener Kinos wird »Toska« gegeben. Erster Akt: Der Gouverneur naht sich Toska. Er will ihr seine Liebe gestehen, findet aber nicht den rechten Mut dazu, er ist unentschlossen. Da plötzlich spielt die Musik den Einzugsmarsch aus »Carmen«: »Auf in den Kampf, Toreador!« Der Ernst der Situation ist weg, das Publikum wälzt sich vor Lachen, aus dem Trauerspiel wird ein Lustspiel.
In einem anderen Wiener Kino wird »Maria Magdalena« gegeben. Die Hauptdarsteller Frl. Thea Rosenquist und die Herren Benke und Edthofer sind im Zuschauerraum anwesend. Kein Mensch achtet auf das Stück, alles findet die lebenden Schauspieler im Zuschauerraum interessanter als ihre lebenden Photographien auf der Leinwand, natürlich auf Kosten des vortrefflichen Dramas.
Liebe Leserin! Ich könnte dir noch viele solche Beispiele anführen und ich bin überzeugt davon, daß du selbst dich auf einige Fälle erinnern wirst können, wo irgend ein äußerer Einfluß die Wirkung des Kinostückes schwächte, und wäre es auch nur ein Gewitter, das draußen niederging, nur ein Donnerschlag, der das Publikum ablenkte, man flüstert, man spricht, man bedauert, keinen Regenschirm mitgenommen zu haben – und die schönsten Szenen finden keine Beachtung.
Das Kinodrama von Mayerling.
So war es nicht gemeint!
Aufhebung der Zensur, Abschaffung der Prüderie, Verschwinden Tartüffes: alles sehr schön. – Aber auf eine Freiheit, die in den Kloaken verlassener Paläste herumrumort und den Kanalräumer abgibt, der unter den k. k. Überresten immer noch etwas herausschnüffelt, was unter republikanischen Umständen einem freien Volke als Gaumen- und Sensationslust reizendes Kitschknackwürschtel vorgesetzt werden könnte, können wir dankend verzichten. Dieser Film»dichter«, der sich mit Geierfängen auf den Aas gewordenen Aar stürzt und einen dreitausendfünfhundert Meter langen »Stoff« verfilmt, um republikanische Abende mit Hintertreppengestank unter Perolinspritzenbegleitung zu füllen, ist ein Symptom jener billigen Sorte von Freiheit, die die Monarchie nur zu dem Zwecke abgesetzt hat, um ungestört in deren verwanzten Matratzengrüften stöbern zu können. Diese Freiheit begnügt sich nicht damit, die »erste Geliebte Kaiser Karls« in der Kärntnerstraße um den Preis von zwanzig Hellern zu kolportieren, sondern sie findet auch Filmunternehmungen, die – auch eine Art Revolutionsgewinner – aus dem großen Reinemachen das Ungeziefer aufklauben und es in die Sphäre des Kinoheldentums erheben.
Nach dem ausgiebigen Regen der Revolution sind – besonders aus dem Berliner Boden – die Schimmelpilze der neuen Filmunternehmungen dunkelster Schattierung reichlich emporgeschossen. Das Kronprinz-Rudolfdrama, das allem Anscheine nach sich zu einem Gerichtssaaldrama auszuwachsen beginnt, ist ebenfalls das Produkt einer solchen Filmunternehmung. In der gröbsten, geschmacklosesten Weise werden Vorgänge und Personen des ehemaligen Kaiserhauses dargestellt. Nicht der Umstand, daß z. B. Kaiser Franz Joseph als hilfloser Greis dem Publikum vorgeführt zu werden die zweifelhafte Ehre hat, ist bedauernswert. Aber daß es Leute gibt, die darauf spekulieren, daß ein Kronprinz Rudolf in Unterhosen und Nachthemd, daß eine angeheiterte Prinzengeliebte und ein zweifelhafter Türsteher auch ein republikanisches Publikum zur Kassenfüllung verleiten werden, ist traurig und zu verurteilen. Das in einem Wiener größeren Filmunternehmen hergestellte Mayerlingdrama hält sich immer noch auf der Höhe – oder Fläche – üblicher Filmdramatik. Es ist objektiv, sachlich und nur mit der gewohnten Sentimentalität verbrämt und in einem Kitschakkord ausklingend. Aber »Kronprinz Rudolf«, ein Erzeugnis des wildesten Berliner Westens, müßte unter allen Umständen verboten werden. Allerdings – seit den Umsturztagen funktioniert die polizeiliche Überprüfungsstelle nicht mehr so genau und ohne auf jene sicherlich unwahren Gerüchte hinzuweisen, die wissen wollen, daß man sich’s auch da »richten« könne, muß doch mit allem Nachdruck betont werden, daß hier eine arge Nachlässigkeit geschehen ist.
Frau Windisch-Grätz und ihr Vertreter, Herr Dr. Bell, haben, wie man aus Fachkreisen erfährt, alle Aussicht, schon in erster Instanz durchzudringen. Das Kronprinz Rudolf-Drama wird aller Wahrscheinlichkeit nach verboten werden. Daß die Filmzeitschriften dennoch das Drama unentwegt weiter ankündigen, hängt damit zusammen, daß die Berliner Fabrik, die sehr viel Geldmittel zur Verfügung hat, sich’s angelegen sein läßt, die Kinobesitzer vorläufig für den Ankauf zu gewinnen und so viel Vorschüsse, als möglich, einzustecken, ehe der Prozeß zur Kenntnis der weiteren Öffentlichkeit gelangt. Es ist im Interesse des guten Geschmacks und der Öffentlichkeit zu wünschen, daß das Verbot in Kraft tritt, aber auch die polizeiliche Prüfungsstelle, die solche Auswüchse grober Geschmacklosigkeit und rüder Spekulation in Zukunft zu verhindern hätte.
Ob man Kinofreund oder -Gegner ist: an Kinokitsch und »spannender« Kriminalromantik haben wir nachgerade genug. Daß nun auch die Revolution ein Anlaß zur Entladung niedrigster Masseninstinkte sein soll, müssen wir uns strenge verbitten. Ob es dem Kino gar so viel nützt, wenn ein Drama statt auf der Filmleinwand auf der Schmutzwäsche des Hauses Habsburg vorgeführt wird?! …
Mein Kinodrama.
Mit einem Schlage wird es mich berühmt machen. Ich ahne einen ungeahnten Erfolg. Bei einer telepathischen Prügelei überkam mich die Erleuchtung. Man höre:
»Der veilchenblaue Tod.«
Der bekannte Telepath, Professor Jonathan Oberchochem, hat eine Nichte, die reizende Maud, die ihn nach seinem Tode beerben wird. Maud liebt aber den erbittertsten Gegner Professor Jonathans, den jungen Harry Boxcalf, der dessen Theorien von der Galerie aus bekämpft.
Den größten Teil des ersten Aktes überlegt nun der Professor mit Händen und Füßen, wie er sein kolossales Vermögen von 50.000 Millionen Pfund vor den vermeintlich gierigen Händen seines Gegners retten könne. Harry aber meint es ehrlich mit Maud. Er schreibt ihr, er verachte den schnöden Mammon und er würde sie auch heiraten, wenn sie nur fünf Millionen hätte. Professor Oberchochem aber traut ihm nicht und beschließt, seine Nichte selbst zu heiraten, so daß er, als der Mann seiner Nichte, das Geld nach seinem Tode selbst erbe. Dann schreibt er einen Brief, denn er kann nicht wissen, ob er im Verlaufe des Stückes noch Gelegenheit dazu haben wird. Hiermit schließt der erste Akt.
2. Akt. Harry, der junge Gegner Professor Jonathans, sitzt in sich versunken in seiner eleganten Wohnung in der Kleinen Schiffgasse. Man sieht seinen prächtigen, schnurgeraden Scheitel aus der Öffnung seines blendend weißen Stehumlegekragens schauen. Er denkt nach. Plötzlich hat er eine Vision. Er sieht im Geiste den Professor und Maud, dessen reizende Nichte. Aus der Überschrift weiß er, daß der Professor seiner Nichte den Willen aufzwingt, suggeriert, ihn zu heiraten und Harry zu vergessen. Das kann Harry nicht dulden. 50.000 Millionen sind keine Kleinigkeit. Er denkt daran und schauert. Kalter Schweiß dringt aus seinen Poren. Man sieht ihn (den Schweiß nämlich) vom Sessel tropfen. Harry schrickt auf und schaut mit verstörtem Gesicht wild um sich. Jetzt hat er es entdeckt, das Badethermometer, er reißt es an sich und taucht es in die Lache unter seinem Sessel. Nach fünf Minuten liest er: drei Grad unter Null! Er lacht kurz auf, ein Lichtstrahl bricht aus seinem Auge, der Vorhang fängt Feuer, er entfernt sich in mächtigen Sätzen durch eine Tür, das Haus in der Kleinen Schiffgasse brennt ab.
3. Akt. Der Professor sitzt in einem Fauteuil und liest mit dämonischem Gesichtsausdruck die Kronenzeitung. Plötzlich stürzt Harry herein. Ihre Blicke verbohren sich ineinander. Man sieht es ganz deutlich. Sie schauen einander eine Stunde lang starr in die Augen. Die Gehirne arbeiten. Veilchenblaue Bläschen steigen auf. Und sie werden größer und größer, bis sie mit einem lauten Krach zerplatzen. Die Leinwand schwankt, die beiden Gegner stürzen entseelt zu Boden … Durch das Getöse wird Maud hereingelockt. Kaum erblickt sie die beiden Leichen, so rafft sie ihr kostbares Seidenkleid auf und setzt sich nieder. Herrliche Naturaufnahme! Große Tränen quellen aus ihren Augen. Sie weint. Und sie weint so lange, bis sie in der aufsteigenden Tränenflut betend versinkt. Musik: »Seemannslos«.
Auf Anraten vieler gutmeinender Freunde, denen ich mein Drama vorgelesen habe, gab ich meinen Beruf auf und wurde Praktikant bei Gerngroß.
Streiflichter
Das moderne Kino hat das alte Puppentheater verdrängt, aber manche Theaterpuppen herübergenommen.
Wie glücklich ist doch der Filmschauspieler: er darf über das Publikum die Wahrheit reden, während dieses glaubt, er spiele ihm eine Lüge vor …
Ein Kinobesitzer macht nie glänzende Geschäfte, höchstens flimmernde …
Der einzige Unterschied zwischen dem wirklichen Leben auf Erden und dem vorgestellten auf der Leinwand ist nur der: Die Erde ist rund, und die Leinwand ist flach.
Am 7. Tag wollte sich der liebe Gott nicht mehr anstrengen. Deshalb ruhte er am Vormittag, am Nachmittag erschuf er die Sonntagsvorstellungen: sie sind auch danach.
Der erste Sensationsfilm der Welt hieß: Auszug der Juden aus Ägypten …
Als dem lieben Gott gar nichts mehr einfiel, erschuf er den ersten Liebhaber: Adam. Die modernen Filmautoren tun das Gleiche …
Peter Schlemihl war der erste Kinoschauspieler: er verkaufte seinen Schatten für Tantiemen …
Allerdings dem Bösen und nicht einem Filmunternehmer. Aber wo ist der Unterschied?
Mit »Streiflichtern« ist es eine traurige Sache: Wem sie nicht gefallen, der versteht sie nicht, wer sie versteht, dem – gefallen sie nicht …
Typen aus dem Glashaus
Der Komiker
Der Komiker ist, wie schon seine Bezeichnung sagt: komisch. Das ist sozusagen seine Tragik: Er muß immer komisch sein. Dafür wird er bezahlt. Und gut bezahlt. Er ist dünn oder dick, überlang oder ellenkurz, aber immer unwiderstehlich und zum Lachen herausfordernd. Er fühlt sich verpflichtet, stets Witze zu machen und den Regisseur bei den Proben zu ärgern, was ihm natürlich den Beifall aller Kollegen einträgt. Diesen gegenüber ist er stets gefällig, weshalb er auch jedem von ihnen gefällt, er ist ein »guter Kerl«-Typus, den man zuweilen auslacht, weil er einfach dazu da ist, mit dem man Schabernack treibt und dem man einen faulen Witz nicht übel nimmt, weil er für üble Witze nie zu faul ist. Er ist ein Adabeimensch, ausgelassen und übermütig und über heikle Situationen unbekümmert hinwegsehend. Er ist körperlich gewandt, übt sich früh im Hinausgeschmissenwerden und Treppenhinunterkollern, wozu ihm sein Äußeres häufig Gelegenheit bietet. Das lächerlichste, das ihm passieren kann, ist eine Heirat. Und gerade das soll häufig vorkommen. Er ist der einzige, den die Diva manchmal erhört, nachdem sie ihn angehört hat, und dem sie manchmal angehört, ohne ihn erhört zu haben. …
Der Operateur
Sein äußerer Habitus ist nebensächlich, weshalb darüber nichts zu sagen ist. Wertvoller ist sein inneres Ich. Im Gegensatz zum Regisseur ist er die Personifikation der Ruhe und der Bedächtigkeit. Pedant vom Scheitel bis zur kleinen Zehe, läßt er manchmal zehnmal hintereinander proben, um seine Aufnahme ja recht deutlich herauszubringen. Darüber werden Regisseur und Darsteller oft ungehalten, was ihnen aber wenig hilft, denn der Operateur ist nun einmal, wie gesagt, nicht aus seinem Häusel zu bringen, weil er die ganze Zeit über nur in seinem Häusel zu tun hat. Wenn er dem Regisseur einen Schabernack antun will, behauptet er steif und fest, dieses oder jenes Detail wäre ihm entgangen und die ganze Geschichte muß von vorn wieder angehen. Im übrigen gehört er eigentlich mehr zum unbeweglichen Mobiliar eines Filmunternehmens und ist nicht mehr als ein, allerdings sehr wichtiger Bestandteil seines Apparates. Apparat und Operateur gehören zusammen, wie Zehe und Hühnerauge oder Roß und Reiter. Sein Privatleben interessiert weniger. Durch seinen Verkehr mit Schauspielerinnen fühlt er sich allerdings häufig bewogen, Seitensprünge zu unternehmen. Hat er bei solchen Gelegenheiten Geld verloren, so verwendet er seine Erlebnisse dazu, einem Filmautor einen »Tip« zu geben, was er sonst nur mit jungen Kinoelevinnen zu tun pflegt. …
Der Autor
Der Autor ist derjenige, der ein Filmdrama verfaßt hat. Das ist leicht. Schwierig ist, eines zu stehlen. Doch auch das letztere treffen manchmal Filmautoren. Er versteht von der Kinotechnik nur das Notwendigste und ist lange nicht so versiert, wie der Regisseur. Er hat nur den Verstand, der zur Abfassung eines Films gehört, und das ist nicht viel. Daher kommt es auch, daß der Autor bei den Proben dasitzt, wie ein Tanzbär auf einem Maskenball. Es passiert ihm, daß der Regisseur sein ganzes Stück umkrempelt und häufig fragt der Autor bei den Proben seines eigenen Stückes den Regisseur, wer denn dieses herrliche Drama verfaßt habe. Denn der Autor kennt sich selbst und traut sich deshalb nicht übermäßige Fähigkeiten auf dem Gebiete der Kinodramatik zu. Seine Fähigkeiten beweist er viel mehr auf anderen Gebieten, wo er sogar den Regisseur besiegt, weil der letztere sich in seinem Fache eben zu sehr – verausgabt, der Dramatiker zum Glück so etwas niemals in seinen Filmdramen tut. …
Kino
Es gibt eine Menge Anachronismen im Film. Ganze Kinostücke, die Anachronismen sind.
Sie bestehen aus Ereignissen, deren Motivierung aus den Gegenwartsverhältnissen heraus unmöglich ist.
Sie operieren mit Personen, deren körperliche und seelische Struktur prärevolutionäre Voraussetzungen erfordert.
Geschwinder, als ein Film abschnurren kann, surrte das Rad der Zeit. In der Stunde, in der zweitausend Meter Handlung über die Leinwand gleiten, hat die soziale Walze zehntausend Kilometer Reformen umgewälzt.
Im Film sehe ich einen Mann, der sich wegen einer halben Million Kronen erschießt. Ehe sein Revolver noch losgeht, ist der Kronenwert Null. Wozu sich erschießen?
Alle Dramen, in denen die Valuta ein Grund zur Tragik sein könnte, sollten gut ausgehen.
Ich war im Kino. Man gab den »Herzog von O.« O. ist im Kino ein beliebter Buchstabe, wenn es Geheimnisse gilt. Ein O ist rund, ohne Anfang, ohne Ende, man kann es auch für eine Null halten, für ein absolutes Nichts. Man gab also nicht den Herzog von X oder Y, sondern den von O.
Die Leute stellten sich vor der Kasse an. Es waren sicherlich auch Arbeiter- und Betriebsräte unter den Leuten. Sie stellten sich an, um einen Herzog zu sehen. Dabei war der Titel schon längst abgeschafft.
Im »Herzog von O.« gab es vor allem den Herzog, dann einen Kammergrafen, seine Tochter, einen Leibdiener, ein Rennpferd, einen Jockey, einen Fabrikanten, seinen Sohn, eine Fabrik und Arbeiter. Man wird schon ahnen, daß der Fabrikantensohn etwas mit der Kammerkomtesse hatte. Und diese ausgerechnet für den Jockey schwärmte. Der Fabrikant lieh dem Kammergrafen Geld. Der Fabrikantensohn dem Jockey. Der Leibdiener bestand aus zwölf Goldknöpfen und einem Backenbart und einer treuen Seele. Der Herzog war glattrasiert, mit einem Orden um den Hals. Er war durchaus würdig und sah stets aus, als ob er direkt vom Regieren käme. Er hielt sich gerade, so, als ob er einen Stock geschluckt hätte. Aber es war eine würdige Steifheit. Nicht einen Stock, sondern ein Szepter muß er geschluckt haben.
Der Fabrikant trug ein Monokel als Adelsprädikatersatz. Er sah auf, wie die verkörperte Aufzucht des Menschengeschlechtes. Er fabrizierte sich sozusagen zum Junker empor. Er schlenkerte mit den Händen beim Gehen, und das war das einzige, was in seinem Äußeren noch das Bürgertum verriet.
Ein viel größeres Monokel trug sein Sohn. Seine Haare waren in der Mitte glatt gescheitelt, sein Kopf sah stets so aus, als stände er im Schaufenster eines Friseurladens.
Die Komtesse war von einer Kinodiva agiert. Sie war infolgedessen entzückend. Sie trug kurze Kleider und ließ ihre schönen schlanken Beine nicht so häufig sehen, wie eine Komtesse es sonst zu tun pflegt, sondern wie eine Kinodiva.
Jener glattrasierte Fabrikantensohn sollte die Diva heiraten. Diese liebte natürlich den Jockey.
Eine tragische Ironie verursachte einen Geldverlust des Kammergrafen im Kartenspiel. 50.000 Mark.
Am nächsten Tag wurde er gepfändet. Ein Rennpferd, einen Wagen, ein Auto und eine Brillantnadel mußte er hergeben.
Inzwischen kujonierte der Fabrikant seine Arbeiter, weil ihn das Gewissen plagte. Offenbar bedauerte er, dem Kammergrafen nicht ausgeholfen zu haben, der sich natürlich pünktlich erschoß.
Sein Tod verursachte den Jockey, ins Schloß zu kommen, um die Komtesse zu trösten, weiters die Fassungslosigkeit des livrierten Dieners und schließlich ein Aufseufzen des Publikums, das durch den dunklen Saal aufflackerte wie ein Nachtvogel und so lange schweben blieb, bis es durch Perolin zum Zerstäuben gebracht wurde.
Hierauf wurde es hell.
Nun frage ich: Wo gibt es noch einen Herzog, der ein Szepter schluckt? und einen Jockey, der mit Schiebern keine Geschäfte macht? Und einen Fabrikanten, der nicht froh ist, kein Junker zu sein? Und einen Markgrafen, der in einem nichtsozialisierten Schloß wohnt? Wer erschießt sich heute wegen 50.000 Mark? Wie kann man ihm so viele Wertgegenstände für diesen Betrag pfänden? Was sind heute 50.000 Mark? Und warum lassen sich die Arbeiter alles gefallen? Haben sie keinen Arbeiterrat? Aber das Unverständlichste: warum gehen die Leute hin zu so einem Stück? Warum seufzen sie bei Unwahrscheinlichkeiten? Und warum, frage ich, kostet ein Platz zehn Kronen? Wenn 50.000 Mark noch so viel wert sind, daß man sich ihretwegen erschießt?
Ja, ernst ist das Leben, heiter die Kunst, sagte der Portier, als ich hinausging. Aber es war nur das Drama, das nächste Woche gegeben wird.
Praterkino.
Vor dem Eingang sprudelt der Herr Portier. Breitgoldene Borte um das Kappenrund leuchtet ihn empor in Amtsregionen. Wäre er barhäuptig nur, erschiene er mir und den andern sehr zu seinem Schaden als personifizierte Dienstfertigkeit. Denn kleingewachsen und untertan ist sein Wesen zahlenden Mächten der Umwelt gegenüber und lichterloh entzündbar an leisem Banknotenknistern. So aber, breitrandige Chargengloriole ums Haupt, erweckt er demütigende Ideenassoziationen, wie:
»Amt und Würden«, »Zucht und Ordnung«, »Hintertürl und Bestechung«. Dank dieser Amtskappe erhält er auch äußere Berechtigung, zwischen Nur-Jugendlichen und Schon-Sechzehnjährigen zu unterscheiden und der Bartlosigkeit verdächtigte Besucher je nach der Höhe des Trinkgeldes in diese oder jene Kategorie mit beamteter Unerbittlichkeit einzureihen. Man kann der Minderjährigkeit entgehen, wenn man mit Rücksichten auf seinen Nebenverdienst zehn »Sporteln« verlangt und also durch Nikotinismus Kinoreife beweist.
Sein »Prrrogrrrammm« ist ein kurz-heftiger Trommelwirbel, den er jedem Besucher entgegenpoltert und verspricht von Spannung, Sensation, Aufgeregtheit, täte er selbst nichts mehr dazu. Aber auf den Trommelwirbel folgen Fanfarenstöße, gesprochenes Feuerwerk: »Das rrrote Aß« und »Aß« fällt, wie zischende Funken aus Loderbrand, daß man glauben muß, ein Loch im Rock bekommen zu haben. »Das rote Aß« ist das unerhörteste Filmzauberwerk sämtlicher Kontinente, in Amerika herausgepulvert mit einem Aufwand an Munition, wie ihn der letzte Weltkrieg gebraucht hat und enthält in komprimierter Form zweimalhunderttausend Kriminalromanserien; ein Extrakt aus allen Greueltaten der Verbrechergeschichte. Von der Stirn des Herrn Portiers rinnt Begeisterung in Schweißströmen, wenn er die Vorzüge des »roten Aß« mit polternden Zungenlauten vor den staunenden Zuhörern preist.
»Das rote Aß« wird im Praterkino von den Zuschauern gegeben. Slowakische Arbeiter, kleiner Goldreif im linken Ohrläppchen, rotgeblümtes Halstuch, Soldatenhemd, grauweiß geschecktes Gesicht und heraushängende Augenkugeln, gleichsam ohne Zusammenhang mit dem Hirn. Dirnen und Zuhälter, lärmende Schminke auf Backenknochenpolen, bandagierte Hände, verkommene Krüppel. Alle Menschen hier kommen von der Filmleinwand, kommen aus den berüchtigtsten Slums, aus dem wilden Westen. »Das rote Aß« beginnt vor der Vorstellung.
Glöckchenbimmel, Türen auf Kommandorufe: Rechts gehen, Fohtöhl links, Menschenfleischduft krallt sich qualmend um Brust und Hals, Dunkel überrumpelt dich, wie übermächtiges Raubtier. Hinter deinem Rücken breitet sich surrend Unheil vor, bleiches Lichtbündel zuckt aus quadratischer Augenöffnung, fährt scharf und pfeilschnell, Finsternis spaltend, fährt scharf über systemisiertes Gewirr von Köpfen, zeugt mit fahler Leinwand verruchtes Geschlecht verzerrter Schattenteufel. Unerklärliches geschieht, meine Nachbarin von links hält einen rauchenden Revolver, schießt besinnungslos, ist Kellnerin in einer Wildwestschenke, ihr Chef ist der Kinoportier, ja, dieselbe Tellermütze mit dem breiten Goldstreifen – steht er nicht mehr draußen? Nein, Schankwirt ist er in der Nähe der Goldgruben, er verkauft keine »Sport«, sondern lehnt an einem Bierfaß: ha! jetzt habe ich ihn erkannt: So ist er. Seine Augen gefielen mir nicht, noch als ich eintrat, sie hatten so eine zwinkernde Bestialität in Stellung und Ausdruck. Natürlich, jetzt weiß ich’s: einen geheimnisvollen Menschen hat er in seinem Oberstüberl verborgen, einen Doktor Diaz, der um jeden Preis das Geheimnis der fabelhaften Munitionserzeugung wissen muß und nun den Detektiv beseitigen will, jenen glattrasierten Menschen mit der zynischen Mundfalte und dem Aha-weißschon-Blick, der sich vorhin bei der Kassen einen Fohtölsitz kaufte. Sein Freund aber ist der »kleine Bär«, ein ungemein geschickter Mensch, der soeben noch, bürgerlich solide in Haltung und Winterrock Plätze angewiesen hat, und dem ich nie zugetraut hätte, daß er vom Rücken eines galoppierenden Rappen auf den höchsten Zweig eines Baumes springen kann, um den Detektiv zu retten. Die Freundin aber, ich weiß schon, jetzt entspinnt sich ein Liebesverhältnis, jene Blondine, blaß, Lockenkopf, rührend-weiblich und männlich-mutig, die – sitzt sie nicht zwei Reihen hinter mir? Ach, die Arme hockt in einer Felsenhöhle, sie wird wohl erst bestenfalls im vierten Akt herauskommen können und bis dahin ist ihre Munition schon längst verpfeffert. Und das alles wegen des Schankwirts! Der Teufel hole den Kinoportier!
Ein blutlüsterner Indianer, braunglänzend, ich rieche seinen Juchtenduft, kriecht gewandt auf allen Vieren, duckt sich, lugt aus, seine Augen, Gott! wo habe ich die schon gesehn? Das ist der slowakische Arbeiter mit dem Goldring im Ohrläppchen; wo der nur so schnell die Indianermontur her hat, möcht’ ich wissen .. So ein Vieh, von dem elenden Diaz gekauft! Ha! jetzt hat sie ihn getroffen. Dieser Slowake stirbt wirklich, wie ein Indianer.
Ein wuchtiger Hieb auf ein Trommelkalbfell begräbt die restlichen Töne der Musik. Im Hintergrund zischt es, giftige Schlange, oder so. Licht bricht aus zehn Birnen in die Welt, neben mir die Kellnerin, vor mir der Detektiv, der »kleine Bär« ruft: »Nächste Vorstellung acht Uhr abends«, sein Winterrock ist gar nicht beschädigt von der selbstmörderischen Kletterei. Aus aufgeplatzten Türen strömt Masse in zweitem Aggregatzustand und draußen steht immer noch der heimtückische Schankwirt als Kinoportier verkleidet und trommelt Prrrogrrrammmwirbel …
Der slowakische Arbeiter verliert sich irgendwo im Pratergebüsch, wo er herumspionieren will. Heute Nacht noch stirbt er einen Indianertod.
Scheinwelt
Im Schoße der Zukunft ruht die Verwirklichung des heute Unmöglichen. Wunder der Vorzeit sind Selbstverständlichkeiten der Gegenwart. Das Unglaubliche von heute wird morgen alltäglich. Dieses Alltägliche von morgen, heute schon verwirklicht zu sehen, ermöglicht die Scheinwelt des Kinos. Die Bretter, die die Welt bedeuten, bedeuten ein idealisiertes oder verzerrtes, erhobenes oder karikiertes Leben der Gegenwart oder der Vergangenheit. Aber die Kinoleinwand, die heute zumindest eine halbe Welt bedeutet, birgt ungeahnte Möglichkeiten: das Unfaßbare zu fassen, das Körperlose zu gestalten, die Zukunft zu vergegenwärtigen. Und hier ist die Zukunft der Scheinwelt des Kinos. Hier, in der Greifbarmachung des Morgen, liegt ihre Bedeutung.
Noch aber weist die Entwicklung des Kinos nicht in die Zukunft. Noch beschränkt es sich darauf, dem Theater Konkurrenz zu machen. Noch sucht es seine Macht in der »Spannung«. Was im Theater dargestellt, einer unbarmherzigen Vernichtung durch Publikum, Kritik, also »öffentliche Meinung«, anheimfallen würde, gewinnt im Kino Anziehungskraft. Sagen wir es offen: was im Theater »Kitsch«, ist im Kino Zugstück. Dadurch wird das Kino herabgedrückt, Theater zweiten oder dritten Ranges, was es nicht unbedingt sein muß und soll. »Erkenne dich selbst!« gilt für das Kino. Erkenne dich als Welt des Scheins, nicht des Seins! Sei Prophet des Morgen, Schwarzkünstler, Zauberer! Aber verdirb nicht das Heute! Wo immer das Kino die Zukunft packt, da ist es interessant. Das Verborgene aufzudecken, Geheimnisse zu entschleiern, das Unsichtbare darzustellen – das ist die Aufgabe des Films. Das Wachstum einer Pflanze, die Weltordnung eines Ameisenhaufens, der Liebesroman eines Schmetterlings, aber auch die Wunderwelt der Technik, der märchenumsponnene Meeresgrund, Dramatisierung der Volkssage – warum sollte das nicht Kino und Publikum auf ein höheres Niveau heben? Dann, und nur dann wird das Kino aufhören, Konkurrent des Theaters zu sein und wird dessen notwendige Ergänzung werden. Nützt die Möglichkeiten des Unmöglichen aus im Kino!
U 35.
Irrungen, Wirrungen eines Films.
»U 35« heißt ein Film, den die deutsche Regierung zur Verherrlichung der Unterseeboottaten herstellen ließ. Dieser Film fiel zur Zeit des Waffenstillstandes, statt ins Wasser, den Engländern in die Hände.
Die Engländer dachten sich: U-Boot ist U-Boot, und ausgerechnet auf die deutsche Matrosenkappe kommt es nicht an. Sagen wir: Die Heldentaten sind nicht deutsch, sondern englisch. Sagen wir: Kitchener statt Tirpitz. Denn die englische Mine ist ebenso von zerfetzender Wirkung wie die deutsche. Und ein zerfetzter Körper ist ein zerfetzter Körper. Ein deutscher Fleischlappen sieht einem englischen verdammt ähnlich. Also ward der deutsche Film zum englischen.
Vor kurzer Zeit kam der Film nach Madrid in Spanien. In Madrid aber protestierte der deutsche Vertreter gegen die Vorführung des Films. Protestierte, weil der Film – deutsch war. Ehre dem Manne, der so die deutschen Interessen wahrt! Er schämte sich des Films, der Fleischfetzen Fleischfetzen sein läßt und Tirpitz – Kitchener.
Der englische Vertreter protestierte nicht. Aber der Unternehmer verstand es, die Sache zu deichseln. Er redete den Protestierenden ein, daß der Film das spanische Publikum nur für die Deutschen einnehmen könne, nicht gegen sie.
Woraus zu ersehen ist, daß die Welt sich überall gleich bleibt. Wie gesagt: Fleischfetzen sind Fleischfetzen. Tirpitz Kitchener und ein spanischer Unternehmer – ein Unternehmer. Ja, selbst das spanische Publikum, das noch nicht Gelegenheit hatte, in den ersten Schützengrabenlogen eines Weltkrieg-Theaters zu sitzen, ist – Publikum und für U-Boote eingenommen.
Und die U-Boote sind schließlich U-Boote. Die Kriminalistik ist international.
Die Tragödie eines Großen
wird jetzt im »Marmorhaus« aufgeführt. Es sind »sechs schicksalsschwere Akte nach einer Idee von Paul Gruner«. »Sechs Akte« hätte genügt. Man muß sich nicht von vornherein schicksalsschwer diskreditieren. Man muß nicht mit der Tür ins Marmorhaus fallen. »Tragödie eines Großen« sagt genug. Sagt sogar zu viel.
Der Große ist Rembrandt. Warum gerade Rembrandt, erklärt das Programm: »Während bei den meisten derartigen Filmen das private Leben des Helden wenig bietet, das für die Allgemeinheit wirklich interessant ist, verlockt die tiefe Tragik des Menschen Rembrandt geradezu zu einer dramatischen Gestaltung.«
Es genügt nicht, daß etwas »geradezu verlockt«. Besonders dann nicht, wenn die Tiefe der Tragik eines Großen auf die Fläche einer Kinoleinwand projiziert werden soll. Viel zu innig sind die Beziehungen zwischen technischem Darstellungsobjekt und dem Darzustellenden. Kein Film der Welt wird »die tiefe Tragik Rembrandts« dramatisch gestalten können. Vielleicht die äußere Tragödie eines Menschen, der außerdem noch Rembrandt war. Aber muß es deshalb Rembrandt sein?
In den sechs Akten ist Rembrandt der Mann zwischen zwei Frauen. Zwischen Tochter und Nichte des reichen Kunsthändlers. Rembrandt heiratet die Nichte. Und findet nach fünf schicksalsschweren Akten zurück zu Nisly, der Tochter. In ihrem Schoß stirbt er.
Rembrandt ist in diesem Film zuerst »Künstler«, Schlapphutmensch sozusagen, leichtsinnig, vom Leben beschwipst. Dann zum Schluß »gebrochen«, verloren, betrunken. So muß Rembrandt im Film aussehen. Nicht anders.
Er malt beneidenswert schnell, wie ein tüchtiger Schildermaler. Flugs, fällt ihm was ein, greift er zu Pinsel und Palette. Als wollte er sagen: Momang, wern det Ding gleich haben! Bitte recht freundlich! So muß Rembrandt im Film malen.
Also warum Rembrandt? Warum das Genie in der Vorstellung Zehntausender von Philistern neben den Caféhausbohémien stellen, warum den Begriff »Genie« profanieren helfen? Warum aus Rembrandt einen Schildermaler machen? Nur weil er das Pech hatte, zwischen zwei Frauen zu stehen? Mit der »Tragödie« war’s genug gewesen für »sechs schicksalsschwere Akte«. Es mußte nicht die »Tragödie eines Großen« sein.
Schon gar nicht, wenn man direkt aus der Komödie einer Größe kommt, die vor der »Tragödie eines Großen« gezeigt wird: nämlich Slezaks, des Kammersängers, Leben auf seinem Gut. Slezak, wie er ißt, betet, lacht, Witze erzählt. Parallelität der Erscheinungen. Man könnte beide Filmwerke verbinden. Ihnen einen gemeinsamen Titel geben. Etwa: die Unterwäsche zweier Lieblinge des Publikums: Rembrandt und Slezak.
Regisseur Günsburg tat manches, hätte mehr tun können. Holländische Häuser haben keine römischen Aulen. Glatte Fensterscheiben gab es nicht im sechszehnten Jahrhundert. Aufreizend stillos wird die Regie nirgends.
Ein Experiment
Die Andern, die zwei und fünf Mark gezahlt hatten, dürften sich sogar geärgert haben. Ich aber langweilte mich nur, denn ich war eingeladen.
Carl Mayer – kennen Sie Carl Mayer? – (Er hat den Caligari-Film miterzeugt, was immerhin Begabung beweist. Aber, oh! – wäre es dabei geblieben! …) Carl Mayer also bearbeitete den Fuldaschen »Dummkopf«, ein Lustspiel in abgestandener Kitschtunke, für den Film. An und für sich ist es ein Verdienst, deutsche Literatur zu reduzieren. Aber, sich einzubilden, daß sie nach der Reduktion erst recht Literatur sei, ist Unsinn. Ludwig Fulda ist genug. Carl Ludwig Mayer-Fulda kann man gerade noch im Film vertragen. Dieser Kentaur mit Filmphysiognomie und literarischem Unterleib aber wurde im Meistersaal in der Köthenerstraße verlesen. Herr Doktor Pauli, der »einführender Worte« eine Menge sprach, erklärte, es sei ein »interessantes Experiment« hier zum ersten Mal versucht: die Vorlesung eines Filmmanuskripts.
Ich hätte es mir ersparen können, hier, just an dieser Stelle, wo Raummangel Wichtigeres gebeut, über dieses Experiment zu sprechen, wäre es nicht irritierend-klassisches Beispiel für die lächerlichen Bemühungen Derer um den Film, diesen justament und unermüdlich auf eine höhere Wertsprosse der Literaturleiter zu heben. Mir däucht, die Berliner Filmtechnik und all ihr Drum und Dran sind alt genug, um dieser Primanerambitiönchen endlich einmal ledig zu sein. Dieses krampfhafte Suchen nach Beweisen für den »Kunstwert« des Films führte zu einer Vorlesung, bei der Lupu Pick, der verurteilt war, aus dem Experimentalobjekt schweißtriefend einen »interessanten Abend« auszugraben, mit bemitleidenswertem Opfermut sechs Akte las und es immerhin durch ein gewisses Können zustande brachte, daß die Andern sich ärgerten, ich mich langweilte, aber nur wenige aufrichtig genug waren, fortzulaufen. Das hat man davon …
Ein Bühnendrama kann man vorlesen, ein Filmmanuskript nicht. Denn jenes wird, auch, wenn aufgeführt, gesprochen, dieses gestikuliert. Der künstlerische Ausdruck für das Bühnendrama ist bei Aufführung und Vorlesung das Wort. Ein Filmmanuskript kann man nicht verlesen, sondern, wenn man will, vorgestikulieren. Denn nicht das Wort, sondern die Geste ist das künstlerische Ausdrucksmittel für das Filmwerk. Diese einfache Weisheit kapierte man nicht. Also kam das »Experiment« zustande. Gott behüte uns vor einer Wiederholung!
Mosaik aus Ostpreußen.
Kino
Auch im Kino war ich. Man gab »Die Sucht nach Luxus«. Die Geschichte einer schönen Jüdin, die ihre Familie verläßt, die Geliebte eines Grafen mit Monokel wird und schließlich zugrunde geht.
Diese Filmtragödie ist tendenziös. Durch die Löcher ihrer Tragik schimmert junkerlicher Antisemitismus durch.
Man klatscht Beifall im Königsberger Kino. Es ist sehr finster. Vorn, auf den dritten Plätzen, kichert jemand, wie gekitzelt.
An tragischen Höhepunkten spielt die Musik:
Puppchen, du bist mein Augenstern.
Die goldene Krone
Aus dem Inventar der Berliner Woche ist Olga Wohlbrück endlich, endlich in das der Universum-Film-A.-G. übernommen worden. Die Abonnenten der Woche können im Mozartsaal am Nollendorfplatz ein Wiedersehn mit der goldenen Krone feiern.
Olga Wohlbrück, fruchtbar unberufen, Courths-Mahler mit Niveau und grammatikalischem Deutsch, lebte davon, daß Bürgertöchter sich vergeblich und schmerzhaft in Fürsten verliebten und diese aus der Etikette nicht heraus konnten. So entstand »Tragik«. Niemand hatte schuld. Jeder »trug Schicksal«. Es war sozusagen Hebbelsche Notwendigkeit, aus oberflächlich gesellschaftlichen Formen herausgeschürft. Nicht ungeschickt. Glaubhaft. Scheinbar mit kühler künstlerischer Objektivität, ohne Parteinahme. Tiefer nur sah man »Woche«-Interesse für höhere Sphären. Wie Prinzen leben, lieben, leiden, sterben, begraben werden und selig.
So die goldene Krone: Marianne (Henny Porten), Tochter des Gasthauses zur goldenen Krone und Herzog Franz Günther, der tuberkulos ist und sterben wird. Und wäre er kein Herzog und nur tuberkulos und müßte sterben, was wetten Sie? Marianne täte ihn auch lieben. Aber er ist auch noch Herzog.
Und erstens: Herzog. Zweitens: Todgeweiht. Beides verursacht Liebe ohne Erfüllung. Nun ist, wird Marianne noch mit Klaus Stöven, dem Großfischhändlerssohn – gute Partie – verlobt. Klaus ist ein anständiger Mensch. Er ist bereit zu Kompromissen. Franz Günther? Gut! Sie lieben sich? Gut! Für mich bleibt ja auch was.
Er hat sich getäuscht, Klaus. Er kennt die Olga Wohlbrück nicht! Marianne eilt aus Verlobungsfeiern, Segenswünschen, Brautnächten zu Franz Günther, der sterben muß. Schloß, Diener, Livree, Ah!, Ärzte. Marianne pflegt. Pflegt.
Eines Tages kommt des Herzogs Familie. Hochwohlgeboren. Marianne muß weichen. Und in dieser Nacht stirbt er. Gerade in dieser.
Noch eine Komplikation: Sterbend hatte Franz Günther seinem Adjutanten aufgetragen, doch ja Marianne zu heiraten. Und dieser Adjutant erschießt sich. Weil er nicht heiraten kann von wegen der Familie. Ja, ja, so einfach ist das nicht bei Fürstlichkeiten.
Nun, wer die Woche liest, weiß, daß Marianne jetzt heimkehren und Klaus heiraten wird.
Ich aber protestiere dagegen, daß heute, am siebten August neunzehnhundertundzwanzig, noch nicht zwei Jahre nach der Revolution, die Weltanschauung der Woche aus »trauten Familienkreisen« durch den Film ins Volk getragen wird. Daß Fatzkerei tragisch wirkt, weil Olga Wohlbrück leben muß.
Ich protestiere!!!
Der Nabel der Sittlichkeit.
Wie Plakate zensiert werden.
Berlin, 26. August.
Die »Vergraulung der Erwachsenen« wird gewöhnlich durch Behörden herbeigeführt. Das Wort »Vergraulung« lernte ich von einer solchen Behörde. Ich kann nichts dafür. Und das kam so:
Über die Sittlichkeit des halbwüchsigen Berlins wacht neben der Reichszensur die Ortspolizei. Die Reichszensur ist der Nabel der Sittlichkeit. Mit ihr durch eine Nabelschnur verbunden ist die ortspolizeiliche Zensur. Weder die Reichs- noch die ortspolizeiliche Zensur können es verhüten, daß Jugendliche unter sechzehn Jahren von lebenden Frauenkörpern, die wahrnehmbar und, gewiß auch der Ortspolizei nicht ganz fremd, durch die Straßen wandeln, verführt werden. Dies zu verhüten ist auch weder die Aufgabe der Reichs- noch die der ortspolizeilichen Zensur. Im Gegenteil haben diese beiden Behörden nichts gegen jene Obszönität, die aus Fleisch und Blut besteht. Die Aufgabe der Zensur ist es vielmehr, die Jugendlichen vor Schaden durch Frauenspersonen, die nur aus Farbe und Papier bestehen, zu behüten.
Daher kommt es, daß Plakate der Reichs- bzw. ortspolizeilichen Zensur überwiesen werden und hier vor das Auge des Gesetzes kommen. Es sind eigentlich mehrere Augen des einen Gesetzes. In der Reichszensur die Augen älterer, juristisch gebildeter Staatsbeamten, deren Prüderie man eigentlich versteht, weil Sinn und Zucht mit den Jahren kommt und Avancements erleichtert. Das Auge des Gesetzes in der ortspolizeilichen Zensur aber wird von einem Herrn, namens Langner benützt, der, vor Jahren zwar, aber anscheinend mit Nachdruck, Küster gewesen sein soll.
Die Filmgesellschaften machen Reklame für ihre neuen Filme durch Plakate. Und da es sich nicht vermeiden läßt, daß Frauen in besagten Filmen Hauptrollen spielen, und diese Hauptrollen nicht immer gerade Nonnenkostüme erfordern, gelangen die Frauen auch auf das Reklameplakat. Und eben über das Maß der Unsittlichkeit dieser Frauenspersonen und über den eventuell für die unreifere Jugend erwachsenden Schaden hat die Reichs- bzw. ortspolizeiliche Zensur zu urteilen. Auf einem der letzten Filmplakate war eine Frau in einem etwas erotischen Kostüm dargestellt, das den Unterleib frei und einen Streifen Bauch sehen ließ. Der Nabel der Sittlichkeit empörte sich gegen jenen auf dem Plakat abgebildeten und verfügte, daß mindestens ein sanfter Schleier über jene nackte Partie geworfen werden müsse. Der Schleier wurde hergestellt. Ferner: Das Filmplakat für den Film »Das Skelett des Herrn Markutius« wies in irgendeiner Ecke einen Totenschädel auf. Herr Langner behauptete, es sei seine Pflicht, die Minderjährigen nicht nur vor täuschend nachgebildeten Frauenbeinen zu bewahren, sondern auch vor Totenköpfen. Das sei, sagte er, nicht »for die Kinder«. Und es gelang ihm bei dieser Gelegenheit, jenes prächtige Wort zu bilden, dessen ich mich sofort im Anfang dieser Auseinandersetzung bemächtigt habe: Man dürfe, sagte Herr Langner weiter, die Kinder »nicht vergraulen«.
Auch politische Bedenken sind unter Umständen den hiesigen Zensurstellen nicht fremd. Das Sumurun-Filmplakat von Matejko zeigt eine lächelnde Frau, die sich von einem fremdrassigen Mann – halb freiwillig – rauben läßt. Die Reichszensur dekretierte nun: Man empöre sich in Deutschland, wenn weiße Frauen in den besetzten Gebieten sich mit den Schwarzen einließen. Sei dieses vom gesellschaftlichen Standpunkt unangängig, so könne man ein Bild, auf dem eine weiße Frau sich so ganz ohne Widerspruch von einem Fremdrassigen rauben lasse, keineswegs dulden. Also mußte der Maler das Bild retouchieren, und die nun bräunlichgewordene Frau gibt zu keinen politischen Bedenken mehr Anlaß.
Es wird sicherlich sehr viel Obszönes, Schamloses, wirklich Sittenverderbendes gemalt, gedruckt, erzeugt und vertrieben. Eine Zensur ist gewiß notwendig. Aber eine Zensur, die selbst zugibt, sich von künstlerischen Gesichtspunkten nicht leiten zu lassen, und die Gründe solcher Art, wie sie hier verzeichnet sind, mühselig hervorsucht, macht sich selbst der Überflüssigkeit verdächtig.
Katharina, die Große.
Richard-Oswald-Lichtspiele.
»Prunkfilm« von Lüthge und Reinhold Schünzel. Regie: Reinhold Schünzel. Gute Regietricks, gute Bilder, auch gute Gesinnung, gute Hinter-den-Kulissen-der-Weltgeschichte-Kenntnis. Illustrationen zu einem amüsanten historischen Werk. Vieles Kulturhistorische falsch. Sonst eine der gelungensten Sachen der Saison. Nur muß man nachlesen, wer Katharina die Zweite war. Nicht jeder Kinobesucher hat jene Quellen gelesen, die Herr Lüthge gelesen hat, als er den Film schrieb. Schünzel als Zar Peter und Lucie Höflich als Katharina II. geben Allerbestes.
Pathos.
Gestern war ich in einer Operettenpremiere. Ich glaube, es ist kein Zufall, daß die Damen und Herren, die in Orchesterreihen, Logen und Parkettstühlen saßen, so schön gekleidet waren. Ich liebe die Damen, die auf den vorderen Plätzen des Theaters sitzen. Warum sollte ich es leugnen? Ich liebe ihre Kleider, die kostbare Vorwände sind, nichts mehr, nichts weniger. Ich liebe ihre nackten Arme, von denen ich bestimmt weiß, daß sie gepudert sind. Ich liebe den Puder. Ihre Augenbrauen sind mit Schwarzstift geschminkt. Ich liebe den Schwarzstift. Sie haben Atropin in den wunderbar natürlich glänzenden Augen. Ich liebe das Atropin und die Augen.
Auch die Herren mag ich gern. Sie haben Smoking und weiße steife Hemdbrust. Ihre Hemdbrust knistert. Sie haben Glatze oder pomadisierte Scheitel. (Nur die Pomade mag ich nicht.) Und sie haben Gesten, oh, Gesten!
Allen diesen Damen und Herren haben gütige Feen Logenbillets in die Wiege gelegt. Diesen Glauben lasse ich mir nicht nehmen. Salonorchester lullten sie, noch als sie klein waren, alle in den Schlaf. Über Deiner Wiege, aber, Mensch in der zehnten Reihe, blies ein simpler Pausbackengel auf einer Kindertrompete ein dummes, dummes Schlaflied, vom Vater und vom Schaf!
Vor einigen Tagen – ich liebe diese Premieren eben so sehr – ging ich in eine Filmpremiere. Sie fand in einem großen Kinotempel Berlins statt, und viele, viele Wagen fuhren vor dem Tempel vor. Eine Livree, die offenbar über einen Menschen gestülpt war, stand vor den Toren des Tempels und öffnete die Wagentüren. Und heraus stiegen: Hemdbrüste, Schminke, Puder, Atropin.
Alle Menschen, die ich in der Filmpremiere sah, die auf der Leinwand und die im Saal, hatten große Gesten. Allmählich konnte ich die Geschehnisse der Leinwand und die des Saales nicht mehr auseinanderhalten. Alle Menschen auf der Leinwand benahmen sich – es war ein »Gesellschaftsdrama« – wie bei einer Premiere. Alle Menschen im Saal – es war eine Premiere – benahmen sich, wie in einem Gesellschaftsdrama. Wenn Sie »Danke!« sagten, lag in diesen zwei Silben die Hälfte ihrer Seele. Wenn sie den Nachbarn auf den großen Zeh traten, sprangen sie elastisch zurück, als hingen sie an einem Gummiband und flüsterten: Verzeihung. In dem »zeih« lag so viel Güte, Weichheit und Humanität. Lag Delikatesse als Weltanschauung.
Der Film gefiel allen Menschen ausgezeichnet und sie klatschten. Wem klatschten sie? Fragte ich mich. Den Schatten? Das sind Menschen, ganz winzige Menschenbilder, deren Körper und Bewegungen in Millionen Atome zerhackt – kaschiertes Bildfleisch – auf winzige Marken geklebt sind.
Sie aber klatschten, die Menschen, denen der Film so gut gefallen hatte. Ich dachte: nie werden ihnen diese vergrößerten Körperatome der Schauspieler den Gefallen erweisen und auf die Leinwand kommen, um sich zu verneigen.
Während ich so dachte, kam ein Schauspieler, wirklich, vor die Leinwand und verneigte sich.
Ich hatte nicht daran gedacht, daß die Schatten im Saal saßen, bei der Premiere, und Gesellschaftsdrama spielten.
Wir treiben einen unerhörten Aufwand mit Gesten. Jede Lächerlichkeit hat ihr Pathos.
Alle Dummheiten tragen Reifröcke und Pleureusen. Jede primitive Handlung, jeder Schritt, jedes Gefühl steckt in einer Livree. Wozu komplizieren wir das Einfache, und Primitive?
Ich kannte einen Mann, er war ein biederer, einfältiger Kaffeehausmusiker. Aber er trug einen Radmantel und einen Plüschhut.
Der Filmschauspieler kann keinen Radmantel und keinen Plüschhut tragen. Er macht Armbewegungen mit der Zunge, mit den Augen, mit der Nase.
Nach Schluß der Operettenpremiere klatschten die Leute so lange, bis der Regisseur, der Dichter, der zweite Dichter, der dritte Dichter, der Komponist, der Kulissenmaler auf die Bühne kamen. Der Dichter, der erste, kam nicht so einfach. Er war im Frack, also hatte er mit einem Bühnenaufzug der Operettenurheber gerechnet. Aber er ließ sich vom Regisseur schleifen. Nicht aus Bescheidenheit, sondern aus dem Bedürfnis nach Geste und Pathos.
Am Kurfürstendamm sprach mich nachts ein Mann an und gab mir einen Zettel. Darauf stand: »Das größte Ereignis des Jahrhunderts: Likörstube a. C.«
Eine Likörstube ist das größte Ereignis des Jahrhunderts. Oh, wie groß ist dieses Jahrhundert! …
Ich möchte auf die Operette zurückkommen:
Irgendwo im zweiten Akt verfinstert sich das Antlitz der eben noch sommerlich grün blühenden Kulisse, ein Scheinwerferblitz fächelt über die Landschaft ein kleines Schauerlein und dazu erdonnern des Orchesters Baßgeige und Kesselpauke und die Geigen wimmern herzzerreißend, als würden sie abgewürgt und das Fagott quietscht erbärmlich und die Tschinellen tropfen, wie schwerer Silberregen in das chaotische Treiben des entfesselten Kapellmeisters.
Wozu der Lärm?! – Roderich geht aus dem Vaterhaus in eine ungewisse Zukunft. Bei dieser Gelegenheit singt er ein Chanson. So übel ist ihm zumute. So tragisch ist diese Angelegenheit.
Wozu Baßgeige, Kesselpauke, Götterdämmerung, Weltuntergang?
Ich kenne den Schauspieler, der den Roderich gab, zufällig. Er ist ein ernster Künstler; aus Verlegenheit oder weiß Gott, warum, singt er Chansons. Er ist sehr vernünftig, ein Ironiker eher, als Lyriker, unsentimental, sachlich, skeptisch. Wie hält er den Weltuntergang aus, der seinetwegen arrangiert wurde?