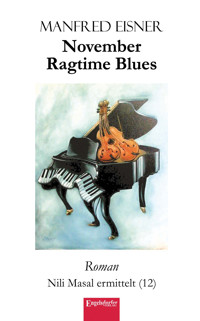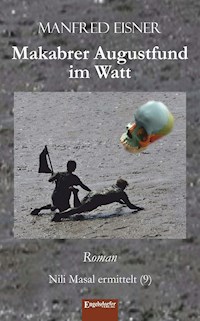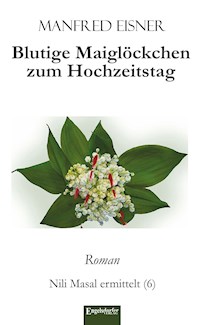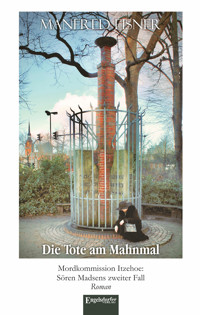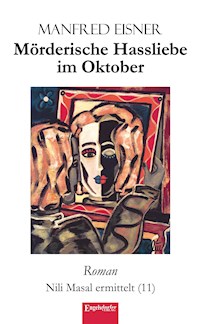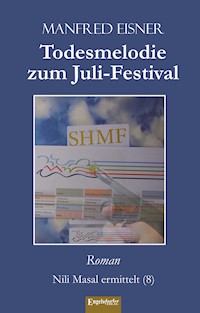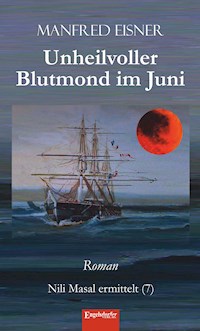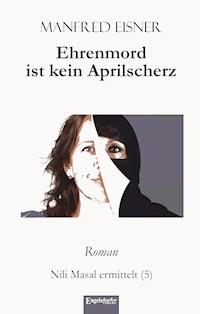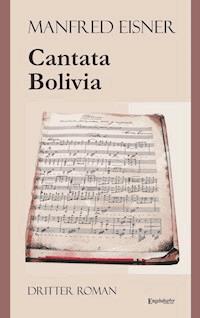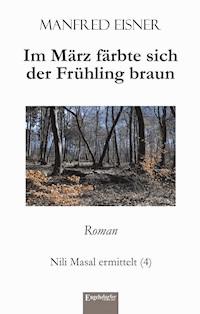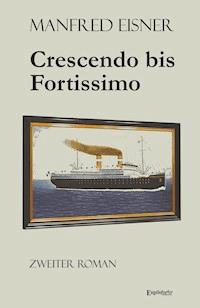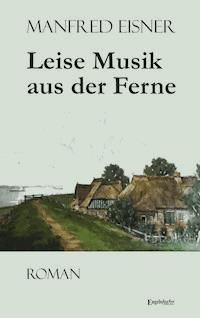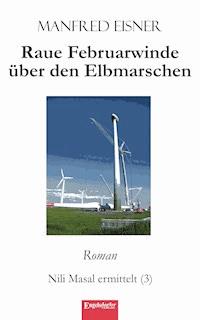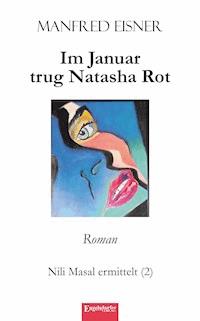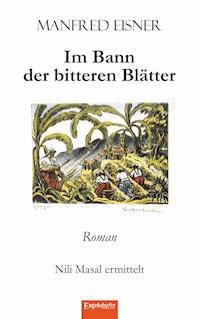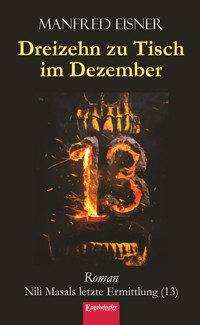
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Landeskriminalämter in Hamburg und Kiel sowie der Itzehoer MoKo II in deren Aufklärungsbemühungen. Mitwirkung und Spürsinn der Sonderermittlerin Nili Masal und ihres Teams führen erfolgreich zur Identifizierung der Drahtzieher und Festnahme der Täter. »Mit ›Dreizehn zu Tisch im Dezember – Nili Masals letzte Ermittlung‹ macht Manfred Eisner den Sack zu. Was vor zehn Jahren mit Nilis dreibändiger Familiengeschichte begonnen hat, mündet mit diesem dreizehnten Kriminalroman in ein großes Finale. Als Lektorin dieses umfassenden Werkes verspüre ich Wehmut, wenn ich daran denke, dass dies der letzte Band ist. Der inzwischen fast neunzigjährige Autor hat es während all der Zeit geschafft, mich mit seinen Geschichten zu fesseln. Nicht nur Nili, die stets den richtigen Riecher hat, wenn es gilt, Verbrecher dingfest zu machen, ist mir regelrecht ans Herz gewachsen. Großartig finde ich die stets aktuellen und brisanten Themen, aus denen Manfred Eisner spannende Verbrechen strickt.« (Birgit Rentz, www.fehlerjaegerin.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Eisner
Dreizehn zuTisch imDezember
Roman
Nili Masals letzte Ermittlung (13)
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2025
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Die Illustration auf der Titelseite stammt vom israelischen IT-Spezialisten Yigal Levi und wurde eigens für dieses Buch geschaffen. Die Grafikcollage auf dem Rückumschlag ist ein Werk des Künstlers Jens Rusch aus Brunsbüttel.
Copyright (2025) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
www.engelsdorfer-verlag.de
Angaben nach GPSR:
www.engelsdorfer-verlag.de
Engelsdorfer Verlag Inh. Tino Hemmann
Schongauerstraße 25
04328 Leipzig
E-Mail: [email protected]
»Cum-Ex: Eine neue Form der Organisierten Kriminalität« […] Die waren schon gut vernetzt – die Einflussnahme auf Medien, auf Wirtschaft und auf Justiz, entweder über Einschüchterung oder über faktische Einflussnahme […] und das macht es ebenso auch so gefährlich – die Unterwanderung.«
Staatsanwältin Anne Brorhilker – zitiert von M. Bognani und G. Mascolo, NDR-ARD Tagesschau 07.11.2021]
»Bei Banken gibt’s heutzutage auch Selbstbedienung. Allerdings gilt das nur für die Vorstände.
[Willy Meurer (1934–2018), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist.]
»Errare humanum est, sed in errare preseverare diabolicum.« (Irren ist menschlich, aber auf Irrtümer zu bestehen, teuflisch.) So lautet die gesamte Sentenz.
[Cicero, Orationes Philippicae, 12,2; https://de.wiktionary.org/wiki/errare_humanum_est, Zugriff: 27.08.2024]
»Woran man einen Vollblutpolitiker erkennt: Er verfügt über ein hervorragend schlechtes Gedächtnis für jeden einzelnen seiner Fehler.«
[Unbekannter Aphoristiker, erstellt 1999, geändert 2012. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Aphoristikern, Zugriff: 28.08.2024]
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Anmerkung
1. Die Bankiers
2. Stürmischer Dezembertag
3. Familienkrieg
4. Rätselhafter Einbruch
5. Facetten
6. Auf der Pirsch
7. Aus Nilis Tagebuch
8. Stürmisches Wochenende
9. Erhellende Indizien
10. Unfreiwillige Beichte
11. Vernehmung und Befragung
12. Alter Schwede!
13. Nilis letzter Eintrag
Kulinarisches
Danksagung
Der Autor
Vorwort
Anstand und Moral sind auch da geboten, wo etwas nicht ausdrücklich verboten ist!
Als Anstand wird […] ein als selbstverständlich empfundener Maßstab für ethisch-moralischen Anspruch und Erwartung an gutes oder richtiges Verhalten bezeichnet. Der Anstand bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart.1 Unter Moral verstehen – zumindest sollte es so sein – wir auch heute noch jene Werte und Regeln, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Unter vielen anderen sind dies vor allem Respekt, Gemeinsinn, Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und der angelsächsische Begriff der Fairness. In diesem Kontext klingen mir heute noch gelegentlich die mahnenden Worte der Eltern in den Ohren, die da lauteten: »So etwas tut man nicht, das gehört sich nicht.« Oder gar: »Das ist unanständig!« Auf diese Weise wurden so manche meiner kindlichen und jugendlichen Entgleisungen kommentiert. Charakteristikum der – deutschen – Gesellschaft in den Dreißigern des vorigen Jahrhunderts, in dem ich geboren wurde, waren die (von anderen Völkern zumeist belächelte) Erziehung zur Gehorsamkeit und die strikte Befolgung der teils rigiden Vorschriften, von denen manche noch aus der Kaiserzeit stammten. Deren Schattenseiten (blinder Gehorsam!) erlebte unser Volk allerdings mit schmerzlichen Folgen in der dunkelsten Zeit unserer Nation während der NS-Diktatur. Mit einigen dieser Eigenarten wurde ich auch noch nach meiner Rückkehr 1957 und während meines Studiums in West-Berlin konfrontiert.
Ich erinnere, dass einer meiner Lehrer am Gymnasium in Bolivien in seinem Unterricht den Verlauf der menschlichen Geschichte mit einem Pendel verglich, das stets von einem Extrem in das andere hin und her wechselt. So kam denn auch eine allmähliche ›Lockerung der Sitten‹ in der Folge des krawallartigen Aufmuckens der ›berühmt-berüchtigten‹ 68er in Gang, die jedoch in der Endkonsequenz in der antiautoritären Kindererziehung ausuferte. Als deren bedauernswerte Begleiterscheinung geriet so mancher ethische Verhaltensbegriff in Vergessenheit, weil dieser seitens der Eltern und Erzieher der nächsten Generation nicht mehr vorgelebt wurde.
Wundern wir uns also nicht so sehr darüber, wenn gelegentlich das Verhalten von jemandem ›da oben‹ nicht dem Anstand entspricht, den wir eigentlich von dieser Person erwarten dürften. Politiker, Lehrer, Richter, aber auch der viel zitierte Otto Normalverbraucher – wir alle sind in unserer Handlungsweise nolens volens irgendwie Spiegel dieser Gesellschaft. In den Vorwörtern zu manchen meiner vorangegangenen Kriminalromane habe ich des Öfteren die rüde Art und Weise angeprangert, in der manche Individuen mit ihren Mitmenschen umgehen. Der zunehmende Mangel an Respekt und die gesteigerte Angriffslust sowie Aggressionen gegen Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute, THW-Freiwillige, Ärzte und ihre Gehilfen – sämtlich sozial engagierte Mitmenschen, die uns alle doch in der Not zu Hilfe kommen – sind böse Zeichen, dass der Anstandspegel leider das gegenüberliegende Ufer der maximalen Unsittlichkeit angeschlagen hat. Diese üblen Erscheinungen sind schwer tolerierbar, dennoch hilft dagegen auch kein noch so wohlgemeintes Verschärfen der Gesetze, nach dem fast alltäglich gerufen wird. Von oben angeordneter Zwang zum Wohlverhalten wird in der heutigen Zeit, in der jeder dahergelaufene sogenannte ›Influencer‹ auf Instagram, TikTok und Co. in seinem Blog eine weit wirksamere Suggestion auf seine ›Follower‹ ausübt, kaum erfolgreich werden. Wir haben aber doch eine deutliche innere Stimme in uns, die uns jenes Gefühl vermittelt, das man Gewissen nennt. Dieses Gewissen ist es auch, das uns zur Verantwortung mahnt für all das, was wir tun oder lassen.
Ziel muss es eher für die Erzieher sein, diese deutliche Gewissensstimme in den Menschen erneut zu wecken und zu stärken, um den unsinnigen und teils haarsträubenden Aberwitz, der zurzeit vorwiegend in den Sozialen Medien kursiert, zu durchschauen und dagegenzuhalten. Zum Schluss zitiere ich gerne die allabendlichen Verabschiedungsworte eines bekannten Moderators der ARD Tagesthemen, die da lauten: »Bleiben Sie zuversichtlich!«
Manfred Eisner, im Winter 2024
Anmerkung
Wie stets in Nili Masals vorangegangenen zwölf Ermittlungsfolgen sind auch in dieser die geschilderten Geschehnisse sowie die Namen der genannten Unternehmen, Akteure und ihre Positionen rein fiktiv und der Fantasie des Autors geschuldet. Eine etwaige Übereinstimmung mit real existierenden Firmen, Personen, deren Berufen, Dienstgraden sowie mit den aufgeführten Begebenheiten wäre rein zufällig.
Zur Schreibweise: Mit Verweis auf die gültigen Rechtschreibregeln der deutschen Sprache nutzt der Autor in seinem Text keine Gendersprache. Die gelegentliche Maskulin-Feminin-Doppelnennung bedeutet allerdings in seinem Verständnis keinesfalls eine Diskriminierung der »LGBTQIA+«-Community.
1. Die Bankiers
Salomon Silberberg wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Hamburg als einziger Sohn jüdischer Eltern geboren. Deren Einstellung zu ihrer Religion war äußerst ungezwungen und ihr Lebenswandel machte – bis auf die rituelle Beschneidung des Sohnes sieben Tage nach der Geburt und dessen Barmitzwa am dreizehnten Geburtstag – kaum Gebrauch von deren Riten oder gar strengen Speisevorschriften. Die Familie war in hohem Maße assimiliert und akkulturiert. Die Art der im Haushalt konsumierten Speisen orientierte sich standesgemäß an den in Hamburg üblichen Gerichten.
Der Erste Weltkrieg fand zunächst den Vater und zum argen Ende ebenfalls den Sohn als Frontkämpfer in der Deutschen Wehrmacht. Beide, der Erstgenannte als Hauptmann der Reserve, Letzterer bis zum Fähnrich avanciert, wurden mehrfach für Tapferkeit und Einsatz für das deutsche Vaterland dekoriert und kehrten 1918 unversehrt nach Hause zurück.
Der Vater war – bereits vor dem Krieg – ein angesehener Rechtsanwalt gewesen, der seiner Familie auch danach ein sorgenfreies und angenehmes Leben mit seinem ertragreichen Einkommen sichern sowie seinem Filius eine angemessene Schulbildung angedeihen lassen konnte. Gerne hätte er es gesehen, wenn dieser in seine Fußstapfen getreten wäre und nach seinem kriegsbedingten Notabitur die Jurisprudenzkarriere aufgenommen hätte. Salomon tat ihm zunächst den Gefallen, gab jedoch schon im Laufe des lustlosen zweiten Semesters auf und folgte eifrig seinem Traum, indem er sich als Lehrling bei der renommierten Karolinen-Privatbank in der Moorweide verdingte. Neben der praktischen Lehre besuchte er eine private Akademie zur Ausbildung zum Bankkaufmann, die er bereits nach zwei Jahren mit Glanzleistung absolvierte. Die Bankwelt der 1920er Jahre erlebte vor allem in Deutschland ihre ›goldene‹ Hochblüte. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Hyperinflation von 1923 entwickelten sich die Wirtschaft sowie das gesamte Leben einer begünstigten Mittelklasse zu bisher nicht bekannten Höhepunkten. Nach der Inflation kündigte Salomon seine Stellung bei der Bank, in der er bereits zum stellvertretenden Leiter der Effektenhandel-Abteilung avanciert war, und beschloss, sich als selbstständiger Börsenhändler zu etablieren. Man brachte dem Sohn des ehrsamen Rechtsanwalts Silberberg besonderes Vertrauen entgegen, und so konnte dieser in kurzer Zeit erfolgreich emporkommen. In Hamburger Börsenkreisen galt er als besonders zuverlässiger und kundiger Berater, der mit findigen Transaktionen seinen Kunden reichliche Gewinne zukommen ließ. Das Spekulationsfieber, vor allem in den USA, jedoch nachfolgend auch in Europa, ließ die Aktienkurse rasant ansteigen, woraufhin sich im Oktober 1929 die Aktienwerte seit 1925 verdreifacht hatten. Börsenspekulanten verursachten eine euphorische Blase, in deren Folge die Aktien zu einem immer höheren (weit über dessen reellen) Wert gehandelt wurden.
Als hätte er instinktiv den bevorstehenden großen Börsencrash vorhergesehen, überlebte Salomon Silberberg den ›Schwarzen Freitag‹ am 29. Oktober einigermaßen unbeschadet. Die bei seinen Geldgeschäften erwirtschafteten satten Provisionen machten ihn zum wohlhabenden Makler, der seine Gewinne äußerst geschickt anstatt in volatilen Aktien in Immobilien sowie in Lagerhäusern von Weizen, Gerste und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen investiert hatte. So entpuppte er sich als einer der wenigen Gewinner des globalen monetären Zusammenbruchs, hatte er doch nicht auf eigene Rechnung, sondern stets im Kundenauftrag spekuliert. Die Einführung der kurz danach erfolgten Börsensteuer fand ihn als etablierten ›selbständigen Börsenbesucher‹ mit genehmigter Akkreditierung und Zugang zu dieser. Silberbergs erfolgreiche Karriere und sein instinktives Anlagegeschick hatten sich in Bankier- und Börsenkreisen herumgesprochen. So erschien ihm das Angebot des gerade mal zwanzigjährigen Balthasar von Holsten-Störenfeldt, ihn als Sozius seines zwar durchaus renommierten, jedoch aufgrund der nachfolgenden Wirtschaftskrise stark gebeutelten Bankhauses aufzunehmen, kaum überraschend. Störenfeldt, vom frühen Tod des Vaters in die Verantwortung zur Leitung der Bank vergattert, hatte sich wohl von Silberbergs Kundschaft, die überwiegend aus zahlreichen und eher wohlhabenden Glaubensgenossen bestand, einen substanziellen Zugewinn versprochen. In der Euphorie des alsdann eingetretenen Erfolges firmierte man nunmehr als ›Hamburger SSK-Privatbank (Störenfeldt, Silberberg und Konsorten)‹. Keiner der Beteiligten ahnte damals, dass dies Jahre später zu einer bösen Hypothek für das Unternehmen werden sollte. Der Bankier war seit jungen Jahren mit einer österreichischen Edelfrau vermählt.
Elfrieda Edle von Augusta schenkte ihm zwei Kinder, Sohn Johannes-Balthasar und Tochter Therese. Entgegen seinen auf Tradition besonderen Wert legenden Vorfahren war Balthasar kein Familienmensch und vorwiegend seiner Bank und weniger der Ehefrau und der Nachkommenschaft zugewandt. Nach einer betont emotionsgeladen geführten Auseinandersetzung einigte man sich darauf, dass die Ehefrau mit den Kindern zu ihrer elterlichen Familie nach Graz zurückziehen würde. Ebenso, dass der Vater zu deren Geburtstagen dort zu erscheinen habe und diese wiederum das Weihnachtsfest bei ihm in Hamburg begehen würden.
Bei einem Besuch im Hause eines seiner besten Kunden lernte Salomon den Kaufmann Isidor Rosenzwejg und dessen jüngste Tochter Hermine kennen. In Letztere verliebte er sich auf Anhieb und nach ihrer Trauung in der Bornplatzsynagoge wurde im großen Stil im ehemaligen Familienschloss der von Holsten-Störenfeldt gefeiert – das Schloss hatte der Bankier nach dem Wirtschaftscrash schweren Herzens an eine Hotelkette veräußern müssen, um seine Bank zu retten. Bald darauf kamen Sohn Aaron und ein Jahr danach Töchterchen Judith zur Welt. Im Gegensatz zu seinen assimilierten Eltern stammte Salomons Ehefrau aus einer liberalkonservativen jüdischen Familie, die zwar keinen streng koscheren Haushalt führte, jedoch stets bemüht war, wenigstens die üblichen Gebräuche zum freitagabendlichen Sabbatbeginn und zu den hohen Feiertagen einzuhalten. Salomon selbst hatte zwar seine Barmitzwa über sich ergehen lassen, danach jedoch keinerlei Interesse an irgendwelcher religiösen Betätigung gezeigt. Nun aber ließ er dies alles um sich herum geschehen und seine Kinder wurden auf Wunsch seiner Frau in der Talmud-Thora-Schule am Grindelhof eingeschult.
*
Das wirtschaftliche Desaster gegen Ende der Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts war verheerend. Die enorm angestiegene Arbeitslosigkeit, summiert mit der Ohnmacht der Regierenden in der Weimarer Republik, um das zunehmende Chaos und den ständigen Aufruhr in den Griff zu bekommen, brachte den nach der Macht strebenden Nationalsozialisten sowie der Kommunistischen Partei einen beachtlichen Zuwachs an Mitgliedern, womit eine notorische Zunahme von Hass und Judenfeindlichkeit einherging. Im Reichstag zunächst als unbedeutende Partei geduldet und sträflich unterschätzt, gelang Hitlers NSDAP am 30. Januar 1933 die Machtergreifung, woraufhin die Feindschaft und der Groll gegen die Juden an die Spitze getrieben wurden und zunächst in der ›Reichskristallnacht‹, dem ärgsten Pogrom der Neuzeit, kulminierten. Nach dem als ›Arisierung‹ bezeichneten Berufsverbot von Juden und deren durch die Rassengesetze erzwungenen Hinauswurf aus dem Wissenschafts-, Kultur- und Wirtschaftsleben bekam Salomon Silberberg dies ebenso zu spüren, wenn auch in der Hansestadt Hamburg dieser Prozess bis 1938 aus welchen Gründen auch immer noch nicht so stark forciert wurde wie im Rest des Reiches. Dennoch wurde seine Position nach seiner Entfernung aus dem Börsenmakler-Register immer prekärer. Er durfte nur noch im Hintergrund agieren und soufflierte dem vorgeschalteten Kollegen Kahl seine vom Instinkt geprägten Anlagenvorschläge. Nach wie vor lag er zumeist mit seinen Prognosen richtig, das Lob dafür kassierte hingegen Heinrich Kahl.
*
Anfang 1939 bekam die Bank persönlichen Besuch vom Hamburger NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter, der Herrn Balthasar von Holsten-Störenfeldt unverblümt klaren Wein einschenkte: Unverzüglich habe er den Juden Salomon Silberberg als Sozius zu entfernen und ihn von jeglicher Tätigkeit in seiner Bank zu entbinden. Es sei untragbar, dass solch niedrig gesinnte Elemente sich weiterhin am deutschen Volk bereicherten. Der Name der Bank sei ebenfalls entsprechend zu revidieren. Sprach’s, ließ keinerlei Einwand zu und verließ den Besprechungsraum mit einem zackigen »Heil Hitler!«.
Dem war nichts entgegenzusetzen. Salomon Silberberg packte seine persönlichen Habseligkeiten, räumte wehmütig seinen Schreibtisch und verschwand unbemerkt durch eine Seitentür der Bank. Als er Tage danach, gleichermaßen von Neugier und Trübsinn getrieben, am Prunkgebäude vorbeilief, bemerkte er die neue, glänzend polierte Messingtafel neben dem Portal: ›Hamburger SK-Privatbank (Störenfeldt & Kahl). »Na ja«, murmelte er mit einem traurigen Lächeln, »der böse Jud is weg, SA-Obersturmbannführer Kahl hat es nun endlich geschafft! Er bekam den Posten, den er schon vor meinem Bankeintritt heiß begehrte. Man frage sich also, wer das Vögelchen gewesen sein könne, das ins Ohr des Herrn Reichsstatthalter gezwitschert hat?« Der vor der Bank stehende livrierte Portier hatte ihn wohl bemerkt und machte zunächst Anstalten, ihn wie vormals jeden Morgen zu begrüßen, hielt aber plötzlich inne, machte rasch kehrt und verschwand eilig hinter dem Portal. Auch Salomons sorgfältig angehäufte Getreidesilos sowie die Immobilien fielen nach und nach der ›Arisierung‹ und der ›Entjudung‹ zum Opfer und wurden von gierigen NS-Parteigenossen und Mitläufern erworben; die weit unter ihrem reellen Wert liegenden Beträge, die dafür erlöst wurden, wanderten – ebenso wie sämtliches damals von den Nazis geraubtes Hab und Gut der Entrechteten – auf die ominösen Sperrkonten bei der De-Go, der halbstaatlichen Deutschen Golddiskontbank.
*
Salomons Vater, dessen Rechtskanzlei nach dem Berufsverbot von seinem Sozius Doktor jur. Otto von Rottach übernommen wurde, erkannte bald die Zeichen der Zeit und wanderte im Oktober 1936 mit seiner Ehefrau in die USA aus. Von Rottach war zwar ein überzeugter Nationalsozialist, der bereits kurz nach Gründung der Partei deren Mitglied wurde, allerdings teilte er nicht den von der NSDAP verordneten Judenhass und verhielt sich, soweit es ihm unter den herrschenden Bedingungen möglich war, äußerst fair gegenüber seinen arg benachteiligten jüdischen Mandanten, die bei ihm um Hilfe ersuchten. Salomon hingegen glaubte irrigerweise (wie zahlreiche seiner Leidensschwestern und - brüder) immer noch daran, dass man ihm als unbescholtenem Deutschen und ehemaligem Frontkämpfer nichts anhaben könne und dass das an ihm begangene Unrecht rückgängig gemacht werde, sobald das unsägliche Naziregime wieder abgewählt würde. Der 9. November 1938 lehrte ihn allerdings die bittere Wahrheit, wurde er doch bereits in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages von zwei Gestaposchergen abgeholt. Mit vielen seiner Freunde und ehemaligen Kunden fand er sich im Gefängnis in Fuhlsbüttel wieder, wo zunächst die Hamburger Juden gesammelt wurden. Wenig später sollten sie in das Konzentrationslager in Oranienburg nördlich von Berlin verlegt werden. Seine Ehefrau Hermine kontaktierte den ehemaligen Sozius ihres Schwiegervaters und bat ihn um Hilfe. Otto von Rottach setzte daraufhin seine Parteikontakte in Bewegung und es gelang ihm innerhalb weniger Tage, Salomon gegen Hinterlegung einer Kautionssumme von einer Million Reichsmark freizubekommen. Er erhielt die Auflage, binnen eines Monats zusammen mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Dank des Affidavits2, das ihm sein Vater in Boston gewähren konnte, erhielten sie gerade noch rechtzeitig das Visum, das ihnen die Einreise in die USA gewährte. Sie reisten zunächst mit der Eisenbahn nach Kopenhagen, wo sie an Bord des polnischen Dampfers Batory gingen, der sie nach New York brachte. Dort angekommen, erhielt Salomon dank seiner ehemaligen Bekanntschaft im internationalen Börsenhandel schon bald eine Stelle bei einem renommierten Broker. Sein Haus in Winterhude samt der gesamten Hinterlassenschaft an Pertinenzien wurde schließlich, wie zumeist alle unter Zwang hinterlassenen Vermögenswerte von emigrierten und deportierten Juden, zugunsten des NS-Staates eingezogen.
*
Heinrich Kahl war zeit seines Lebens ein gewiefter Opportunist gewesen. Er stammte aus einer eher bescheidenen Baumschulenfamilie in der Pinneberger Gegend. Als deren vierter Sohn konnte er wohl kaum ein erträgliches Einkommen aus dem Verbleib im elterlichen Betrieb erwarten. So ging er andere Wege: Nach dem Abschluss der Grundschule machte er seine kaufmännische Lehre bei einem der Familie wohlgesinnten Rauchwarenhändler in Wilster. Als Achtzehnjähriger wurde er gemustert, konnte jedoch wegen einer ihm ärztlich attestierten angeborenen Herzschwäche der darauffolgenden Einberufung entgehen. Der aufgeweckte und arbeitswillige Jüngling wechselte anschließend an die Handelsschule in Itzehoe, wo er den Brief als Einzel- und Großhandelskaufmann erwarb. Der sehr gut aussehende junge Mann engagierte sich schon sehr früh in der NSDAP, der er 1926 beitrat, und ebenso in der SA, bei der er dank seiner offen gezeigten Brutalität während der Schlägerzüge gegen Kommunisten und NS-Gegner bis zum Obersturmbannführer avancierte. Bei einem Parteitreffen in Hamburg fiel ihm eines der BDM-Mädchen auf, die dort Volkstänze vorführten. Er sprach sie an und diese aparte Gunhilde, wie er wenig später herausfand, entpuppte sich als die jüngste Schwester des renommierten Privatbankiers Balthasar von Holsten-Störenfeldt. Da Gunhilde sehr hübsch war und sich gegenüber seinen Avancen nicht abgeneigt zeigte, beschloss Heinrich, sich diese glückliche Bekanntschaft zu Nutze einer zukünftig erfolgreichen Karriere zu machen. So traf man sich danach des Öfteren, zunächst innerhalb der parteilichen Veranstaltungen, dann aber auch zu zweit, und so entwickelte sich allmählich eine starke Zuneigung Gunhildes zu ihrem ehrgeizigen Bewerber. Nach den ersten begehrenden Küssen, in deren Folge es beinahe zum vollendeten Geschlechtsverkehr gekommen wäre, spielte Heinrich seine detailliert geplante Kavaliersrolle, in der er sich im richtigen Augenblick ruckartig zurückzog und ihr rührig eröffnete, dass er sie wirklich liebe und hochachte und sie deshalb nicht derart leichtfertig entehren werde. Mit einem tiefen Blick in ihre Augen fragte er sie daraufhin, ob sie seine Frau werden und ihn heiraten wolle. Voller Glück stürzte sich die fast vollständig entkleidete junge Dame an seine Brust und bedeckte ihn wild mit ihren Küssen. Einige Tage später machte der raffiniert berechnende Bräutigam in spe bei Gunhildes Bruder Balthasar und Schwester Adelgunde von Holsten-Störenfeldt in voller SA-Montur seine Aufwartung und bat offiziell um die Hand von deren jüngster Schwester. Gunhildes Eskapaden kamen Balthasar schon seit einiger Zeit zu Ohren und trieben ihn um, denn er war sowohl wegen der obskuren Herkunft des Freiers als auch dessen zweifelhaftem SA-Ruhm besorgt. Zudem erahnte man deutlich die tatsächliche Motivation zu dieser für ihn vorteilhaften Verbindung. Andererseits, wie vom Syndikus seiner Bank empfohlen, durch den er sich beraten ließ, könne eine solche Verbindung zu den zunehmend erfolgreichen NSDAP-Kreisen für die Bank von Vorteil sein. Rechtsanwalt Otto von Rottach – da selbst Parteigenosse – machte ihm zudem klar, dass man sich bald keine Feindschaft gegen diese wachsende politische Kraft mehr leisten könne, die erheblichen Stimmengewinne bei den letzten Wahlen machten dies doch wohl deutlich. Derart hin- und hergerissen stand er nun allein vor dieser schwerwiegenden Entscheidung, denn seine etwas depressive Schwester Adelgunde war ihm dabei wenig hilfreich. »Lass sie doch selbst ihr Glück bestimmen«, war alles, was sie ihm zu dieser Frage erwiderte. Wenig später folgte auch sie ihrer Devise, verzichtete auf Stand und Adelstitel und heiratete den Ingenieur Markus Balsam. Zusammen mit dem Gatten zog sie nach Neumünster, wo er kurz zuvor die Leitung des Eisenbahnausbesserungswerks übernommen hatte.
»Ich weiß wohl Ihre Zuneigung zu meiner Schwester Gunhilde hochzuschätzen, sehr geehrter Herr Kahl«, war dann auch Balthasars erste Erwiderung zu dessen Antrag gewesen. Dann – dem Vorschlag seines Anwalts folgend – fügte er weiter aus: »Um ehrlich zu sein, würde ich Sie aber vor einer Antwort auf Ihren wohlgemeinten Antrag schon ganz gern ein wenig besser kennenlernen. Mir ist bekannt, dass Sie einen Handelsschulabschluss besitzen. Daher schlage ich vor, dass Sie zunächst als Angestellter in meine Bank eintreten und Ihre diesbezüglichen Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit unter Beweis stellen. Eine Beförderung und sogar eine spätere Partnerschaft winken Ihnen durchaus bei entsprechender Eignung, wenn Sie mit meinem Vorschlag einiggehen.«
Heinrich Kahl bedankte sich und ergriff gierig die ihm gereichte Hand. Er lachte sich ins Fäustchen, war es ihm doch gelungen, einen Fuß in die Tür der Bank zu stellen, ohne zugleich den lästigen Ballast einer doch nicht unbedingt gewünschten Hochzeit in Kauf nehmen zu müssen. Schon am nächsten Tag machte er sein Entree im neuen Wirkungskreis und entwickelte sich, sehr zur Verwunderung des Bankiers, zu einem geschickten Fachmann, der sich seine ersten Sporen in der Kreditabteilung verdiente. Vor allem während der Inflationsperiode trug er durch geschäftstüchtiges Taktieren dazu bei, dass die Verluste der Bank zwar beträchtlich waren, jedoch nicht ins substanziell Uferlose gerieten. Durch raffinierte Verhandlung gelang es ihm sogar, den für die Rettung der Bank notwendig gewordenen Verkauf des Familienschlosses der von Holsten-Störenfeldt derart günstig zu gestalten, dass die arg gebeutelten Kassen des Unternehmens mit US-Dollar- und Englischen Pfundnoten wieder einigermaßen gesichert waren. Ein herber Rückschlag traf ihn dann doch: Die Entscheidung Balthasars neben der Aufnahme Salomon Silberbergs als Partner, diesem auch noch die von ihm begehrte Leitung des Effektenhandels zu übertragen, war für ihn niederschmetternd und unerträglich. Zudem hatte sich seine Liebesbeziehung zu Gunhilde in dem Maße abgekühlt, in dem sein Erfolg im Bankhaus gestiegen war. Als er bei seinem Chef vorstellig wurde, um sich wegen dieser Wahl zu beschweren, setzte ihm dieser die Pistole auf die Brust: entweder sofortige Hochzeit oder Rauswurf! Gunhilde lag ihm schon seit Wochen in den Ohren und bestand nun auf Erfüllung der Vereinbarung. Balthasar war es inzwischen ziemlich egal: Solle sie doch den Kerl heiraten, dann gebe sie endlich Ruhe, habe er doch ganz andere Sorgen. Zähneknirschend beugte sich Heinrich der Forderung, schwor aber heimlich Rache gegen den Emporkömmling, noch dazu ein verdammter Jude, der ihn um seine ersehnte Stelle gebracht habe. Wie dieser nach seinem Rausschmiss richtig vermutete, war es Kahl gewesen, der ihn gegenüber seinen NS-Parteioberen denunziert hatte. Dann wurde er also nolens volens mit der nun beglückten Gunhilde vermählt. Der von seiner plagegeistigen Schwester nunmehr befreite Bankier schenkte dem jungen Ehepaar eine kostspielige Hochzeitsreise, die sie über fast zwei Monate nach Griechenland, Italien und zuletzt an die dalmatinische Küste führte. Heinrich Kahl war dann auch erleichtert, als er wieder an seinem Schreibtisch im Bankhaus saß. Sein Horizont erhellte sich bald wieder, als der verhasste Silberberg von einem Tag zum anderen aus der Szene verschwand und er endlich den ersehnten Posten bekam. Sinnigerweise zog das Paar in das ehemalige Wohnhaus der Familie Silberberg in Winterhude, das Balthasar von Holsten-Störenfeldt aus dessen Hinterlassenschaft erwerben konnte.
Die allgemeine Lage der deutschen Finanzwelt jener Zeiten war allerdings nicht gerade rosig, spitzte sich doch die Devisenknappheit wegen der damaligen überdimensionalen Wehrmachtsaufrüstung immer weiter zu.
Ein erfolgreicher Coup gelang Balthasar, indem er nach und nach bedeutende Anteile der Bankaktiva aus den durch die Wirren der alliierten Bombenangriffe unbemerkt gebliebenen illegalen Transaktionen bei einem befreundeten Schweizer Bankhaus parkte.
Kurz nach Kriegsausbruch erhielt Heinrich Kahl den Einberufungsbefehl. Als sogenannter Freiwilliger registriert, wurde er jedoch vorerst wieder nach Hause geschickt. Wenig später wurde er infolge einer erneuten ärztlichen Untersuchung endgültig vom Wehrdienst befreit und konnte die Aufgaben in der SK-Bank wieder aufnehmen. Der englische Sprengbombenvolltreffer, der 1943 deren Gebäude während der ›Operation Gomorra‹ fast vollkommen zerstörte, kostete ihn beinahe das Leben. Schwer verwundet holte man ihn aus den Trümmern; erst nach fast einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern und längerem Kuraufenthalt konnte er wieder einigermaßen am Stock gehen. Dank des Einsatzes von Rechtsanwalt von Rottach – dem man im Zuge der Entnazifizierung trotz Parteimitgliedschaft wegen seiner durch überlebende Zeugen nachgewiesenen Hilfsbereitschaft bei der Ausreise vieler Juden den Persilschein und damit die Erlaubnis zur weiteren Berufsausführung gewährt hatte – kam auch Kahl ungeschoren davon und unternahm gemeinsam mit von Holsten-Störenfeldt den mühsamen Wiederaufbau der Bank. Als Grundvermögen diente ihnen das vorweg in die Schweiz gerettete Devisenpaket. Instinktiv ahnte Kahl – trotz der strikt angeordneten Geheimhaltung – die unmittelbar bevorstehende Währungsreform von 1948 und überzeugte seinen Partner, ihr gesamtes Reichsmarkvermögen mit dem Erwerb von Devisen, Immobilien und Sachwerten abzusichern. Nach Einführung der D-Mark konnte man diese nunmehr mit sattem Eigennutzen wieder veräußern. Mit dem Erblühen des darauffolgenden Wirtschaftswunders gedieh die SK-Privatbank prächtig und etablierte sich erneut vorwiegend mit ihrer Kundschaft aus wohlhabenden Hanseaten. So manches dubiose Vermögen aus der NS-Zeit konnte – ungeachtet dessen obskurer Herkunft und natürlich mit einer beachtlichen Gewinnmarge – nicht zuletzt durch Kahls trickreiche Manöver in die Legalität zurückgeführt werden. Allerdings waren sie mit diesem unsittlichen Gebaren nicht die Einzigen, denn fast sämtliche sogenannte ›ehrbare‹ Geldinstitute, einschließlich jene in der neutralen Schweiz und in Schweden, taten es ihnen gleich. Zig Millionen englische Pfund, US-Dollar sowie Goldbarren, Kunst- und Wertgegenstände aus der vormalig deponierten Habe jener verzweifelten vom NS-Hass und Mordlust Verfolgten lagerten über Jahrzehnte in deren Tresoren, da keiner von ihnen die Schoah überlebt hatte, bis die sogenannte internationale Restitutionsvereinbarung wenigstens deren teilweise Herausgabe an Hinterbliebene und Erben oder, mangels derer, ersatzweise an den Staat Israel erzwang.
*
Da der ehemalige Familiensitz damals zwangsweise veräußert worden war, wollte der älteste Sohn Johannes-Balthasar, der nach dem NS-Zusammenbruch mit Mutter Elfrieda und Schwester Therese aus Österreich nach Hamburg zurückgezogen war und zwischenzeitlich seinen Vater geschäftlich unterstützte, wieder einen Landsitz im schleswig-holsteinischen Umland der Hansestadt etablieren. Es sollte jedoch kein prunkvolles, sondern eher ein bescheiden wirkendes Wochenendrefugium für traute Zusammenkünfte im engeren Familienkreis sein. Nach längerem Suchen fand sich ein geeignetes Objekt im Kreis Steinburg: das ehemalige Herrenhaus der ›von Steinberg‹-Familie in der Elbmarschen-Kleinstadt Oldenmoor. Nach dem Ableben der letzten Eigentümer, Hans-Peter und Johann von Steinberg, war es unbewohnt und stand zum Verkauf. Auch fünfundzwanzig Hektar von den durch das ehemals zunehmend verarmte Geschlecht notdürftig veräußerten Ländereien in der Umgebung des Gutes wurden nach und nach wiederbeschafft.
Johannes Balthasar hatte anlässlich einer Kreditbürgschaftsbesprechung mit einem betuchten Bankklienten, dem Hamburger Bauunternehmer Ferdinand Friedenhelm, die Bekanntschaft mit dessen junger Tochter gemacht, die ihn dabei begleitet hatte. Johanna Friedenhelm schenkte ihm nach der prunkvollen Hochzeit im Hotel Vier Jahreszeiten dann auch den vom Patriarchen herbeigesehnten Enkel Gunther-Balthasar, dem zwei Jahre danach ein Schwesterchen folgte, dem sie den Namen Gitta-Juliette gaben. Noch ein Jahr darauf erblickte das dritte Kind des Paares das graue Novemberlicht Hamburgs. Wie auch seine vorangegangenen Geschwister wurde es standesgemäß in Hamburgs Hauptkirche Sankt Michaelis auf den Namen Edith-Adelgunde von Holsten-Friedenhelm getauft. Ihre Schwester sowie auch schon die Mutter trugen nun diesen Namen, derart es der Brautvater damals bei der Überschreibung einer gewichtigen Mitgift vereinbarte. Nur der erstgeborene Gunther-Balthasar behielt den Familiennamen der ›von Holsten-Störenfeldt‹-Dynastie, wurde er doch mit seiner Geburt als die Nachfolgegeneration des Bankhauses erkoren.
*
Heinrich Kahl wurde an einem Montag im vorangegangenen Oktober von Ehefrau Gunhilde in seinem Schlafzimmer in deren Hamburger Villa an der Elbchaussee tot aufgefunden, nachdem er nicht, wie üblich, am Frühstückstisch erschienen war. Am Vorabend hatte im Hause ein feierliches Diner stattgefunden, an dem er und ein Dutzend Gäste sich an den erlesenen gastronomischen Kreationen eines bekannten Fernsehkochs gütlich getan hatten. Der herbeigerufene Leibarzt der Familie, Doktor med. Alwin Breitenbach, bei dem er seit vielen Jahren wegen seiner angeborenen Herzinsuffizienz in Behandlung gewesen war, attestierte im Totenschein sein Ableben aufgrund des Organversagens. Die Trauerfeier für den angeheirateten Verwandten fand im großen gesellschaftlichen Rahmen mit viel Pomp und begleitet von geblähten Lobreden von Wirtschaftlern und Politikern in der Sankt-Marien-Kirche statt und die Beisetzung dann auch in unmittelbarer Nähe des dortigen Familiengrabes der von Holsten-Störenfeldt. ›Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei Beerdigungen und vor Gericht‹, besagt ein bekanntes Sprichwort, dem auch beim anschließenden Leichenschmaus zur Genüge gewürdigt wurde. Obwohl so manchem Trauergast die obskure Vergangenheit des Verblichenen während der NS-Zeit durchaus bekannt war, verlor niemand darüber auch nur ein Wort, denn es heißt ja ebenfalls: ›von den Toten nichts außer auf gute Weise‹.
Heinrich Kahls Witwe jedenfalls war nunmehr ziemlich erleichtert, den inzwischen von ihr verschmähten Ehegatten endlich losgeworden zu sein. Ihre Gunst galt schon seit längerer Zeit ihrem fünfzehn Jahre jüngeren Geliebten namens Joachim Reiter, ein gelernter Bankkaufmann, der bereits auf Gunhildes Geheiß bei der SK-Privatbank hatte eintreten dürfen und der nach Kahls Ableben Prokura zugesprochen bekam. Schon zu Heinrichs Lebzeiten hatte sie zu ihm eine intime Beziehung unterhalten – ein im Familienkreis und auch in der Bank allgemein bekanntes ›Geheimnis‹, das jedoch niemanden zu stören schien, zuallerletzt den hintergangenen Ehemann, der im Grunde genommen froh gewesen war, von seinem ihm zunehmend lästig gewordenen Weibe derart entlastet worden zu sein.
*
Johannes-Balthasar von Holsten-Störenfeldt, der nach Umzug des Vaters in den Aufsichtsrat der Bank die Leitung des Unternehmens übernommen hatte, fand Gefallen am Neuling und machte ihn zum vertrauten Leiter seiner Investmentabteilung. Irgendwann gelangte jedoch Prokurist Joachim Reiter fatalerweise in den Dunstkreis der Anhänger jenes Steueranwalts, der als Erfinder der Cum-Ex3-Masche gilt, und mischte in diesem Sumpf kräftig mit. Satte Gewinne ergaben sich durch diese Transaktionen. Sie trugen maßgeblich zu den brillanten Bilanzen bei, mit denen sich die SK-Privatbank ihren Klienten präsentieren konnte.
2. Stürmischer Dezembertag
An diesem stark windigen frühen Montagmorgen Anfang Dezember hat es vor allem an der Ostküste Schleswig-Holsteins reichlich geschneit. Während der vorangegangenen Nacht traf in der Landesmitte ein starkes skandinavisches Hochdruckgebiet mit eisigen Temperaturen auf eine beinahe stürmische und wolkenverhangene Tiefdruckzone. Diese wehte von der Westküste herüber und verursachte einen massiven Niederschlag, der binnen weniger Stunden eine vierzig Zentimeter hohe Schneedecke auf den bereits eisglatten Straßen hinterließ, bevor das Unwetter ebenso schnell in östliche Richtung weitergezogen ist. Dementsprechend groß ist das hierdurch verursachte Verkehrschaos auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen. Zahlreiche ausgerückte Räumungs- und Streufahrzeuge bleiben ebenso wie Tausende von Pendlern und Lkws in den verwehten Massen stecken, wenn sie nicht gerade machtlos von der vereisten Fahrbahn in die Gräben schliddern.
»Macht wohl wenig Sinn, weiterzufahren«, konstatiert die frustrierte Nili Masal am Steuer ihres vor Kurzem von den auf tragische Weise verstorbenen Freunden Javier und Conchita Espinoza in Antwerpen geerbten Audi Q3. Sie stecken bereits seit fast einer Stunde noch kilometerweit vor der Auffahrt Neumünster Mitte auf die A 7 im Stau.
Ihr Beifahrer und Kollege Kriminaloberkommissar Robert Zander nickt zustimmend und greift zum iPhone.
Kurz darauf meldet sich KK Timo Bohns fröhliche Stimme am anderen Ende: »Moin, Kollegen! Kann mir schon denken, warum ihr noch nicht hier seid, aber tröstet euch, das ganze Haus 12 am Kieler Eichhof ist so gut wie verwaist. Auch Manolo kommt gerade erst völlig echauffiert herein und Margret hat von zu Hause angerufen, sie käme nicht aus der Tür, da stünde eine meterhohe Schneewehe davor. Waldi hat sich telefonisch aus Berlin gemeldet, er sei gut angekommen und werde erst morgen Abend wieder zurück sein. Er hofft, dass die Konferenz im BKA rechtzeitig beendet ist, sodass er den letzten Zug erreicht – wenn der denn überhaupt gehen sollte! Ihr wisst ja, die gute alte Deutsche Bahn – ›Alle reden vom Wetter, wir nicht!‹ – haha!«