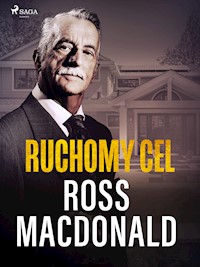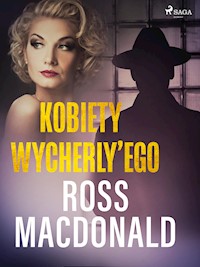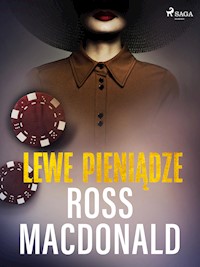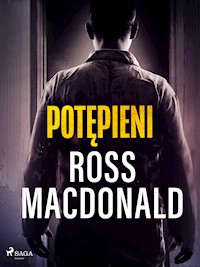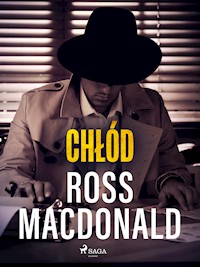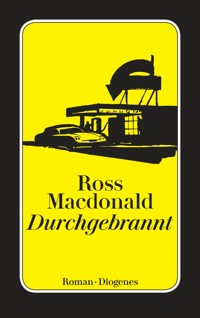
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
LSD, sexuelle Promiskuität, hilflose Eltern konfrontiert mit verzweifelten Teenagern – die Krimilegende Ross Macdonald erforscht die moderne amerikanische Psyche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ross Macdonald
Durchgebrannt
Roman
Aus dem Amerikanischen von Helmut Degner
Diogenes
{5}1
Auf dem Sepulveda herrschte leichter Morgenverkehr. Als ich über den Paß fuhr, ging über den blauen Klippen auf der andern Seite des Tals glutrot die Sonne auf. Bevor der Tag richtig begann, sah ein oder zwei Minuten lang alles frisch und neu und erhaben aus wie am ersten Tag der Schöpfung.
Ich verließ die Autobahn am Canoga Park, hielt an einem Drive-in und nahm ein Neunundneunzig-Cent-Frühstück zu mir. Dann fuhr ich nach Woodland Hills hinauf zu den Sebastians.
Keith Sebastian hatte mir genau beschrieben, wie ich sein Haus finden würde. Es war ein rechteckiger, moderner, an einen Berghang angebauter Bungalow. Der Hang fiel steil zum Rand eines Golfplatzes ab, der grün vom ersten Winterregen war.
Keith Sebastian trat in Hemdsärmeln aus dem Haus. Er war ein gutaussehender Mann von etwa Vierzig mit dichtem, lockigen, braunen Haar, an den Schläfen graumeliert. Er hatte sich noch nicht rasiert, und die Bartstoppeln an seinem Kinn sahen aus wie eingeriebener Schmutz.
»Schön, daß Sie so schnell gekommen sind«, sagte er, als ich mich vorgestellt hatte. »Ich weiß, es ist eine unchristliche Zeit –«
{6}»Nicht so schlimm – Sie haben sie sich ja nicht ausgesucht. Ich nehme an, sie ist noch nicht heimgekommen.«
»Nein. Nachdem ich Sie angerufen hatte, stellte ich fest, daß noch etwas fehlt. Meine Schrotflinte und eine Schachtel Patronen.«
»Sie glauben, Ihre Tochter hat sie mitgenommen?«
»Ich befürchte es. Der Gewehrschrank ist nicht aufgebrochen, und niemand anders weiß, wo der Schlüssel ist. Außer meiner Frau, natürlich.«
Mrs. Sebastian erschien wie auf ein Stichwort hin in der Haustür. Sie war mager und dunkelhaarig und recht hübsch; sie hatte frisch geschminkte Lippen und trug ein frisches gelbes Leinenkleid.
»Kommt doch rein«, rief sie uns zu. »Scheußliche Kälte.« Sie verschränkte fröstelnd die Hände vor der Brust und verharrte in der Stellung.
»Das ist Mr. Lew Archer«, sagte Sebastian. »Der Privatdetektiv, den ich angerufen habe.« Er sagte es, als unterbreite er ihr ein Friedensangebot.
»Das habe ich mir gedacht«, antwortete sie gereizt. »Kommt rein, ich habe Kaffee gemacht.«
Ich setzte mich zwischen die beiden an den Küchentisch und trank aus einer dünnen Tasse das bittere Gebräu. Der Raum schien sehr sauber und sehr leer. Das Licht, das zum Fenster hereinfiel, war von einer grausamen Helligkeit.
{7}»Kann Alexandria ein Gewehr abfeuern?« fragte ich.
»Das kann doch jeder«, sagte Sebastian mürrisch. »Man braucht doch nur am Abzug zu ziehen.«
»Sandy ist sogar eine ganz gute Schützin«, warf seine Frau ein. »Die Hacketts haben sie vor ein paar Monaten mal zur Wachteljagd mitgenommen. Übrigens ganz gegen meinen Willen.«
»Das hast du schon oft genug betont«, sagte Sebastian. »Diese Erfahrung war sicher nützlich für sie.«
»Sie hat es schrecklich gefunden. Das hat sie in ihr Tagebuch geschrieben. Sie findet es abscheulich, Tiere umzubringen.«
»Sie wird schon drüber hinwegkommen. Und Mr. und Mrs. Hackett hat es Spaß gemacht, das weiß ich.«
»Geht es schon wieder los?«
Doch bevor es losging, sagte ich: »Wer, zum Teufel, sind Mr. und Mrs. Hackett?«
Sebastian warf mir einen vielsagenden Blick zu; halb ärgerlich, halb gönnerhaft.
»Mr. Stephen Hackett ist mein Chef. Das heißt, ihm gehört die Holdinggesellschaft, der die Bank gehört, bei der ich arbeite. Ihm gehört auch noch einiges mehr.«
»Du, zum Beispiel«, sagte seine Frau. »Meine Tochter aber nicht.«
»Das ist ungerecht, Bernice. Ich habe nie gesagt –«
»Darauf kommt es nicht an, sondern auf dein Verhalten.«
{8}Ich stand auf, ging um den Tisch herum und sah die beiden an. Sie blickten ein wenig erschrocken und verlegen drein.
»Höchst interessant, das alles«, sagte ich. »Aber ich bin nicht um fünf Uhr morgens aufgestanden, um bei einem Familienstreit zu schiedsrichtern. Konzentrieren wir uns doch bitte auf Ihre Tochter Sandy. Wie alt ist sie, Mrs. Sebastian?«
»Siebzehn. Sie ist in der letzten High-School-Klasse.«
»Gute Schülerin?«
»Bis vor ein paar Monaten. Dann wurden ihre Zensuren plötzlich schlecht.«
»Warum?«
Sie blickte in ihre Kaffeetasse. »Ich weiß nicht.« Es klang vage, als wolle sie selbst der Frage ausweichen.
»Natürlich weißt du das«, sagte ihr Mann. »Das Ganze hat angefangen, als sie sich mit diesem wilden Mann einließ. Diesem Davy oder wie er heißt.«
»Mann ist gut. Er ist ein neunzehnjähriger Junge, und wir haben die Sache völlig falsch angepackt.«
»Was für eine Sache, Mrs. Sebastian?«
Sie streckte die Arme aus, als versuche sie die Situation zu umfassen; dann ließ sie sie resigniert sinken. »Na, die mit dem Jungen. Wir haben das Ganze verkorkst.«
»Sie meint natürlich, ich hab’ es verkorkst – wie immer«, sagte Sebastian. »Aber was hätte ich denn tun {9}sollen? Sandy hat ja völlig den Verstand verloren. Sie hat die Schule geschwänzt und ist nachmittags mit diesem Kerl rumgezogen. Nachts hat sie sich auf dem Strip und weiß Gott wo rumgetrieben. Gestern abend bin ich losgezogen und hab’ die beiden aufgestöbert –«
»Nicht gestern abend«, unterbrach ihn seine Frau. »Vorgestern abend.«
»Ist doch ganz egal.« Seine Stimme schien unter ihrem ständigen Genörgel zu schwanken. Sie schlug um, und er fuhr in schreiendem, leiernden Ton fort: »In einer üblen Kneipe in West Hollywood hab’ ich sie aufgestöbert. Eng umschlungen saßen sie vor allen Leuten da. Ich hab’ ihm gesagt, wenn er meine Tochter nicht in Ruhe läßt, dann hol’ ich meine Schrotflinte und knall’ ihn ab.«
»Mein Mann sieht sich zu viele Krimis im Fernsehen an«, sagte Mrs. Sebastian trocken.
»Mach dich ruhig lustig über mich, Bernice. Was ich getan hab’, war völlig richtig. Meine Tochter hat sich mit einem Kriminellen rumgetrieben. Ich hab’ sie heimgebracht und in ihr Zimmer gesperrt. Was hätte ich denn sonst tun sollen?«
Diesmal schwieg seine Frau. Sie bewegte langsam ihren zarten, dunklen Kopf hin und her.
Ich sagte: »Woher wissen Sie, daß der junge Mann ein Krimineller ist?«
{10}»Er hat wegen Autodiebstahls im Distriktsgefängnis gesessen.«
»Wegen einer Spritzfahrt.«
»Nenn’s, wie du willst. Außerdem war es nicht sein erstes Delikt.«
»Woher wissen Sie das?«
»Bernice hat es in ihrem Tagebuch gelesen.«
»Dieses berühmte Tagebuch würde ich gern mal sehen.«
»Nein«, sagte Mrs. Sebastian. »Schlimm genug, daß ich’s gelesen hab’. Das hätte ich nicht tun dürfen.« Sie holte tief Luft. »Ich fürchte, wir waren ihr keine sehr guten Eltern. Im Grund bin ich genauso schuldig wie mein Mann. Aber das wird Sie wohl kaum interessieren.«
»Im Moment nicht.« Ich hatte den Generationenkrieg satt, die Attacken und Gegenattacken, die Eskalationen und Verhandlungen, das endlose Hin und Her über den Tisch hinweg. »Seit wann ist Ihre Tochter fort?«
Sebastian blickte auf seine Armbanduhr. »Seit fast dreiundzwanzig Stunden. Ich hab’ sie gestern morgen aus ihrem Zimmer gelassen. Sie schien sich beruhigt zu haben –«
»Sie war wütend«, sagte ihre Mutter. »Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, daß sie nicht zur Schule geht. Erst gestern abend gegen sechs, als sie nicht zum {11}Essen heimkam, sind wir dahintergekommen. Ich rief ihre Lehrerin an, und es stellte sich heraus, daß sie den ganzen Tag die Schule geschwänzt hatte. Um die Zeit war es schon finster.«
Sie schaute aus dem Fenster, als sei es immer noch finster, jetzt und für alle Ewigkeit. Ich folgte ihrem Blick. Zwei Leute schlenderten über den Golfplatz, ein Mann und eine Frau, beide weißhaarig, als wären sie auf der Suche nach dem kleinen weißen Ball alt geworden.
»Eins verstehe ich nicht«, sagte ich. »Wenn Sie gestern morgen dachten, sie geht zur Schule – wie war das dann mit der Flinte?«
»Sie muß sie in den Kofferraum ihres Wagens gelegt haben«, sagte Sebastian.
»Ach, sie fährt einen eigenen Wagen?«
»Das ist ja einer der Gründe, warum wir uns solche Sorgen machen.« Sebastian schob seinen Kopf über den Tisch. Ich kam mir vor wie ein Barkeeper, den ein Betrunkener um einen Rat anfleht. Doch in seinen Augen war echte Angst. »Sie haben doch Erfahrung in solchen Dingen. Weshalb um Himmels willen hat sie bloß meine Flinte mitgenommen?«
»Da könnte ich mir einen Grund denken. Sie haben doch gedroht, ihren Freund damit abzuknallen, nicht?«
»Aber das kann sie doch nicht ernst genommen haben?«
{12}»Ich nehm’s ernst.«
»Ich auch«, sagte seine Frau.
Sebastian senkte den Kopf wie ein Angeklagter vor Gericht. Doch dann sagte er leise: »Bei Gott, wenn er sie nicht zurückbringt, bring’ ich ihn um.«
»Eine gute Idee, Keith«, sagte seine Frau.
2
Die Streiterei zwischen den beiden ging mir allmählich auf die Nerven. Ich bat Sebastian, mir seinen Gewehrschrank zu zeigen. Er führte mich in ein kleines Herrenzimmer, das teils als Bibliothek, teils als Gewehrkammer diente.
Der Waffenschrank war aus Mahagoni. Hinter seiner Glastür standen aufrecht leichte und schwere Gewehre. Dazwischen war eine Lücke: dort mußte die doppelläufige Schrotflinte gestanden haben. Die Bücherregale enthielten Bestseller und Buchklubausgaben und eine Reihe abgegriffener Fachbücher über Volkswirtschaft und Werbepsychologie.
»Sind Sie in der Werbebranche?«
»Public Relations. Ich bin Leiter der Public-Relations-Abteilung der Centennial Bank. Eigentlich müßte {13}ich jetzt dort sein. Wir stellen gerade unser Programm für das nächste Jahr auf.«
»Das hat doch sicher bis morgen Zeit, oder?«
»Weiß nicht.«
Er drehte sich zum Gewehrschrank um, sperrte die Tür auf und öffnete die Schublade, in der er die Patronen aufbewahrte – beides mit dem gleichen Messingschlüssel.
»Wo war der Schlüssel?«
»In der obersten Lade meines Schreibtischs.« Er öffnete sie und ließ mich hineinsehen. »Sandy wußte natürlich, wo er lag.«
»Aber jemand anders hätte ihn auch leicht gefunden.«
»Stimmt. Aber ich bin sicher, daß sie ihn genommen hat.«
»Wieso?«
»Einfach so ein Gefühl.«
»Ist sie schießwütig?«
»Wie kommen Sie denn darauf? Wenn einem der Umgang mit Gewehren richtig beigebracht wird, dann wird man nicht schießwütig, wie Sie es zu nennen belieben.«
»Wer hat ihr denn das Schießen beigebracht?«
»Natürlich ich. Schließlich bin ich ihr Vater.«
Er ging zum Waffenschrank und strich über den Lauf des einen Gewehrs. Dann machte er sorgsam die {14}Glastür zu und versperrte sie. Anscheinend fiel sein Blick auf sein Spiegelbild im Glas. Er zuckte zurück und faßte an sein stoppliges Kinn.
»Ich sehe ja furchtbar aus. Kein Wunder, daß Bernice so auf mir rumhackt. Ich muß mein Gesicht in Ordnung bringen.«
Er entschuldigte sich und ging hinaus. Ich warf einen Blick auf mein eigenes Gesicht in der Glasscheibe. Es sah nicht gerade heiter aus. Frühmorgens bin ich kein besonders guter Denker, dennoch kam ein vager, düsterer Gedanke: Sandy war eine Art Puffer in einer gespannten Ehe; im Moment war ich der Puffer.
Mrs. Sebastian trat leise ins Zimmer und stellte sich neben mich vor den Waffenschrank.
»Ich bin mit einem Pfadfinder verheiratet«, sagte sie.
»Es gibt traurigere Schicksale.«
»Meinen Sie? Meine Mutter hat mich davor gewarnt, einen gutaussehenden Mann zu heiraten. Sie meinte, ich soll mir lieber einen intelligenten suchen. Aber ich hab’ nicht auf sie gehört. Ich hätte lieber Mannequin bleiben sollen – da hätte ich bestimmt Karriere gemacht. Auf meine eigenen Knochen kann ich mich wenigstens verlassen.« Sie klopfte sich auf die Hüfte.
»Ihre Knochen sind beachtlich. Und Ihre Offenheit auch.«
»Die letzte Nacht hat mich dahin gebracht.«
»Zeigen Sie mir das Tagebuch Ihrer Tochter.«
{15}»Ich denke nicht daran.«
»Hat sie etwas getan, was Ihnen peinlich ist?«
»Mein eigenes Verhalten ist mir peinlich«, sagte sie. »In dem Tagebuch steht nichts, was ich Ihnen nicht auch erzählen könnte. Was möchten Sie wissen?«
»Ob sie mit diesem Jungen geschlafen hat, zum Beispiel.«
»Natürlich nicht«, sagte sie leicht gereizt.
»Oder mit einem andern.«
»Völlig absurd.« Doch sie wurde blaß.
»Hat sie?«
»Ganz bestimmt nicht. Sandy ist für ihr Alter erstaunlich unschuldig.«
»Kann sein, daß sie’s war. Hoffentlich ist sie’s immer noch.«
Bernice Sebastian verlagerte das Gespräch auf eine andere Ebene. »Ich – wir haben Sie nicht als Tugendwächter unserer Tochter engagiert.«
»Bis jetzt haben Sie mich überhaupt nicht engagiert. In einem so unsicheren Fall wie diesem muß ich einen Vorschuß verlangen, Mrs. Sebastian.«
»Was soll das heißen – unsicher?«
»Ihre Tochter könnte ja jeden Moment heimkommen. Oder Sie und Ihr Mann könnten sich’s anders überlegen –«
Mit einer ungeduldigen Handbewegung unterbrach sie mich. »Schön, wieviel wollen Sie?«
{16}»Für zwei Tage Honorar und Spesen – sagen wir zweihundertfünfzig.«
Sie setzte sich an den Schreibtisch, nahm ein Scheckheft aus der zweiten Lade und stellte mir einen Scheck aus. »Sonst noch was?«
»Ein paar neuere Fotos von ihr.«
»Setzen Sie sich. Ich hole Ihnen welche.«
Als sie draußen war, sah ich mir die Auszahlungsabschnitte in dem Scheckheft an. Nach Bezahlung meines Vorschusses hatten die Sebastians nicht einmal mehr zweihundert Dollar auf ihrem Konto. Ihr elegantes, über einen steilen Abhang gebautes neues Haus symbolisierte auf geradezu verblüffende Weise ihre Existenz.
Mrs. Sebastian kam mit einer Handvoll Fotos zurück. Sandy war ein ernst dreinblickendes Mädchen, das mit seinem dunklen Typ der Mutter stark ähnelte. Die meisten Bilder zeigten sie bei einer sportlichen Tätigkeit: auf einem Pferd, auf dem Fahrrad, auf einem Sprungbrett kurz vor dem Absprung, mit einem Gewehr im Anschlag. Das Gewehr sah aus wie die 22er-Büchse im Waffenschrank. Sie hielt es, als verstünde sie damit umzugehen.
»Woher hat sie diesen Gewehrtick, Mrs. Sebastian?«
»Natürlich von Keith. Sein Vater pflegte ihn schon als kleinen Jungen auf die Jagd mitzunehmen. Und Keith hat die große Tradition an seine Tochter weitervererbt.« Ihre Stimme klang spöttisch.
{17}»Ist sie Ihr einziges Kind?«
»Ja. Wir haben keinen Sohn.«
»Darf ich mir ihr Zimmer ansehen?«
Sie zögerte. »Was hoffen Sie zu finden? Beweise für Transvestismus? Rauschgift?«
Sie versuchte spöttisch zu sein, doch ihre Fragen kamen mir gar nicht komisch vor. Ich hatte in den Zimmern junger Leute schon Merkwürdigeres gefunden.
Sandys Zimmer war voller Sonne und frischer süßer Düfte. Was ich fand, war so ziemlich das, was man im Zimmer eines unschuldigen, anständigen Mädchens, das die letzte High-School-Klasse besucht, zu finden erwartet. Eine Menge Pullover und Röcke und Bücher – Schulbücher und ein paar gute Romane wie A High Wind in Jamaica. Eine Stofftiermenagerie. Collegewimpel, hauptsächlich Ivy League. Einen Toilettetisch mit einem rosa Volant, auf dem zu geometrischen Mustern geordnete Kosmetika lagen. An der Wand das silbern gerahmte Foto eines anderen lächelnden jungen Mädchens.
»Wer ist das?«
»Sandys beste Freundin, Heidi Gensler.«
»Ich würde gern mit ihr reden.«
Mrs. Sebastian zögerte. Dieses Zögern, das ich nun schon mehrmals bemerkt hatte, war kurz, doch gespannt und brütend, als plane sie in einem Spiel, bei {18}dem es um einen hohen Einsatz ging, ihre Züge weit im voraus.
»Die Genslers wissen nichts von der Sache«, sagte sie.
»Sie können nicht eine Suchaktion nach Ihrer Tochter starten und zugleich das Ganze geheimhalten. Sind Sie mit den Genslers befreundet?«
»Sie sind unsere Nachbarn. Die beiden Mädchen sind gut befreundet.«
Sie entschloß sich plötzlich. »Ich werde Heidi bitten, herüberzuschauen, bevor sie zur Schule geht.«
»Warum nicht sofort?«
Sie verließ das Zimmer. Ich sah mich rasch nach möglichen Verstecken um – unter dem rosafarbenen ovalen Schafwollteppich, zwischen Matratze und Federrost, auf dem hohen dunklen Regal im Kleiderschrank, hinter und unter den Sachen in der Kommode. Ich nahm ein paar Bücher und schüttelte sie. Aus den Portugiesischen Sonetten flatterte ein Stück Papier heraus.
Ich hob es vom Teppich auf. Es war ein Teil einer linierten Notizbuchseite, auf den jemand in sauberer schwarzer Schrift geschrieben hatte:
Vogel, du erfüllst mich mit einem Schmerz,
Der mich mit meinem Blut durchströmt.
Am besten, ich öffne mein Herz,
Damit du aus mir quillst.
{19}Mrs. Sebastian stand in der Tür und sah mich an. »Sie sind sehr gründlich, Mr. Archer. Was ist das?«
»Ein kleines Gedicht. Ob es wohl Davy geschrieben hat?«
Sie entriß es mir und las es.
»Sinnloses Zeug.«
»Ich finde nicht.« Ich nahm es und steckte es in meine Brieftasche. »Kommt Heidi?«
»Gleich. Sie sitzt noch beim Frühstück.«
»Schön. Haben Sie irgendwelche Briefe von Davy?«
»Natürlich nicht.«
»Könnte ja sein, daß er Sandy welche geschrieben hat. Ich möchte wissen, ob das Gedicht seine Handschrift ist.«
»Keine Ahnung.«
»Haben Sie ein Foto von Davy?«
»Wie sollte ich zu einem Foto von ihm kommen?«
»Auf die gleiche Art, wie Sie an das Tagebuch Ihrer Tochter gekommen sind.«
»Wie oft werden Sie mir das noch vorhalten!«
»Tu’ ich gar nicht. Ich würde es bloß gern lesen. Es würde mir bestimmt weiterhelfen.«
Sie zögerte wieder und starrte einen Moment düster ins Leere.
»Wo ist das Tagebuch, Mrs. Sebastian?«
»Es existiert nicht mehr«, sagte sie langsam. »Ich habe es vernichtet.«
{20}Ich war überzeugt, daß sie log, und ich bemühte mich nicht, es zu verhehlen. »Wie?«
»Ich hab’ es zerkaut und geschluckt, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.«
Sie wartete neben der Tür, bis ich das Zimmer verlassen hatte; dann machte sie sie zu und versperrte sie. Das Schloß war neu.
»Wer hat das Schloß anbringen lassen?«
»Sandy. Sie hat sich in den letzten Monaten ziemlich zurückgezogen. Mehr, als gut für sie war.«
Sie ging in ein anderes Schlafzimmer und machte die Tür zu. Sebastian saß am Küchentisch und trank Kaffee. Er hatte sich gewaschen, rasiert, sein lockiges braunes Haar gebürstet, eine Krawatte umgebunden, eine Jacke angezogen und eine hoffnungsvollere Miene aufgesetzt.
»Noch eine Tasse Kaffee?«
»Nein, danke.« Ich holte mein kleines schwarzes Notizbuch hervor und setzte mich neben ihn. »Können Sie mir Davy beschreiben? Wie sieht er aus?«
»Wie so ein junger Strolch eben aussieht.«
»Strolche gibt’s in den verschiedensten Formen und Größen. Wie groß ist er ungefähr?«
»Etwa so groß wie ich. Ich bin mit Schuhen einsachtzig.«
»Gewicht?«
{21}»Er sieht ziemlich schwer aus – vielleicht zweihundert Pfund.«
»Kräftig und muskulös?«
»Das kann man wohl sagen.« Er hatte einen säuerlich eifernden Unterton in seiner Stimme. »Aber verlassen Sie sich drauf – ich wäre mit ihm fertig geworden.«
»Das bezweifle ich nicht. Beschreiben Sie sein Gesicht.«
»Er sieht gar nicht übel aus. Aber er hat diese typisch finstere Miene, wie alle diese Burschen.«
»Vor oder nach Ihrer Drohung, ihn abzuknallen?«
Sebastian stand auf. »Was glauben Sie eigentlich, wofür wir Sie bezahlen? Dafür etwa, daß Sie gegen mich sind?«
»Für diese Unterhaltung«, sagte ich. »Und für eine Menge andere unangenehme Unterhaltungen. Glauben Sie, ich finde das besonders amüsant? Was für Haar hat er?«
»Blondes.«
»Lang?«
»Kurz. Wahrscheinlich haben sie es ihm im Knast abgeschnitten.«
»Blaue Augen?«
»Ich glaube.«
»Bart?«
»Nein.«
{22}»Was hatte er an?«
»Die übliche Uniform. Enge Hose, tief auf den Hüften sitzend, breiter Gürtel, ausgebleichtes blaues Hemd, hohe Schuhe.«
»Wie hat er gesprochen?«
»Mit dem Mund.« Sebastian schien am Ende seiner Geduld.
»Gebildet oder ungebildet? Wie ein Hippie oder wie ein Normalbürger?«
»Um das festzustellen, hat er nicht genug gesagt. Er war wütend. Genau wie ich.«
»Wie schätzen Sie ihn ein?«
»Er ist ein Halunke. Ein gefährlicher Halunke.« Er wandte sich mit einer merkwürdigen, raschen Bewegung um und sah mich mit aufgerissenen Augen an, als hätte ich ihn so genannt. »Hören Sie, ich muß jetzt unbedingt ins Büro. Wir haben eine wichtige Besprechung wegen des Programms für das nächste Jahr. Und danach bin ich mit Mr. Hackett zum Mittagessen verabredet.«
Bevor er ging, ließ ich mir von ihm den Wagen seiner Tochter beschreiben. Es war ein ein Jahr alter zweitüriger hellgrüner Dart, zugelassen auf ihren Namen. Ich schlug vor, ihn auf die Suchliste der Polizei setzen zu lassen, doch davon wollte er nichts wissen. Die Polizei dürfe von der Sache nichts erfahren.
»Sie wissen nicht, wie das in meinem Beruf ist«, {23}sagte er. »Ich muß eine makellose, bombenfeste Fassade aufrechterhalten. Wenn sie einstürzt, stürze ich mit. Das Wichtigste im Bankgeschäft ist Vertrauen.«
Er fuhr in einem neuen Oldsmobile weg, der ihn, laut den Abschnitten in seinem Scheckheft, monatlich hundertzwanzig Dollar kostete.
3
Ein paar Minuten später öffnete ich Heidi Gensler die Haustür. Sie war ein hübsches junges Mädchen mit glattem blonden Haar, das ihr bis auf die mageren Schultern herabhing. Soviel ich sah, trug sie kein Makeup. Unterm Arm hatte sie eine Schulmappe.
Mit ihren blaßblauen Augen sah sie mich unsicher an. »Sind Sie es, der mich sprechen möchte?«
Ich nickte. »Mein Name ist Archer. Kommen Sie herein, Miss Gensler.«
Sie blickte an mir vorbei ins Haus. »Ich weiß nicht recht.«
Mrs. Sebastian tauchte aus ihrem Zimmer auf. Sie trug ein flauschiges rosa Kleid. »Komm nur, Heidi, keine Angst. Nett, daß du hereinschaust.« Ihre Stimme klang nicht mütterlich.
{24}Heidi trat ein und blieb zögernd und befangen in der Diele stehen. »Ist Sandy was passiert?«
»Das wissen wir nicht, Liebling. Wenn ich dir sagen soll, was wir wissen, mußt du mir eins versprechen: daß du in der Schule und zu Hause nichts davon erzählst.«
»Aber nein. Das hab’ ich doch nie.«
»Was soll das heißen, Liebling: Das hast du nie?«
Heidi biß sich in die Unterlippe. »Ich meine – ach, nichts.«
Mrs. Sebastian ging auf sie zu wie ein rosa Vogel mit einem gierig vorgereckten dunklen Kopf. »Hast du gewußt, daß sie mit diesem Jungen was hat?«
»Das – das ließ sich doch gar nicht vermeiden.«
»Und du hast uns nichts davon gesagt. Das war aber nicht sehr nett von dir.«
Das Mädchen war den Tränen nahe. »Aber Sandy ist doch meine Freundin.«
»Schon gut, schon gut. Dann willst du uns doch sicher helfen, damit sie wieder zurückkommt, oder?«
Das Mädchen nickte. »Ist sie mit Davy Spanner durchgebrannt?«
»Bevor ich dir darauf antworte, mußt du mir versprechen, niemandem etwas zu erzählen.«
»Das ist doch unnötig, Mrs. Sebastian«, fiel ich ein. »Es wäre mir wirklich lieber, Sie würden mich mit ihr reden lassen.«
{25}Sie wandte sich zu mir. »Welche Garantie habe ich, daß Sie Diskretion bewahren werden?«
»Keine. Sie können die Situation nicht unter Kontrolle halten. Sie ist außer Kontrolle. Am besten gehen Sie hinaus und überlassen mir das Ganze.«
Mrs. Sebastian weigerte sich, hinauszugehen. Sie schien entschlossen, mich hinauszuwerfen. Es war mir egal. Es sah mir immer mehr danach aus, als ob ich mit diesem Fall weder Freunde gewinnen noch Geld verdienen würde.
Heidi berührte meinen Arm. »Könnten Sie mich nicht zur Schule fahren, Mr. Archer? Wenn Sandy nicht da ist, habe ich niemanden, der mich hinbringt.«
»Gern. Wann möchten Sie fahren?«
»Wann Sie wollen. Wenn ich zur ersten Stunde zu früh komme, kann ich ja noch ein paar Hausaufgaben machen.«
»Hat Sandy Sie gestern zur Schule gefahren?«
»Nein. Ich hab’ den Bus genommen. Sie rief mich gestern morgen, etwa um diese Zeit, an und sagte, sie ginge nicht zur Schule.«
Mrs. Sebastian beugte sich vor. »Hat sie gesagt, was sie vorhatte?«
»Nein.« Das Mädchen setzte eine verschlossene, störrische Miene auf. Wenn sie mehr wußte, so würde sie es Sandys Mutter bestimmt nicht sagen.
Mrs. Sebastian sagte: »Ich glaube, du lügst, Heidi.«
{26}Das Mädchen wurde rot; Tränen stiegen ihr in die Augen. »Sie haben kein Recht, so was zu sagen. Sie sind nicht meine Mutter.«
Ich mischte mich wieder ein. Im Haus der Sebastians würde aus dem Mädchen kaum etwas herauszuholen sein. »Kommen Sie«, sagte ich zu Heidi. »Ich bring’ Sie zur Schule.«
Wir gingen hinaus, stiegen in meinen Wagen und fuhren den Berg hinunter zur Schnellstraße. Heidi saß stumm neben mir; zwischen uns auf dem Sitz lag ihre Schulmappe. Offenbar war ihr eingefallen, daß es sich nicht gehörte, zu einem fremden Mann ins Auto zu steigen. Nach einer Pause sagte sie schließlich: »Mrs. Sebastian schiebt mir die Schuld zu. Das ist einfach nicht fair.«
»Die Schuld? Wofür?«
»Für alles, was Sandy tut. Was kann ich denn dafür, daß sie mir alles mögliche erzählt? Ich bin doch nicht für sie verantwortlich.«
»Was hat sie Ihnen erzählt?«
»Na, von Davy. Ich kann doch nicht mit allem, was Sandy mir sagt, zu Mrs. Sebastian rennen. Ich bin doch keine Petze.«
»Es gibt Schlimmeres.«
»Zum Beispiel?« Ich zog ihren Ehrenkodex in Zweifel, deshalb klang es ziemlich trotzig.
»Zum Beispiel, seine beste Freundin ins Unglück {27}rennen zu lassen und keinen Finger zu rühren, um sie daran zu hindern.«
»Ich hab’ sie nicht in ihr Unglück rennen lassen. Was hätte ich denn tun sollen? Was heißt übrigens Unglück? Sie denken doch nicht etwa …«
»Daß sie ein Baby kriegt? Nein. Das wäre nicht das Schlimmste. Es gibt schlimmere Dinge, die einem Mädchen passieren können.«
»Was für welche?«
»Umzukommen und kein Baby mehr kriegen zu können. Oder ganz plötzlich alt zu werden.«
Heidi gab einen leisen Laut von sich wie ein kleines verschrecktes Tier. Dann flüsterte sie: »Genau das ist Sandy passiert. Woher wissen Sie das?«
»Ich hab’s schon bei anderen Mädchen erlebt, die nicht warten konnten. Kennen Sie Davy?«
Sie zögerte einen Moment. »Flüchtig.«
»Was halten Sie von ihm?«
»Er ist ein recht interessanter Mensch«, sagte sie bedächtig. »Aber er paßt nicht zu Sandy. Er ist brutal und ungehobelt. Ich glaube, er ist nicht ganz normal. Sandy ist kein leichtfertiges Ding. Sie ist einfach in eine dumme Sache hineingeraten.«
»Was meinen Sie damit? Daß sie auf Davy hereingefallen ist?«
»Nein, ich meine den andern. Davy Spanner ist im Vergleich zu dem andern gar nicht so übel.«
{28}»Wer ist dieser andere?«
»Sie hat mir seinen Namen nicht gesagt. Sie wollte mir überhaupt nichts über ihn verraten.«
»Woraus schließen Sie dann, daß Davy besser ist?«
»Das hab’ ich doch gemerkt. Sandy ist viel glücklicher als vorher. Vorher hat sie die ganze Zeit von Selbstmord geredet.«
»Was heißt ›vorher‹? Wann?«
»Im Sommer, bevor die Schule anfing. Sie wollte bei Zuma Beach ins Meer gehen und rausschwimmen. Ich hab’s ihr ausgeredet.«
»Was hatte sie denn – eine Liebesaffäre?«
»So könnte man’s nennen.«
Mehr wollte Heidi nicht erzählen. Sie hatte Sandy einen feierlichen Eid geschworen, keinem Menschen etwas zu verraten, und mit dem, was sie mir gesagt hatte, hatte sie ihn bereits gebrochen.
»Haben Sie mal ihr Tagebuch gesehen?«
»Nein. Ich weiß, daß sie eins geführt hat. Aber sie hat es nie jemandem gezeigt – keinem Menschen.« Sie wandte sich auf dem Sitz zu mir und zog dabei ihren Rock über die Knie. »Darf ich Sie was fragen, Mr. Archer?«
»Bitte.«
»Was ist Sandy eigentlich passiert? Diesmal, meine ich.«
»Keine Ahnung. Sie ist vor vierundzwanzig Stunden {29}von zu Hause weggefahren. Am Abend zuvor hat ihr Vater sie mit Davy in einem Lokal in West Hollywood erwischt. Er hat sie heimgeschleppt und über Nacht in ihr Zimmer gesperrt.«
»Kein Wunder, daß Sandy von daheim ausgerissen ist«, sagte sie.
»Sie hat die Schrotflinte ihres Vaters mitgenommen.«
»Wozu das?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, daß Davy vorbestraft sein soll.«
Das Mädchen ging auf die versteckte Frage nicht ein. Sie blickte auf ihre Hände nieder, die zu Fäusten geballt auf ihrem Schoß lagen. Wir waren am unteren Ende des Berges angelangt und fuhren in Richtung Ventura Boulevard.
»Glauben Sie, daß sie bei Davy ist, Mr. Archer?«
»Ich nehme es an. Wo ist Ihre Schule?«
»Halten Sie bitte einen Moment.«
Ich parkte im scharfen Morgenschatten einer Eiche, die den Bau der Schnellstraße und des Boulevards irgendwie überlebt hatte.
»Ich weiß, wo Davys Bude ist«, sagte Heidi. Sie sprach das Wort mit einem gewissen Stolz aus, als beweise es, wie erwachsen sie schon war. »Sandy hat mich mal zu ihm mitgenommen. Er wohnt im Laurel-Apartmenthaus in Pacific Palisades. Umsonst, wie {30}Sandy mir erzählt hat. Er hält dafür den Swimming-pool in Ordnung und so.«
»Was haben Sie in seiner Bude gemacht?«
»Nichts weiter. Bloß rumgesessen und geredet. Es war sehr interessant.«
»Worüber geredet?«
»Über die Art, wie die Menschen heutzutage leben. Über ihre schlechte Moral.«
Ich bot Heidi an, sie bis zu ihrer Schule zu bringen, doch sie lehnte ab mit der Bemerkung, das restliche Stück könne sie mit dem Bus fahren. Ich ließ sie an der Ecke stehen, ein zartes Geschöpf, das in dieser Welt hoher Geschwindigkeiten und niedriger Moral ein wenig verloren schien.
4
Ich verließ den Sepulveda am Sunset Boulevard, fuhr nach Süden zum Geschäftsviertel von Pacific Palisades und bog nach links auf den Chautauqua ab. Das Laurel-Apartmenthaus war in der Elder Street, einer abschüssigen Straße an dem langen, zum Meer abfallenden Hang.
Es war eines der neueren und kleineren {31}Apartmenthäuser in dem Viertel. Ich parkte meinen Wagen am Rinnstein und ging in den Innenhof.
Der Swimming-pool blitzte. Die Sträucher im Garten waren grün und sorgfältig gestutzt. Roter Hibiskus und purpurne Prinzeßblumen schimmerten zwischen den Blättern.
Aus einer der Parterrewohnungen trat eine Frau, die irgendwie zu dem Hibiskus paßte. Sie trug einen eleganten schwarzen Hausmantel mit orangefarbenem Muster, unter dem sich ihr Körper bewegte, als sei er es gewohnt, angestarrt zu werden. Sie hatte rotgefärbtes Haar, das ihr hübsches Gesicht ein wenig ordinär erscheinen ließ, gutgeformte braune Beine und nackte Füße.
Mit einer angenehmen Stimme, die keinen Collegeschliff, jedoch Erfahrung verriet, fragte sie mich, was ich wolle.
»Sind Sie die Verwalterin?«
»Ich bin Mrs. Smith. Mir gehört das Haus. Im Moment ist leider nichts frei.«
Ich stellte mich vor. »Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten.«
»Worüber?«
»Sie haben einen Angestellten namens Davy Spanner.«
»So?«
»Soviel ich gehört habe.«
{32}»Wie wär’s, wenn Sie ihn endlich mal in Ruhe lassen würden?« sagte sie in mürrischem, abweisendem Ton.
»Ich hab’ ihn noch nie im Leben gesehen.«
»Aber Sie sind doch von der Polizei, nicht? Wenn Sie sich richtig dahinterklemmen, werden Sie’s sicher schaffen, ihm wieder was anzuhängen. Das möchten Sie doch, oder?« sagte sie gereizt.
»Nein, bestimmt nicht. Ich bin gar kein Polizist.«
»Dann sicher ein Bewährungshelfer. Für mich ein und dasselbe. Davy Spanner ist ein guter Junge.«
»Und er hat zumindest eine gute Freundin«, sagte ich in der Hoffnung, das Gespräch in angenehmere Bahnen zu lenken.
»Wenn Sie damit mich meinen, haben Sie nicht so unrecht. Was wollen Sie von Davy?«
»Ich möchte ihm nur ein paar Fragen stellen.«
»Vielleicht kann ich sie beantworten.«
»Meinetwegen. Kennen Sie Sandy Sebastian?«
»Flüchtig. Ein nettes kleines Ding.«
»Ist sie hier?«
»Wohnen tut sie nicht hier. Sie wohnt bei ihren Eltern, irgendwo im Valley.«
»Sie ist gestern morgen von zu Hause weggefahren und seither verschwunden. War sie hier?«
»Glaub’ ich kaum.«
»Und wo ist Davy?«
{33}»Hab’ ich heute morgen noch nicht gesehen. Ich bin eben erst aufgestanden.« Sie blickte zum Himmel auf, als liebe sie das Licht, habe aber nicht immer darin gelebt. »Sie sind also doch ein Bulle.«
»Nein, Privatdetektiv. Sandys Vater hat mich engagiert. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf – lassen Sie mich mit Davy reden.«
»Besser, ich tu’ das. Sie würden ihn bloß in Wut bringen.«
Sie führte mich zu einem kleinen Apartment auf der Rückseite des Gebäudes neben der Garageneinfahrt. Auf einer weißen Karte an der Tür stand »David Spanner«, in der gleichen klaren Schrift wie das Gedicht, das aus Sandys Buch gefallen war.
Mrs. Smith klopfte leise, und als sich nichts rührte, rief sie: »Davy.«
Hinter der Tür hörte man Stimmen, die Stimme eines jungen Mannes und dann eine Mädchenstimme, die mein Herz ganz unsinnigerweise schneller schlagen ließ. Ich hörte leise Schritte. Dann ging die Tür auf.
Davy war nicht größer als ich, doch er schien den Türrahmen auszufüllen. Unter seinem kurzärmligen schwarzen Pullover spannten sich pralle Muskeln. Sein blonder Kopf und sein Gesicht wirkten irgendwie unfertig. Er blinzelte ins helle Sonnenlicht, als sei es ihm widerlich.
»Was gibt’s denn?«
{34}»Ist deine Freundin bei dir?« sagte Mrs. Smith in einem Ton, über den ich mir nicht ganz im klaren war. Ich fragte mich, ob sie eifersüchtig auf das Mädchen war.
Davy schien den Ton ebenfalls zu bemerken. »Ist irgendwas passiert?«
»Offenbar schon. Dieser Mann sagt, deine Freundin sei verschwunden.«
»Verschwunden? Wieso? Sie ist hier«, sagte er leise, als nehme er sich zusammen. Er wandte sich zu mir. »Sicher schickt Sie ihr Vater.«
»Genau.«
»Richten Sie ihm aus, daß wir in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts leben. Vielleicht konnte früher ein Vater seine Tochter einsperren. Aber die Zeiten sind vorbei. Sagen Sie das dem alten Sebastian.«
»Er ist nicht alt. Nur in den letzten vierundzwanzig Stunden ist er ziemlich gealtert.«
»Freut mich. Ich hoffe, er kratzt bald ab. Und auch Sandy hofft das.«
»Kann ich sie sprechen?«
»Ich gebe Ihnen genau eine Minute«, sagte er. Und zu Mrs. Smith: »Würdest du bitte für eine Minute verschwinden.«
Er sprach in ruhigem, festem Ton, doch hatte man das Gefühl, daß er sich mühsam beherrschte. Auch die {35}Frau schien das zu spüren. Sie ging ohne Widerrede und ohne sich umzublicken auf die andere Seite des Hofes, so als hätte sie ziemlichen Respekt vor ihm. Wieder fragte ich mich, in welchem Verhältnis sie wohl zu ihm stand.
Er wandte sich, die Tür mit seinem Körper versperrend, um und rief: »Sandy? Komm mal her.«
Sandy kam an die Tür. Sie trug eine dunkle Brille, die ihr Gesicht ausdruckslos machte. Wie Davy trug sie einen schwarzen Pullover. Sie beugte sich vor und lehnte sich mit jener rührenden Verworfenheit, deren nur ganz junge Mädchen fähig sind, an Davy. Ihr Gesicht war starr und blaß, und ihr Mund bewegte sich kaum, als sie sprach.
»Ich kenne Sie nicht.«
»Ihre Mutter schickt mich.«
»Damit Sie mich wieder heimschleppen?«
»Ihre Eltern wüßten verständlicherweise gern, was Sie vorhaben.«
»Sagen Sie ihnen, sie werden bald genug dahinterkommen.« Es klang eigentlich nicht gereizt oder wütend. Ihre Stimme war dumpf und ruhig. Hinter ihrer dunklen Brille schien sie nicht mich anzusehen, sondern Davy.
Man spürte, daß es mehr als Neigung zwischen den beiden gab. Ein leiser brenzliger Geruch schien in der Luft zu liegen, wie von einem schwelenden Feuer, als {36}hätten Kinder mit Streichhölzern gespielt und einen Brand gelegt.
Ich wußte nicht, welchen Ton ich anschlagen sollte. »Ihre Mutter ist ganz krank vor Sorge um Sie, Miss Sebastian.«
»Sie wird bald noch kränker sein.«
»Das klingt ja wie eine Drohung.«
»Das ist es auch. Sie wird garantiert bald noch kränker sein.«
Davy sah sie kopfschüttelnd an. »Hör auf. Die Minute, die ich ihm gegeben hab’, ist um.« Er blickte mit umständlichem Gehabe auf seine Armbanduhr, und mir wurde plötzlich klar, wie es in seinem Kopf aussah: Große Pläne, konfuse, feindselige Gefühle und komplizierte Vorhaben, die nicht immer mit der Wirklichkeit in Einklang standen. »Ihre Minute ist um. Auf Wiedersehen.«
»He – ich brauche noch eine Minute, vielleicht auch zwei.« Ich wollte dem Jungen nicht absichtlich in die Quere kommen, aber andererseits wollte ich ihm auch nicht ausweichen. Schließlich war es mehr als wichtig zu sehen, wie weit er wirklich gehen würde. »Tun Sie mir einen Gefallen, Miss Sebastian. Nehmen Sie Ihre Brille ab, damit ich Sie sehen kann.«
Sie griff mit beiden Händen nach der Brille und nahm sie vom Gesicht. Ihr Blick war wirr und verloren.
{37}»Setz sie wieder auf«, sagte Davy.
Sie gehorchte.
»Befehle hast du nur von mir entgegenzunehmen, sonst von niemandem, Kleines.« Er wandte sich zu mir. »Und Sie verschwinden jetzt augenblicklich. Das ist ein Befehl.«
»Sie sind zu jung, um irgendwelche Befehle zu erteilen. Wenn ich gehe, kommt Miss Sebastian mit.«
»So? Meinen Sie?« Er schob sie hinein und machte die Tür zu. »Sie wird nie in diesen Kerker zurückgehen.«
»Immerhin noch besser, als mit einem Psychopathen zusammenzuleben.«
»Ich bin kein Psychopath!«
Zum Beweis schoß er seine rechte Faust auf meinen Kopf ab. Ich lehnte mich zurück, und der Schlag ging vorbei. Doch seine Linke folgte sehr schnell und traf mich seitlich am Hals. Ich taumelte zurück in den Garten, den schwankenden Himmel auf meinem Kinn balancierend. Mein Fuß stieß an die Betoneinfassung des Swimming-pools, und mein Hinterkopf schlug auf den Beton.
Zwischen mir und dem Himmel tauchte Davy auf. Ich wälzte mich herum. Er trat mir zweimal mit dem Fuß in den Rücken. Irgendwie rappelte ich mich hoch und stürzte mich auf ihn. Es war, als versuchte ich, mit einem Bären zu ringen. Er hob mich mühelos hoch.
{38}»Schluß jetzt!« rief Mrs. Smith. Sie sagte es, als sei er tatsächlich ein nur halbgezähmtes Tier. »Möchtest du wieder ins Gefängnis?«
Er schwieg und hielt mich weiter wie ein Bär umklammert, so daß ich kaum Luft bekam. Die rothaarige Frau ging zu einem Wasserhahn, an dem ein Schlauch befestigt war, und drehte ihn auf. Sie richtete den Strahl auf Davy. Ein Teil des Wassers spritzte auf mich.
»Laß ihn los.«
Davy ließ mich los. Die Frau richtete weiter den Schlauch auf ihn. Er versuchte nicht, ihn ihr zu entreißen. Er beobachtete mich. Ich starrte einer Grille nach, die über den Beton durch das Wasser kroch wie die winzige, unbeholfene Karikatur eines Menschen.
Die Frau sagte über ihre Schulter hinweg: »Machen Sie lieber, daß Sie wegkommen, Sie Stänkerer.«
Sie fügte der körperlichen Attacke eine verbale hinzu, doch ich ging. Nicht sehr weit: um die Ecke zu meinem Wagen. Ich fuhr rund um den Block und parkte ihn wieder auf der abschüssigen Straße oberhalb des Apartmenthauses. Den Innenhof und die Türen, die auf ihn hinausgingen, konnte ich nicht sehen, doch die Garageneinfahrt.
Ich blieb eine halbe Stunde sitzen und behielt sie im Auge. Meine Wut und Gekränktheit schwanden allmählich. Der Rücken tat mir immer noch weh.
{39}Ich hatte nicht erwartet, zusammengeschlagen zu werden. Daß es passiert war, bedeutete, daß ich alt wurde oder daß Davy ein ziemlich schwerer Junge war. Ich brauchte keine halbe Stunde, um zu dem Schluß zu kommen, daß wahrscheinlich beides zutraf.
Die Straße, in der ich parkte, hieß Los Baños Street. Es war eine recht hübsche Straße mit neuen Terrassenhäusern, die übereinander in den Berghang geschnitten waren. Jedes Haus unterschied sich in irgendeinem ausgeklügelten Detail vom andern. Zum Beispiel war in dasjenige auf der anderen Straßenseite, mit den zugezogenen Vorhängen, ein zehn Fuß hoher Lavabrocken in die Fassade eingesetzt. Der Wagen auf der Zufahrt war ein neuer Cougar.
Ein Mann in Wildlederjacke trat aus dem Haus, öffnete den Kofferraum des Wagens und nahm eine kleine flache Scheibe heraus, die mich interessierte. Sie sah aus wie eine Tonbandrolle. Der Mann bemerkte meine Neugier und steckte das Ding in die Jackentasche.
Er fand, dies sei noch nicht genug, und kam mit entschlossenen Schritten über die Straße auf mich zu. Es war ein großer, kräftiger Mann mit einer Glatze voller Sommersprossen. Die scharfen, harten Augen in seinem großen, schlaffen, lächelnden Gesicht wirkten wie Kiesel in Eiercreme, ein etwas schockierender Kontrast.
{40}»Wohnen Sie hier in der Nähe, Freundchen?« sagte er zu mir.
»Ich seh’ mich bloß ein bißchen um.«
»Wir mögen keine fremden Schnüffler. Wie wär’s, wenn Sie sich verziehen würden?«
Ich wollte kein Aufsehen erregen, und so verzog ich mich. Die Nummer des Cougar und die Hausnummer merkte ich mir: 702 Los Baños Street.
Ich besitze ein ziemlich gutes Gefühl für den richtigen Zeitpunkt, oder umgekehrt. Als ich losfuhr, stieß ein hellgrüner Wagen rückwärts aus der Garage des Laurel-Apartmenthauses. Er rollte den Berg hinunter zur Küstenstraße. Sandy saß am Steuer, Davy neben ihr auf dem Vordersitz. Ich fuhr ihnen nach. Sie bogen nach rechts auf die Schnellstraße ab und überquerten bei Gelb die Kreuzung am unteren Ende des Sunset Boulevard. Zähneknirschend hielt ich an der roten Ampel.
Ich fuhr bis hinaus nach Malibu und versuchte, sie einzuholen. Vergeblich. Ich fuhr zurück zum Laurel-Apartmenthaus in der Elder Street.
{41}5
Auf der Tür von Apartment eins stand: »Mrs. Laurel Smith«. Sie öffnete die Tür, soweit das die vorgehängte Kette zuließ, und knurrte mich an:
»Sie haben ihn vertrieben. Hoffentlich sind Sie jetzt zufrieden.«
»Soll das heißen, sie sind abgehauen?«
»Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
»Das sollten Sie sich überlegen. Ich bin kein Stänkerer, aber es könnte leicht Stunk geben. Wenn Davy Spanner Bewährung hat, ist er fällig. Ich brauche nur der Polizei zu erzählen, daß er auf mich losgegangen ist.«
»Sie haben ihn herausgefordert.«
»Das ist Ansichtssache. Anscheinend stehen Sie auf Davys Seite. Sie sollten lieber mir helfen.«
Sie überlegte kurz. »Helfen? Wie?«
»Ich möchte das Mädchen. Wenn ich sie in angemessener Frist – das heißt, noch heute – relativ heil zurückkriege, werde ich Davy nicht in Schwierigkeiten bringen. Sonst ja.«
Sie machte die Kette los. »Okay, Mr. Herrgott. Kommen Sie herein. Die Wohnung ist zwar in einem schlimmen Zustand, aber Sie ja auch.«
Sie lächelte mit einem Mundwinkel und einem Auge. {42}Ich glaube, sie wäre gern wütend auf mich gewesen, doch sie hatte zu viele Dinge im Leben kennengelernt, um lange wütend zu sein. Eins von diesen Dingen, das merkte ich an ihrem Atem, war Alkohol.