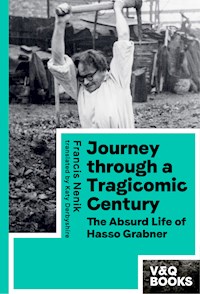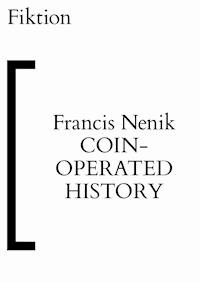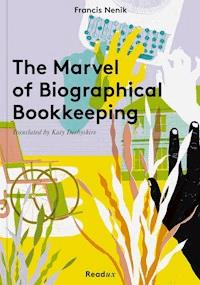Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
April 1945, auf einer Insel in der Mulde. In einem Gebüsch hält sich ein Mann versteckt. Seine Knie sind aufgeschlagen, seine Sachen nass, in der Ferne ist das Geräusch krachender Haubitzen zu hören. Er blickt auf das Pfarrhaus am Ufer, in dem er mit seiner Frau und den Kindern gelebt hat. Aber jetzt sind sie weg. Sie scheinen verschleppt worden zu sein, und er ist sich sicher, dass ihr Verschwinden etwas mit ihm zu tun hat. Er versucht sich zu erinnern. Ein Mann mit einem Klumpfuß kommt ihm in den Sinn. Und ein kleines Mädchen, von dem er nach und nach zu erzählen beginnt. Was er sieht, hört und denkt, schreibt er auf. Ein Abschiedsbrief an seine Frau. Ein Bericht, mit dem er Zeugnis ablegt. Er notiert seine Worte auf der Rückseite von Akten. Sie liegen in dem Koffer, den er bei sich führt, zwischen Dosenfleisch, einer zersplitterten Uhr und einem langsam hart werdenden Laib Brot. Ein Roman, dessen Fassade langsam zerbricht und der die Abgründe unter der dünnen Firnis der Zivilisation sichtbar macht. "Ein dunkler Roman über einen Arzt, der gefangen ist auf der Insel seines Denkens. Ich kenne nichts Vergleichbares in der deutschen Gegenwartsliteratur." (Gunnar Cynybulk)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Entstehung dieses Werkes wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ermöglicht.
© Verlag Voland & Quist GmbH,
Berlin und Dresden 2021
ISBN 978-3-86391-241-3
eISBN 978-3-86391-300-7
www.voland-quist.de
Lektorat:
Gunnar Cynybulk Korrektorat:
Helge Pfannenschmidt
Umschlaggestaltung & Satz:
Guerillagrafik
Druck und Bindung:
PBtisk a.s.,Příbram
E.
ODER DIE INSEL
FRANCIS NENIK
Inhalt
Samstag, 14. April 1945
Sonntag, 15. April 1945
Montag, 16. April 1945
Dienstag, 17. April 1945
Mittwoch, 18. April 1945
Donnerstag, 19. April 1945
Freitag, 20. April 1945
Samstag, 21. April 1945
Sonntag, 22. April 1945
Montag, 23. April 1945
Dienstag, 24. April 1945
Mittwoch, 25. April 1945
Donnerstag, 26. April 1945
Samstag, 14. April 1945
Marie, wo bist du? Was haben sie mit dir und den Kindern gemacht?
Ich bin auf der Insel im Fluss. Ich halte mich in den Büschen versteckt. Ich habe mich tief unter die Zweige geschlagen.
Du kannst mich nicht sehen, und du hörst mich auch nicht. Ich kritzle meine Worte stumm aufs Papier.
Marie, es ist viel passiert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sitze hier, meine Sachen sind nass, und ich friere. Dabei sollte ich neben dir liegen. Ich wollte dich überraschen, wollte zu dir ins Bett steigen, mich an dich schmiegen und dir sagen, dass alles gut ist. Dass ich die Stadt verlassen habe. Dass dieser Krieg hinter mir liegt.
Ich wäre gern eher gekommen. Aber es ging nicht. Ich musste noch ein Kind begleiten. Ein Mädchen, noch keine zehn Jahre. Ich konnte es nicht allein lassen auf seinem Weg.
Marie, du brauchst keine Angst zu haben, für mich ist gesorgt. Ich habe ein Dach aus Blättern und Zweigen und Vorräte für mehrere Tage. In meinem Koffer sind Büchsen mit Kondensmilch und Wachsbohnen. Sogar Dosenfleisch habe ich. Und Brot.
Ich habe es aus L. mitgebracht. Die ganze Stadt wurde gestern versorgt. Es heißt, die Zuteilungszeiträume seien zusammengelegt worden. Dabei weiß jeder, dass es Sonderzuteilungen waren, wie wir sie nach jedem Luftangriff kriegen. Aber ich habe mich nicht mit in die Schlange gestellt. Ich hatte mir meinen Teil schon zwei Tage vorher geholt. In der Nacht, in der die Bomber gekommen sind.
Ich hatte mich gerade hingelegt, als der Alarm durch die Ruine geheult ist. Es war bereits der vierte an diesem Tag, und ich war es leid, durch die riesigen Flure zu rennen und Schutz im Keller zu suchen.
Du kannst es nicht wissen, Marie, aber der Keller ist leer. Die eilfertigen Diener des Untergangs haben sämtliche Akten aus den Schränken geholt und auch sonst nichts zurückgelassen. Als müssten sie Platz machen für unseren Schutz. Dabei waren wir nur noch zu zweit, das Mädchen und ich.
Ich bin liegen geblieben und habe an die Decke gestarrt. Ich war mir sicher, sie würden uns nicht attackieren. Es gab nichts mehr zu holen, rundherum war doch schon alles verbrannt. Aber dann ist die Kleine aufgewacht und hat angefangen zu wimmern. Sie hat ganz flach geatmet, und ich habe sie aus dem Bett genommen und fest an mich gedrückt. Aber ich konnte sie nicht beruhigen. Also habe ich den Leuchtkasten über meinem Tisch angemacht und ihr die Bilder gezeigt, doch auch das hat nichts gebracht. In meiner Not habe ich die Pappen aus den Fenstern entfernt, und wir haben raus in den Nachthimmel geschaut. Auf die Flieger, die von Osten hereinzogen, und die Stadt, die wenig später zu brennen begann.
Ich weiß nicht, warum, aber das hat sie ruhig gestimmt. Ich habe es erst gemerkt, als sie schon wieder eingeschlafen war. Ich hatte nur Augen für die brennende Stadt.
Marie, mir ist kalt, und alles ist nass. Die Sachen kleben an meiner Haut wie mein Stift auf dem Papier. Alles andere hat sich gelöst. Ist kaputtgegangen. Zerfallen.
Wie ich da stand und durch die glaslosen Fenster geblickt habe. Auf den Nachthimmel und die vielen Maschinen … Sie hatten sich zu einem langen Rechteck geformt, als versuchten sie, einen Sarg in den Himmel zu zeichnen.
Sie sind von Osten gekommen und übers Stadtzentrum gezogen. Dann sind sie nach Nordwest abgedreht und haben angefangen, ihre Leuchtbomben zu werfen.
Es gab keine Gegenwehr. Die Flak hat nur spärlich geschossen und auch erst dann, als die Bomben schon fielen. Offenbar hat sie der Angriff überrascht. Vielleicht ist ihnen die Verteidigung einer Stadt, die bereits zerbombt worden ist, aber auch sinnlos geworden. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Abwehrfeuer aus der Nähe kam. Wahrscheinlich die Flakstellung in der Torgauer Straße.
Die Kaserne trägt den Namen des Stadtteils, in dem sie steht. „Heiterblick“. Was für eine lächerliche Ironie.
Sie haben nur noch für ihr Gewissen geschossen. Der Glaube an den Sieg liegt längst unter ihren Stiefeln begraben. Die Flak hat gegen die Flieger nichts ausrichten können. Selbst wenn sie einen getroffen haben, war seine Ladung schon unterwegs. Die Bomben hingen an kleinen Fallschirmen und kamen ganz langsam herabgeschwebt. Als wollten sie den Menschen eine letzte Chance geben, in die Keller zu eilen.
Aber ich bin nicht gegangen. Ich habe am Fenster gestanden und zugesehen, wie die Bomben lange, leuchtende Schlieren in den Nachthimmel gemalt haben und das Feuer in die Stadt zu tropfen begann. Ein glühender Sternregen. Und in meinen Armen das Mädchen, das zu wimmern aufgehört hatte.
Ich weiß nicht, wie lange ich da gestanden habe. Ich weiß nur, dass ich keine Angst hatte. Die Flugzeuge waren weit weg, sie hatten sich ein anderes Ziel ausgesucht. Für sie existierte der Ort, an dem ich stand, gar nicht mehr. Sie hatten ihn schon erledigt. Für sie war es nur noch eine Trümmerwüste. Ein Ruinenfeld. Eine Sache, die abgehakt war. Sie konnten nicht wissen, dass das Kind und ich überlebt hatten.
Die Kleine war in meinen Armen eingeschlafen, und für einen Augenblick habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ihr Gesicht im Schein des brennenden Phosphors zu leuchten begänne.
Drüben, die Fenster des Pfarrhauses sind dunkel. Nur die Holzstoff-Fabrik schüttet ihr Licht vor mir aus. Sie kippt es direkt in den Fluss.
Was kann ich tun, außer hier hocken und warten. Mir mit dem Stift die Kälte aus dem Körper rausschreiben? Als ob das was brächte! Ich bin nass, von oben bis unten. Ich kann den Bleistift kaum halten. Ich schreibe nur, um meine Hände zu spüren.
Als ich am Fenster stand, habe ich mir für einen Moment gewünscht, dass einer der Flieger aus der Formation ausbricht und Kurs auf mich nimmt. Er kann es nicht ertragen, dass ihn jemand beobachtet bei dem, was er tut. Es ekelt ihn an, dass inmitten des Krieges ein Mensch in aller Ruhe da steht, hinter einem zerborstenen Fenster, mit einem schlafenden Mädchen im Arm.
Aber das ist nicht passiert. Als die Flieger ihre Leuchtbomben abgeworfen hatten, sind sie nach Süden gedreht, und dann ist auch schon die zweite Welle gekommen. Wie Tiere sind sie über die Stadt hergefallen. Sie hatten den Auftrag, die Sache zu Ende zu bringen. Und das haben sie auch getan.
Es fiel ihnen nicht schwer. Die erste Welle hatte ganze Arbeit geleistet und das Ziel mit den Leuchtbomben markiert. Sogar aus der Ferne war zu erkennen, was sie sich ausgesucht hatten. Es war der Verladebahnhof im Nordwesten der Stadt.
Es war nicht ihr erstes Ziel an dem Tag. Ein paar Stunden zuvor hatten sie schon den Rangierbahnhof im Osten attackiert. Nach dem Angriff hing eine große, blaue Rauchwolke über der Stadt. Sie sah aus wie ein himmlisches Kainsmal.
Als die Bomber dann in der Nacht wiedergekommen sind, war die Wolke verschwunden, und die Flieger haben angefangen, mit ihren Bomben leuchtende Schlieren in den kristallschwarzen Himmel zu zeichnen. Und ich? Ich stand am Fenster und habe ihnen dabei zugeschaut. Mit einem schlafenden Kind im Arm und einem Haufen dicker Pappen zu meinen Füßen. Und neben mir, über dem Tisch, der Leuchtkasten, der stumm vor sich hin brannte.
Marie, es fällt mir schwer, meinen Worten zu glauben. Es ist, als berichtete ich von einer anderen Zeit, von einer anderen Welt, von einem anderen Menschen. Aber das bin ich, Marie. Ich, der auf dieser Insel hier sitzt und wartet. Auf dich und die Kinder!
Es gibt nichts zu bereuen, Marie. Was ich getan habe, war richtig, und ich würde es wieder so tun. Ich wäre nur gern ein paar Stunden eher gekommen. Dann lägen wir jetzt zusammen im Bett, und nebenan schliefen die Kinder, und der Krieg würde uns nicht mal im Traume erscheinen.
Carl und Irmchen und Paul … Ich wünschte, ich hätte ein Bild von ihnen bei mir. Ein Bild von euch allen. Eines, das ich aus der Ferne vor die dunklen Fenster des Pfarrhauses halten kann. Aber da ist nur die Holzstoff-Fabrik, die mich mit ihren stinkenden Augen anfunkelt.
Marie, ich hatte nicht vor, mich auf den Weg raus zum Verladebahnhof zu machen. Schon gar nicht in dieser Situation. Aber als die Kleine eingeschlafen war, ist etwas passiert, und ich musste plötzlich daran denken, was vor anderthalb Jahren mit den Kindern in der Baracke nebenan geschehen ist, dass sie in ihren Betten verbrannt sind und dass ich diesmal vielleicht jemanden retten konnte. Wenn schon nicht hier, dann auf dem Verladebahnhof. Dort lagen die Menschen auch in Baracken, und vielleicht hatten es ein paar von ihnen geschafft.
Es war, als hätte ich eine zweite Chance bekommen. Als hingen die Bomben noch immer am Fallschirm, als fielen sie diesmal so langsam vom Himmel, dass ich eingreifen konnte.
Ich hätte es besser wissen müssen.
Ich habe fast zwei Stunden bis raus zum Bahnhof gebraucht. Als ich ankam, hatten sie die Verletzten bereits abtransportiert und nur die Leichen liegen gelassen, und alles, was mir blieb, waren die zerstörten Bahnhofsgebäude und der Zug, der neben den Gleisen lag wie eine Spielzeugeisenbahn, die jemand aus Wut umgekippt hatte. Die Lok war völlig zerstört, und die Waggons waren der Länge nach aufgerissen. Es sah aus, als hätte jemand mit einem riesigen Beil reingeschlagen.
Einige Waggons brannten noch stumm vor sich hin, andere waren in einen großen Bombenkrater gerutscht und hatten die nachfolgenden mit sich gerissen und andere aus den Gleisen gehoben, und je mehr ich mich umschaute, umso unheimlicher wurde es mir. Eine Druckwelle hatte zwei der Waggons in das Stellwerk katapultiert und es zum Einsturz gebracht. Auch die Baracke mit den Fremdarbeitern hatte Feuer gefangen, und nicht alle waren dem Inferno entkommen.
Es war, als wollte mich das Schicksal dafür bestrafen, dass ich mich auf den Weg gemacht hatte, als müsste es mir noch einmal vor Augen führen, was damals mit den Kindern passiert war und wie hilflos ich immer noch war.
Die Arbeiter, die es aus der brennenden Baracke raus geschafft hatten, hockten zwischen den aufgeschlitzten Waggons, und erst da erkannte ich, dass es ein Versorgungszug war. Die Männer hatten die Hände voll Fleisch und fraßen sich satt. Und neben ihnen lagen die Leichen.
Es sah aus, als hätte der Krieg sein eigenes Gemälde erschaffen. Einer der Toten hing auf dem Ende einer aus dem Boden gerissenen Schiene, und unter ihm türmten sich die Konserven.
Es gab keine Wachen am Bahnhof, und auch keine Soldaten. Jeder konnte sich nehmen, was immer er wollte. Es war genug da von allem. Die Waggons waren bis unters Dach mit Lebensmitteln gefüllt, und alles quoll heraus, Kartoffeln, Brot, Eier, Speck, zentnerweise Konserven … Als hätte jemand das Schlaraffenland in die Luft gejagt.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte nichts davon nehmen, aber ich konnte auch nicht mit leeren Händen zurückkehren. Es hätte sich wie ein weiterer Verlust angefühlt. Also habe ich mir ein paar Konserven genommen, dazu noch einige Dosen Kondensmilch und ein Brot, das mir einer der Fremdarbeiter in die Hände gedrückt hat.
Ich habe mich schäbig gefühlt. Ich wollte das Brot nicht haben und noch weniger, dass er es mir gibt. Er roch nach Fleisch und Blut, und aus seinen Mundwinkeln lief Milch. Sein ganzes Gesicht bestand nur noch aus Knochen. Und doch gab er mir, einem Deutschen, einen Laib Brot. Er hat ihn zu mir emporgereckt, als ich an ihm vorbeilief. Als wollte er mir zeigen, dass er keinen Anspruch darauf erhebt. Dass ich das Brot haben kann. Und ich habe es genommen.
Ob er gespürt hat, dass ich keiner von den Kriegstreibern bin? Dass ich mich auf den Weg gemacht hatte, um zu helfen?
Aber wie sollte er? Er wusste doch nichts über mich, und ich habe auch kein Wort gesagt. Ich habe einfach nur das Brot genommen und bin gegangen. Und jetzt liegt es hier auf der Insel. Zwischen Weidenbüschen, im Nebel.
Marie, ich habe alles, was ich an Essen habe, vor mir auf den Koffer gelegt. Das Brot, vier Dosen mit Fleisch, drei mit Wachsbohnen und dazu noch drei mit Kondensmilch. Es sieht aus, als würde ich ein Picknick veranstalten.
Du kannst jetzt kommen, Marie. Der Tisch ist gedeckt. Du und die Kinder, ihr könnt euch neben mich setzen.
Nur einen Dosenöffner habe ich nicht. Er liegt in der Küche, drüben im Pfarrhaus.
Im Pfarrhaus. Wo auch ich liegen sollte. Und du, Marie. Und Carl und Irmchen und Paul. Ihr solltet alle da sein. Aber ihr wart nicht da, als ich kam.
Marie, was ist passiert? Wo bist du? Und wo sind die Kinder?
Ich kann nicht glauben, dass ihr weg seid. Aber ich muss es tun. Und ich sehe es ja auch. Kein Licht im Pfarrhaus und kein Rauch oben im Schornstein. Überhaupt kein Zeichen von Leben.
Ihr seid weg. Und ich bin hier auf der Insel. Allein mit meiner Henkersmahlzeit … Erinnerst du dich an die Windmühle neben dem Verladebahnhof, Marie? Es war, als würde sie mir nachschauen, als ich mich mit dem Brot in der Hand zurück auf den Weg zu dem Mädchen gemacht habe. Als wüsste sie noch, wie wir damals unter ihren Flügeln im Gras lagen … Wir hatten uns gerade erst kennengelernt. Ich war unsicher und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, und habe mich an den Grasbüscheln festzuklammern versucht. Ich wollte nichts Falsches sagen und dich auch nicht mit mir selbst überfallen. Aber Schweigen konnte ich auch nicht. Also habe ich angefangen, dir von General Blücher zu erzählen und wie er seine Soldaten an der Mühle versammelt hat, um sie in die Schlacht gegen Napoleon zu schicken, während er selbst hoch in den Mühlturm gestiegen ist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die Bewegungen seiner Truppen zu koordinieren.
Ich wäre beim Sprechen am liebsten im Boden versunken, so sinnlos und dumm fand ich das, was ich dir da erzählt habe. Zu meinem Glück hast du mich irgendwann unterbrochen und mir gesagt, dass dich diese alten Kamellen nicht interessieren und dass ich dir lieber eines meiner Gedichte vorlesen soll.
Du wusstest, dass ich ein paar von ihnen eingesteckt hatte, und du hattest nicht vor, mich damit entkommen zu lassen. Also habe ich sie aus der Tasche gezogen und angefangen zu lesen, und du hast mir zugehört, hast an meinen Lippen gehangen, und ich habe immer weitergelesen, so lange, bis ich keine Gedichte mehr hatte, bis all meine Heimlichkeit aufgebraucht war, und da war es plötzlich, als hätte sich eine Welt vor mir aufgetan.
Das ist fast fünfzehn Jahre her. Ich hätte damals nicht gedacht, dass es eines Tages Krieg geben wird, ich konnte nicht ahnen, dass wir nie wieder an die Mühle zurückkehren werden. Aber selbst wenn, hätte ich nichts anderes tun wollen, als mit dir im Gras zu liegen und Gedichte zu lesen. Die Mühle hat ihren Platz in meiner Erinnerung, und der Krieg kann sie nicht trüben.
Den Gedichten geht es genauso, auch wenn ich schon lange keine mehr schreibe.
Im Koffer liegt ein großer Stapel Papier. Es sind die Akten, auf deren Rückseite ich diese Zeilen notiere. In meinem Kopf aber liege ich mit dir unterhalb der Mühle im Gras und spüre, wie uns die Verse verbinden.
Wer weiß, vielleicht erinnere ich mich nur deshalb an diesen Tag, weil er so einmalig war. Weil er sich nicht wiederholen lässt, was immer wir auch tun. Ein jedes hat seine Zeit, Marie, und dass wir uns kennengelernt haben, ist alles, was zählt. Weil es der Anfang war. Von uns und Carl und Irmchen und Paul … Und was ist schon die Schönheit eines Gedichts gegen das Glück einer Familie!
Ich kann nicht glauben, dass ihr weg seid, Marie. Du und die Kinder. Etwas muss passiert sein. Aber ich weiß nicht, was.
Ich werde es herausfinden, aber ich muss vorsichtig sein. Die Menschheit taumelt durch einen nicht enden wollenden Strudel aus Schlachten, und nichts bleibt sich gleich. Sogar die Mühle hat ihr Antlitz verändert. Sie ist schwarz angestrichen worden, selbst ihre Flügel hat man gefärbt, damit die Flieger sie vom Himmel aus nicht erkennen. Aber es hätte nichts genützt. Am Ende war es einfach nur Glück, dass der Bombenteppich an dieser Stelle ein Loch hatte, durch das die Mühle gerutscht ist. Sie hat den Angriff auf den Verladebahnhof unversehrt überstanden. Aber die Wiese, auf der wir einst lagen, war mit Bombenkratern übersät.
Warum schreibe ich das alles auf? Du wirst diese Zeilen nie lesen, Marie. Und falls doch, so wird es mich nicht mehr geben.
Dann ist das hier also mein Abschiedsbrief. Vielleicht ist es aber auch bloß ein Bündel Papier, das ich bei mir trage und das ich heimlich vernichten werde, wenn ich diese Insel verlasse und zurückkehre zu dir und den Kindern.
Ich weiß, Marie, du wolltest nicht, dass ich gehe, du wolltest, dass ich bei euch bleibe und nicht noch mal zurück nach L. fahre. Aber ich musste es tun. Ich konnte dir nicht sagen, warum. Du hättest es nicht verstanden. Und ich wollte dich auch nicht in Gefahr bringen, Marie.
Es waren nur fünf Tage. Fünf Tage, die ich nicht bei euch war. Und doch ist so viel passiert. Inzwischen sind sämtliche Bahnhöfe in Leipzig zerbombt, und ich musste gestern Abend stundenlang laufen, um einen Zug zu finden, der mich zu euch bringt.
Er stand draußen in den Feldern, irgendwo vor der Stadt, als hätte er nur auf mich gewartet. Ich bin eingestiegen, als könne man einfach so aus dem Krieg rausmarschieren, und der Schaffner hat das Signal zur Abfahrt gegeben.
Aber wir sind nicht weit gekommen. Nach der Hälfte der Strecke waren die Gleise zerstört, und wir waren gezwungen, den Zug zu verlassen. Der Lokführer hat uns dann zu einem Bahnwärterhäuschen geführt, dort sollten wir warten. Aber ich wollte nicht. Also bin ich weitergelaufen, die ganze Nacht durch, immer an den Schienen entlang. Ich wollte zu dir und den Kindern. Aber ihr wart nicht da.
Warum schreibe ich, als sei das alles längst vergangen? Es ist doch noch keine zwei Stunden her, dass ich die Wohnung betreten habe! Was sind denn zwei Stunden in einem Krieg, der nun schon fast sechs Jahre dauert?!
Es ist alles so sinnlos, Marie, so grausam und sinnlos! Anderthalb Jahre lang war ich ohne dich und die Kinder allein in der Stadt. Anderthalb Jahre lang bin ich jeden Samstagabend mit dem Zug zu euch gefahren, um die restlichen Stunden des Wochenendes mit euch zu verbringen, bevor mich am frühen Montagmorgen die Pflicht zurück nach Leipzig gerufen hat. Nur diesmal war es anders, diesmal bin ich schon am Freitag in den Zug gestiegen, und diesmal wollte ich bleiben. Ich hatte meine Pflichten alle erfüllt und wollte nur noch eines: bei euch sein und diesen Krieg zusammen mit euch überstehen. Aber jetzt sitze ich auf einer Insel im Fluss, keine zweihundert Meter von unserem Zuhause entfernt, sitze unter Weidenbüschen im Dreck, während mein Kopf unter einer Windmühle im Gras liegt und alte Verse aus meinem Mund sprudeln.
Ich möchte schreien, Marie. Ich möchte deinen Namen rufen, aber ich darf nicht. Ich habe Angst, dass andere mich hören. Andere als du und die Kinder. Menschen, von denen ich nicht möchte, dass sie hinter den Nebelwänden auf mich warten. Und man schreit nicht, wenn man nicht gehört werden will.
Jetzt, wo ich die Worte vor mir auf dem Papier sehe, wird mir klar, dass zwischen schreien und schreiben nur ein einziger Buchstabe liegt. Er ist eine Insel. Eine Insel in mir. Es ist der Ort, von dem aus ich zu dir und den Kindern reise. Der Ort, von dem aus ich nach euch suchen kann.
Marie, ich weiß nicht, warum ihr gegangen seid und wohin. Ich weiß nur, dass ihr weg seid. Und dass gestern Abend etwas passiert sein muss. Als ich heute Morgen kurz vor fünf in die Wohnung kam, stand euer Abendessen noch auf dem Tisch. In den Gläsern war Tee, und auf den Tellern lag Brot. Eines war sogar mit Butter bestrichen, und der Rest klebte noch am Messer. Aber niemand hatte etwas gegessen. Alles war unberührt.
Warum bin ich nicht geblieben? Es ist doch unser Zuhause! Seit anderthalb Jahren schon. Ein Neuanfang, nach allem, was mit uns passiert ist.
Ich hätte auf euch warten müssen, Marie. Länger, als ich es getan habe. Aber ich konnte nicht. Der Krieg liegt in seinen letzten Zügen, und je enger sich die Schlinge zieht, umso geringer sind die Abweichungen, die die Kriegstreiber dulden. Als ich Leipzig gestern verlassen habe, hatten sie gerade zwei „Verräter“ gerichtet. Sie brauchten nicht mal ihr eigenes Grab zu schaufeln. Sie haben sie einfach zu einem der Bombenkrater am Exerzierplatz geführt und sie nach dem Genickschuss über den Rand kippen lassen.
In mir ist alles ganz klar, und doch kann ich nicht sagen, was hier gerade passiert. Der Fluss hat seine nasskalten Arme um die Insel geschlungen, und ich weiß nicht, ob er mich umarmen oder von der Welt fernhalten will.
Ich hätte nie gedacht, dass ihr in Gefahr seid, Marie. Aber selbst wenn, was hätte ich denn tun sollen? Ich konnte Leipzig nicht früher verlassen. Ich musste noch dieses Kind begleiten. Ich war bei ihm bis zum Schluss, und danach habe ich mich sofort auf den Weg zu euch gemacht. Aber ihr wart nicht mehr da. Und jetzt, jetzt hocke ich hier auf der Insel, in eine Decke geschlagen, zitternd und frierend, und um mich herum tritt langsam die Welt aus dem Nebel.
Was, wenn du mit den Kindern inzwischen zurückgekehrt bist? Wenn ihr drüben im Pfarrhaus in der Küche sitzt und die Brote vom Vorabend esst? Jetzt, in diesem Moment, wo ich diese Worte hier schreibe. Vielleicht seid ihr über den Hof gelaufen, während ich aufs Papier gestarrt habe. Oder der Nebel hat euch vor mir verborgen. Er zieht in dicken Schwaden über den Fluss und lässt das Pfarrhaus immer wieder vor meinen Augen verschwinden. Vielleicht seid ihr also längst wieder zu Hause?
Aber warum solltet ihr die Wohnung verlassen, wenn das Essen noch auf dem Tisch steht? Und wo hättest du über Nacht sein können, noch dazu mit den Kindern?
Irgendwas muss gestern Abend passiert sein. Aber was? Als ich heute Morgen um kurz vor fünf ankam, war das Haus bereits leer, nur habe ich es nicht gleich bemerkt. Ich bin direkt von den Gleisen gekommen und nicht, wie sonst, über den Hof gelaufen, an der Kirche und der Schule vorbei. Stattdessen habe ich den Weg über die Rückseite genommen, bin durch das Gartentor gehuscht und über die Wiese gelaufen, und fast wäre ich über das Ende der Wippe gestolpert.
Warum erzähle ich dir das alles? Du weißt es ja selbst. Du hast die Wippe schließlich selbst aufgebaut und auch die Reifen darunter vergraben, damit die Kinder nicht so hart aufschlagen. Du, für die keine Arbeit zu schwer ist. Du, die Leichtigkeit in Person.
Als ich die Treppe zu unserer Wohnung hochgestiegen bin, fiel mir auf, dass die Schuhe der Kinder nicht da sind. Und deine auch nicht. Sie stehen sonst immer in der kleinen Nische rechts vor der Tür. Und darüber hängen die Jacken. Aber auch die waren weg. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und die Tür leise geöffnet. Ich wollte euch nicht wecken.
Als ich reinkam, war alles ganz still. Als würdet ihr schlafen. Aber die Türen der Zimmer standen alle offen, und die Betten waren leer. Ich habe eure Namen gerufen, ich dachte, ihr hättet euch vielleicht nur versteckt. Aber ihr wusstet nicht, dass ich komme. Und man kann sich nicht verstecken, wenn man nicht weiß, dass es jemanden gibt, der nach einem sucht.
Ich habe mir einzureden versucht, dass ihr in der Stadt seid und nach Lebensmitteln ansteht. Aber dafür war es viel zu früh, und als ich in die Küche gekommen bin, war der Tisch noch vom Vorabend gedeckt und das Holz im Ofen heruntergebrannt, und da wurde mir klar, dass ihr schon vor Stunden gegangen sein müsst. Die Stühle waren zurückgezogen. Als hättet ihr euch gerade an den Tisch setzen wollen. Als hätte euch jemand direkt vom Tisch weggeholt …
Das würde zu den fehlenden Schuhen und Jacken passen!
Marie, es geht alles durcheinander in mir. Als ich in der Wohnung stand und nach Hinweisen auf euren Verbleib gesucht habe, überkam mich plötzlich die Angst, ich könnte eine Spur hinterlassen. Als wäre nicht ich derjenige, der nach euch sucht, sondern derjenige, nach dem gesucht wird. Aber vielleicht bin ich das ja auch. Dann hätte mich mein Gefühl nicht getäuscht.
Meine innere Stimme hat mir gesagt, dass ich nichts verändern oder anfassen darf. Mich nicht auf den Stuhl setzen, nichts von dem Brot nehmen, nicht mit der Hand unter das Kopfkissen fahren, über die Bettdecke streichen, sie hochschlagen gar. Alles, was ich durfte und was ich getan habe, war, mit den Augen nach Hinweisen zu suchen. Und trotzdem habe ich eine Spur hinterlassen. Es waren nur ein paar Grashalme. Sie haben an meinen Schuhen geklebt und sind abgefallen, als ich über die Dielen geschlichen bin. Aber das hätte gereicht, um zu erkennen, dass jemand die Wohnung betreten hat. Dass ich in der Wohnung war.
Ich wusste, dass ich die Spur beseitigen muss. Dass nicht der kleinste Krümel zurückbleiben darf. Dass ich verschwinden muss. Also habe ich das Gras mit den Händen zusammengekehrt und bin auf diese Weise rückwärts aus der Wohnung gekrochen. Ganz langsam und vorsichtig, damit ich auch ja keinen Halm übersehe und kein neuer Dreck von den Schuhen abfällt. Und dabei ist die Angst immer tiefer in mich gedrungen. Angst, jemand könnte hinter mir stehen und nur darauf warten, dass ich meine Arbeit beende.
Ich habe alle Spuren beseitigt, Marie. Aber es war, als entfernte ich mich damit auch selbst. Als stimmte ich dem, was passiert war, zu. Als beseitigte ich mit meinen Spuren auch mein Recht auf ein Leben mit euch.
Aber dieses Recht kann mir niemand nehmen. Nur du, Marie, du bist die Einzige, die das kann. Aber du würdest das niemals tun. Du hast all die Jahre zu mir gestanden und mir selbst dann, als ich nicht mehr jeden Tag bei euch sein konnte, das Gefühl einer Familie gegeben.
Es ist, als müsste ich eine Prüfung bestehen. Nur dass ich nicht weiß, wer sie mir auferlegt hat. Ich weiß nur, dass ihr weg seid und dass ich auf mich allein gestellt bin. Aber vielleicht ist das Teil dieser Prüfung. Dass ich sie vor mir selbst ablegen muss. Dass ich sie nur vor mir selbst ablegen kann.
Mir ist kurz der Gedanke gekommen, die Insel hier könnte eine Falle sein. Aber wer hätte wissen können, dass ich hier lande? Wer hätte einen Plan aufstellen können, in dem der Zufall die Richtung bestimmt? Dass ich hier sitze, Marie, ist mein Schicksal. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Aber ich werde mich fügen. Es wäre zu gefährlich, jetzt blindlings nach vorn zu stürmen und überall nach euch zu suchen. Ich habe nicht all die Jahre Vorsicht walten lassen, um jetzt noch draufzugehen.
Marie, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich eure Anwesenheit noch gespürt habe, als ich in die Wohnung gekommen bin, dass eure Seelen noch im Raum standen und nur die Körper entwichen waren. Aber dieses Gefühl hatte ich nicht.
Ich habe im ganzen Haus nach euch gesucht. Sogar unten, in der Kammer, in der Pfarrer Adam gewohnt hat, bin ich gewesen, und auch in dem Zimmer, in dem Adam den Religionsunterricht gegeben hat. Aber auch da war niemand, und ich wollte schon wieder gehen, als ich auf dem Tisch ein Flugblatt entdeckt habe. Ich habe es nicht angerührt. Ich habe nur einen kurzen Blick drauf geworfen. Ich kannte die Worte. Ich wusste, dass sie mir galten.
In diesem Moment ist mir endgültig klar geworden, dass es um mich geht. Dass ich es bin, den sie suchen. Und dass sie euch geholt haben, um mich zu bekommen.
Ich bilde mir das doch nicht alles ein, Marie!
Für einen Augenblick habe ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Dann bin ich zur Haustür gegangen und habe durch die kleine Scheibe auf den Hof rausgespäht. Aber da war niemand zu sehen. Nur die Schule und auf der anderen Seite des Hofes die Kirche. Und über ihnen der Mond. Als wollte er mir zeigen, dass ich nichts zu befürchten habe. Aber dann habe ich gesehen, dass die Tür der Kirche offen steht. Als wollte jemand, dass ich reingehe. Und ich habe es ja auch getan. Aber in der Kirche war keiner, und hätte der Mond nicht durch die Fenster geschienen, wäre ich auch gleich wieder gegangen. So aber fiel sein Licht ins Innere und strich wie zum Hohn über das Chorgestühl unter der Orgelempore. Es hat fünf Plätze. Einen für jeden von uns.
Die Stühle waren leer. Als wären wir schon gar nicht mehr da. Als sei ich nur noch in die Kirche gekommen, um Abschied zu nehmen. Von dir und den Kindern. Und auch von mir.
Ich bin dann in die Sakristei gegangen, aber auch da war niemand, nur der Tisch, auf dem der Pfarrer das Abendmahl vorbereitet – und darauf lag der Rest einer Bombe.
In diesem Moment habe ich mir gewünscht, dass jemand aus dem Dunkel tritt und mit kalter Stimme meinen Namen ruft. Es hätte sich für mich wie eine Erlösung angefühlt.
Aber es ist niemand gekommen, und ich wollte nur noch verschwinden. Ich bin durch die kleine Tür hinter den Betstuben raus aus der Kirche. Ich wusste nicht wohin – und in diesem Augenblick habe ich die Insel im Mondlicht gesehen. Wie sie sich vor mir aus der Strömung erhob. Direkt unterhalb des Wehrs. Es war, als würde mir das Schicksal die Richtung weisen. Als habe es die Insel nur für mich aus den Fluten gehoben.
Und jetzt hocke ich auf ihr, zwischen Brombeerranken und Weidengebüsch, umgeben von altem Laub, Steinen und Dreck, und nichts weiß ich, nichts.
Nur dass ich zittre und friere. Aber das ist meine eigene Schuld. Ich hätte besser aufpassen müssen …
Ich habe mich unterhalb der Kirche die Böschung hinabgeschlichen und mich immer wieder umgedreht. Aber da war niemand. Nur der Mond, der hoch über dem Kirchdach stand. Er hatte alles in ein weißgelbes Licht getaucht, und vor meinen Füßen haben die Steine des Wehrs im Wasser geglitzert. Es sah aus, als hätte mir jemand eine Brücke gebaut.
Im Grunde war es ja auch so. Das Wehr ist mit großen Steinen ausgemauert. Es ist nicht schwer, darauf zu laufen. Zumal nur wenig Wasser darübergeflossen ist. Ich habe nicht gezögert und bin losgegangen, und nur einmal habe ich innegehalten und mich umgedreht, um zu schauen, ob da jemand ist, ob jemand am Ufer steht und mir dabei zusieht, wie mich die Angst übers Wehr treibt. Aber es war keine Menschenseele zu sehen. Also bin ich weiter, bis zur Mitte vom Fluss. Von da aus wollte ich die restlichen Meter zur Insel waten. Das Wasser ist dort nicht tief und die Strömung durch den niedrigen Pegel auch nicht so stark. Ich habe mir trotzdem die Schuhe ausgezogen und die Hose gleich mit. Ich wollte nicht, dass sie nass werden, wenn ich in den Fluss steige. Aber die Steine waren glitschig, und ich habe einen Moment nicht aufgepasst und bin ausgerutscht.
Ich bin hart aufgeschlagen und das Wehr runtergestürzt, und dabei hat es mir den Koffer aus den Händen gerissen. Ich hatte Glück, dass der Verschluss nicht aufgesprungen ist, sonst wäre der Koffer voll Wasser gelaufen und untergegangen. Wie ein U-Boot, das auf Tauchstation geht. So aber ist er nur ein paar Meter den Fluss hinabgetrieben, und die Strömung hat ihn sacht gegen die Insel gespült.
Im Koffer ist alles heil geblieben. Sogar das Opernglas hat den Sturz unbeschadet überstanden. Nur meine Uhr ist kaputt. Das Glas ist gesprungen. Es muss passiert sein, als ich auf die Steine geknallt bin. Um Punkt fünf Uhr zweiunddreißig haben die Zeiger aufgehört, sich zu drehen. Seitdem stehen sie still und künden vom Beginn meines Exils.
Durch den Riss ist Wasser gesickert. Das ganze Ziffernblatt scheint zu schwimmen. Nur die Zeiger hängen fest. Sie sehen aus wie zwei spitzköpfige Aale, die unter Glas gepresst worden sind. Aber sie können nicht weg. Sie sind an ihren Schwänzen zusammengebunden. Jemand hat ihnen einen kleinen Stiftnagel durch die Flossen geschlagen. Sie dürfen nicht auseinandertreiben, denn das hieße, die Zeit zu verlieren. Also hängen sie fest, unter einem Himmel aus zerrissenem Glas, genau wie ich auf der Insel.
Marie, ich sitze hier und kann nichts tun. Nur versuchen, alles noch einmal durchzugehen, in der Hoffnung, etwas übersehen zu haben. Aber da war nichts. Sogar die Tasche, die wir für den Notfall gepackt hatten, stand noch unter dem Bett.
Was ist mit euch passiert, Marie? Was haben sie mit dir und den Kindern gemacht?
Ich habe nur Fragen, keine Antworten.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe diese Insel hier. Sie lässt mich in eurer Nähe bleiben, ohne dass ich Gefahr laufe, entdeckt zu werden. Wenn ihr zurückkehrt, Marie, wird mir das nicht entgehen.
Ich habe das Opernglas an einen abgebrochenen Ast gehängt. Wenn ich mich gegen den Weidenbusch lehne, beginnt es zu schaukeln. Wie ein Pendel, das seine Antwort noch vor mir verbirgt.
Du hast mir das Opernglas zu unserem ersten Hochzeitstag geschenkt, und seitdem habe ich es bei mir. Vierzehn Jahre lang lag es auf meinem Schreibtisch, und jetzt hängt es hier im Gebüsch.
Weißt du noch, was du damals gesagt hast? Du hast gesagt, dass du es mir schenkst, weil du mich damit entdeckt hast.
Wie schön wäre es, dich jetzt damit zu entdecken, Marie. Dich und die Kinder.
Du hast mich entdeckt – wie das klingt … Aber es stimmt, auch wenn es schon so lange her ist und sich wie ein anderes Leben anfühlt. Der Abend steht mir trotzdem noch deutlich vor Augen. Als hätte er sich mir in die Netzhaut gebrannt. Sie haben den „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ gegeben, erinnerst du dich? Brecher hat dirigiert, aber er hätte die Aufführung fast nicht zu Ende gebracht. Im Saal hatten sich NSDAP-Leute versammelt. Sie haben versucht, das Schauspiel mit ihrem Geschrei zu verhindern. Ich saß ein paar Reihen vor ihnen und bin, zusammen mit anderen, aufgestanden, um sie zur Ordnung zu rufen. Aber der Mob ließ sich nicht beirren und hat weitergepöbelt, und erst als die Platzanweiser eingeschritten und handgreiflich geworden sind, hat der Spuk ein Ende gefunden.
Im Grunde muss ich diesem Lumpenpack dankbar sein, Marie. Hätte ich mich ihnen nicht entgegengestellt, wärst du nicht auf mich aufmerksam geworden. Du, die oben in der Loge saß. Mit dem Opernglas in der Hand. Damals, im Neuen Theater, das jetzt nur noch eine Ruine ist.
Wie alles hinter uns zerfällt. Wie es zerfällt und verschwindet. Nur der Nebel ist anders. Er setzt das Land wieder zusammen, während er langsam vergeht. Nicht mehr lange, und die ganze Welt wird aus dem Nebel treten und klar und deutlich vor mir stehen. Dann erfahre ich vielleicht auch, was mit euch passiert ist.
Du brauchst keine Angst zu haben, Marie. Sie werden euch nichts tun. Ich bin derjenige, nach dem sie suchen. Mit dem sie abrechnen wollen. Jetzt, wo dieser Krieg seinem Ende zu geht, wollen sie noch mal zu den Siegern gehören. Ein allerletztes Mal, bevor der Vorhang fällt und die Vorstellung vorbei ist.
Aber sie täuschen sich. Ich kann warten. Und ich werde es auch!
Marie, du weißt, dass ich kein Draufgänger bin, auch wenn ich damals im Theater nicht gezögert habe, mich gegen die grölenden NS-Männer zu stellen. Ich habe es getan, weil genug andere auf meiner Seite waren. Ohne sie hätte ich es niemals gewagt. Allein schon deshalb, weil ich das Geschrei verabscheue und noch mehr die rohe Gewalt. Aber es war nicht die Gewalt, die mich dazu gebracht hat, meine Stimme gegen den drohenden Krieg zu erheben, und auch nicht der wachsende Terror im Land. Ich hatte andere Gründe. Von Anfang an. Und ich habe sie vorgetragen, wann immer sich mir die Möglichkeit bot. Aber meine Äußerungen wurden zunehmend als Verrat abgetan, und als dann das große Schlachten begann, habe ich mich entschieden, zu schweigen. Weil ich uns nicht in Gefahr bringen wollte. Und weil ich wusste, dass Worte gegen Waffen nichts ausrichten. Ich gehöre nicht zu jenen, die an die Kraft des Martyriums glauben. Und noch weniger glaube ich an seinen Nutzen. Also habe ich geschwiegen und weiter meine Arbeit getan. Im Verborgenen, so wie es mir aufgetragen worden war und wie ich es selbst für richtig hielt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass ich sie jetzt auf dieser Insel hier zu Ende bringen werde.
Hinter mir gurgelt das Wasser. Es klingt, als würde der Fluss seine Morgentoilette machen. Ich sollte es ihm gleichtun. Der Dreck auf meinem Gesicht ist trocken geworden und spannt. Außerdem muss ich die Wunde auswaschen. Ich habe mir beim Sturz auf die Steine das Knie blutig geschlagen. Aber ich will nicht aufstehen. Ich will einfach nur weiter hier sitzen, rüber zum Pfarrhaus schauen und verstehen, was ich nicht glauben kann. Die zerrissene Hose kann ich ohnehin nicht flicken, und die nassen Sachen trocknen nicht im Nebel. Außerdem, so lange ich mich nicht bewege, spüre ich die Wunde nicht. Die Kälte hat auch ihr Gutes.
Es ist ein seltsames Gefühl, hier zu sitzen und diese Akten zu beschreiben, während die SS-Leute in Leipzig seit Tagen nichts anderes machen, als sämtliche Unterlagen zu vernichten, derer sie habhaft werden können. Es sind Millionen Dokumente, ganze Archivkeller voll, und ihnen bleibt nicht viel Zeit. Also karren sie sie mit Lastwagen zum Krematorium und lassen das Papier in dicken Packen im Feuer verschwinden.
Es geht alles Hand in Hand, Marie, nur wir sind getrennt.
Vor mir steht der Koffer, darauf liegt das Brot, und daneben stehen die Konserven und meine Schuhe. Es sieht aus, als hätte ich mich für eine Reise gerüstet. Dabei ist mein Weg hier zu Ende.
Nein, das stimmt nicht. Die Insel hier ist nur eine Zwischenstation. Sie ist der Anfang meiner Suche nach euch. Und überhaupt: Es ist unsere Insel, Marie! Sie war immer da. Wenn wir Montagfrüh auf dem Hof standen und uns verabschiedet haben, lag sie neben uns. Eine kleine Insel im Fluss, keine zweihundert Meter vom Pfarrhaus entfernt. Nur einmal ist sie verschwunden. Letztes Jahr im März, als der Fluss Hochwasser führte.
Erinnerst du dich, wie wir hochgeschreckt sind, als Paul in unser Zimmer gestürmt kam? Die Insel ist untergegangen!, hat er gerufen und ist an uns vorbei zum Fenster gerannt und hat es zu öffnen versucht. Aber er war zu klein und ist nicht bis an den Griff hoch gekommen und hat seine Hände gegen das Glas gepresst, während wir noch im Bett lagen und nicht wussten, was überhaupt los ist. Aber dann bist du aufgestanden, hast dich neben ihn gestellt und einfach nur geschaut. Eine wunderschöne kleine Ewigkeit lang. Hast geschaut, ihn auf deine Arme genommen und das Fenster geöffnet. Und dann, dann hast du ihm über die Wange gestrichen und ihm gesagt, dass die Insel nicht untergegangen ist, dass sie nie untergehen wird. Der Fluss ist gestiegen, hast du gesagt, aber er wird wieder sinken. In ein paar Tagen, wenn das Hochwasser weg ist, wird die Insel wieder da sein. Und so kam es dann auch.
Und jetzt, jetzt sitze ich auf der Insel, und drüben das Fenster ist dunkel und leer.
In meinem Kopf ist dieses Bild, immer wieder dieses Bild … die leere Wohnung, der gedeckte Tisch, das heruntergebrannte Holz, die Butter, die an dem Messer klebt … Wenn Paul jetzt am Fenster steht, dann nur, weil er Angst hat. Weil er raus will. Weil er mich sieht, hier auf der Insel.
Jede Insel ist ein Zuhause.
Ich weiß nicht, warum, aber dieser Gedanke kam mir gerade. Und es stimmt ja auch. Mein Weg auf die Insel hat mich nicht in die Fremde geführt. Im Gegenteil. Ich brauche mir kein Bild meiner Lage zu machen. Ich kenne die Insel, ich weiß genau, wo ich bin. Ich habe sie mir jahrelang von allen Seiten anschauen können, sogar von oben, vom Turm der Burg aus, hab ich sie gesehen. Der einzige Blick, der mir bisher verwehrt war, war der von der Insel selbst. Aber damit ist es jetzt vorbei. Sobald sich der restliche Nebel verzogen hat, werde ich wissen, wie es ist, die Welt von einer Insel aus zu betrachten.
Und Paul? Wie er am Fenster steht, hinter Glas, starr und steif, wie die Zeiger meiner Uhr. Dazu die kleinen Hände, die sich gegen die Scheibe pressen. Und die leuchtenden Augen, die einen Mann im Gebüsch der Insel fixieren …
Der Bleistift rutscht übers Papier. Er hinterlässt nichts als graue Schlieren, einen verwaschenen Eindruck meines eigenen Lebens. Ich muss meine Hand anhauchen, damit sie mir nicht das letzte bisschen Arbeit verweigert, das ich noch habe.
Ich habe einen der abgebrochenen Zweige genommen und bin damit durch die Rillen in den Sohlen meiner Schuhe gefahren. Ein paar Flusskiesel hatten sich darin verfangen. Jetzt liegen sie auf dem Koffer, zwischen den Konservendosen und dem langsam hart werdenden Brot.
Nur die Schuhe stehen nicht mehr da. Ich habe sie zum Trocknen in die Büsche gehängt. Nicht mehr lange, und die Sonne wird rauskommen. Ich kann sie hinter dem Nebelschleier schon erkennen. Er verleiht ihr eine Klarheit, die sie sonst nicht hat. Ein einfacher Kreis, ohne Gleißen, ohne Strahlen, das Innere ein wenig verwaschen, dafür außen mit einer scharfen Kante versehen. Als wäre der Himmel ein Stück Papier und die Sonne ein Loch, das man herausgestanzt hat.
Ich musste gerade an Leipzig denken und wie ich am Morgen nach dem großen Angriff ins Freie getreten bin. Die Sonne war nur als flache Scheibe zu sehen. Die ganze Stadt war unter dem Qualm und der Flugasche begraben, die Straße vor meinen Füßen aufgerissen und die Oberleitung ins Gleisbett gestürzt. In der Ferne brannten noch einige Häuser, aber die meisten waren bereits zusammengebrochen, und die Sonne hing über den aufgesprengten Lücken, als warte sie nur darauf, die Stadt endlich durchstrahlen zu können.
Das ist lange her, und jetzt bin ich derjenige, der wartet. Die ausgewaschene Sonnenscheibe spendet noch kein bisschen Wärme. Zum Glück habe ich meine Decke. Sie wärmt mich ein wenig, auch wenn sie die nasse Kälte nicht aus meinem Körper zu vertreiben vermag.
Du hast mir die Decke vor ein paar Jahren zu Weihnachten geschenkt, Marie, erinnerst du dich? Ich habe sie eigentlich nur mitgenommen, um das Opernglas zu schützen und das Brot und die Konserven darin einzuwickeln, damit sie nicht im Koffer herumklappern.
Nichts wäre dieser Insel ferner als ein Mann, der mit einem klappernden Koffer durchs Gebüsch zieht. Das einzige Geräusch, das sich in dieses Eiland hier fügt, ist das Rauschen des Wassers. Und das der Weidenblätter, die über mir tanzen, wenn ich meinen Körper gegen’s Geäst drücke.
Die Weidenblätter haben eine ganz besondere Farbe. Ein helles, leicht ins Gelb spielende Grün, und doch gleicht keines dem anderen. Es tut gut, sie zu betrachten. Es gibt mir Kraft. Als würde ich in eine glückliche Zukunft schauen …
Der Nebel und die Weidenbüsche, sie sind es, die mich verbergen. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Wenn sich die letzten Nebelschwaden verzogen haben, beginnt endgültig das große Versteckspiel, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als tief im Gebüsch zu verharren und zu schauen, was um mich geschieht. Wie es um mich geschieht, wenn ich nicht vorsichtig bin.
Das klingt, als hätte meine Stunde schon geschlagen. Aber das hat sie nicht, und sobald drüben der Kirchturm aus dem Nebel tritt, werde ich auch wissen, wie spät es ist.
Ich wünschte, der Nebel wäre noch dicker. Dann könnte ich das Gebüsch verlassen und alles erkunden. Als wäre ich ein Schiffbrüchiger und das Eiland ein mir fremdes Archipel. Aber dann würde ich Gefahr laufen, euch zu verpassen, wenn ihr zurückkehrt, Marie. Und ich würde auch nicht sehen, wenn hinter einem der Fenster im Pfarrhaus ein Licht angeht. Oder der Schornstein zu rauchen beginnt.
Marie, meine Erkundigungen gelten nicht der Insel, sie gelten dir und den Kindern. Ich will wissen, was mit euch passiert ist!
Der Nebel hat sich inzwischen fast völlig verzogen. Der einzige Grund, mich jetzt noch auf eine kleine Reise über die Insel zu begeben, wären meine erstarrten Knochen und das kurze Glück eines aufrechten Ganges. Aber ich habe bereits genug Spuren auf der Insel hinterlassen. Die Abdrücke meiner Füße im taunassen Gras sind noch immer zu sehen. Es ist eine lange Spur, und sie läuft direkt auf mich zu.
Ich habe Glück. Vom Ufer aus dürfte sie nicht zu sehen sein.
Es fühlt sich an wie ein Traum. Nach dem Sturz bin ich auf die Insel gekrochen und wie ein Schatten über die Erde gestrichen, aber wo immer ich war, war dieses seltsam glanzlose Licht. Der Nebel und das verwaschene Gleißen in den Fenstern der Holzstoff-Fabrik. Wie die stumpf gewordene Version meiner eigenen Geschichte. Als müsste ich erst noch begreifen, dass aus dem Spiel Ernst werden kann … Der Scheinwerfer, der ins Publikum gedreht wird, auf mir verharrt und mich in gleißendem Licht aufscheinen lässt. Wie ich da stehe, in Richtung der pöbelnden Horden gewandt, und wild gestikuliere. Und irgendwo über mir, unter dem Dach des Theaters, du, Marie, die alles verfolgt.
Marie, es fühlt sich bedrohlich an, deinen Namen zu schreiben. Als würde ich eines Tages herausfinden, dass du zu dem Zeitpunkt, als ich diese Worte notiert habe, schon von mir gegangen warst. Und die Kinder mit dir.
Die Kinder. Carl und Irmchen und Paul. Ihre Namen zu schreiben macht mir nicht weniger Angst. Als existierten sie nur noch auf dem Papier. Als wärt ihre alle nur noch in meinen Erinnerungen lebendig …
Ich friere. Die Kälte liegt in mir wie ein nasskalter Stein, den ich nicht ausscheiden kann. Aber es kann nicht mehr lange dauern, bis die Sonne mit ihren Strahlen die Büsche hier flutet. Dann wird die Kälte verschwinden. Sie wird schmelzen wie der Eiszapfen, den ich als kleiner Junge verschluckt habe.
Es war eine Mutprobe. Der Eiszapfen war nicht sehr groß. Er ist wie ein gefrorenes Bonbon durch meine Kehle geglitten. Für einen Moment war es unglaublich kalt, aber es hat nicht lange gedauert, und ich habe gespürt, wie sich der Eiszapfen auflöst in mir, wie alles wieder warm wurde.
Ich bin noch ein Stück tiefer ins Unterholz reingekrochen. Die Weiden stehen hier enger beisammen, und die Brombeerbüsche sorgen für zusätzlichen Schutz. Ihre Blätter haben eine satte, tiefgrüne Farbe, und es ist mein Glück, dass sie im Winter nicht abfallen. Sie lassen mich noch besser verschwinden, und die Sonne kann mich mit ihren Strahlen trotzdem erreichen. Die Zweige der Weiden über mir sind nicht sehr dicht, und sobald die Sonne durch sie hindurchscheint, wird sich die Wärme in den Brombeerbüschen zu stauen beginnen. Dazwischen aber ist Platz für mich. Nicht viel, aber es genügt, um mich auszustrecken, wenn mir das Sitzen zu viel wird. Noch aber hocke ich hier, zusammengekrümmt, und schreibe. Und die Decke über meinen Schultern wärmt mich ein wenig.
Hinter den Brombeerbüschen brodelt das Wasser. Es ist nur ein paar Meter von mir entfernt, doch die Ranken sind so dicht, dass ich den Fluss nicht sehen kann. Aber das muss ich auch nicht. Ich kenne die Stelle. Es ist die einzige, an der die Insel eine Böschung aufweist, die steil zum Wasser hin abfällt. Der Fluss hat die Stelle im Laufe der Jahre ausgewaschen, und mit der Zeit ist immer mehr von der Böschung heruntergebrochen und ins Wasser gestürzt. Als ich vor einigen Monaten mit den Kindern drüben am Ufer stand und sie ihre Steine auf die Insel zu werfen versuchten, ist mir die Stelle zum ersten Mal aufgefallen. Als hätte ich geahnt, dass ich eines Tages auf der anderen Seite sein werde.
Der Fluss hat an dem Tag mehr Wasser als heute geführt, und ich weiß noch, wie die Strömung gegen die Böschung geprallt ist. Als würde sich der Fluss dafür rächen, dass sich die Insel über ihn erhebt. Vielleicht hat er ihr deshalb ein Stück aus der Flanke gerissen und erlaubt es seitdem jedem, einen Blick in ihr Innerstes zu werfen. Nur mir ist dieser Blick jetzt verwehrt. Aber ich kenne ihn schon, und es gibt auch nicht viel zu sehen, nur ein paar Wurzeln, die aus den Uferwänden rausragen und ihre verwitterten Köpfe zum Fluss hinab neigen, als wollten sie trinken.
Im Sommer ist die ganze Insel kniehoch mit Gras überzogen. Aber jetzt ist das Gras abgewintert und treibt nur langsam wieder aus, genau wie die Weidenbüsche, die quer auf der Insel verteilt sind. Die meisten stehen allein, nur manchmal stehen zwei oder drei Büsche zusammen, und nur hier, in meinem Lager, sind es genug, um sich darin zu verstecken. Die Büsche bilden einen Kreis, in dessen Innerstem sich ein kleiner, noch nicht ganz zugewachsener Raum befindet, in dem ich sitze und schreibe. Die Zweige der Weiden sind bereits ineinander gewuchert, aber direkt über mir ist noch ein Stück nackter Himmel zu sehen. Ein Loch, durch das ich, wenn ich aufstehe, meinen Arm schieben kann. Wie ein Ertrinkender, der seine Hand aus dem Wasser streckt.
Ein Hilferuf, der mich das Leben kosten könnte …
Die Weidenruten geben ein quietschendes Geräusch von sich, wenn ich mich gegen sie lehne. Als wollten sie nicht, dass ich mich ausruhe. Wenn ich zu schreiben beginne, verstummt das Geräusch. Dann lehne ich mich nach vorn, und mein nasskalter Rücken drückt nicht länger gegen das Holz.
Die Weidenruten sind nicht dick, aber es würde reichen, um eine Kerbe für den heutigen Tag einzuritzen. Allerdings habe ich kein Messer bei mir. Ich müsste einen der scharfkantigen Flusskiesel nehmen. Aber das werde ich nicht tun.
Ich habe nicht die Absicht, lange auf dieser Insel zu bleiben. Außerdem, wer auf einer Insel strandet, ritzt seine Tage nicht in einen dürren Weidenbusch, sondern in einen richtigen Baumstamm. Bäume gibt es auf der Insel aber keine. Nur drei große, vom Wasser blank geschmirgelte Äste, die unter dem Holunderbusch liegen, der vorn an der Spitze der Insel steht. Die Äste sind vollkommen kahl, zumindest kann ich weder Blätter noch Zweige an ihnen entdecken. Selbst durch das Opernglas nicht, das mir inzwischen als Fernglas dient. Ich erkunde damit die Insel. Und schaue auch rüber zum Pfarrhaus. Aber da ist nichts.
Wahrscheinlich wurden die Äste angeschwemmt. Genau wie ich.
Im Gegensatz zu den Weiden scheinen die Blätter des Holunderbusches von einem einheitlichen Grün. Seiner Größe nach muss es ein sehr alter Busch sein. Andererseits, was heißt schon alt auf einer Insel, auf der die Natur immer wieder reinen Tisch mit sich macht.
Es wäre nicht das erste Mal, dass die Insel hier in den Fluten versinkt. Aber momentan besteht keine Gefahr. Der Fluss führt Normalwasser, und der einzige Grund, warum er ab und an steigt, ist der Mühlgraben. Er fließt durch das Gelände der Holzstoff-Fabrik, und am Samstagabend, wenn die Arbeit getan ist, lassen die Männer die Stützen herunter und schließen die Tore. Dann staut sich das Wasser im Graben zurück, und der Fluss steigt wieder an. Aber noch ist es nicht so weit, noch arbeiten sie drüben in der Fabrik. Ihre Fenster waren das Erste, was ich gesehen habe, als ich heute Morgen auf die Insel gekommen bin. Ganz blass, wie Signallampen eines Schiffes im Nebel, sind sie vor mir aufgetaucht und haben ihr Licht in Richtung des Flusses geschüttet.
Die Holzstoff-Fabrik produziert ihren eigenen Strom, und selbst bei Fliegeralarm wird es im Innern des Gebäudes nicht dunkel. Die Arbeiter setzen einfach große Holzplatten in die Fenster und machen weiter, als sei nichts geschehen. Ich dagegen hatte nur Pappen. Und als die Flieger kamen, hab ich sie aus den Fenstern entfernt …
Der Nebel ist fast völlig verschwunden. Ich kann den großen Schornstein sehen, der hinter der Fabrik steht. Nur seine Spitze ist noch verdeckt. Aber ich weiß, dass er raucht. Den Qualm, den er ausstößt, bringt auch der Nebel nicht zum Verschwinden. Es ist der Gestank zerkochter Cellulose. Er liegt wie ein schweres Tuch über dem Land.
Zum ersten Mal genieße ich es, den Qualm einzuatmen. Der süßlich-beißende Geruch ist mir bekannt. Er gibt mir ein Gefühl von Vertrautheit. Als wäre ich dadurch mit dem Lande verbunden.
Als wir vor anderthalb Jahren mit dem Zug zum ersten Mal hierhergekommen sind, habe ich den Geruch wahrgenommen, noch bevor ich das Dorf gesehen habe. Seitdem weiß ich, wie diese Landschaft hier riecht. Auch die Häuser bleiben nicht davon verschont. Der Geruch kriecht durch sämtliche Wände, und niemand kann ihm entgehen.
Der Nebel lichtet sich weiter. Ich kann das Wehr sehen und dahinter den Fluss. Er wirkt ganz ruhig, fast wie ein See. Das Wasser staut sich durch das Wehr bis weit hinter die Brücke, die ein Stück stromaufwärts von hier den Fluss überspannt. Sie ist noch im Nebel verschwunden, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis auch sie aufzutauchen beginnt. Und mit ihr die Wachposten, die schon seit Monaten auf ihr patrouillieren.
Langsam kommt alles wieder …
Inzwischen sind auch die Häuser links am Hang aus dem Nebel getreten. Erst jetzt, wo ich hier auf der Insel sitze, fällt mir auf, wie verschieden die beiden Dörfer links und rechts sind. Als würde der Fluss nicht nur zwei Dörfer, sondern auch zwei Landschaften trennen. Die Häuser auf der linken Seite, stromaufwärts betrachtet, sind groß und die Grundstücke gepflegt. Sie haben akkurat geschnittene Hecken, Vorgärten, die sich über mehrere Terrassen erstrecken, und schmiedeeiserne Zäune. Und den besseren Blick gibt es dort auch. Die Leute in den Häusern sehen morgens die Sonne hinter sich aufgehen und abends auf der anderen Seite des Flusses wieder verschwinden. Ihre Sicht ist durch nichts eingeschränkt. Wären nicht die Weiden und das Brombeergestrüpp, wäre es ein Leichtes für sie, mich hier zu entdecken. Von hier aus betrachtet hat es fast den Anschein, als wäre der Hang eine Tribüne und die Häuser nichts anderes als Zuschauerplätze, von denen aus das Geschehen auf der Insel verfolgt werden kann. Aber die Insel ist keine Bühne, denn auf der stehen sie selbst!
Auf den Grundstücken ist noch keine Menschenseele zu sehen. Die Leute sitzen noch an ihren Tischen beim Frühstück.
Und drüben? Auf der anderen Seite, im Pfarrhaus? Da steht das Abendessen noch auf dem Tisch. Aber die Stühle sind alle leer. Und ich liege hier …
Wenn die Leute an den Frühstückstischen wüssten, dass ich mit meinem Fernglas ihre Grundstücke absuche … Aber es gibt nicht viel zu sehen. Die Büsche in den Vorgärten tragen kaum Blätter. Alles ist kahl und leer. Kein Ort, um sich zu verstecken.
Diese Insel hier ist ein Glück. Trotz allem. Besonders jetzt, wo sich der Nebel verzieht und die Sonne durchbricht. Die Wärme wächst von außen nach innen. Erst in meinem Gebüsch und danach in mir.
Marie, ich habe gerade mit dem Fernglas durch das Loch in den Zweigen über mir gespäht, und dabei kam es mir in den Sinn, dass du vielleicht bei den Sternguckern bist. In dem großen Schloss ein paar Kilometer stromabwärts von hier.
Sterngucker, das war dein Wort, Marie. Du hast die Männer im Schloss immer Sterngucker genannt. Dabei waren es Astronomen. Aber du hast es vorgezogen, ihnen mit deinem Blick zu begegnen. Für dich waren es Sterngucker, vom ersten Tag an, und dabei ist es geblieben.
Ich erzähle mir unsere Geschichte. Als hätten wir etwas zu feiern. Als gäbe es ein Publikum für meine Worte, während du neben mir stehst und still in dich rein lächelst und am Ende meiner Rede nach meiner Hand greifst und sie zärtlich umschließt, während alle anderen klatschen.
Du bringst mich zum Träumen, Marie. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sich die Insel vom Grunde des Flusses losreißt und stromabwärts zu treiben beginnt. Ganz langsam, als wolle sie nicht, dass jemand ihr Verschwinden bemerkt. Nur ich spüre es, spüre, wie die Insel anfängt, den Fluss runterzutreiben, und spanne meine Decke auf wie ein Segel, damit sie an Fahrt gewinnt, und während die Insel in den Wellen dahintreibt, mache ich mich bereit, klopfe mir den Dreck aus den Sachen und nehme mein Fernglas, um nach dem Schloss Ausschau zu halten, in dem die Sterngucker wohnen.
Es sind Astronomen, Marie. Aber nicht für dich. Niemals. Du hast deinen eigenen Blick auf die Welt, und der hat mich glücklich gemacht. Dabei war es nicht immer leicht, dir zu folgen. Ich weiß noch, dass ich am Anfang gar nicht glauben konnte, was du mir von den Sternguckern erzählt hast. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es nur ein paar Kilometer von hier entfernt ein Schloss gibt, in dem ein Astronomisches Institut untergebracht ist. Aber du hast gesagt, dass es dieses Schloss gibt, und dass die Sterngucker aus Berlin gekommen sind, weil sie evakuiert werden mussten, und da habe ich langsam verstanden. Ich wusste ja selbst um die Notwendigkeiten des Krieges, ich habe die Evakuierungen schließlich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und trotzdem kam es mir ganz und gar unwirtlich vor, dass ein großes wissenschaftliches Institut aus Berlin in ein Dorf ins Niemandsland zieht, zwischen lauter Felder, Scheunen und Bauerngehöfte, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie Dutzende Astronomen eine Heimat zwischen grobschlächtigen sächsischen Bauern finden. Am allerwenigsten aber hätte ich gedacht, dass eine Traumtänzerin wie du, Marie, einmal in einem Astronomischen Institut arbeiten wird.
Schlossfrau wirst du werden, hast du mir gesagt, als ich aus L. gekommen bin und du mir von deiner neuen Arbeit erzählt hast. Letztes Jahr im August war das, ich erinnere mich noch genau. Von nun an, hast du gesagt, wirst du jeden Tag für vier Stunden Schlossfrau sein. Sechs Tage die Woche, und die Sonntage sind frei. Ich habe erst nicht verstanden, kannte weder das Schloss noch das Institut aus Berlin, und ich wusste auch nicht, was du als Schlossfrau da machst.
Nur ein bisschen putzen, hast du gesagt und so getan, als wäre es ein Leichtes, so ein Schloss sauber zu halten.
Aber für dich war es das. Im Gegensatz zu mir hast du dir nie zu viele Gedanken gemacht. Du hast die Dinge genommen, wie sie kamen, und als du die Chance hattest, Schlossfrau zu werden, hast du sie ergriffen.
Wäre die Schule nicht geschlossen worden, würdest du immer noch Schlossfrau sein. So aber musstest du dich um die Kinder kümmern, musstest tagsüber da sein für sie und konntest nicht mehr jeden Morgen in den Zug steigen, eine Station in Richtung L. fahren und dann noch ein paar Kilometer laufen. Immer der Nase nach. Immer nach Nordwesten. Jeden Morgen, hast du mir gesagt, komme ich dir ein kleines Stück näher. Und jeden Morgen, Marie, habe ich an dich gedacht.
Aber du bist nicht im Schloss, Marie, nicht wahr? Wenn du im Schloss wärst, hättest du mir davon erzählt. Dann hättest du mir einen Brief geschrieben und ihn auf den Küchentisch gelegt, und darin hätte gestanden, dass du jetzt Schlossfrau bist, sieben Tage die Woche, und ich solle zu dir kommen, denn dies sei eine Einladung – eine Einladung, Schlossherr zu sein.
Aber es gibt keinen Brief, keine Einladung, nichts. Alles, was ich habe, ist die Gewissheit, dass du nicht mehr da bist, und das Gefühl, dass dir und den Kindern etwas passiert ist. Dass euch jemand geholt hat und dass in Wahrheit ich derjenige bin, den sie in ihre Hände bekommen wollten.
Deshalb bin ich auf diese Insel gegangen. Und deshalb werde ich auch ausharren auf ihr. Euer Verschwinden, Marie, ist der Grund meines Bleibens. Ich bin landbrüchig geworden.
Vielleicht werden sie mich eines Tages hier finden, kniend, zwischen hüfthohem Gras und Gebüsch, den Kopf nach vorn gebeugt, auf meine Hinrichtung wartend.