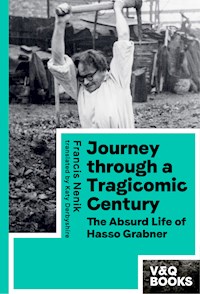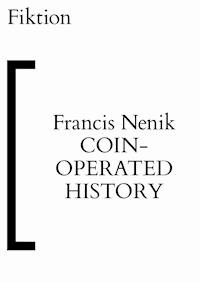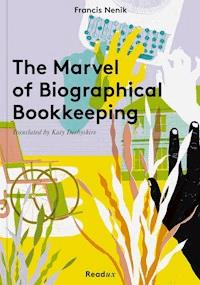0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fiktion
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amanda Susan Marie Hollis erhält den Auftrag, das Leben eines arbeitsscheuen Bibliothekars aus der Gründungszeit Harvards zu archivieren. Die Vernetzung von Geschichte und Leben erweist sich als äußerst riskant und verbrecherisch. Wie hängen die Eroberung Amerikas, die Vinland-Karte, Mongolenstürme, spanische Mönche und ein verschwundener Deckenleuchter miteinander zusammen? Ist Hollis eine geniale Rechercheurin oder wahnsinnig? Gibt es eine Wahrheit jenseits des Archivierbaren? Neniks Roman liest sich wie die irrlichternde Vorgeschichte von Google.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Erstveröffentlichung
Fiktion, Berlin 2016
www.fiktion.cc
ISBN 978 3 95988 031 2
Projektleitung
Mathias Gatza, Ingo Niermann (Programm)
Henriette Gallus (Kommunikation)
Julia Stoff (Organisation)
Lektorat
Mathias Gatza
Korrektorat
Rainer Wieland
Design Identity
Vela Arbutina
Programmierung
Maxwell Simmer (Version House)
Das Copyright für den Text liegt beim Autor.
Dieses Buch steht unter eine Creative Commons Zero Lizenz. Sie dürfen das Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, auch zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen.
Fiktion wird getragen von Fiktion e.V., entwickelt in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt und gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.
Fiktion e.V., c/o Mathias Gatza, Sredzkistrasse 57, D-10405 Berlin
Vorstand
Mathias Gatza, Ingo Niermann
Francis Nenik MÜNZ- GESTEUERTE GESCHICHTE
Das hier ist für euch.
Die Utopie ist nicht nur eine Frage der Zeit,sondern auch eine des Raumes.
I
Am 31. Oktober 1963 trat William Croswell in Amanda Hollis’ Leben. In einer Pappbox. In 234 Teilen.
Er war ein Geschenk der New England Historic Genealogical Society und Amanda Hollis dazu auserkoren, ihn wieder zusammenzusetzen und einen Mann aus ihm zu machen. Dass William Croswell zu diesem Zeitpunkt bereits einhundertneunundzwanzig Jahre tot war, war nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, es war geradezu die Voraussetzung, um in Amanda Hollis' beständig schwitzenden Händen zu landen.
Sie, deren vollständiger Name Amanda Susan Marie Hollis lautete, hatte an der Drexel-University in Philadelphia Bibliothekswissenschaften studiert und am 28. März 1956 um Punkt 18 Uhr ihre Abschlussurkunde erhalten – und das war auch schon alles, was sich über ihre Studienzeit und im Grunde auch über ihre Jugend sagen ließ. Zwei Stunden nach der Urkundenübergabe explodierte in Philadelphia der direkt neben der Universität liegende Getreidespeicher. Der durch die Market Street rasende Feuerball beschädigte das Studentenwohnheim, und die dazugehörige Schockwelle zersiebte sämtliches Glas im Umkreis von 200 Metern. Amanda Hollis war mit einem großen Knall ins Erwachsenenleben getreten, und es gab kein Zurück.
Also war sie nach Harvard gegangen, noch bevor der Sommer begann, und hatte im Büro des Personalleiters der Universitätsbibliothek ihre Urkunde auf den Tisch gelegt. Sie tat es nicht, um eine Karriere zu starten oder einem renommierten Hause zu dienen, es war überhaupt keine Frage der Qualität, sondern eine der Zahl, eine einfache Rechnung, in der sie, Amanda Hollis, die einzige Unbekannte war.
Die Universitätsbibliothek von Harvard jedenfalls, das wusste sie, war die größte des Landes, ja die größte wissenschaftliche Bibliothek der Welt, und deshalb, so dachte Amanda Hollis, war dort am ehesten eine Stelle für sie frei. Außerdem trug sie – dem Kurs über randständiges Bibliothekswissen bei Prof. Orscube sei Dank – den Namen eines englischen Exzentrikers, der der Universität von Harvard zweihundert Jahre zuvor Tausende Bücher geschenkt und obendrein noch ein nettes Sümmchen vermacht hatte, nachdem die dortige Bibliothek komplett abgebrannt war, und wer weiß, vielleicht würde der Personalleiter ja ihren Namen mit dem seinen verbinden, an das ebenso dezente wie beeindruckende Fortleben einer großen Tradition denken, in ehrfurchtsvoller Anerkennung stumm nicken und – aus genau diesem Grund – von jenen Nachfragen absehen, die klarmachen würden, dass sie, Amanda Hollis, mit Thomas Hollis dem V. nicht nur nicht verwandt, sondern auch sonst das größtmögliche Gegenteil eines englischen Exzentrikers war.
Also fuhr Amanda Hollis an einem verregneten Maitag des Jahres 1956 nach Harvard, legte dem Personalleiter ihre Urkunde auf den Tisch und wartete darauf, dass etwas passierte. Aber der Personalleiter sagte kein Wort und schaute sie lediglich an, als fehle noch was.
Aber in Amanda Hollis' Leben gab es nichts außer der Urkunde und ihrer Person. Und beide waren hier, waren anwesend im Raum, wie man nur in einem Raum anwesend sein konnte, wobei die Sache mit der Anwesenheit im Falle von Amanda Hollis für ihren eigenen Geschmack ruhig ein bisschen, nun ja,weniger umfangreichhätte ausfallen können.
»Meine Urkunde liegt einsam und verlassen auf dem Personalleitertisch, während ich auf einem Stuhl sitze, der viel zu schmal für mein Hinterteil ist«, dachte sie, während das Schweigen auf der anderen Seite die Größe der Bibliothek von Harvard annahm. Aber von der Bibliothek war keine Rede. Es war überhaupt von nichts eine Rede, und deshalb musste es außer ihr und der Urkunde noch ein Drittes geben. Aber was?
Amanda Hollis überlegte. Und war kurz davor, zu erzählen, wie das war, damals, als Thomas Hollis in England Bücher für die Bibliothek in Harvard aussuchte, ihr Äußeres mit teuren Einbänden und obskuren Insignien verzierte und das Innere mit Anstreichungen und Kommentaren versah, die Bücher anschließend in riesige Holzkisten packte und sie schiffeweise über den Ozean schickte, um das zu werden, was man Harvards allergrößten Bücherspender nennt, und wie er dann, am Neujahrstag 1774, ganz plötzlich verstarb und sich auf einem Feld seines Anwesens begraben ließ, zehn Fuß tief und ohne ein Buch unten im Sarg, dafür aber mit einem Pferd oben auf dem Acker, das das Feld, kaum dass Thomas Hollis der V. unter der Erde war, umpflügen musste, ganz einfach, weil er ein englischer Exzentriker war und es sich so gewünscht hatte und außerdem weder Frau noch Kinder besaß, die ihn an seinem Grab hätten besuchen können, was freilich die Verbindung zu ihr, Amanda Hollis, sofort gekappt hätte, und deshalb schwenkte sie – den Kopf in den endlosen Annalen der Bibliothekswissenschaft und das Hinterteil in einem zu engen Stuhl – um und erzählte dem Personalleiter der Bibliothek von Harvard von der Urkunde, die ihr Prof. Orscube am 28. März in die Hand gedrückt hatte, und dem, was danach passiert war.
Sie tat es, weil sie hoffte, auf diese Weise das, was hinter ihr lag, mit dem, der vor ihr saß, verbinden zu können. Außerdem, so schien ihr, war es die einzige Möglichkeit, die Unbekannte in ihrer Rechnung zu tilgen.
Und so begann sie und berichtete von jenen Menschen, die am Abend des 28. März 1956 in Philadelphia auf der Straße knieten und beteten, während sie, Amanda Hollis, im Studentenwohnheim vor ihrem Bett stand, die Urkunde in den Händen hielt und aus dem Fenster sah, dessen Scheibe vor ihr auf dem Fußboden lag wie ein Puzzle, das darauf wartete, endlich zusammengesetzt zu werden.
Draußen aber war alle Ordnung dahin, war ganz Philadelphia in ein tief orangefarbenes Licht getaucht, das Bürogebäude gegenüber von seiner Hülle befreit und seltsam verbogen, dazu lodernde Feuer, Sirenengeschrei, aufgerissene Münder und Wände, wohin man auch blickte, und sie, Amanda Hollis, mittendrin und doch allem enthoben, oben, in der vierten Etage des Studentenwohnheims, zu dessen Füßen Menschen auf der Straße knieten und beteten, zwischen verbogenen Stahlträgern und sich krümmenden Häusern, an diesem schiefen Mittwoch, diesem Unglückstag, an dem der Herr verkauft und verraten worden war, da stand sie vor ihrem Bett, dessen Decke zurückgeschlagen war, als sei die Druckwelle darunter gefahren, und wusste doch, dass sie es gewesen war, die sie zurückgeschlagen hatte, ganz einfach, um schlafen zu gehen, weil sie morgen früh raus musste, um in der Kirche die Karmette zu feiern.
Jetzt aber, wo die Welt um sie herum explodiert war, war an Feiern nicht mehr zu denken, und als Amanda Hollis sich fragte, was ihr im Angesicht der Katastrophe noch blieb, fiel ihr Blick auf die Urkunde in ihren Händen. Also legte sie sich ins Bett, begrub ihren bekleideten Körper unter der Decke, legte die Urkunde obendrauf und wartete, dass jemand kam und sie beide holte.
Als es soweit war, ließ sie alles mit sich geschehen, ließ sich aus dem Wohnheim führen, in eine Turnhalle bringen und in den Tagen danach die ganze Geschichte erzählen, um zwei Monate später alles wieder hervorzuholen, sich selbst, die Urkunde und die Geschichte dahinter. Und zu guter Letzt noch jene Zahlen, die sie in Philadelphia alle auswendig kannten: drei Tote, achtzig Verletzte und eine Sprengkraft von 1.100 Pfund Dynamit, Resultat einer zu hohen Staubkonzentration im Getreidespeicher der Stadt.
Als Amanda Hollis mit ihrer Erzählung fertig war, schaute sie den Personalleiter erwartungsvoll an, doch schaute der ganz und gar teilnahmslos zurück, falls von so etwas wieZurückschauen überhaupt die Rede sein konnte, denn tatsächlich starrte er einfach nur durch sie hindurch, als sei die richtige Kandidatin soeben hinter ihr in der Tür aufgetaucht. Also drehte sich Amanda Hollis um, sah, dass die Tür geschlossen und auch sonst niemand im Raum war – und drehte sich wieder zurück, um weiter durchstarrt und angeschwiegen zu werden.
»Er muss mich sehen, aber er sieht durch mich durch, als sei ich noch nicht mal im Raum«, kam es Amanda Hollis in den Sinn. »Andererseits, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht sieht er ja gar nicht durch mich hindurch, sondern reicht mit seinem Blick überhaupt nicht zu mir. Weil er auf dem Weg von seiner Seite des Tisches auf meine mit etwas zusammengestoßen ist. Etwas, das ich nicht sehen kann.«
Aber was konnte das sein? Der Geist von Harvard? Eine übermäßige Konzentration von Gedanken in der Luft? Die Fiktion eines Pferdes, das statt auf einem Acker auf einem Schreibtisch rumstand?
Amanda Hollis hatte nicht den Hauch einer Ahnung, doch schien ihr die Vorstellung eines Zusammenstoßes so falsch nicht zu sein, denn kaum dass der Gedanke gedacht war, prallte der Blick des Personalleiters gegen etwas, das Amanda Hollis’ Augen entzogen über der Tischplatte thronte, fiel senkrecht nach unten und klatschte auf die Urkunde.
Leider war die anschließende Untersuchung des Papiers nicht von der Art, die Amanda Hollis sich ausgemalt hatte, denn statt sich ihre Qualifikationen anzuschauen, sah es aus, als suche der Personalleiter in der Urkunde nach den Resten der Explosion, als glaube er, ihren Niederschlag darin zu finden.
Aber da war nichts, nichts außer einem Stempel, zwei Unterschriften und drei Zeilen Text, und Amanda Hollis wusste, dass das die maximale Eindampfung eines Lebens war, von dessen größtmöglicher Ausdehnung sie soeben berichtet hatte.
Und das war der Moment, in dem sie erkannte, dass es keinen Sinn hatte, es hier weiter zu versuchen. Die Bibliothek von Harvard war ein paar Nummern zu groß für sie. Oder sie zu klein. Oder beides. Jedenfalls passte es einfach nicht, und einen Job hatten sie wahrscheinlich auch nicht zu vergeben.
Also stand sie auf und reichte dem Personalleiter die Hand. Das heißt, eigentlich reichte sie ihm beide Hände – mit der einen wollte sie sich verabschieden und mit der anderen ihre Urkunde zurück. Nur waren Absicht und Wirkung ein wenig verschieden, wodurch die ganze Aktion eher den Eindruck eines plumpen Annäherungsversuchs denn den einer galanten Verabschiedungsgeste erweckte, was zweifellos auch daran lag, dass nicht nur Amanda Hollis, sondern auch ihr Stuhl mit aufgestanden war und ihr wie ein überdimensionierter Melkschemel am Hinterteil festklemmte.
Und so kam es, dass Amanda Hollis ihre Hände zurückzog, sie auf die Armlehnen des Stuhles legte, den Stuhl auf den Boden presste und, kaum dass das getan war, ihren Hintern folgen ließ, das heißt ihn – schlipp, schlupp – zwischen den Armlehnen hindurch zurück auf die Sitzfläche zwängte, woraufhin der Personalleiter – vielleicht verängstigt, vielleicht verwundert, vielleicht aber auch einfach nur verspätet – sein Schweigen brach.
»Amanda Susan Marie Hollis«, sagte er, und es klang, als würde er den Namen von der Urkunde ablesen, was daran lag, dass er den Namen tatsächlich von der Urkunde ablas. Dann hob er den Blick und schaute sie an, als hätte er erst jetzt bemerkt, dass sie vor ihm saß, leibhaftig und nicht nur auf dem Papier, und fragte: »Sind Sie bereit, am Unterhemd von Heinrich dem Ermahner zu riechen?«
Amanda Hollis glaubte, sich verhört zu haben.
Amanda Hollis glaubte, im Kopf nicht ganz richtig zu sein.
Aber der Personalleiter wiederholte die Frage noch mal.
»Amanda Susan Marie Hollis, sind Sie bereit, am Unterhemd von Heinrich dem Ermahner zu riechen?«
Nun, was sollte sie darauf antworten? Von einem Heinrich dem Ermahner hatte sie noch nie was gehört, und auch sonst schien die Sache von eher zweifelhaftem Charakter zu sein. Was den Personalleiter freilich nicht davon abhielt, eine weitere Frage von derselben Sorte zu stellen.
»Interesse am Rohrstock von Präsident Chauncey?«
»Der Mann ist kein Personalleiter, sondern ein Perverser«, durchfuhr es Amanda Hollis. Allerdings nur in Gedanken, derweil der polymorphe Perverse vor ihr die dritte und offensichtlich alles entscheidende Frage stellte, denn er stand auf und beugte sich über den Tisch und die Urkunde zu Amanda Hollis, die auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen versuchte, es nicht schaffte und die Breite ihres Hinterns verfluchte.
»Mein Arsch verhält sich zu diesem verdammten Stuhl wie Harvard zu mir«, kam es ihr unvermittelt in den Kopf, doch hatte der, der mit seiner Nasenspitze jetzt fast die ihre berührte, ganz andere Gedanken.
»Lust, unter Tage zu arbeiten?«
Nun, das klang verdächtig nach einem Jobangebot, war wahrscheinlich aber nur die nächste Schweinerei, verklausulierter als die beiden zuvor, ansonsten aber vom selben Charakter und obendrein noch mit dem erwartungsvollen Gesicht eines Personalbürohengstes im mittleren Alter garniert, was allein schon Grund genug war, die Sache hier abzublasen, nur wusste Amanda Hollis nicht, wie sie das tun, wie sieverneinensollte. Also sagte sie »Ja«, und dann noch »Natürlich«, und dann gab es keine Fragen mehr.
Kurz darauf wurde die Urkunde auf dem Tisch gegen eine neues Stück Papier ausgetauscht, und nachdem Amanda Hollis ihrem Gegenüber dabei zugesehen hatte, wie er stumm ihren Namen eingetragen, seinen Stempel draufgesetzt und das Blatt unterschrieben hatte, bekam sie es von ihm überreicht, wozu sie ordnungsgemäß aufstand und eine Hand zu schütteln versuchte, die sich ihr nicht darbot. Also setzte sie sich wieder, wunderte sich, dass der Stuhl nicht mit aufgestanden war, betrachtete, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, ihre Finger, die schon wieder schweißnass waren und wartete darauf, dass irgendwo in der Nähe ein Getreidespeicher explodierte.
Aber nichts passierte, und auch der Personalleiter hatte sich wieder aufs Starren und Schweigen verlegt, weshalb es den Anschein hatte, als sei sie, Amanda Susan Marie Hollis, schon gar nicht mehr im Raum und existent nur noch auf dem Papier. Also inspizierte sie das Blatt in ihren Händen, las ihren Namen, dachte an nichts Böses, sah als künftigen Arbeitsort »Pussy Library« eingetragen, sah den Personalleiter entgeistert an, erntete weder eine Reaktion noch einen Laut, schaute noch einmal auf das Papier, las »Pusey Library« und verließ eilends das Büro.
Der Weg, den sie nahm, war nicht das Resultat einer inneren Stimme, der sie folgte, sondern einer Karte, die sie führte. Sie war an das Stück Papier angeheftet, das sie bekommen hatte und lotste Amanda Hollis quer über eine regennasse Wiese und unter triefenden Magnolienbäumen hindurch in Nathan Puseys Untergrundbibliothek, einem vierzig Fuß tiefen Loch im Boden, das außen mit Beton ausgekleidet und innen mit Büchern und Akten vollgestellt war. Es war ein Ort, an dem kein Sonnenstrahl die Verblichenen traf und kein Feuerball die Lebenden verbrannte. Und dort blieb sie. Und verlor ihre Unschuld. An einen Haufen Toter, deren Größe sich in Regalmetern maß.
Das war vor siebeneinhalb Jahren, und als Amanda Hollis am 31. Oktober 1963 William Croswells Leben vor sich auspackte, spürte sie mehr als jemals zuvor, dass ihr eigenes dabei war, zu vergehen – spurlos und an ihr vorüber. Und die Tatsache, dass sie in zwanzig Tagen dreißig Jahre alt wurde und ein Viertel ihres Lebens in acht Metern Tiefe unter dem Campus von Harvard im universitätseigenen Archiv verbracht hatte, war nur der zahlenmäßige Ausdruck des ganzen Dilemmas.
II
Nach allem, was der Genealogen-Box zu entnehmen war, war William Croswell 1760 auf die Welt gekommen und hatte sie 1834 wieder verlassen. Dazwischen lag ein Leben, das, so wie es sich vor Amanda Hollis’ Augen entblätterte, vor allem aus Briefen, Tagebucheinträgen, Zeugnissen, Empfehlungsschreiben, Mietverträgen und Rechnungen bestand.
Es schienen vierundsiebzig höchst langweilige Jahre gewesen zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Der zweite indes machte die Sache nur noch schlimmer, denn kaum dass Amanda Hollis William Croswell aus der Box genommen und ihn auf dem Tisch ausgebreitet hatte, bekam sie – aus einem anderen Teil des Archivs, von einer anderen Person mit lautlos verrieselnden Träumen – die Geschichte seines Harvarder Studentenlebens serviert. Einstufungsergebnisse, Vorlesungsverzeichnisse, Krankenbescheinigungen, weitere Briefe, weitere Rechnungen, weitere Zeugnisse. Empfehlungsschreiben: Fehlanzeige. Aber immerhin hatte William Croswell am 21. April 1780 auf Latein eine Ode auf die Astronomie zum Besten gegeben.
Der Rest des Tages war schnödes Auspacken und stupendes Sortieren, und als Amanda Hollis am späten Nachmittag damit fertig war, lag William Croswell in nunmehr 526 Teilen vor ihr auf dem Tisch. Er erinnerte sie an die Scheibe, die damals im Studentenwohnheim auf dem Boden gelegen hatte. Mit einem Unterschied: Diesmal galt es, das Puzzle tatsächlich zusammenzusetzen – und sie war diejenige, die dafür verantwortlich war.
Aber was sollte sie auch anderes tun? Der Raum, den man ihr gegeben hatte, besaß kein Fenster, und die Welt um sie herum bestand aus Papier. Das war die Aussicht. Das war sie seit siebeneinhalb Jahren. Und daran würde sich in den nächsten dreißig Jahren aller Voraussicht nach auch nichts ändern.
Als Amanda Hollis kurz nach 18 Uhr aus dem Loch im Boden zurück auf die Wiese kraxelte, die das Dach der Untergrundbibliothek bildete, hoffte sie einen Moment lang auf eine Katastrophe, auf Feuer, betende Menschen, Geschrei, aber alles, was sie fand, waren zwei Studenten, die sich im Regen über irgendwas Unverständliches stritten, und ein Bus, in den sie stieg, um zurück zu ihrer Wohnung zu fahren, wo sie ein fetter, fleischiger Kürbis empfing, der vor ihrer Tür stand und sie angrinste, als wolle er ihr zeigen, dass es nur eine einzige Sache gab, die hier und heute tieforange leuchtete.
Am darauffolgenden Tag – es war ein Freitag und es hatte die ganze Nacht über geregnet – kroch Amanda Hollis um kurz vor acht zurück in den Betonbunker, der der Schlussstein all der Ambitionen war, die sie nie hatte, und als sie die Tür ihres Zimmers öffnete, fand sie auf ihrem Schreibtisch eine weitere Box.
Sie sah nicht anders aus als die beiden, die sie gestern bekommen hatte, nur dass auf dieser hier ein Etikett klebte, darauf die Worte »William Croswell, Buchtitelkatalogisierer, Harvard College Library.«
Es musste wirklich ein schrecklich langweiliges Leben gewesen sein.
Allein, das änderte nichts an der Sache, ja im Grunde bestätigte es sie sogar, denn sie, Amanda Susan Marie Hollis, war dazu da, noch das langweiligste Leben mit großen Schlagworten zu versehen und selbige fein säuberlich auf jene Karteikarten zu schreiben, die man hier in Pusey Katalogkarten nannte und deren Größe auf exakt 7,5 x 12,5 Zentimeter festgelegt worden war.
Das war der Raum, den Amanda Hollis füllen musste. Der Raum, in dem sie sich austoben durfte. Dass sie dabei nicht über die Stränge schlug, dafür sorgten die Schlagworte selbst – und die Tatsache, dass es darum ging, mit ihrer Hilfe einen Index zu erstellen, anhand dessen nicht nur die ruhmreiche Geschichte von Harvard und seiner Bibliothek erforscht und erzählt werden konnte, sondern sich auch die Fortschritte in der Buchtitelkatalogisierung feiern ließen, samt der dazugehörigen Heldentaten, vollbracht mit Füller und Papier.
Und selbst wenn das keinen interessierte und William Croswell nur ein unbedeutender Baustein in den heiligen Hallen von Harvard war – es war ihre Pflicht, an der papiernen Registratur der Universität weiterzuschreiben und alles Leben zu indizieren, das dem großen Harvard gedient hatte, auch wenn es schon hundertneunundzwanzig Jahre vorbei, überaus langweilig und in Form einer Pappurne von irgendeiner genealogischen Gesellschaft aus der Papiergruft gezogen worden war.
Im Übrigen hatte der Leiter des Archivs, ein kleiner pergamentfarbener Mann, der auf den Namen Heath Cover Evil hörte, nie schlief und nachts wie Krepppapier raschelnd durch sein Reich streunte, sich während ihrer Abwesenheit Zugang zu ihrem Zimmer verschafft und Box Nummer drei einer Aufforderung gleich auf dem Tisch platziert, es dabei jedoch nicht belassen, sondern bei der Gelegenheit auch noch einen Zettel auf die Box der Genealogen-Gesellschaft geklebt, auf dem stand: »Benöt. WC IA ei ei ei!«, was zweifellos »Benötige William-Croswell-Index für einen Aufsatz, eilt, eilt, eilt!« hieß.
Amanda Hollis nahm den Zettel, klebte ihn sich – ob aus Protest oder als Zeichen der Resignation, wusste sie selbst nicht genau – auf die Stirn und widmete sich der neu angekommenen Box Nummer drei. Abgesehen von ihrem Etikett war sie mit den anderen beiden identisch, ein Folio-Faltkarton in Mausgrau, mit einer Pappklappe vorn dran und einer Größe von 380 x 255 x 110 mm, das ganze absolut rechteckig und laut Aufdruck säurefrei und basisch gepuffert.
Amanda Hollis öffnete die Klappe und ließ die Reste des Buchtitelkatalogisierers William Croswell ins Licht gleiten. Dann zählte sie, was von seiner Bibliothekars-Existenz übrig geblieben war. Es waren 388 Aktenstücke, was in der Summe ein Lebenswerk von 914 Blatt Papier ergab. Ganz unten in der Box aber fand Amanda Hollis einen Geldschein. Es waren einhundert Britische Pfund, ausgestellt von der Bank von England.
Vielleicht, so dachte sie, hatte William Croswell ja doch nicht so ein langweiliges Leben gehabt.
Als sie mit dem Sortieren fertig war und alle Blätter paginiert, das heißt durchgezählt und die Zahl oben rechts mit Bleistift aufs Papier geschrieben hatte, erinnerte sich Amanda Hollis an den Notizzettel, der noch immer auf ihrer Stirn klebte.
Sie überlegte kurz, ihn kleben zu lassen und sich später, zu Hause, damit vor den Spiegel zu stellen, um sich selbst zu zeigen, was sie hier unten eigentlich tat,womit sie ihr Leben verbrachte.Aber dann befand sie, dass das keine gute Idee war, riss den Zettel ab, knüllte ihn zusammen, öffnete auch die Klappen der beiden anderen Kartons vor sich auf dem Tisch, schloss die Augen, tat mit der Hand so, als würde sie winken – und warf. Dann schloss sie die Klappen und öffnete die Augen. Der Zettel war verschwunden.
Und so ging Heath Cover Evils Aufforderung, Schlagworte zu schreiben und einen Index zu erstellen, dahin, wurde dechiffriert, zusammengeknüllt und zum unsichtbaren Glücksbringer eines Hütchenspiels ohne Hütchen gemacht, und während Amanda Hollis auf ihrem Stuhl saß und, statt sich dem Papier auf ihrem Schreibtisch zu widmen, auf die Weltkarte starrte, die über ihm angebracht war, wurde ihr klar, dass Heath Cover Evil nicht nur keine Lust, sondern auch keine Veranlassung hatte, höchstselbst durch die Untiefen von William Croswells Papierleben zu schippern, schließlich hatte er sie, Amanda Susan Marie Hollis – was auch der Grund war, warum er so drängen konnte.
»Für Heath Cover Evil bin ich die perfekte Entschuldigung«, dachte Amanda Hollis, »eine Katalogisierungstante mit Stichwortgeberfunktion.«
Und weil sie einmal dabei war, sich mit den Augen anderer selbst anzuklagen: »Mit William Croswell erfüllt sich mein Schicksal. Denn wozu braucht einer sonst eine studierte Bibliothekswissenschaftlerin mit Erfahrung im Schlagworte-Schreiben in seinem untergründigen Archiv, wenn nicht, um das Wirken eines Mannes zusammenzufassen, dessen Lebensaufgabe offensichtlich darin bestand, der Bibliothek von Harvard ein Verzeichnis ihrer sämtlichen Buchtitel zu liefern?!«
Und weil das noch immer nicht genug war (und Amanda Hollis glaubte, den Regen an den Außenseiten des Betonbunkers herablaufen zu hören):
»Heath Cover Evil will nicht nur, dass ich William Croswells Leben mit Tinte in Schlagworte gieße, ich soll ihm auch dabei helfen, aus den gesammelten Banalitäten jene zwei, drei Aktenstücke herauszusuchen, die auf die besonderen Leistungen im Leben dieses Buchtitelkatalogisierers verweisen. Dabei gibt es diese besonderen Leistungen gar nicht, und wenn, dann sind sie nichts anderes als die ebenso trockenen wie traurigen Höhepunkte, die jede Bibliothekarsexistenz aufzuweisen hat.
Heath Cover Evil aber ist das egal. Er wird die Aktenstücke dazu verwenden, um aus dem Leben eines Papiertigers ein abenteuerliches Epos zu machen und allen zu zeigen, dass selbst Menschen, deren Lebenssinn das geordnete Beschreiben von Katalogkarten ist, vom Geist Harvards befruchtet werden können.«
Was Amanda Hollis für eine ebenso versteckte wie direkt auf sie gemünzte Gemeinheit hielt, eine, die sie – da konnte sie tun, was sie wollte – mit voller Breitseite traf, und vielleicht, so dachte sie sich, war in diesem Fall Nichtstun, das heißt die gepflegte Ignoranz bei gleichzeitiger Besinnung auf die eigenen Kräfte (und das bedeutete: die eigene Nichtigkeit), das Beste, was sie machen konnte.
Immerhin, Heath Cover Evils Absichten waren damit geklärt und auch seine kleine Insulte hatte sich Amanda Hollis’ Dechiffrierkünsten nicht entziehen können, und das Einzige, was jetzt noch aufgedeckt werden musste, war der Ort der geplanten Publikation, doch ließ sich auch der nicht lange vor Amanda Hollis verbergen, denn sie erinnerte sich daran, dass auf dem Notizzettel, den sie in eine der drei Pappboxen geworfen hatte, der Schriftzug »The Register« aufgedruckt war – ein Titel, der, das wusste sie, Anmaßung und Abkürzung zugleich war und für eine Zeitschrift stand, die sich mit vollem NamenThe New England Historical and Genealogical Registernannte, was – weiter gedacht – nur den Schluss zuließ, dass Heath Cover Evils Aufsatz in ebendiesem Journal erscheinen sollte, gewissermaßen als Gegenleistung für das Geschenk der Genealogen-Gesellschaft, das »Ich gebe damit du gibst« der Wurzelwerker, womit sich der Kreis schloss und Amanda Hollis das dumpfe Gefühl beschlich, Teil einer Geschichte zu sein, die in Pappboxen daherkam und aus nichts als Papier bestand, das von den Seilschaften alter Männer zusammengehalten wurde.
III
Der Weg ins Archiv des Archivs oder, wie Amanda Hollis ihn nannte, »den Keller« führte aus ihrem Zimmer nach links über einen langen Flur, zu dessen beiden Seiten, von dünnen Mauern verdeckt, ein Heer von Archivaren in fensterlosen Räumen über Papierbergen saß, derweil das Ende des Flurs von einer kleinen dicken hechtgrauen Tür markiert wurde, hinter der sich eine Rundtreppe in die Tiefe hinabschraubte.
Als Amanda Hollis die Tür öffnete, flammte ein Scheinwerfer auf. Er war direkt oberhalb des Türsturzes angebracht und warf seinen Lichtkegel hinab in die Tiefe, als sei das nicht nur der Weg, der zu gehen, sondern auch eine Aufforderung, der Folge zu leisten war.
Die Treppe, die sich vor ihr in den Keller hinabschraubte, bestand aus grobmaschigen Gitterroststufen, die sich unter ihren Füßen auffächerten und sich, Schritt für Schritt, um die eigene Achse drehten. Die Stufen selbst waren in der Mitte an einen dicken Holm angeschweißt, wurden nach außen hin breiter und erstrahlten statt in dem üblichen Zinkgrau in einem satten Honiggelb, und hätte Amanda Hollis genauer hingeschaut, so hätte sie bemerkt, dass die Stufen das Aussehen von Flügeln einer zukünftigen Rasse Insekten besaßen.
Aber Amanda Hollis hatte keine Augen für die futuristischen Feinheiten ferromonischer Fabrikate. Ihr Interesse galt einzig und allein jenen drei Sloppy Joes, die sie, in Aluminiumfolie gepackt, Tag für Tag in den Keller hinabschleppte, als seien sie Gefangene in den Katakomben eines geheimen Gefängnisses, Delinquenten auf ihrem Weg zurück in den Staub, Abgeurteilte, die noch ein letztes Mal hinaus in den Tag treten, nur um sogleich zum Richtplatz gebracht zu werden, wo schon der Henker auf sie wartet, begierig darauf, seine Arbeit zu tun, fernab aller offiziellen Geschichte, beschienen nur vom gleißenden Licht einer hoch stehenden Sonne, im Hinterhof der auf Gewalt und Gehorsam getrimmten Schule der Americas.
Aber ebenso wenig wie Amanda Hollis Augen für das hatte, was ihr zu Füßen lag, hatte sie Gedanken in ihrem Kopf, zumindest keine, die nicht aufs Essen gerichtet waren, und deshalb setzte sie sich, kaum dass sie am unteren Ende der Treppe angelangt war, Tag für Tag auf die vorletzte Stufe, wünschte sich selbst Guten Appetit und begann, ohne weitere Umschweife, Sloppy Joe Nummer eins zu entkleiden.
Was dann folgte, war für gewöhnlich ein lauthalsiges »Lecker!«, begleitet von einem letzten Blick auf den nackten Sloppy Joe in ihren Händen, einem sich genüsslich öffnenden Mund und zwei sich nicht minder genüsslich schließenden Augen.
Dann biss Amanda Hollis zu. Und biss und biss, bis es vorbei war. Sie hatte zwanzig Minuten. Sie brauchte nur neun. Drei für jeden Sloppy Joe, den sie verschlang. Mit ihrem Mund. Im Keller. In der Untergrundbibliothek. Ein Loch in einem Loch in einem Loch.
Und doch war dieser Raum der einzige, der ihr Halt gab, der Ort, an den sie sich seit nunmehr fast sieben Jahren zum Zwecke ihres Frühstücks zurückzog und überdies der einzige Platz in Nathan Puseys ganzer verdammter Untergrundbibliothek, an dem sie sich nicht mit irgendwelchen Akten rumschlagen musste, denn die lagen gut verschlossen in den großen, eisernen Schränken, die hinter der Treppe an der Wand aufgereiht standen wie riesige, stumme Wächter, deren Aufgabe es war, alle zu sammeln zum Zwecke ihrer späteren Vernichtung.
Während der Zeit ihres Frühstücks aber kümmerte sich Amanda Hollis nicht um die Schränke und dachte auch nicht an das, was sich in ihnen befand, sondern widmete sich einzig und allein ihren Sloppy Joes, und nie hätte sie, während ihre Augen vor Vorfreude glänzten und sich alles in ihr verzückte, daran denken können,dass das, was da warm und weich in ihren Händen lag, das perfekte Gegenstück zu den Arrestanten in den Archivschränken war, schließlich bestanden ihre Sloppy Joes nicht aus Papier, sondern aus Rinderhackfleisch, Tomaten und Zwiebeln, mit Wächtern aus Weißbrot statt Eisen.
Mit anderen Worten: Der Keller war für Amanda Hollis der Ort ihres Magens, nicht der ihres Kopfes, denn der gehörte in den Raum, der über ihr lag, in den Raum der Pappboxen, des Papiers und der Tinte. Dort war der Schlagwortraum, hier dagegen war der Raum, in dem sie sich den Magen vollschlagen konnte. Und zwar ungehindert. Denn das war ein weiterer Grund, weshalb sie jeden Tag hierherkam. Sie hatte einfach keine Lust, dass ihr jemand dabei zusah, wie sie ein Sloppy Joe-Sandwich nach dem anderen verdrückte. Noch nicht einmal die Frau, die sie vier Meter weiter oben war, sollte sie sehen. Deshalb musste sie eine andere werden. Hier unten. Im Keller. Und sei es auch nur für zwanzig Minuten.
Und warum auch nicht? Der Keller war Amanda Hollis' Anderswelt, ihr Augenblicks-Reich, und selbst wenn sie statt in einen Sloppy Joe in einen Apfel gebissen hätte, so wäre sie dennoch nicht wie die anderen Archivare nach oben,insFreiegestiegen, um ihr Frühstück auf den Bänken zu sich zu nehmen, die auf dem Dach der Untergrundbibliothek standen, allein schon deshalb nicht, weil sie das eilige Herauskraxeln aus einem Betonbunker zum Zwecke der Nahrungsaufnahme deprimierend fand, und noch mehr die nach der Pause folgende Rückkehr in einen fensterlosen Raum.
Also stieg Amanda Hollis hinab in den Keller, um mit ihren drei Sloppy Joes alleine zu sein. Dass sie sie direkt nach der Ankunft alle verschlang und am Ende ihres Verzehrens, das heißt nach neun Minuten, nicht nur allein, sondern einsam war, war Teil der Geschichte. Ihr blieben dann immer noch elf Minuten, in denen sie die abgelegten Folienkleider einsammeln und ihrem Magen beim Verdauen zuhören konnte – und schließlich der Gang über die Rundtreppe nach oben, der nach dem großen Fressen etwas Befreiendes hatte.
Es war also kein Wunder, sondern Teil einer bereits sieben Jahre währenden Tradition, dass Amanda Hollis am 1. November des Jahres 1963 die Treppe hinab in den Keller stieg, sich auf die vorletzte Stufe setzte, die Beine ausstreckte und sich daranmachte, dem ersten ihrer drei Sloppy Joes den Kopf abzubeißen. Oder den Hintern, das war so genau nicht zu sagen. Andererseits war es auch egal, denn just in dem Augenblick, in dem Sloppy Joe Nummer eins geköpft (bzw. enthintert) werden sollte, sagte jemand »Hallo« und fragte, ob sie wisse, dass Amerika in großer Gefahr sei.
»Nein«, sagte Amanda Hollis mit offenem Mund, die Zähne kurz davor, sich tief ins Brötchen und von da aus weiter in die Tomaten-Zwiebel-Rinderhack-Pampe zu graben.
Aber dazu kam es nicht. Zumindest nicht jetzt, denn Amanda Hollis zog sich den schlackernden Sloppy Joe aus dem Mund und schaute sich um, um zu sehen, wer da mit ihr sprach.
Allein, es war niemand zu sehen, nur das reifendicke Rohr, das von jeher vor der gegenüberliegenden Wand den Raum in Hüfthöhe von links nach rechts querte, und so wie es aussah, saß auch heute niemand darauf oder hockte darunter, und alles, was Amanda Hollis blieb, war, die Glaswollmatten zu betrachten, mit denen das Rohr ummantelt und die dünne Schicht Aluminiumfolie, mit der es außen versteppt war. An einer Stelle aber, an der Unterseite des Rohres, war das Geflecht durchbrochen und ein kleines Lüftungsgitter eingesetzt worden.
Zum Glück war die Stimme so freundlich, innezuhalten und keine weiteren Fragen zu stellen, und erst als Amanda Hollis aufstand und ihr Ohr auf das Rohr presste, um sicherzugehen, dass sie halluzinierte, erfuhr sie, dass Amerika von einer Horde mongolischer Würmer bedroht wurde, die ihm seine Geschichte rauben und eine neue schreiben wollten.
»Oh«, sagte Amanda Hollis und hörte, wie unter ihrem Ohr das Glaswollmatten-Aluminium-Geflecht zu knistern begann. »Ich halluziniere.«
IV
»914 Blatt Papier und 100 Britische Pfund, die werden mich wieder normal werden lassen«, beschwor sich Amanda Hollis, setzte sich an den Tisch und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Aber alles, was sie zu fassen bekam, war Sloppy Joe Nummer eins, der sich schon begnadigt gewähnt hatte und dem Amanda Hollis jetzt mit einem großen »Happ« die linke Flanke wegbiss. Dann noch die rechte – und dann war's mit ihm vorbei.
Das Kauen aber beruhigte Amanda Hollis, und bald schon hielt sie das, was unten im Keller passiert war, für eine Halluzination und das »Nein« der Stimme für eine Halluzination innerhalb dieser Halluzination.
Und selbst wenn es das nicht war, dann war es eben eine unglückliche Fügung, dann hatte sich einfach jemand nebenan in einen der Kellerräume geschlichen und in ein Rohr reingebrüllt. Was natürlich die Frage nach sich zog, wer so etwas tat und warum.
Amanda Hollis überlegte. Zugang zu den anderen Kellerräumen, das wusste sie, hatte man nur über die am anderen Ende des Flurs liegende Tür, die genauso klein und dick und hechtgrau war wie jene, durch die sie Tag für Tag zum Frühstück marschierte. Und doch gab es da einen Unterschied: Die andere Tür war verschlossen, und es gab, außer Heath Cover Evil und dem Hausmeister, niemand, der einen Schlüssel besaß.
Andererseits, selbst wenn sich jemand, auf welchen Wegen auch immer, Zugang zu den übrigen Kellerräumen der Untergrundbibliothek verschafft hatte, so stellte sich noch immer die Frage, warum er diesen Ort dazu benutzte, um in ein Rohr reinzuschreien?
Gewiss, man musste in so einem Keller auch nicht unbedingt frühstücken, aber es lag immer noch näher, den Mund zu öffnen, um ihn sich vollzustopfen, als ihn aufzureißen und unangekündigt irgendwelche Verlautbarungen über mongolische Würmer von sich zu geben. Mal ganz abgesehen von der Frage, woher derjenige, der da hinabgekrabbelt war, überhaupt wusste, dass es dort unten ein solches Rohr gab, das nicht nur bereit, sondern auch – vermittels eines offen liegenden Endes oder sonst einer Vorrichtung – technisch in der Lage war, einen derartigen Unfug in sich aufzunehmen und weiterzutransportieren, zu ihr, Amanda Hollis, die nur in Ruhe ihre drei Sloppy Joes verschlingen und sich nicht mit irgendwelchen Mongolen rumschlagen wollte, mochten die nun Amerika bedrohen oder auch nicht.
Wobei das mit der Bedrohung zweifellos ein Witz war. Oder besser gesagt: ein Witz innerhalb eines Witzes, was wiederum ziemlich nahe an der Vorstellung lag, dass es sich hier tatsächlich nur um eine Halluzination handelte, die aus irgendeinem Grund nicht bereit war, aus ihrem Kopf zu verschwinden, und deshalb erst einmal »Nein« gesagt hatte.
Aber gut, selbst wenn die ganze Sache keine Einbildung, das heißt irgendjemand tatsächlich in einen der Kellerräume auf der anderen Seite vorgedrungen und dort auf ein Rohr gestoßen war – warum um alles in der Welt sprach er dann rein? Und erzählte auch noch so einen vollkommenen Mist? Warum? Weil er sich einen Scherz machen wollte? Dann konnte es nur ein Student sein, von denen es zwei Etagen weiter oben, im Lesesaal der Untergrundbibliothek, nur so wimmelte und die sich schon zu William Croswells Zeiten einen Spaß daraus gemacht hatten, die Bibliothekare in den Wahnsinn zu treiben. Zum Beispiel indem sie ein Skelett aus dem Prähistorischen Institut mit in den Lesesaal nahmen und es während ihrer permanenten Pausen auf einen der leeren Stühle setzten, nur um es später, als der Tag vorbei und doch nichts gelernt war, an die Decke zu hängen, in der sicheren Annahme, William Croswell werde den Knochenmann auf einem seiner nächtlichen Streifzüge durch die Bibliothek schon zu Gesicht bekommen, leuchtend und funkelnd im Angesicht seiner in den Händen gehaltenen Laterne …
Und auch wenn es jetzt, einhundertneunundzwanzig Jahre später, in Harvard kein Prähistorisches Institut mehr gab, im universitätseigenen Archiv die Geschichte den Lauf der Dinge bestimmte und die Tür zum Keller auf der anderen Seite fest verschlossen war, so waren dem studentischen Unfug doch neue, um nicht zu sagen ganz andere Türen geöffnet, schließlich war Nathan Puseys Untergrundbibliothek durch eine Reihe von Tunneln direkt mit den drei angrenzenden Bibliotheken – Widener, Houghton und Lamont – verbunden, was besonders für die Erstsemester, die in der benachbarten Lamont-Library ihre Kindsköpfe hinter dicken Einführungswerken versteckten, geradezu eine Einladung sein musste, das Lesen sein zu lassen und rüber nach Pusey zu wandern, um dort ein paar »Erdmenschen« zu erschrecken.
Und selbst wenn es nicht soweit kam, weil die Tunnel zwar offen, die Keller in Pusey jedoch alle verschlossen waren, so blieb noch immer die Möglichkeit, die Idiotien direkt von Lamont aus ins Rohr reinzubrüllen, in der begründeten Hoffnung, dass irgendwer sie schon hörte.
Ja, im Grunde genommen bedurfte es nicht mal einer Bibliothek, um irgendwelche irrwitzigen Botschaften zu verbreiten und Amerikas Untergang herbeizubeschwören, schließlich waren fast alle Universitätsgebäude in Harvard durch ein drei Meilen langes und – ob der vielen Anlaufpunkte – überaus verzweigtes System aus Tunneln miteinander verbunden, durch das nicht nur Heizungsrohre, Telefonleitungen und Stromkabel liefen, sondern auch ein Nazi-Spion.
Zumindest war das die Geschichte, von der früher oder später jeder erfuhr, der in Harvard unter Tage arbeitete, und ihr Ende war auch nicht gerade ermutigend gewesen, denn nicht einmal den FBI-Agenten, die den Spion damals, anno 1939, verfolgt hatten, war es gelungen, ihn zu fassen.
Er war, im Wissen, dass man ihm auf den Fersen war, einfach in eines der universitätseigenen Häuser am Charles-River gerannt, dort in einen unterirdischen Tunnel gestiegen und nicht wieder aufgetaucht, und alle Versuche, ihn zu finden, waren erfolglos geblieben.