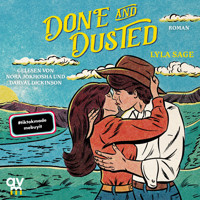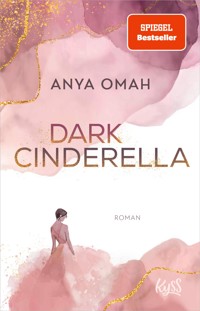Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vancouver Island Dreams
- Sprache: Deutsch
Hat ihre Liebe eine Chance, wenn ihre Gefühle füreinander eigentlich nicht sein dürften? Für Savannah war es immer der größte Traum, die Marketingfirma ihrer Eltern zu übernehmen - bis diese bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Kaum ein Jahr später wird sie entführt und ihr Leben erneut auf den Kopf gestellt. Auch wenn die Polizei sie rettet, gelingt ihrem Kidnapper die Flucht. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als für eine Weile unterzutauchen und dem attraktiven Cop Matt nach Vancouver Island zu folgen. Im malerischen Küstenort Oakajoks fühlt sie sich endlich wieder frei. Neue Freundschaften und ihre Unterstützung im "Oakajoks Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre" helfen ihr dabei, zurück zu sich selbst zu finden. Wäre da nur nicht Matt, der als neuer Cop in Oakajoks nur allzu begehrt ist und ihr Herz innerhalb kürzester Zeit höher schlagen lässt. Auch wenn er sich ebenfalls zu Savannah hingezogen fühlt, hält die Vernunft ihn zurück. Bis die Gefahr, die ihm die Frau, die er liebt zu nehmen droht, in ungeahnte Nähe rückt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
If you can dream it
You can Do it
Walt Disney
Für den, der mein Herz
schneller galoppieren lässt.
Und für alle,
die geliebt und verloren haben.
Gebt nicht auf.
Liebe Leser:innen,
da „If Today We Fall In Love” schwierige Themen
aufgreift und potenziell triggernde Inhalte enthält,
findet ihr am Ende eine Triggerwarnung. Diese enthält
Spoiler für das gesamte Buch.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!
Alles Liebe
Eure Christina
Inhaltsverzeichnis
Playlist
Prolog-SAVANNAH
Kapitel 1-MATT
Kapitel 2-MATT
Kapitel 3-SAVANNAH
Kapitel 4-MATT
Kapitel 5-SAVANNAH
Kapitel 6-SAVANNAH
Kapitel 7-SAVANNAH
Kapitel 8 -SAVANNAH
Kapitel 9-MATT
Kapitel 10-SAVANNAH
Kapitel 11-SAVANNAH
Kapitel 12-MATT
Kapitel 13-SAVANNAH
Kapitel 14-SAVANNAH
Kapitel 15-MATT
Kapitel 16-SAVANNAH
Kapitel 17-MATT
Kapitel 18-SAVANNAH
Kapitel 19-MATT
Kapitel 20-SAVANNAH
Kapitel 21-SAVANNAH
Kapitel 22-SAVANNAH
Kapitel 23-MATT
Kapitel 24-SAVANNAH
Kapitel 25-SAVANNAH
Kapitel 26-SAVANNAH
Kapitel 27-MATT
Kapitel 28-SAVANNAH
Kapitel 29-SAVANNAH
Kapitel 30-MATT
Kapitel 31-SAVANNAH
Kapitel 32-SAVANNAH
Kapitel 33-MATT
Kapitel 34-SAVANNAH
Kapitel 35-MATT
Kapitel 36-SAVANNAH
Kapitel 37-MATT
Kapitel 38-SAVANNAH
Kapitel 39-SAVANNAH
Kapitel 40-SAVANNAH
Kapitel 41-MATT
Kapitel 42-SAVANNAH
Kapitel 43-SAVANNAH
Kapitel 44-SAVANNAH
Kapitel 45-SAVANNAH
Kapitel 46-MATT
Kapitel 47-MATT
Kapitel 48-SAVANNAH
Kapitel 49-SAVANNAH
Kapitel 50-MATT
Epilog-SAVANNAH
Nachwort
Danksagung
Autorenvita
Triggerwarnung
Playlist
James Arthur – Just Us
Kelly Clarkson – Because Of you
Shawn Mendes – Fallin’ All In You
James Bay – One Life
James Blunt – You’re Beautiful
Ronan Keating, Bryan Adams – The Way You Make Me Feel
Rixton – Appreciated
Eric Clapton – Wonderful Tonight
David Nail – Whatever She’s Got
Luke Bryan – Play It Again
James Blunt – Tears and Rain
Freya Ridings – Lost Without You
James TW – You & Me
Sunrise Avenue – Nothing Is Over
Boyce Avenue, Jennel Garcia – Demons
Ryan Kinder – Stay
Marnix Emanuel – You Are Amazing
Bea and her Business – Born To Be Alive
Liv Harland – Dancing in the Sky
Joshua Hyslop – Home
Eylie – Singing Without You
Jamie Miller – No Matter What
Leona Lewis – Footprints in the Sand
Lights Follow – Live Your Beautiful Live
Christina Perri – human
Niall Horan – Science
ClockClock – Fight For Love
Prolog
SAVANNAH
Ein Buch ist wie das Leben, und doch auch wieder nicht. Ein Buch erzählt eine Geschichte, die schon festgeschrieben ist. Man könnte zu einer beliebigen Seite blättern und lesen, was dort geschrieben steht, ohne den Anfang oder das Ende zu kennen.
Im Leben kann man nicht einfach vorspulen.
Doch was, wenn man es könnte? Würde man dann den Blick für das Wesentliche, das Hier und Jetzt, verlieren, um drauf los in die Zukunft zu rennen? Würde man die Vergangenheit später bereuen? Wenn man die Vergangenheit dann überhaupt noch kennt?
Oder würde man sich vor lauter Angst vor der Zukunft verkriechen, sich zusammenrollen und keinen Schritt weitergehen? Würde man sein Hier und Jetzt verschwenden für das, was in entfernter Zukunft passiert?
Man würde gewiss viele Sachen anders machen – aber mit den schlechten würden ebenfalls die guten Dinge ausradiert werden.
Vielleicht würde man seine Zeit auch anders nutzen.
Ich wünschte, ich hätte meine besser genutzt.
Oder was heißt meine Zeit – ich lebe ja noch.
Ich meine die Zeit mit meinen Eltern.
Schweigend sitze ich in der Nische auf der Fensterbank in meinem kleinen Wohnzimmer und starre hinaus in den Regen, die Tasse in meiner Hand fühlt sich kühl an von dem erkalteten Tee.
Wie alles in mir.
Das aufgeschlagene Buch in meinem Schoß wartet nur darauf, gelesen zu werden, doch irgendwie kann ich mich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Meine Gedanken schweifen immer wieder zum letzten Buch und lassen keinen Platz für eine neue Story.
Ich liebe das Lesen. Anders als bei Filmen gibt es dem Leser den Raum, das Geschriebene im Kopf selbst auszuschmücken und sich die Personen vorzustellen.
Als Kind habe ich dicke Wälzer innerhalb von Tagen verschlungen. Als ich älter wurde, war dann anderes wichtiger – Partys, Jungs, Alkohol.
Doch seitdem meine Eltern tot sind, ist dies wieder unwichtig. Ich lasse mich lieber von meinen Bücherwelten in ihren Bann ziehen, wünsche mir manchmal sogar, ein Teil dieser magischen Welten zu sein. Eine wichtige Rolle in jemandes Leben zu sein.
Ein Happy End zu haben.
Allerdings rufe ich mir oft in Erinnerung, dass die Protagonisten meist viel mehr durchmachen müssen als ich, um zu ihrem Happy End zu gelangen. Und bin dann wieder froh, dass mein Leben nicht ganz so schlimm ist.
Seufzend beginne ich nun doch zu lesen. Früher habe ich immer zuerst das Ende gelesen, heutzutage hüte ich mich davor. Die Autoren halten oft unerwartete Wendungen für uns bereit, und auch wenn wir mit dem Ende nicht immer einverstanden sind, zerstört es die Spannung der Geschichte.
Genauso ist es mit dem Leben. Wenn wir wüssten, was passiert – wie würden wir dann handeln?
Nach einigen Seiten lege ich das Buch wieder weg. Ich bin definitiv noch nicht bereit für eine neue Story.
Na gut, dann gehe ich eben laufen.
Dass es wie aus Kübeln schüttet, stört mich nicht besonders.
Auf dem Weg ins Bad komme ich an Max’ Körbchen vorbei, in dem der Beagle genüsslich schlummert. Als ich mich vor ihn auf den Boden knie und sein dichtes Fell kraule, gähnt er herzhaft.
»Na, alter Junge? Alles klar?«
Wie zu einer Antwort legt er seinen Kopf in meine Hand und sieht mich aus großen dunklen Knopfaugen an.
Max ist bereits dreizehn und mittlerweile merkt man ihm sein Alter leider an. Früher habe ich ihn immer mitgenommen, wenn ich laufen gegangen bin, doch daran ist nicht mehr zu denken. Wenn er vor die Tür geht, dann nur um seine Notdurft zu verrichten.
Ich kraule ihn noch einen Augenblick, bevor ich in meine Sportkleidung sowie Laufschuhe schlüpfe und durch das Treppenhaus laufe, um von meiner Wohnung im zweiten Stock hinaus ins Freie zu treten.
Sobald ich einen Fuß auf das nasse Pflaster des Bürgersteigs setze, fühle ich mich augenblicklich befreiter. Ich stecke mir meine Kopfhörer in die Ohren, jogge los und lächle zufrieden in mich hinein – im Regen laufen zu gehen bedeutet auch, keinen Menschenmassen ausweichen zu müssen, die sich sonst auf den Straßen Edmontons tummeln.
Meine Füße tragen mich in Richtung eines kleinen Parks, der direkt an die Stadt grenzt und von meiner Wohnung aus in nur wenigen Minuten erreichbar ist. Dies ist meine absolute Lieblingsstrecke, gerade weil sie etwas abgelegen ist und mich den Großstadttrubel vergessen lässt.
Über den nassen Asphalt trabend freue ich mich, endlich das satte Grün der Bäume anstatt ständiger Häuserblocks um mich herum zu haben.
Plötzlich bemerke ich ein Motorengeräusch hinter mir, was seltsam ist, denn dieser Park ist für Fahrzeuge jeglicher Art gesperrt. Zum Glück habe ich mir angewöhnt, die Musik nicht allzu laut zu stellen, um meine Umgebung weiterhin wahrnehmen zu können.
Ich schaue mich um und entdecke einen schwarzen Lieferwagen. Ein mulmiges Gefühl keimt in mir auf, doch er überholt mich und der Fahrer scheint mich gar nicht weiter zu beachten.
Als ich gerade erleichtert ausatmen will, legt das Gefährt einen scharfen Stopp direkt vor mir ein und der Fahrer stellt den Bulli quer auf den Weg. Bevor ich reagieren kann, wird die Schiebetür am hinteren Teil des Fahrzeugs aufgerissen, ein Mann steigt aus und packt mich. Schreiend schlage ich um mich, doch der Griff des Hünen ist unbarmherzig, als er mich in den Lieferwagen zieht.
Kapitel 1
MATT
Ich bin erschöpft.
Erschöpft von diesem Tag und auch von den Tagen zuvor. Ich habe nicht richtig geschlafen, komme abends erst spät ins Bett und muss morgens wieder früh raus – wenn ich an solch langen Tagen überhaupt noch nach Hause fahre.
Ich steige aus dem Wagen und die kalte Nachtluft umfängt mich wie eine frostige Umarmung. Es ist erst Mitte September und doch merkt man, wie die Abende hier in Edmonton kühler werden. Schnellen Schrittes lege ich die kurze Strecke von der Auffahrt bis zum Haus meiner Eltern zurück und laufe die Veranda hinauf. Schon beim ersten Tritt auf die hölzernen Stufen bellt Duncan laut und ich vernehme seine Krallen, die über den gewienerten Dielenboden kratzen, als er zur Tür sprintet.
»Duncan!«, ruft mein Vater.
Ich öffne zunächst die Fliegengittertür und drehe dann den Türknauf der Holztür. Kaum habe ich sie einen Spalt geöffnet, springt Duncan mir in die Arme. Er ist so groß wie ein Kalb und ich versuche lachend, mein Gleichgewicht wiederzufinden, während ich den Deutschen Schäferhund kraule. Sein ganzer Körper bebt vor Freude, als meine Finger durch sein dunkles, fast schon schwarzes Fell fahren. In seinem Wurf ist er der Welpe mit dem dunkelsten Fell gewesen – und genau deswegen habe ich ihn ausgesucht. Schmunzelnd schiebe ich ihn nun sanft ein Stück zurück.
»Hi, Buddy.« Lachend lasse ich mir die Arme von ihm abschlecken, bevor ich den Blick hebe. »Hi, Dad«, begrüße ich meinen Vater, der sich gerade aus seinem ledernen Sessel stemmt. Das Wohnzimmer wird nur von einer Stehlampe dahinter in spärliches Licht getaucht.
Alles ist noch genauso wie früher.
Dads alter Sessel in der hinteren Ecke links von mir, daneben das dunkelrote Sofa. Davor ein Couchtisch aus dunklem Massivholz, ein Bücherregal an der gegenüberliegenden Wand. Der Kamin zu meiner Rechten, in dem am heutigen Abend jedoch kein Feuer brennt. Der riesige dunkle Teppich auf den Dielen.
»Hi. Anstrengenden Tag gehabt?«
Seine Augenringe heben sich deutlich von der blassen Haut ab. Ein Blick auf meine Armbanduhr bestätigt, dass es bereits ein Uhr nachts ist.
»Ja, leider.« Ich mustere meinen Vater. »Du hättest doch auch schlafen gehen können, Dad.«
»Ach was«, winkt er ab. »So sehe ich dich wenigstens mal.«
Ich nicke nur und schließe ihn in die Arme. »Kann ich Duncan in den nächsten Tagen noch einmal vorbeibringen? Im Moment ist es echt verrückt auf dem Revier.«
»Immer noch wegen des Mädchens, das entführt wurde?«
»Ja. Leider gibt es noch keine Spur.« Ich wende mich an Duncan, der aufgeregt hinter mir steht. »Dann wollen wir mal, was, mein Großer?« Ich wehre ihn sanft ab, als er an mir hochspringen will, bevor ich meinem Vater auf die Schulter klopfe und mich dann zum Gehen wende. »Danke, Dad. Gute Nacht.«
»Wünsche ich dir auch, mein Junge.«
Ich öffne die Tür zur Veranda und trete hinaus in den Garten. Das Licht des Bewegungsmelders hüllt die gepflegten Blumenbeete, die der ganze Stolz meiner Mutter sind, in dunkles Schimmern. Meine Eltern wohnen recht ländlich, somit kann Mom ihre Liebe zu einer großen Gartenanlage hier ungestört ausleben. Früher hat sie einen kleinen, heimeligen Blumenladen in der Stadt betrieben, während mein Dad eine erfolgreiche Autowerkstatt geführt hat. Seitdem beide in Rente sind, widmen sie ihre Aufmerksamkeit liebevoll ihrem Grundstück etwas außerhalb von Edmonton.
»Du solltest dir wirklich mal ein paar Tage frei nehmen und dich ausruhen, findest du nicht?«, ruft mein Dad mir hinterher, als ich zu meinem Wagen laufe.
Meine Mundwinkel heben sich zu einem Schmunzeln. Ich habe meinen Eltern noch nicht erzählt, dass ich in wenigen Wochen für ein halbes Jahr eine andere Stelle auf Vancouver Island antreten werde.
Um genau dies zu tun.
»Keine Zeit dafür, Dad!«
Duncan springt auf die Rückbank, als ich die Tür meines Trucks öffne. Dad steht auf der Veranda und hebt eine Hand zum Abschied. Ich tue es ihm gleich, bevor ich mich auf den Fahrersitz schwinge.
Die letzten Wochen auf der Arbeit sind anstrengend gewesen und ich habe deshalb keine Zeit gehabt, meine Eltern zu sehen oder Freunde zu treffen. In meinem Kopf mache ich mir eine Notiz, mir dafür in Zukunft wieder mehr Zeit zu nehmen.
Auf dem Weg nach Hause drehe ich das Radio lauter, um einem meiner Lieblingssongs auf einem Country-Sender zu lauschen – ›Whatever She’s Got‹ von David Nail.
Duncan liegt auf der Rückbank und schnarcht zufrieden vor sich hin. Lächelnd lasse ich den Blick über die Skyline schweifen, die ein Stück entfernt vor dem nächtlichen Himmel aufragt und vom hellen Vollmond angestrahlt wird. Die Lichter der Stadt ragen hoch hinauf und machen die Sicht auf den Sternenhimmel unmöglich.
Auch das ist etwas, auf das ich mich in Zukunft freue.
Den Sternenhimmel sehen zu können – auf Vancouver Island.
Abgelenkt werden meine Gedanken von den Nachrichten. Ich drehe die Lautstärke ein Stück auf, um die Nachrichtensprecherin besser zu verstehen, denn es geht – wie in den ganzen letzten Tagen schon – nur um ein Thema: die Entführung von Savannah Roberts.
»Die Polizei hat immer noch keine neuen Erkenntnisse über den Aufenthaltsort der jungen Frau«, teilt die Dame ihren Zuhörern mit.
Seufzend konzentriere ich mich wieder auf die Fahrbahn vor mir.
Es stimmt leider. Seit Tagen arbeiten wir schon an dem Fall, doch auch nach zahlreichen Hinweisen wissen wir nicht, wo sie ist oder was genau ihr zugestoßen ist.
Mitten in der Nacht schrecke ich hoch.
Zunächst weiß ich nicht, wo ich bin oder wer mich geweckt hat, doch dann werden nach und nach die Umrisse meines Schlafzimmers sichtbar und ich bemerke Duncan am Fußende meines Bettes, der sich genüsslich streckt und gähnt.
Ich fahre mir mit einer Hand übers Gesicht und schaue dann auf mein Handy, welches der Grund für mein Aufwachen ist. Seitdem Savannah Roberts verschwunden ist, stehen wir vom ERT-Team, das in Extremsituationen eingreift, quasi jederzeit auf Abruf bereit.
Auf dem Display erscheint der Name meines Teamleiters.
»Ja, David?«, nehme ich den Anruf entgegen und fahre mir mit der anderen Hand erneut übers Gesicht, um mich zum Aufwachen zu zwingen.
»Matt. Wir wissen, wo sie ist. Wir brauchen alle Einheiten vor Ort.«
»Verstanden.«
Das bedeutet im Klartext: Schwing deinen Hintern zur Dienststelle – und zwar sofort.
Nach diesen Worten legt David auf. Er klang gestresst. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel – oder besser wenig – Schlaf wir alle in den vergangenen Tagen gehabt haben.
Mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass es gerade einmal vier Uhr nachts ist. Ich habe also weniger als drei Stunden geschlafen.
Seufzend schwinge ich meine Beine über die Bettkante und stehe auf, sehr zum Missfallen von Duncan, der unmissverständlich grunzt.
»Ich weiß, Dicker. Ich muss schon wieder los.« Ich tätschele ihm den Kopf. »Wenn es zu lange dauert, rufe ich Dad an, dann holt er dich. Alles klar?«
Ein erneutes Grunzen folgt, doch wahrscheinlich eher aus Reflex, als dass er mich wirklich verstanden hat.
Lächelnd gehe ich ins Bad.
Als ich keine halbe Stunde später auf der Dienststelle ankomme, sind noch nicht alle Einsatzkräfte eingetroffen. Es wurden mehrere ERT-Teams, also Spezialeinheiten, auf die Entführung angesetzt, doch auch andere Kommissare tummeln sich unter den Leuten im Besprechungsraum.
Ich gehe zu Peter hinüber, einem Kollegen, mit dem ich die Ausbildung für die Spezialeinheit gemeinsam absolviert habe und mit dem ich im selben Team bin.
»Weißt du schon irgendetwas?«
Peter schüttelt den Kopf. »Nein, Hutch und David haben sich noch nicht blicken lassen.«
Lucas Hutch ist unser Einsatzkommandant und autorisiert David sowie die anderen Teamleiter.
Just in dem Moment, als hätte er gehört, dass wir über ihn gesprochen haben, fliegt die Tür zum Nebenraum auf und Hutch kommt, gefolgt von David und weiteren Teamleitern, in den Besprechungsraum gerauscht.
»Okay, Leute.« Hutch lässt seinen Blick über unsere Köpfe schweifen und schnaubt missmutig. Seine Lippen verziehen sich zu einer schmalen Linie und seine Augen erinnern an die eines Greifvogels.
Hutch ist ein guter Einsatzleiter. Er ist fair, präzise und kennt alle Stärken und Schwächen seiner Leute, was im Gefecht Gold wert ist. Doch dieser Blick jagt selbst mir einen Schauer über den Rücken. Er gilt jedoch nicht uns, sondern den Umständen.
Es ist für alle eine enorme Stresssituation und jeder will nichts weiter, als diesen Fall endlich aufzuklären.
»Wir warten noch einen Moment.«
Offenbar fehlen einige Leute. Ich schaue mich um und kann weder Ash noch Tom oder Leon entdecken, die ebenfalls Teil unseres Teams sind.
Innerhalb der nächsten fünf Minuten jedoch sind fast alle eingetroffen, sodass Hutch erneut die Stimme erhebt.
»Okay, Leute«, wiederholt er seine Worte von vorhin. »Wir glauben zu wissen, wer Savannah entführt hat und wo sie und ihr Entführer sich aufhalten, dank eines Hinweises zu dem gestohlenen Fahrzeug.« Hutch legt eine Pause ein und schaut in die Runde.
Das gestohlene Fahrzeug, ein schwarzer Bulli, ist seit der Entführung unsere heißeste Spur. Jetzt einen Hinweis dazu zu bekommen, könnte ein echter Gamechanger sein.
Dann wendet unser Einsatzleiter sich dem Bildschirm hinter ihm zu, der fast die gesamte Wand einnimmt. Er zeigt ein großes Waldstück, das ein wenig entfernt von Edmonton liegt. Ein Fleck in Form einer Stecknadel erscheint darauf, wie es aussieht auf einem Feldweg, der in einen kleineren Ort führt.
»Hier wurde der Wagen gestern am späten Abend gesehen«, eine zweite Stecknadel ploppt mitten im Wald auf, »und hier befindet sich ein Campingplatz.« Hutch wendet sich wieder an uns. »Wir haben mittlerweile durch mehrere Anhaltspunkte und Überprüfung seiner letzten Aufenthaltsorte die Vermutung, dass es sich bei dem Entführer um Steve Boucher handelt. Er ist, wenn man so will, ein entferntes Familienmitglied von Savannah Roberts. Als ihre Großmutter Martha Roberts starb, heiratete ihr Großvater, Henry Roberts, erneut, und seine zweite Frau, Jane Boucher, hatte eine Tochter. Diese starb leider sehr früh an Krebs und hinterließ einen Sohn, der allerdings auf die schiefe Bahn geriet und gerade im Zusammenhang mit Drogen sehr auffällig war. Jane und ihr Enkel hatten laut unseren Kenntnissen auch Ewigkeiten vor ihrem Ableben kaum Kontakt. Bleibt also die Frage, wieso er die Enkelin vom Mann seiner Großmutter entführt hat. Es liegt nahe, dass er es auf das Erbe abgesehen hat.«
Ich seufze auf. Als uns die Entführung von Savannah Roberts bekannt gegeben wurde, haben wir alle ein Briefing zu dem Fall erhalten. Von einem Passanten, der vor wenigen Tagen in einem Park am Stadtrand spazieren gewesen ist, haben wir erfahren, dass er mit ansehen musste, wie eine blonde junge Frau in einen schwarzen Lieferwagen gezerrt wurde. Er hat sofort die Polizei verständigt, doch natürlich war der Lieferwagen schon weg. Auch wenn er uns kein Kennzeichen nennen konnte, hat er uns den Wagen beschrieben – und diese Beschreibung passte perfekt zu der eines kürzlich gestohlenen Fahrzeugs, weshalb dies unser wichtigster Anhaltspunkt ist.
Als dann am selben Abend auch noch ein Freund von Savannah Roberts diese als vermisst gemeldet hat, haben wir eins und eins zusammengezählt. Dieser hatte sich mit Savannah treffen wollen, konnte sie dann allerdings nicht mehr erreichen und hat ihre Wohnung aufgebrochen und verwüstet vorgefunden.
Sowohl die Eltern der Vierundzwanzigjährigen, William und Emilia Roberts, als auch der Großvater und dessen Frau sind im letzten Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Die Familie besitzt eine der größten Marketingfirmen des Landes, ›Marketing and Communication Roberts & Sons‹, die von Savannahs Urgroßvater gegründet wurde und seit mehreren Generationen von der Familie geführt wird. Noch immer sind nicht alle Einzelheiten darüber bekannt, wieso das Privatflugzeug der Roberts abgestürzt ist, doch man geht davon aus, dass es sich um ein Attentat gehandelt hat – auch wenn das bislang nicht bewiesen werden konnte. Da die Roberts eine sehr wohlhabende Familie sind, wäre Geld definitiv ein mögliches Motiv für die damalige Tat.
Und um Geld scheint es jetzt auch zu gehen.
»Das allerdings ist eine Frage für morgen«, nimmt Hutch den roten Faden wieder auf. »Jetzt heißt es erst einmal, Savannah Roberts in einem Stück nach Hause zu holen.«
Einstimmiges Gemurmel erfüllt den Raum.
Hutchs Blick ist eiskalt. Gnade Gott dem Arschloch, der das Mädchen entführt hat, sollte er ihn in die Finger bekommen.
Dann stellt unser Einsatzleiter seinen Strategieplan vor und geht mit uns alle Eventualitäten durch, sollte Boucher sich tatsächlich mit Savannah auf dem Campingplatz befinden.
Eine knappe halbe Stunde später stehen wir alle mit unseren Waffen, den ›300 Blackouts‹, und in Spezialausrüstung bereit und warten auf unseren Teamleiter David, der die Operation auf dem Feld leiten wird. Ich nehme auf dem Fahrersitz des GMC-Suburbans platz, unserem Spezialfahrzeug, während David sich neben mir niederlässt. Die anderen steigen hinten in den Sub ein.
Auf der Fahrt ist es ruhig, alle hängen ihren Gedanken nach. So sehr wir diesen Nervenkitzel kurz vor den Einsätzen mögen – es steckt immer auch ein Funken Nervosität dahinter.
Denn obwohl das Vorgehen von A bis Z durchgeplant ist, weiß man nie, wie die andere Seite reagieren oder wie die Situation sich entwickeln wird.
Kapitel 2
MATT
Als wir auf dem Campingplatz ankommen, ist es noch immer dunkel. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages lassen sich hier draußen im Wald nur erahnen, da die Bäume ihr Licht verschlucken.
Nur ein einziger Camper steht auf der kleinen Lichtung, ein altes, abgeranztes Ding, das definitiv schon bessere Tage gesehen hat. Von dem gestohlenen Fahrzeug fehlt jedoch jede Spur.
»Die anderen sind fünf Minuten hinter uns«, gibt Peter zu verstehen.
»Wir gehen schon rein.« David weist uns an auszusteigen und den Camper zu umkreisen. Wir strömen auseinander und ich schleiche, dicht gefolgt von Ash und Tom, um die rechte Seite des Campers herum. David führt die Truppe auf der anderen Seite an.
»In Position«, gibt David durch. Wir alle sind mit einem Funkgerät miteinander verbunden, um uns jederzeit absprechen zu können.
Außerdem nimmt jeder eine besondere Rolle bei solchen Einsätzen ein – David ist der Teamleiter, ich bin Zweiter, falls er ausfallen sollte. Ash ist der Breacher, der für uns verschlossene Türen aufbricht. Leon ist unser Medic, Peter und Tom die Sniper.
Ich will mich gerade vor der Tür positionieren, um sie auf ihre Verschlossenheit zu überprüfen und Ash im Notfall das Signal zu geben, uns Zugang zum Inneren zu verschaffen, da bedeutet David uns durch ein Funksignal zu halten. Ich schaue vorsichtig an der Schnauze des Campers vorbei und mir stockt kurz der Atem.
Vielleicht fünfzig Meter vor dem Wagen stehen zwei Personen, sie werden fast von der Dunkelheit unter dem dichten Blätterdach verschluckt.
Steve hat uns also erwartet. Woher hat er nur gewusst, dass wir kommen?
Erst jetzt bemerke ich: Die beiden Personen stehen nicht einfach nur nebeneinander, sondern dieser Mistkerl hat das Mädchen am Arm gepackt – und hält ihr eine verdammte Pistole an die Schläfe.
Wir alle stocken mitten in der Bewegung und versuchen, die Lage einzuschätzen. Wir sind zu sechst, drei auf jeder Seite des Campers, er ist allein. Allerdings hat dieser Mistkerl seine Pistole auf die junge Frau gerichtet und offensichtlich Hintermänner, die ihm mitgeteilt haben, dass wir kommen. Weit können also auch die nicht sein.
Verstärkung für uns ist unterwegs, doch wir wissen nicht genau, wie lange sie brauchen werden. Und unser Überraschungsmoment haben wir eindeutig verspielt.
Wir laufen langsam weiter auf die beiden zu, unsere Blackouts im Anschlag und auf Boucher gerichtet, die Umgebung ebenfalls beobachtend. Obwohl ich an Extremsituation gewöhnt bin, beschleunigt sich mein Atem.
Jetzt dürfen wir nur keine Fehler machen oder das Mädchen ist tot.
»Stehen bleiben!« Steve weicht unbeholfen einen Schritt zurück, das Mädchen mit sich ziehend. Er ist Mitte dreißig, also nur ein paar Jahre älter als ich selbst, doch er erscheint viel älter. Man sieht dem Mann mit schütterem, dunklem, strähnigem Haar den jahrelangen Drogenkonsum definitiv an. Er wirkt fast schon knochig und die abgetragenen Klamotten schlabbern nur so um seine hagere Statur. Bouchers Gesicht ist kantig und hat kaum Farbe, seine Augen sind eingefallen – ein weiterer Hinweis auf den Drogenmissbrauch.
David bedeutet uns innezuhalten, nicht aber die Waffen zu senken.
Wir stoppen an der Schnauze des Campers, Steve atmet schwer. Der jungen Frau stehen Angst und Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
»Zulu-7 – Ich versuche T1 von der Flanke aus zu eliminieren«, vernehme ich Toms Stimme an meinem Ohr.
»Verstanden, rück aus«, erwidert David leise.
Tom, der hinter Ash gelaufen ist und damit nicht in Bouchers Sichtfeld war, zieht sich zurück und versucht sich seitlich von Steve zu positionieren, um nach Möglichkeit einen Kontaktschuss zu platzieren und das Ziel – Boucher, Target-1 – zu eliminieren, während wir ihn ablenken.
»Was wollen Sie, Steve?«, fängt David ein Gespräch mit dem Entführer an, um Zeit zu gewinnen, bis Tom sich positioniert hat und das andere Team eintrifft.
»Was ich will?«, ruft Steve aus. »Was ich WILL?« Er spuckt uns die Worte entgegen, schließt für einen Moment die Augen und fletscht dann die Zähne wie es ein bissiger Hund. »Ich will Gerechtigkeit.«
Ich schnaube kaum merklich. Das sagt gerade er.
»Gerechtigkeit wofür?«, hakt David nach und schleicht sich langsam weiter zu den beiden hinüber.
»Gerechtigkeit dafür, dass meine eigene Grandma mir keinen einzigen Cent hinterlassen hat! Diese kleine Göre hier hat alles bekommen!« Steve ist außer sich und sein Gesicht tiefrot angelaufen.
David hält inne und schätzt die Lage neu ein. »Aber denken Sie, dass Sie so Gerechtigkeit bekommen? Wenn Sie sie jetzt töten, bekommen Sie das Geld auch nicht. Ist es das, was Sie sich erhoffen?«
»Diese kleine Schlampe hier soll mir einfach geben, was mir gehört, dann lasse ich sie gehen.« Er zieht Savannah noch näher an sich heran und schreit ihr ins Ohr. »Vorher nicht, hast du mich verstanden? Ich werde nicht zulassen, dass ausgerechnet du kleines Miststück mir mein Leben zerstörst!«
Savannah zuckt zusammen und ein leiser Schluchzer entfährt ihr. Sie schließt die Augen und bemüht sich, ihr Zittern unter Kontrolle zu bringen.
Mir gelingt es nicht, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen, da sie zu sehr auf ihre Angst konzentriert ist. Wahrscheinlich kann sie meine Augen durch die Dunkelheit und meinen Schutzhelm sowie die Schutzbrille sowieso nicht ausmachen.
»Zulu-7 – Ich habe Sicht auf T1, aber keine klare Schusslinie.«
David holt tief Luft. Er möchte gerade zum Weitersprechen ansetzen, da kommt ein Auto näher.
Leider hören nicht nur wir es, auch Boucher sieht von Savannah auf und blickt hinter uns.
»Scheiße, da kommen noch mehr von euch?« Er wirkt gehetzt.
Wir schieben uns wieder näher an die beiden heran.
»Steve, bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind nur hier, um Ihnen aus dieser Situation zu helfen. Geben Sie uns zuerst Savannah, dann reden wir weiter. Nehmen Sie Ihre Waffe runter und kooperieren Sie.«
Boucher wirft den Kopf in den Nacken und stößt so etwas wie ein Heulen aus. »Und Sie denken, ich glaube Ihnen? Dass nach all dem, was ich getan habe, wieder alles gut wird? Verarschen kann ich mich allein, Mann!«
»Dann machen Sie es nicht noch schlimmer, als es schon ist! Geben Sie uns Savannah und ergeben Sie sich, Steve. Wenn Sie jetzt kooperieren, wird sich das gut für Sie auswirken.« David geht weiter auf die beiden zu.
»Bleiben Sie stehen, verdammt!« Bevor unser Teamleiter reagieren kann, zielt Boucher mit seiner Waffe auf ihn und feuert drauf los.
Es geht alles viel zu schnell.
Boucher trifft David am Oberschenkel, sodass dieser einknickt und aufschreit. Boucher schießt unkontrolliert weiter und zwingt uns, in Deckung zu gehen.
Ich ziele auf ihn, doch er benutzt Savannah als Schutzschild, sodass ich keine klare Sicht auf ihn habe. Ich fluche.
»Zulu-7 – kein Kontaktschuss auf T1 möglich, bleibe dran.« Toms Stimme klingt gepresst.
»Bist du okay, David?«, rufe ich unserem Teamleiter zu.
»Ist nur ein Streifschuss. Seht zu, dass ihr sie lebend da raus holt!«, schreit er schmerzerfüllt zurück. Eindeutig ein Befehl.
Während Leon zu David eilt, luge ich hinter einem Baum hervor und sehe, wie Boucher Savannah mit sich zieht bei dem Versuch, rückwärts weiter in den Wald zu laufen. Schreiend schlägt sie mit den Armen und Beinen, doch sein Griff ist fest. Viel fester, als man es ihm durch seine schmale Statur zugetraut hätte.
Ein paar Warnschüsse abfeuernd wage mich weiter vorwärts, allerdings schießt Boucher immer noch wie wild um sich.
Ich bete, dass das andere Team sich beeilt, denn diese Sache gerät langsam außer Kontrolle. Solange Boucher Savannah als lebenden Schutzschild benutzt, können wir nicht viel ausrichten.
Savannah tritt ihrem Entführer gegen das Schienbein, sodass dieser flucht und fast zu Boden geht.
»Du Miststück!«
Diesen Moment nutze ich, um näher an die beiden heranzukommen und hoffentlich einen Schuss auf ihn abfeuern zu können, ohne zu riskieren, Savannah dabei zu verletzen.
Boucher sieht mich jedoch und feuert mehrere Schüsse in meine Richtung. Zurückfeuernd suche ich Schutz hinter den Bäumen.
In dem Moment scheint Steve zu erkennen, dass er so keine Chance auf ein Entkommen hat. Schnell und zielstrebig zerrt er Savannah weiter in den dichteren, düsteren Wald, wo er hügeliger wird. Da er durchgehend Schüsse abfeuert, habe ich Mühe mitzuhalten.
Plötzlich durchschneiden weitere Schüsse die Luft und an ein Vorankommen ist nicht mehr zu denken. Ich kann nicht ausmachen, wie viele Personen nun zusätzlich auf uns schießen, doch sie schießen erbarmungslos. Kugeln fliegen um uns herum durch die Luft, prallen von Bäumen ab und zwingen uns in Deckung zu gehen. Scheinbar hat Steves Hintermann Verstärkung organisiert.
»Da sind noch mehr!« Peters Stimme dringt an mein Ohr und ich nicke nur, darauf bedacht, weiterhin Schutz zu suchen. »Seine Badgers müssen uns kommen sehen haben, das erklärt einiges. Aber warum greifen sie jetzt erst ein?«
»Keine Ahnung.«
Seine Badgers, Bouchers Hintermänner, sind uns an Waffenstärke deutlich überlegen.
»Zulu-8 an Zentrale – wir könnten wirklich Augen in der Luft gebrauchen, stehen unter starkem Beschuss!«, ruft Ash direkt hinter mir in sein Headset.
»Verstanden. Ich sehe, was ich tun kann.« Hutch klingt wie immer völlig ruhig – eine weitere seiner Stärken.
Ich luge um den Stamm des Baums herum, hinter dem ich sitze.
»Gib mir Deckung!«, rufe ich Peter zu, der nickt und das Feuer eröffnet, während ich zum nächsten Baumstamm hechte. Wir tasten uns weiter vor, kommen allerdings nur langsam voran.
»X-Ray!« Peter deutet auf seine Blackout.
Das ist das Codewort dafür, dass seine Munition leer ist – wir nutzen es, damit der Angreifer nichts mitbekommt. Während ich ihm Deckung gebe, wechselt er sein Magazin, bevor wir uns langsam weiter vorarbeiten.
Auf einem steilen Hügel löst Savannah sich plötzlich von dem fluchenden Steve. Es sieht aus, als hätte sie einen Tritt in seine Weichteile platzieren können, woraufhin sein klammernder Griff sich genügend gelockert hat, damit sie sich rauswinden konnte. Sie stolpert los in unsere Richtung, doch Boucher schießt mit schmerzerfülltem Gesicht drauf los, zielt sogar auf sie. Da Savannah weiter auf uns zu rennt, habe ich die Hoffnung, dass er sie verfehlt hat.
»Scheiße!«, sage ich mehr zu mir selbst und versuche, ihr entgegenzulaufen, aber Boucher und seine Badgers schießen wie wild um sich, während er sich weiter von uns wegbewegt. Allerdings können wir nun ohne Bedenken unser Feuer auf ihn eröffnen und versuchen, unser Ziel zu erwischen, doch er ist trotz Savannahs Tritt zu flink und schon zu weit weg im Feuerschutz seiner Männer.
Als die Schüsse endlich verstummen und Boucher hinter etlichen Bäumen verschwunden ist, stürzen Peter und ich auf Savannah zu.
»Wurdest du getroffen?« Wir ziehen sie hinter einen dicken Baumstamm.
»Ich glaube nicht.« Ihre Stimme zittert.
»Check sie durch«, sage ich zu Peter, während ich um den Stamm herum luge und prüfe, ob jemand uns anzugreifen versucht. Per Funk bekomme ich mit, wie Ash und Tom die Verfolgung aufnehmen.
Peter tastet unterdessen Savannahs Körper nach Blut ab.
»Matt.«
Ich schaue zu ihm und stöhne auf – an seiner Hand klebt Blut. Auch Savannah sieht es und ihr steht Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Hoffentlich bekommt sie jetzt keinen Schock.
Es ist völlig normal, dass Angeschossene den Schmerz durch das ausgeschüttete Adrenalin nicht direkt bemerken und somit nicht wissen, dass sie angeschossen wurden. Außerdem konzentriert sich der Körper in solchen Situationen erst einmal darauf, lebenswichtige Organe mit Blut zu versorgen, also kann es passieren, dass zunächst keine Blutung auftritt. Doch als Savannah sich jetzt auf dem Waldboden niederlässt, quillt das Blut aus einer Stelle an ihrem linken Oberarm hervor.
»Wo noch?«
»Oberschenkel«, gibt Peter knapp zurück.
Ich ziehe mein Med-Pack, ein kleines Erste-Hilfe-Set, von meinem Gürtel und eine Spezialschere hervor, mit der ich ihre Hose aufschneide.
»Streifschuss.«
Peter drückt eine Kompresse auf Savannahs rechten Oberschenkel.
»Scheiße«, entfährt es mir, als ich das Oberteil durchtrennt habe. »Durchschuss.«
Die Wunde an ihrem linken Oberarm sieht bei weitem schlimmer aus, dunkelrotes Blut sickert aus ihr heraus. Ich presse je eine Kompresse auf die Eintritts- und Austrittswunde, doch die Blutung ist nicht zu stoppen.
Unterbewusst bekomme ich mit, wie Peter unsere genaue Position per Funk durchgibt und Hilfe anfordert. Zum Glück hat Boucher sie nicht in den Bauchraum oder nahe am Herz getroffen.
»Der Notarzt ist auf dem Weg. Sie können aber keinen Hubschrauber schicken, dauert zu lang und er kann hier sowieso nicht landen.«
»Alles klar.« Ich sehe in Peters ernstes Gesicht. »Wir müssen ein Tourniquet anlegen.«
Er signalisiert mir durch ein knappes Nicken, dass er verstanden hat.
Gerade als ich das Tourniquet aus meinem Med-Pack nehmen will, bemerke ich Bewegung um uns herum. Das zweite Team ist eingetroffen. Tannennadeln stoben auf, als sie schlitternd zum Stehen kommen.
»Ist einer bei David?«
»Ja.« Gus nickt keuchend. »Leon ist noch bei ihm.«
»Okay. Gus, hilf mir mit ihr!« Ich schaue Peter an. »Geh mit den anderen.«
Peter und das zweite Team sprinten in den Wald in die Richtung, in die Boucher verschwunden ist, um Tom und Ash zu unterstützen, die dem Ziel bereits auf den Fersen sind.
Gus kniet sich neben mich und besieht sich Savannah. Da unser Medic bei David ist, muss er als Medic vom anderen Team einspringen. Das viele Blut bemerkend, sieht er mich mit einer Miene an, die ich nicht zu deuten vermag.
»Nimm die mal weg.« Er deutet auf die Kompressen, die ich auf die Wunden gepresst halte. Das Blut quillt nur so aus ihrer Schusswunde am Oberarm. »Durchschuss. Wir müssen ein Tourniquet anlegen.«
»Hab es schon hier.« Ich reiche Gus mein Tourniquet – ein Abbindesystem, mit der die starke und lebensgefährliche Blutung gestoppt werden soll – und sehe dann Savannah an, die mittlerweile am ganzen Körper zittert.
»Savannah, Süße, wir müssen ein Tourniquet an deinem Arm anlegen, um die Blutung zu stoppen.«
Ihre Augenlider flattern, als sie meinen Blick sucht. Angst steht in ihren glänzenden, bräunlich schimmernden Augen, was in dieser Situation überhaupt kein Wunder ist. Und doch sind diese Augen die schönsten, in die ich je gesehen habe.
»Das wird wehtun, aber wenn wir es nicht machen, wirst du verbluten.«
Ein Wimmern entfährt ihr und sie ist schrecklich blass im Gesicht.
»Ich bin hier, nimm einfach meine Hand. Okay?« Als ich die ihre ergreife, fühlt sie sich eiskalt an.
Gus streift ihr das Tourniquet über.
»Bereit?«, fragt er Savannah.
Diese nickt schwach und ihr Atem beschleunigt sich merklich.
Unter ihren unversehrten Arm greifend stütze ich sie, während Gus den Knebel vom Tourniquet dreht und somit das Band durch Rotation verkürzt. Als der Druck sich erhöht, entfährt Savannah ein kehliger Schrei, der durch Mark und Bein geht.
»Ich weiß, das tut weh, aber du musst durchhalten, alles klar?«, versuche ich sie zu beruhigen, doch Savannah sackt unter mir zusammen.
»Scheiße.« Damit sie nicht umkippt und Gus weiter arbeiten kann, halte ich sie fest. »Savannah! Hey, kannst du mich hören?«
Keine Reaktion, sie sitzt einfach gegen meine Brust gelehnt da.
»Zulu-4 an Zentrale – Das Opfer hat das Bewusstsein verloren, haben ein Tourniquet angelegt. Ist der Krankenwagen unterwegs?«, gebe ich Hutch per Funk durch.
»Verstanden. Krankenwagen ist unterwegs, zehn Minuten.«
»Fertig.« Gus fixiert den Knebel und zückt einen Filzstift, um die Zeit, zu der die Aderpresse angelegt wurde, auf die vorgesehene Stelle am Tourniquet und auf Savannahs Stirn zu schreiben. Es darf nur bis zu zwei Stunden angelegt sein, danach läuft das Opfer Gefahr, durch den Blutstau seine Gliedmaßen zu verlieren.
Wir legen Savannah hin, um ihren Kreislauf zu entlasten. Blonde, mit Tannennadeln übersäte Haarsträhnen kleben auf ihrer Haut. Ich streiche sie aus ihrem dreckigen Gesicht.
Die Minuten, bevor der Krankenwagen eintrifft, scheinen nur schleichend zu vergehen. Gus und ich haben Savannah in die stabile Seitenlage gebracht und in dieser Position in eine Rettungsdecke gewickelt. Ich halte meine Hand gegen die Wunde an ihrem Oberschenkel gedrückt.
»Scheiße, das dauert alles zu lange.« Gus blickt auf seine Uhr und schließlich zu den SUVs, die in circa 800 Metern Entfernung am Wegesrand stehen. »Wir müssen sie zum Sub bringen und dem Krankenwagen entgegenfahren, das mit den zehn Minuten haut nicht hin. Wer weiß, wie lange sie über den Waldweg noch brauchen, und sie schaffen es hier sowieso nicht ganz her.«
Zweifel keimen in mir auf. »Wird sie das schaffen?«
»Sie muss.« Sein Blick ist fest.
Schnaubend stimme ich zu.
»Du hebst sie hoch, ich halte ihr Bein, damit die Blutung nicht wieder stärker wird. Alles klar?«
»Okay.« Ich beuge mich näher zu Savannah, doch sie ist immer noch bewusstlos.
Meine Güte, sie ist so zierlich, so verletzlich. Ein Kloß sitzt in meinem Hals, als ich die junge Frau langsam an mich ziehe. Gus hilft mir, sie richtig in meine Arme zu betten, bevor ich mich aufrichte. Sie ist so federleicht – ein weiteres Indiz dafür, was sie im letzten Jahr und in den letzten Tagen durchmachen musste. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Jetzt muss sie erst einmal überleben.
Wir gehen schnellen Schrittes auf die Subs zu und kommen dabei an David und Leon vorbei.
»Ist sie am Leben?« Davids Miene ist schmerzerfüllt.
»Ja, aber sie ist bewusstlos. Geht es dir gut?«, antwortet Gus im Gehen.
»Ja, macht euch um mich keine Sorgen.«
Weiter auf einen der Subs zu eilend, bemühe ich mich, die Hecktür zu öffnen. Mit Savannah in den Armen klettere ich in den Wagen und setze mich auf eine der Bänke, während Gus ihre Beine auf dem Leder ablegt. Ihren Kopf auf meinen Schoß bettend, bringe sie in eine halb liegende Position und streife mir Helm sowie Schutzbrille ab.
Währenddessen steigt Gus vorn ein und wendet den Wagen, um mit Vollgas die Straße, die in die Stadt führt, zurückzufahren.
Nur wenige Minuten später kommt uns der Krankenwagen entgegen. Gus schaltet unsere Sirene an und stellt den Wagen in einer rasanten Bewegung quer, sodass der Krankenwagen nicht weiterfahren kann. Dann steigt er aus und eilt den Rettungskräften entgegen, die ebenfalls ihr Fahrzeug verlassen haben und im Laufschritt auf unseren Wagen zu kommen.
»Jetzt wird alles gut«, murmele ich Savannah ins Ohr und drücke sanft ihre Hand. Kalter Schweiß ist auf ihrer Stirn ausgebrochen und sie ist schneeweiß im Gesicht.
Scheiße.
Die Wagentür wird geöffnet und ein Sanitäter streckt seinen Kopf herein. Er hat eine Glatze und ist etwa um die vierzig. »Ist sie mittlerweile bei Bewusstsein?«
»Nein.«
Er gibt seinem Kollegen Bescheid, der wesentlich jünger zu sein scheint.
»Ihr Kollege hat uns schon knapp erzählt, was passiert ist. Wir müssen sie auf die Trage bekommen.«
Zusammen beginnen der Sanitäter und Gus Savannah sanft aus dem Wagen zu heben, während ich weiter ihren Kopf stütze und sie erst loslasse, als sie sicher auf der Trage liegt. Der andere Sanitäter legt ihr sofort einen Zugang, bevor sie sie eilig in den Krankenwagen schaffen.
»Fährt einer von Ihnen mit?« Der glatzköpfige Sanitäter sieht uns fragend an, während sein Kollege sich um Savannah kümmert.
Ich schaue zu Gus. »Fahr du mit, vielleicht kannst du helfen.«
»Sicher?«
Als ich nicke, springt Gus in den Wagen, bevor der Sanitäter die Türen schließt, sich hinter das Steuer setzt und eilig davonfährt. Die Sirenen durchbrechen auch nach mehreren Kilometern noch die Stille um mich herum.
Tief durchatmend fahre mir mit der Hand durchs Haar.
Hoffentlich schafft sie es.
Erst jetzt bemerke ich das Blut an meinen Händen und putze sie notdürftig an meiner Hose ab, bevor ich den Sub zurück zum Einsatzort fahre und zu David jogge.
An einen Baumstamm gelehnt sitzt er da, Leon presst eine Mullbinde auf seine Wunde.
»Ist sie im Krankenwagen?«
»Ja. Deiner müsste jeden Moment hier sein. Sind die anderen schon zurück?«
»Nein.«
»Soll ich noch eine Einheit anfordern?«
»Ist schon auf dem Weg, mit Hunden und allem drum und dran.« David deutet ein Lächeln an. »Weit kommt das Arschloch nicht.«
Hoffentlich.
Ich setzte Helm sowie Schutzbrille wieder auf und greife nach meiner Blackout, die ich auf meinen Rücken geschnallt habe.
Dann folge ich den anderen in den Wald.
Kapitel 3
SAVANNAH
Von Geflüster geweckt öffne ich sachte die Augen. Mein ganzer Körper schmerzt und mir entfährt ein leises Stöhnen.
Ich weiß nicht direkt, wo ich bin und warum mir alles weh tut – besonders mein Oberarm.
Als ich nach links schaue, finde ich einen dicken Verband um ihn vor, außerdem ist er in einer Schlinge fixiert vor meinen Körper gebunden. Neben mir piept ein Monitor leise vor sich hin.
Ich bin im Krankenhaus.
Erinnerungen an das Geschehene drängen sich an die Oberfläche. Steve, er hat mich …
Tränen steigen mir in die Augen. Wieso hat er das getan?
»Schwester, sie ist wach.«
Mein Blick folgt der Stimme und fällt auf zwei Männer, die vor der geöffneten Tür stehen und zu mir herübersehen. Wenig später kommt eine Krankenschwester auf mich zu.
»Hallo Savannah. Wie geht es Ihnen?« Ihre Stimme ist freundlich und sie greift nach meiner Hand.
»Ich weiß nicht … Ich habe Schmerzen«, stammele ich und winde mich etwas, was den Schmerz leider nur verstärkt.
»Kann ich mir vorstellen, Sie haben ganz schön was mitgemacht. Ich hole den Arzt.« Lächelnd eilt sie davon.
Mein Blick gleitet zurück zu den Männern vor der Tür. Einer der beiden trägt eine Polizeiuniform, der andere geht auf Krücken. Was tun sie hier? Und wozu die Polizei?
Wenige Augenblicke später tritt eine junge Ärztin durch die Tür und schließt sie hinter sich.
»Hallo Savannah. Wie geht es Ihnen?«, wiederholt sie die Frage, die die Krankenschwester mir ebenfalls gestellt hat. Es scheint hier eine Art Standardfrage zu sein.
»Ich habe Schmerzen im Arm«, gebe ich auch ihr zu verstehen und schaue wieder zu den Männern hinüber.
»Kann ich mir denken. Wissen Sie noch, was passiert ist?« Sie bleibt neben meinem Bett stehen und versperrt mir die Sicht auf die beiden.
»Ich wurde angeschossen, oder?« Es klingt zögernd, obwohl ich mir ziemlich sicher bin. Ich kneife die Augen zusammen und reibe mir mit meiner unversehrten Hand über meine Stirn, die sich unweigerlich in Falten legt.
»Ja. Wir mussten Sie operieren. Aber Sie hatten wahnsinniges Glück, dass die beiden Polizisten so schnell gehandelt haben. Ich weiß nicht wie, aber Sie müssen einen wirklichen Schutzengel gehabt haben.« Sie lächelt.
Vier.
Vier Schutzengel.
Erneut steigen mir Tränen in die Augen.
»Sehen Sie einmal her.«
Sie leuchtet mir mit einer Lampe in die Augen und ich folge dem grellen Licht, womit die Ärztin zufrieden scheint.
»In ein paar Monaten werden Sie wieder auf den Beinen sein. Die OP ist gut verlaufen«, meint sie und richtet sich auf.
»Monate?«, stoße ich krächzend hervor.
»Na ja, Sie haben eine sehr schwere Verletzung erlitten. Ihr Muskel wurde geschädigt und Sie müssen, sobald die Wunden an Arm und Bein verheilt sind, langsam mit der Physiotherapie anfangen. Das geht leider nicht von heute auf morgen.« Entschuldigend zuckt sie mit den Schultern. »Ich lasse Ihnen noch ein wenig Schmerzmittel bringen und dann sollten Sie sich erst einmal ausruhen, in Ordnung?«
Ich nicke, dann fallen die Polizisten auf dem Flur mir wieder ein. »Was wollen die beiden Männer dort draußen?«
»Darauf warten, dass Sie aufwachen.«
»Wie lange habe ich denn geschlafen?« Stirnrunzelnd sehe ich sie an.
»Schon eine ganze Weile, das ist aber völlig normal. Ruhen Sie sich aus, ich werde sie nachher zu Ihnen schicken.«
Damit geht sie hinaus und wenig später kommt eine Schwester herein, die mir etwas in den Tropf spritzt. Bald darauf wird der Schmerz in meiner Schulter erträglicher und ich falle erneut in einen traumlosen Schlaf.
Als ich das nächste Mal aufwache, sitzt ein Polizist auf einem Stuhl neben meinem Bett und schaut auf sein Handy. Es ist ein anderer als heute Vormittag, sein Haar ist dunkel und einige Strähnen hängen ihm leicht in die Augen. Ich bewege mich ein wenig und sofort schaut er mich an. Als er erkennt, dass ich wach bin, legt er sein Handy zur Seite.
»Hallo Savannah.«
»Hallo.«
Ich reibe mir übers Gesicht und versuche, dieses benommene Gefühl abzuschütteln. Anders als vorhin scheint nun nicht mehr helles Sonnenlicht in mein Zimmer, es wird lediglich in das orangefarbene Licht der untergehenden Sonne getaucht. Bei dem Versuch mich anders hinzulegen, fährt ein pochender Schmerz in meinen Arm und ich kneife die Augen zusammen.
»Hast du Schmerzen?«
Ich nicke, ohne die Augen zu öffnen, und höre, wie er aufsteht und aus dem Zimmer läuft, nur um kurz darauf mit einer Schwester zurückzukehren.
»Sie haben Schmerzen?«, fragt diese nett und beugt sich leicht zu mir.
»Ja.«
»Ich gebe Ihnen noch ein wenig Schmerzmittel. Sie haben den ganzen Tag geschlafen, das ist gut.« Sie richtet sich wieder auf und spritzt etwas in meinen Tropf. »So, es wird gleich besser werden. Soll ich das Kissen noch anders hinlegen?«
»Können Sie es vielleicht ganz wegnehmen?«
»Klar.« Sie hebt mich leicht an meiner heilen Schulter hoch und zieht das Kissen behutsam unter meinem Kopf hervor. »Besser?«
Ich nicke und verspüre tatsächlich weniger Schmerzen, da ich nun gerade liege.
»Ich bringe Ihnen etwas zu Essen, ja? Sie müssen ja ganz hungrig sein nach all dem Schlaf.« Lächelnd verlässt die Schwester das Zimmer und ich schließe erneut die Augen.
Warum nur bin ich immer noch so müde?
Da fällt mir der Mann wieder ein.
»Was machen Sie hier?« Meine Stimme klingt heiser.
»Erinnerst du dich daran, was gestern passiert ist?«, fragt er leise.
Als ich nun in seine Augen blicke, kommen mir diese seltsam bekannt vor. Dieses satte Moosgrün, das so durchdringend ist. Doch ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern oder wo er mir bereits begegnet sein könnte.
Eindrücke der vergangenen Tage drängen sich an die Oberfläche. »Steve …«
Weiter komme ich nicht. Ich kann es nicht aussprechen. Kann nicht in Worte fassen, was er mir angetan hat.
Wieso?
Was habe ich ihm denn getan?
Hasst er mich etwa so sehr?
Meine Grandma ist vor vielen Jahren verstorben, ich war noch jung, vielleicht zwölf. Sie war lange Zeit herzkrank und letztendlich hatte ihr Herz aufgehört zu schlagen. Als mein Grandpa dann fünf Jahre später wieder geheiratet hat, waren alle überglücklich, denn meine Grandma hatte sich immer gewünscht, dass er nicht den Rest seines Lebens allein verbrachte, sondern eine Frau finden würde, die ihn wieder lächeln ließ.
Diese Frau hatte er in Jane gefunden. Sie war liebevoll, gutmütig und immer freundlich, und sie brachte meinen Grandpa tatsächlich wieder zum Lächeln. Alle schlossen sie direkt ins Herz, und auch wenn Grandma nie vergessen wurde, mochten wir Jane sehr.
Doch sie brachte einen Enkel mit in die Ehe, ich schätze ihn auf Anfang 30. Steve war verzogen und überhaupt nicht von dieser neuen Ehe angetan. Wie Jane immer sagte, kam er nach seinem Vater, der ein Alkoholproblem hatte und gewalttätig wurde, weshalb ihre Tochter nicht bei ihm geblieben war. Nachdem diese allerdings viel zu früh an Krebs verstarb, geriet Steve auf die schiefe Bahn.
Als sie meinen Grandpa geheiratet hatte, sagte Steve sich von seiner Grandma los, obwohl die beiden sowieso immer nur sporadisch Kontakt hatten, da Jane die Hoffnung in ihn nicht aufgeben wollte.
Deshalb kenne ich Steve so gut wie gar nicht. An einer Hand kann ich abzählen, wie oft ich ihn in meinem Leben gesehen habe.
Ich schließe die Augen.
Konnte es an einer Hand abzählen.
Das dürfte nach den vergangenen Tagen wohl nicht mehr ausreichen.
»… hat dich angeschossen«, beendet der junge Polizist den Satz und durchbricht somit meine Gedanken.
Ich blicke ihn an und nicke wieder schwach. Tränen steigen mir in die Augen und ich kann nicht ausmachen, was ich gerade fühle.
Alles und nichts. Es ist, als würde eine Welle über mich einher brechen wollen, aber nur ein taubes Gefühl erfüllt mich. Es ist reiner Selbstschutz. Denn wenn die Taubheit nachlässt, wenn mein Schutzwall bricht, wird diese Welle über mir einbrechen und es wird keinen Halt mehr geben. Nichts wird sie aufhalten können. Sie wird alles mich sich reißen und mich zerstören.
Die Zimmertür öffnet sich erneut und die Krankenschwester von vorhin kommt mit einem grauen Tablet in der Hand herein. Sie stellt es auf dem Tisch neben meinem Bett ab und hilft mir, mich in eine sitzende Position zu bringen. Die Schmerzen in meinem Arm haben dank des Mittels zumindest so weit nachgelassen, dass ich mich etwas aufrichten kann. Mit einer Fernbedienung fährt sie das Kopfteil des Bettes hoch und ich lehne mich, dankbar für die Stütze, wieder dagegen.
Unter einer Haube befindet sich ein Teller mit warmer Gemüsesuppe und Brot. Sie duftet würzig nach Liebstöckel und zaghaft probiere ich, ob mein Magen bereit für etwas Nahrung ist. Tatsächlich grummelt er laut nach dem ersten Bissen, also löffle ich die Suppe langsam aus und bediene mich an einem Stückchen Brot.
Der Cop hat sich indes seinem Handy zugewandt und beobachtet mich nicht beim Essen, wofür ich ihm äußerst dankbar bin.
Als der Suppenteller leer ist und ich den Tischaufsatz von mir wegschiebe, steckt er es wieder ein. Suchend schaue ich nach der Fernbedienung für das Bett. Sie liegt bei meinen Beinen, doch als ich mich danach strecken will, schießt ein Schmerz durch meinen Oberarm und ich ziehe scharf die Luft ein.
»Hier, lass mich dir helfen.« Der Polizist nimmt die Fernbedienung und drückt einen Knopf, sodass das Kopfteil des Bettes langsam nach unten gleitet.
»Besser?«
»Ja, danke.« Für einen Moment schließe ich die Augen, bis sich nicht mehr alles um mich herum dreht.
»Habt ihr ihn gefasst?« Meine Stimme ist kaum mehr als ein Krächzen und ich öffne nach ein paar Sekunden die Augen, um zu sehen, ob er mich überhaupt verstanden hat.
»Nein.« Er schluckt. »Er ist geflohen und wir konnten seinen Aufenthaltsort leider noch nicht ausfindig machen. Deshalb wird immer …«
»Wie, noch nicht ausfindig machen?« Erschrocken will ich mich aufsetzen, vergesse aber den Schmerz in meinem Arm bei dieser ruckartigen Bewegung. Mir wird schwindelig und ich lasse mich wieder aufs Bett zurücksinken, meine rechte Hand auf meine Augen gepresst, aus denen die Tränen nun hervorquellen. Panik keimt in mir auf, doch die Schmerzen drängen sie zurück.
Der Cop steht von seinem Stuhl auf und tritt näher an mein Bett heran.
»Hey, es wird alles gut. Deshalb wird immer einer von uns vor dem Zimmer Wache halten, in Ordnung? Dir wird nichts passieren.«
Mir fehlen die Worte. Vor Verzweiflung, vor Schmerzen, ich weiß es nicht. Aber gerade kann ich nicht reden. Ich versuche mich auf etwas anderes zu konzentrieren, aber die düsteren Gefühle lassen sich nicht verdrängen. Ein Schluchzen entfährt mir.
Scheiße. Kann ich denn gar nicht mehr aufhören zu heulen?
Plötzlich fällt mir Max ein. Ich nehme die Hand vom Gesicht und sehe den Cop entsetzt an. »Ich muss nach Hause, ach du meine Güte, wieso habe ich nicht schon eher daran gedacht!« Ich will mich aufsetzen, doch eine Hand drückt mich sanft, aber bestimmt in die Kissen zurück.
»Mal langsam. Wieso musst du nach Hause?«
»Mein Hund, Max, er ist jetzt seit …« Oh Gott, wie viele Tage war ich weg? Vier? Fünf? »Scheiße, ich muss zu ihm!« Ich stammele vor mich hin und kann keinen klaren Gedanken fassen, weiß nur, dass ich jetzt nach Hause zu Max muss.
»Savannah …« Bedrückt sieht der Cop mich an, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er eigentlich heißt. Doch das ist im Moment völlig nebensächlich. »Wir waren am Tag deiner Entführung in deiner Wohnung. Max war ein Beagle, richtig?«
Ich kann seinen Blick nicht deuten.
»Ja.« Dann dämmert es mir. »Moment mal, war?!«, stottere ich und die Panik legt sich erneut wie ein kalter, nasser Mantel um mich.
»Ja.« Nun sieht er mich definitiv mitleidig an. »Es tut mir unendlich leid, Savannah. Als wir nach der Vermisstenmeldung in deiner Wohnung ankamen, war alles verwüstet. Jemand ist dort gewaltsam eingedrungen.« Er sieht zu Boden. »Wir konnten nichts mehr für deinen Hund tun. Jemand hat ihn erschossen.«
Entsetzen durchfährt mich. Nicht realisierend, was er gerade gesagt hat, starre ich ihn einige Sekunden lang verständnislos an.
»Erschossen?« Das Klingeln in meinen Ohren übertönt meine krächzende Stimme.
Der Cop nickt.
Schwärze umhüllt mich. Ich kann nichts mehr sehen, nichts mehr wahrnehmen. Es fühlt sich an, als würde jemand die Luft aus meinen Lungen saugen und mich gleichzeitig in eiskaltes Wasser tauchen. Ich falle und kann nicht zurück an die Oberfläche. Ich will schreien, doch kein Laut kommt aus meiner Kehle.
Ich bin leer, ich fühle nichts.
Und dann alles auf einmal. Es bricht über mich herein wie ein Orkan, der alles zerstören wird, was ihm in die Quere kommt. Alles mit sich nimmt.
Tränen quellen aus meinen Augen, ein erstickter Laut presst sich aus meiner Lunge hervor. Ich presse meinen gesunden Arm auf meine Augen und beginne hemmungslos zu schluchzen. Gleichzeitig fühlt meine Kehle sich wie zugeschnürt an.
Mein Körper bebt und ich weiß nicht, wo er beginnt und wo er aufhört.
Ich nehme körperliche Schmerzen wahr, doch es ist mein Inneres, das mich zerreißt.
Wie durch einen dichten Nebel spüre ich, wie jemand sanft meine Hand am Ende der Schlinge umfasst und sachte drückt. Die Matratze senkt sich an meiner linken Seite leicht hinunter, als der Cop sich auf die Bettkante setzt.
Schweigend lässt er mich einfach nur weinen. Sekundenlang, minutenlang, stundenlang. Ich weiß es am Ende nicht mehr.
Ich weiß nur, dass Max das Einzige war, das ich von meinen Eltern noch hatte.
Und nun ist er fort.
Ich habe diesen Hund geliebt. Max war für mich da, in den dunkelsten Stunden meines Lebens. Er war immer an meiner Seite. Hat auf mich aufgepasst, mir zugehört.
Max war der Grund, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin. Nur ihm zuliebe habe ich gegessen, bin einkaufen gegangen und habe einen Fuß vor die Tür meines schicken Appartements gesetzt.
Ohne ihn wäre ich verrottet wie alter Fisch in der Restmülltonne.
Doch nun ist er nicht mehr da.
Kapitel 4
MATT
Savannah schluchzt erneut und ein weiterer Krampf lässt ihren zierlichen Körper erzittern.
»Es tut mir so leid, Savannah.« Wieder sage ich diese Worte, die nicht das Geringste an der Situation ändern können.
Sie erwidert nichts, nur die Tränen rinnen wie Sturzbäche ihre Wangen hinab. Ihren gesunden Arm presst sie sich auf die Augen.
Ich weiß nicht, wie lange wir so ausharren, bis sie sich beruhigen kann. Sie in die Arme zu schließen, wage ich nicht. Zum einen, weil ich nicht weiß, wie stark ihre Schmerzen sind. Zum anderen habe ich keine Ahnung, ob sie es wollen würde. Ich kenne sie ja gar nicht.
Irgendwann jedoch kommen keine Tränen nach, wahrscheinlich weil sie keine übrig hat, und ihr Körper zittert nicht mehr so unkontrolliert.
Es vergehen weitere lange Minuten, bis sie ihren Arm von ihrem Gesicht nimmt und es in Richtung des Fensters dreht. Ein orangefarbener Sonnenstrahl trifft auf ihre Haut, und obwohl sie gerade geweint hat, sieht sie umwerfend aus.
Ich räuspere mich. »Ich weiß, dass deine Eltern und Großeltern ebenfalls gestorben sind. Da es sich hier um einen Spezialfall handelt, können wir eigentlich keinem anderen Bescheid geben. Wenn du aber einen Freund hast, den wir anrufen sollen, spreche ich mit meinem Boss und sehe, was sich tun lässt.«
Die letzten Worte kommen zögerlich. Eigentlich ist die Anweisung von David klar gewesen – niemand darf etwas über Savannah und ihren Aufenthaltsort erfahren, solange Steve Boucher frei herumläuft. Dieser Fall ist absolute Verschlusssache.
Doch ein Mensch kann nun einmal nur so viel ertragen. Und Savannah stößt gerade an ihre Grenze, was ich ihr nicht verübeln kann. Dass kein Vertrauter da ist, der sie trösten kann, macht die Situation nicht einfacher.
Aber sie schüttelt nur leicht den Kopf. »Den gibt es nicht.«
Nachdem sie sich mit der Hand übers Gesicht gefahren ist, sieht sie mich an. Ihre Augen sind von den vielen Tränen verquollen, ihre Wangen gerötet.
Mein Blick fährt zu ihren Augen zurück. Sie schimmern in einem hellen Braun und ziehen mich sofort in ihren Bann, genau wie zuvor im Wald. Dann realisiere ich, was sie gesagt hat, und nicke leicht.
»In Ordnung. Dann wird es dabei bleiben, dass niemand erfahren darf, wo du bist, bis dein Stiefcousin …«
»Bitte, nenn ihn nicht so. Das ist er nicht«, unterbricht sie mich. Ihre Stimme ist mit einem Mal messerscharf.
»Okay, tut mir leid. Bis … Steve Boucher gefasst ist.«
Sie nimmt es so hin, keine Diskussion. Wie unglaublich müde und traurig sie sein muss. Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen, bevor er endgültig zerbricht?
Erneut bricht Stille zwischen uns aus. Ich sitze noch immer auf ihrer Bettkante und halte ihre Hand, und sie entzieht sie mir nicht. Vielleicht sucht sie nach der einzigen Art von Trost, die sie gerade bekommen kann. Vielleicht realisiert sie es aber im Moment auch einfach nicht.
Ihr Blick schweift wieder zum Fenster, hinter dem sich aber nur weitere Gebäude erblicken lassen. Ihrem Beispiel folgend sehe ich der Sonne dabei zu, wie sie langsam am Horizont und schließlich hinter den unzähligen Betonblöcken verschwindet.
»Wie geht es jetzt weiter?«, fragt sie nach einer gefühlten Ewigkeit.
»Morgen kommt unser Boss und wird deine … Situation mit dir besprechen. Es ist aber immer jemand von uns hier, also ruh dich ein wenig aus.«
»Meine Situation? Was gibt es denn da zu besprechen?« Sie sieht mich skeptisch an.
Ich lächle schwach. »Morgen werden wir dir alles weitere erklären. Bis dahin musst du dich leider gedulden.«
Savannah schnaubt und schließt müde die Augen. »Okay.«
»Okay. Ich bin gleich hier, wenn etwas ist.« Ich lasse ihre Hand los und spüre, wie der Druck in der Matratze nachlässt, als ich mich erhebe und mich auf meinen Stuhl zurückziehe.
»Wer hat mich eigentlich als vermisst gemeldet?«, fragt sie leise und schaut mich an.
»Hm?«
»Du hast gesagt, dass ihr nach meiner Vermisstenmeldung in meine Wohnung gegangen seid. Wer hat mich denn als vermisst gemeldet?«
»Oh, achso.« Ich nicke und erinnere mich an den jungen Mann, der mir etwas skurril vorkam mit seinem Hipster-Look und seinen roten Haaren. »Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er hieß. Jack vielleicht?«
»Jay?« Sie kneift die Augen zusammen.
Jetzt erinnere ich mich. »Ja, genau.«
»Okay.« Sie dreht den Kopf zur Seite und ich setze mich zurück auf meinen Stuhl. »Ich nehme an, dass er mich nicht besuchen kommen darf?«
Bedauernd schüttele ich mit dem Kopf. »Leider nicht, nein. Wir haben ihm mitgeteilt, dass wir dich gefunden haben – mehr ist leider nicht drin, bis wir wissen, wie genau das Gebilde um Boucher aussieht. Tut mir leid.«
Savannah schnaubt. »Jay hat damit ganz sicher nichts zu tun.«
»Mag sein.« Ich lege den Kopf schief. »Allerdings kann auch er sich verplappern oder als Köder benutzt werden.«
Sie seufzt, widerspricht mir aber nicht weiter.
Ich ziehe gerade mein Handy aus der Hosentasche, als Savannah sich räuspert.
»Wie heißt du eigentlich?«, fragt sie und dreht den Kopf erneut in meine Richtung.
Ich halte in der Bewegung inne und sehe sie an.
»Matt«, sage ich mit einem Lächeln.
»Matt«, wiederholt sie. »Ich bin …«
»Savannah.« Mein Lächeln wird breiter. »Ich weiß.«
Kapitel 5
SAVANNAH
Am nächsten Morgen wache ich auf und fühle mich wie vom Zug überrollt. Ich richte mich ein wenig auf und schalte das Licht über meinem Bett ein, da die Vorhänge vor dem Fenster zugezogen sind.
In der Nacht habe ich kaum geschlafen. Albträume haben mich heimgesucht, und wann immer meine Augen geschlossen waren, sah ich Steves Gesicht vor mir. Oder Max, wie er blutüberströmt in seinem Körbchen liegt.
Seufzend reibe ich mir mit meiner Hand einmal über mein verquollenes Gesicht.
Wenig später, als eine nette Krankenschwester mir mein Frühstück bringt, erhasche ich einen Blick auf den Flur. Vor meiner Tür sitzt ein Polizist, den ich hier noch nicht gesehen habe.
Matt scheint der Einzige zu sein, der sich in mein Zimmer wagt – wieso auch immer. Die anderen habe ich nur draußen sitzen sehen, doch darüber bin ich nicht traurig. Gerade jetzt mag ich meine Privatsphäre mehr als sonst.
Ich esse mein Käsebrötchen, trinke den Tee und genieße die Sonne, die uns die letzten Septembertage ein wenig mit ihrer Wärme versüßen möchte. Eigentlich habe ich keinen Hunger, nachdem Matt mir gestern erzählt hat, dass Max tot ist.
Eine Träne kullert bei diesem Gedanken über meine Wange. Doch mein rational denkendes Ich zwingt mich, wenigstens eine Hälfte zu essen, da ich innerlich weiß, dass meine Genesung und die Entlassung aus diesem Krankenhaus unweigerlich damit zusammenhängen.
Und ich möchte hier so schnell wie möglich raus. Krankenhäuser machen mich wütend.