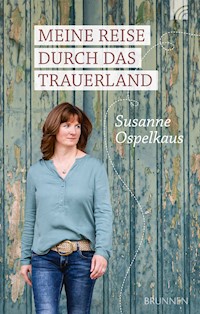Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Gnade ist doch ungerecht!", ruft Jona. Wer war dieser unfreiwillige Prophet und was erlebte er auf seiner Reise nach Ninive? Susanne Ospelkaus erzählt, wie das Leben von Jona ausgesehen haben könnte. Ein Roman für junge Leserinnen und Leser über einen jungen Mann, der an Leid und Unrecht zu zerbrechen droht. Jona diskutiert mit Gott und erlebt, dass Gottes Gnade großzügig ist. Eine herausfordernde biblische Geschichte über Not und Mitgefühl, Freundschaft und Zusammenhalt und eine unglaubliche Begegnung mit Gott. Spannend und zeitgemäß nacherzählt. Für junge Leserinnen und Leser ab 10 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Ospelkaus & J. G. Pulido
Echt jetzt, Jona?!
Doch ein Held?
© 2024 Brunnen Verlag GmbH Gießen
Lektorat: Annette Zaborowski, Alena Dörr
Illustrationen: Justo Pulido
Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger
Satz: Brunnen Verlag GmbH
ISBN Buch 978-3-7655-2176-8
ISBN E-Book 978-3-7655-7872-4
www.brunnen-verlag.de
Du bist mutiger,als du denkst.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel1
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich wirklich. Ich sehe meine Eltern, unser Haus in meiner Heimatstadt Jaffa mit der Palme vor der Tür, Vaters Boot am Ufer, Mutters Schüssel mit Datteln. Wenn ich die Augen öffne, sehe ich verwüstete Gärten, gesplitterte Haustüren, zerfetzte Fischernetze und zerschlagenes Geschirr – nur die Dattelpalme steht, als wäre nichts passiert. Ich schließe die Augen und will sehen, was ich als Kind sah: Mutters Schüssel mit Datteln, Vaters geflickte Netze nach seinem Fischfang, unser Zuhause an der Küste von Juda. Ich stehe vor unserem Haus und sehe das Meer. Vaters Boot schwankt in den Wellen. Zwei Körbe mit Fisch stehen am Strand. Vater hat viel gefangen. Mutter putzt die Fische und legt sie in einen Topf mit Salz. Später werden wir den Fisch verkaufen. Vater sagt, dass unser Fisch vielleicht bis in das Land der Assyrer wandern wird, so lecker sei er. Er zählt auf: Damaskus, Aleppo, Ninive. Ich wiederhole die fremden Namen: Damaskus, Aleppo, Ninive. Sie klingen sehr geheimnisvoll. Und Babylon, frage ich. Da lacht Vater und meint, das sei sehr, sehr weit weg.
„Hey, Träumer! Los, an die Arbeit!“
Ein Stock drückt sich in meinen Rücken und schubst mich aus meinen Erinnerungen. Ich spanne meine Muskeln an, um den Schmerz zu dämpfen, doch der Stock drückt sich tief zwischen meine Schulterblätter.
Ich packe die Steinzange mit beiden Händen und ziehe sie zu dem Marmorklotz. Mit den Füßen suche ich Halt. Überall ist es rutschig. Wir müssen den Steinblock aus dem Schiff hieven, im Hafen lagern, bis ihn Ochsenschlitten wegschaffen.
„Fester! Wir machen hier keinen Sabbat.“
Nein, Sabbat habe ich schon lange nicht mehr gefeiert. Wir leisten Zwangsarbeit. Alle! Außer die reichen Einwohner, die haben sich freigekauft – so wie der Aufseher. Früher saß er im Stadtrat von Jaffa und legte die Zölle für die Schiffe fest.
Ich bin fünfzehn Jahre alt und verlade Marmor. Steinmetze schlagen daraus Säulen, Bänke oder Skulpturen für die Reichen in der Fremde. Ich will keine Steine verladen. Ich will aufs Meer hinausfahren, den Wind spüren, Netze auswerfen und Delfine sehen.
„Ey, arbeite schneller!“
Diesmal schlägt der Aufseher auf meinen Rücken. Der Schmerz schießt in meinen Kopf und bis zu den Füßen. Meine Hände krallen sich an die Steinzange. Ich packe zu, halte fest, ziehe stärker. Schweiß rinnt mir den Rücken hinunter. Meine Muskeln zittern vor Anstrengung.
„Na also“, grunzt der Aufseher. Die Wut reißt an meinen Gelenken. Wieso wendet er sich gegen uns? Müssten wir Judäer nicht zusammenhalten? Die Assyrer peitschten wie ein Sturm über Juda. Sie zerstörten Häuser, Gärten und Boote. Die Kostbarkeiten aus Alabaster, Gold und Leinen haben sie verschont, um damit ihre Häuser zu schmücken. Sie treiben die Angst in unsere Körper und in unsere Träume. Eine immerwährende Angst, die mahnt, dass es noch schlimmer kommen könnte. Nichts ist so wie früher. Unser Gebetshaus ist zerstört, die Priester wurden verschleppt und Schriftrollen verbrannt. Dem einzigen Schriftgelehrten in Jaffa verbieten sie zu unterrichten. Stattdessen stellen sie ihre Götterstatuen auf: Löwen mit Flügeln und Ziegen. Ihr heiligstes Tier ist eine Ziege?
Meine Eltern haben mich lange versteckt. Als mich dann doch ein Soldat entdeckte, befahl er: „Der ist jung und stark. Der soll arbeiten.“ Dann schickten sie mich zum Hafen und drückten mir eine Steinzange in die Hände, seitdem bin ich mit dem Ding verschmolzen. Die Greifer der Zange sind lang wie Männerarme. Wenn ich die Greifer bewege, krallen sie sich in die Kanten der Marmorsteine. Tag für Tag bewege ich Steine, die so groß wie Kälber sind. Steine! Nutzlose Steine! Ich und die anderen jungen Männer verschieben sie eine Hand breit, einen Arm lang und zwei Schritte weit über Stunden, Tage und Wochen.
„Schluss für heute! Bei Sonnenaufgang seid ihr wieder da!“ Der Aufseher lässt den Stock über seine Handfläche kreiseln und pfeift ein Lied. Ich ziehe die Reste meiner Tagesration Brot an mich und winde mich wie ein Wurm davon. Wir sind nicht angekettet oder eingesperrt. Wir können uns frei bewegen, aber nicht wie Katzen oder Schakale, sondern wie Ungeziefer, das bei Sonnenaufgang angekrochen kommt, um Zwangsarbeit zu leisten.
Ich schleppe mich den Pier entlang, vorbei an Statuen, die die Assyrer aufgestellt haben, vorbei an riesigen Handelsschiffen und Kriegsschiffen, vorbei an Fischerbooten und Flößen. Je kleiner die Boote werden, umso niedriger wird die Mauer der Hafenanlage, bis nur noch schroffe Felsen das Ufer säumen. In der nächsten Bucht liegt mein Elternhaus. Es thront auf einem Felsen und ringsum erheben sich Olivenbäume wie Wächter. Mutters Garten ist verwüstet, die Tür hängt schief in den Angeln, Vaters Netze flattern in Fetzen an den Bäumen. Ohne meine Eltern ist das Haus kein Zuhause.
Mutter wurde mit einigen anderen Frauen irgendwo in den Norden verschleppt. Es hieß, sie müsse Orangen ernten. Vater ist irgendwo im Süden und baut Schiffe. Jeden Tag denke ich daran zu fliehen – aber wohin? Überall sind die Assyrer. Sie sind Meister darin, Angst zu verbreiten. Sie stellen Mosaikbilder auf, die Gewalt, Folter und Tod zeigen. Ein Mosaik hängt neben dem zerstörten Gebetshaus. Eine Statue erhebt sich im Hafen, dort, wo Vater unseren Fisch verkauft hat.
Damaskus, Aleppo, Ninive – früher klangen die Namen geheimnisvoll. Heute sind sie eine Warnung: „Wenn du nicht machst, was wir sagen, dann …“
Kapitel2
Ich gehe zu Vaters Fischerboot. Der Bug steckt tief im Sand, denn es wurde schon lange nicht mehr bewegt. Jeden Abend treffe ich mich hier mit Esther. Als Kinder haben wir schon zusammen gespielt und unsere Eltern planten unsere Hochzeit, als wir noch nicht wussten, was eine Hochzeit ist. Doch dann kamen die Assyrer. Sie verschleppten unsere Eltern und ließen uns wie Waisen zurück. Manchmal bekommen wir Mehl und Öl von Nachbarinnen oder von der Frau des Schriftgelehrten. Sie teilen mit uns das Wenige, das sie haben.
„Jona! Ich habe Feigen gesammelt und Ringelblumen. Meine Nachbarin sagt, sie schmecken wie Gemüse.“
„Gemüse? Am liebsten hätte ich Lamm mit Linsen.“
„Hier!“
Esther reicht mir die Blüten und Feigen, klettert in das Boot und lässt sich neben mich fallen. Ihr lockiges Haar berührt meine Wange. Ich schiebe es zur Seite und stecke ihr eine gelbe Blüte zwischen die Locken.
„Ein Stern für meinen Stern“, sage ich.
„Hä?“
„Esther, der Stern.“
„Und was bedeutet dein Name? Jona, der …“
„Die! Jona, die Taube. Wäre ich doch ein Adler oder wenigstens ein Geier.“
„Tauben sind friedlich. Ich bin froh, dass du Jona bist.“
Ich friemle mein Brot aus dem Gewand und reiche Esther ein Stück. Es ist hart. Ich lasse es so lange im Mund, bis es weich wird.
Vor uns geht die Sonne unter und hinter uns strahlt der erste Stern.
„Abendstern“, sagt Esther. „Die Assyrer verehren Sterne als Gott.“
„Ich habe gehört, dass die Assyrer vorhersagen können, wann der Mond finster wird. Sie wissen sogar, wann die Sonne finster wird. Ist das nicht unheimlich?“
„Die Assyrer sind unheimlich. Sie sind die große Finsternis.“
Esther zwirbelt eine Haarsträhne so fest um ihren Finger, dass ich befürchte, sie reißt sich die Haare aus.
„Was ist?“, frage ich.
„Heute … die kleine Miriam … der Aufseher … ach, nichts.“
„Was?“ Ich berühre sie an der Schulter. „Was ist mit Miriam?“
„Sie ist doch noch ein Kind … zerbrechlich … da habe ich …“
„Was denn?“
„Ich habe Miriam versteckt und ihre Arbeit übernommen.“
„Und jetzt?“
„Jetzt überlegt sich der Aufseher eine Strafe für mich. Guck mal! Man sieht die Sterne.“
„Lenk nicht ab. Was für eine Strafe?“
Esther streckt ihren Arm aus und zeigt in den Himmel.
„Wenn du von diesen hellen Sternen eine Linie ziehst, entsteht ein Bild. Das ist der Riese Orion.“
„Esther!“
„Ich werde einfach noch schneller und besser arbeiten. Dann wird mir nichts passieren. Guck, und das sind die Fesseln des Riesen. Irgendwann wird der Riese fallen. Wir müssen durchhalten und zusammenhalten. Einfach machen. Irgendwann wird die Not vorbei sein.“
Noch immer sieht sie in den Himmel. Ihr Kopf wippt, aber vielleicht sind es auch nur die Wellen, die das Boot schaukeln.
„Und diesen Sternenhaufen nennt man Plejaden. Der Schriftgelehrte bezeichnet sie als Familie. Hörst du, Jona, Familie.“
Esthers Stimme plätschert wie das Wasser. Ich schließe die Augen. Mein Kopf ruht an den Planken. Ich denke an Sterne und Familie, Vater und Mutter.
Kapitel3
Das Holz drückt gegen meinen Kopf. Ich spüre die Unebenheiten – eine Kerbe, eine Fuge und ein Stück Rinde. Meine Muskeln werden hart. Nicht mehr lange und ich werde selbst zu einem knorrigen Ast. Aber ich muss still sein. Kein Mucks. Keine Regung. Mutter legt ein Tuch über mich. Ich protestiere. Doch sie zischt und flüstert hastig ein Ich-hab-dich-lieb.
Ich höre Schritte. Metall schlägt gegen Metall. Rufe peitschen durch die Luft. Die Assyrer. Ein Knall. Das muss unsere Haustür sein, die gegen die Wand fliegt. Ein Soldat schreit. Mutter schweigt. Vater spricht. Seine Stimme zittert. Es klappert im Regal. Münzen klackern. Der Soldat schreit noch immer. Scherben splittern auf dem Boden. Mutter schluchzt. Ich will aus meinem Versteck aufspringen, doch dann höre ich Vater. Er scheint die Münzen aufzusammeln, sagt, dass es alles ist, was wir haben. Der Soldat grunzt. Schwere Schritte werden leiser. Vater seufzt. Mutter weint. Ich zerre das Tuch von meinem Kopf. Der Soldat ist weg, Scherben liegen auf dem Boden. Mein Mund ist voller Wut. Ich hole Luft und kreische wie eine Möwe.
Das Kreischen wird immer lauter, dabei habe ich meinen Mund geschlossen. Ich strecke mich. Holz drückt gegen meinen Kopf. Ich spüre die Unebenheiten – eine Kerbe, eine Fuge und ein Stück Rinde. Die Möwen und der Schmerz an meinem Kopf wecken mich auf: Ich habe geträumt. Mit den Händen reibe ich mir über das Gesicht, ich zerre an meinen Haaren und will mir die Erinnerung herausreißen. Ich war elf Jahre alt, als die Soldaten kamen. Immer wieder haben mich meine Eltern versteckt. Ich lebte wie ein Schatten hinter Bäumen, zwischen Körben oder neben Hauswänden. Nur wenn mich Vater in der Dämmerung zum Boot lotste, war ich frei, wenn der Wind uns über das Wasser schob. Mit Vater warf ich die Netze aus. Zweimal am Tag fuhren wir auf das Meer – einmal im Morgengrauen und einmal zur Abenddämmerung. Mutter versuchte, die Fische zu verkaufen. Wir arbeiteten härter als zuvor und verdienten weniger als zuvor. Das Geld holten sich die Soldaten.
Das Kreischen der Möwen vertreibt die Erinnerungen. Ich richte mich im Boot auf. Es ist noch dämmrig. Ich sehe nicht, wo das Wasser endet und der Himmel beginnt. Hinter mir liegt die Stadt. Die aufgehende Sonne spielt mit den Farben Violett, Rot und Orange. Ich starre in die Sonne, bis alles flimmert. Dann blinzle ich.
Esther hat sich im Bug zusammengerollt. Der Wind spielt mit ihren Haaren. Ihr Atem geht gleichmäßig, doch ihre Pupillen tanzen unter den Augenlidern. Sie träumt und ich will sie nicht wecken.