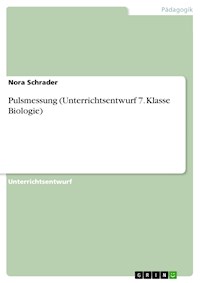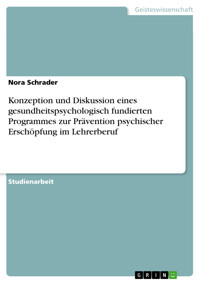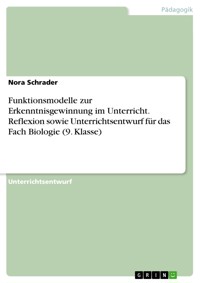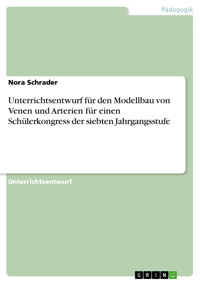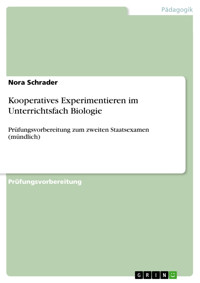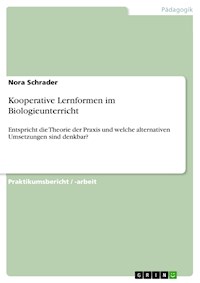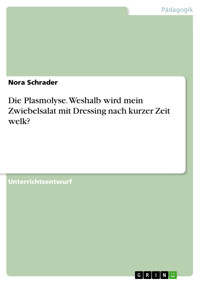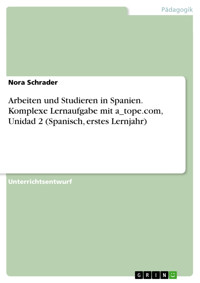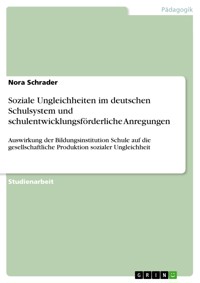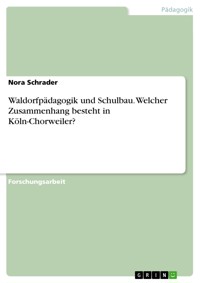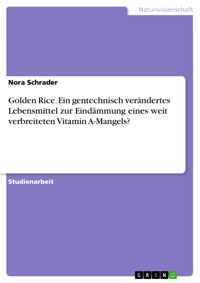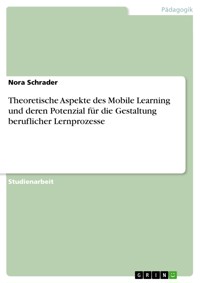Effektive Einführung zielsprachlicher Lexik im Spanischunterricht. Ist die Theorie in der Schulpraxis anwendbar? E-Book
Nora Schrader
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Didaktik - Spanisch, Note: 1,0, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit thematisiert verschiedene, von der Lehrperson gesteuerte Einführungsmöglichkeiten zielsprachlicher Lexik im Spanischunterricht, mit der Schülerinnen und Schüler erstmalig konfrontiert werden. Des Weiteren werden Aspekte, die mit der Darbietung von Wortschatzelementen verbunden sind, fokussiert. Für eine adäquate zielsprachliche Kommunikation ist das Erlernen von Wörtern, die im Sprachgebrauch häufig verwendet werden, unerlässlich. Auf den Spanischunterricht bezogen bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler über Lexik verfügen sollten, die für das Unterrichtsgeschehen relevant ist. Aufgabe der Lehrperson ist es, diese bedeutsamen Wörter herauszufiltern und angemessene Methoden auszuwählen, um Lernenden diesen Wortschatz zu vermitteln. Hierbei sollten auch Bedeutungszusammenhänge, in denen eine Anwendung der Vokabeln erfolgen kann, thematisiert werden. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Welche Möglichkeiten der gesteuerten Einführung zielsprachlicher Lexik gibt es? Welche Aspekte sind vor und bei der Umsetzung im Unterricht zu berücksichtigen? Und lassen sich die theoretischen Ausführungen in der Praxis wiederfinden? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, gibt die Autorin zuerst einen Überblick über die theoretische Grundlagen, die verschiedenen Formen und Phasen der Wortschatzaneignung sowie eine Darstellung der Vorauswahl neuer Lexik. Darüber hinaus erläutert sie Beispiele für die Semantisierung zielsprachlicher Wörter und vergleicht die theoretisch hergeleiteten Annahmen mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Schulpraxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wortschatzaneignung im Fremdsprachenunterricht
2.1 Definition des Begriffs Wortschatz sowie Einbettung in den schulischen Gesamtkontext
2.2 Formen und Phasen der Wortschatzaneignung
2.3 Vorauswahl neuer Lexik und Komponenten der Sprachaufnahmephase
2.4 Berücksichtigung des mentalen Lexikons in der Wortschatzarbeit
2.4.1 Das mentale Lexikon
2.4.2 Beispiele von Faktoren, die die Erstbegegnung mit Wörtern nachhaltig beeinflussen
2.4.2.1 Die multisensorische Einführung
2.4.2.2 Das kontextualisierte und vernetzte Lernen
2.4.2.3 Die exzeptionelle und emotionale Darbietungsart
2.5 Von der Lehrperson bewusst gesteuerte Semantisierungen
2.5.1 Beispiele der nonverbalen Semantisierung
2.5.2 Beispiele der verbalen Semantisierung
3. Die Gestaltung der Sprachaufnahmephase in der Schulpraxis
3.1 Die Gestaltung der Sprachaufnahmephase seitens Lehrpersonen
3.2 Die eigene Gestaltung der Sprachaufnahmephase
3.3. Das Verhältnis von Theorie und Praxis
4. Fazit und Ausblick
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit thematisiert verschiedene, von der Lehrperson gesteuerte Einführungsmöglichkeiten zielsprachlicher Lexik im Spanischunterricht, mit der Schülerinnen und Schüler erstmalig konfrontiert werden. Des Weiteren werden Aspekte, die mit der Darbietung von Wortschatzelementen verbunden sind, fokussiert.
Um mit einem Zitat von Kieweg (2002: 4) zu beginnen:
„Die Vermittlung hochfrequenter Wörter (…) erfordert Professionalität, sie ist die Basis für den Sprachgebrauch“ (ebd.).
Diese Aussage verdeutlicht, dass für eine adäquate zielsprachliche Kommunikation das Erlernen von Wörtern, die im Sprachgebrauch häufig verwendet werden, unerlässlich ist. Auf den Spanischunterricht bezogen bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler über Lexik verfügen sollten, die für das Unterrichtsgeschehen relevant ist. Aufgabe der Lehrperson ist es, diese bedeutsamen Wörter herauszufiltern und angemessene Methoden auszuwählen, um Lernenden diesen Wortschatz zu vermitteln. Hierbei sollten auch Bedeutungszusammenhänge, in denen eine Anwendung der Vokabeln erfolgen kann, thematisiert werden.
Folgende Fragestellungen bilden das Grundgerüst der Arbeit: Welche Möglichkeiten der gesteuerten Einführung zielsprachlicher Lexik gibt es? Welche Aspekte sind vor und bei der Umsetzung im Unterricht zu berücksichtigen? Lassen sich die theoretischen Ausführungen in der Praxis wiederfinden?
2. Wortschatzaneignung im Fremdsprachenunterricht
2.1 Definition des Begriffs Wortschatz sowie Einbettung in den schulischen Gesamtkontext
Geht es um die amtliche Verortung des Themas Wortschatz, so findet sich der Begriff im Hamburger Bildungsplan für neuere Fremdsprachen in der Kategorie Verfügung über sprachliche Mittel in dem Bereich der funktional kommunikativen Kompetenzen (vgl. Hamburger Bildungsplan 2011: 13). Dem Nomen werden oftmals zwei Bedeutungen zugeschrieben:
Zum einem ist darunter die Gesamtheit aller Wörter einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verstehen, zum anderen wird damit die Gesamtheit aller Wörter bezeichnet, die eine einzelne Person kennt oder verwendet (Güll 2010: 52).
Im Hinblick auf den ersten Teil der Definition wird kurz skizziert, wie Wörter klassifiziert werden können. Es gibt eine Einteilung in Autosemantika, Synsemantika sowie Deiktika. Autosemantika sind bedeutungsstarke Inhaltswörter wie Nomina und Verben (vgl. Palm 1995: 42). Als Synsemantika gelten bedeutungsschwache Funktionswörter wie Präpositionen, Konjunktionen und Hilfsverben (vgl. ebd.: 13). Deiktika sind zum Beispiel Pronomen und Adverbien, deren konkrete Bedeutungen erst im Satzkontext offensichtlich werden (vgl. Lenzen 2012: 82). Diese Wortarten sind für eine adäquate Anwendung der Zielsprache bedeutsam und müssen (je nach Relevanz für das Unterrichtsgeschehen) in den Wortschatz der Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden.
Der zweite Aspekt der Definition bezieht sich auf die individuelle Verfügbarkeit von Wörtern. Nach der KMK (2014: 14f.) sollen Schülerinnen und Schülern drei Wortschatzarten vermittelt werden. Der aktive Wortschatz beinhaltet Wörter, die die Lernenden aktiv in ihrem Sprachgebrauch verwenden (vgl. Lahr 2012: 12f.):
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen hinreichend großen Wortschatz, um sich mithilfe von einigen Umschreibungen über die häufigsten Alltagsthemen der eigenen und der fremdsprachlichen Gesellschaft und Kultur äußern zu können (KMK 2004: 14f.).
Der passive Wortschatz umfasst Wörter, deren Bedeutung bekannt ist. Sie sind jedoch nicht im aktiven Sprachgebrauch integriert. Somit sollen Schülerinnen und Schüler nach der KMK (2004: 14f.) imstande sein, „zusätzliche lexikalische Einheiten hörend oder lesend zu verstehen“ (ebd.). Wenn den Lernenden zielsprachliche Wörter zwar unbekannt sind, sie aber erschlossen und in Folge dessen verstanden werden können, spricht man vom rezeptiven Wortschatz (vgl. Lahr 2012: 12f.).
Wie Wortschatzaneignung im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden kann, wird im nächsten Abschnitt dargestellt.
2.2 Formen und Phasen der Wortschatzaneignung
Wortschatzaneignung umfasst drei Formen (vgl. Grünewald 2007: 63): den ungesteuerten[1], den selbstgesteuerten[2] sowie den fremdgesteuerten Wortschatzerwerb. Die fremdgesteuerte Wortschatzarbeit besteht seitens der Lehrperson aus einer Vermittlung zielsprachlicher Lexik, welche die Schülerinnen und Schüler erlernen sollen (vgl. Stork 2003: 39). Diese Form der Wortschatzarbeit wird von Didaktikern in verschiedene Phasen eingeteilt. Wiechert (2007: 24) weist darauf hin, dass „der Unterricht ein Kontinuum darstellt“. Er lehnt es ab, Phasen im Unterricht strikt zu trennen. Stattdessen plädiert er für einen fließenden Übergang letzterer (vgl. ebd.). In der vorliegenden Arbeit soll dennoch in einem bestimmten Rahmen eine theoretische Differenzierung des Unterrichts in Phasen erwähnt sein, weil sie zum einen bei der Unterrichtsplanung hilfreich ist und zum anderen das hier fokussierte Thema, die Sprachaufnahmephase, im Gesamtkontext der fremdgesteuerten Wortschatzarbeit deutlich wird.[3]
Während Thaler (2012) die Wortschatzarbeit in sechs unterschiedliche Schritte gliedert, unterscheidet das Dreiphasenmodell von Zimmermann (1969: 245f.), das in der 80er Jahren die Unterrichtsstruktur prägte, die Sprachaufnahmephase, die Sprachverarbeitungsphase[4] sowie die Sprachanwendungsphase[5]. Die Sprachaufnahmephase wird als die Phase gefasst und in der vorliegenden Arbeit fokussiert, in der die erstmalige Darbietung von Wortschatzelementen stattfindet, die den Lernenden zuvor unbekannt waren (vgl. Wiechert 2007: 24).
Welche Aspekte zunächst bei der Vorauswahl der zu präsentierenden Lexik zu berücksichtigen sind und welche Komponenten die Sprachaufnahmephase umfasst, ist im Abschnitt 2.3 erläutert.
2.3 Vorauswahl neuer Lexik und Komponenten der Sprachaufnahmephase
Grundsätzlich bietet es sich an, neue Lexik vorentlastend bei der Behandlung von Texten oder Arbeitsaufträgen in angemessener Form einzuführen. Entscheidet sich die Lehrperson für die fremdgesteuerte Semantisierung zielsprachlicher Begriffe, sind einige Aspekte zu beachten, die hier beispielhaft aufgeführt sind: In einer Stunde sollten maximal 20 neue Vokabeln semantisiert werden, da die meisten der Schülerinnen und Schüler nicht mehr Informationen aufnehmen können. Auch müssen nicht alle neuen Ausdrücke, die in einem Text auftreten, erläutert werden. Die Lehrperson kann auf Wörter, die im Deutschen identisch sind, verzichten, wie zum Beispiel sp. el zoo dt. der Zoo; sp. beige dt. beige. Einzuführen ist dagegen Lexik, die zum Verständnis des Unterrichtsgeschehens (s.o. z.B. für die Bearbeitung von Texten/Arbeitsaufträgen) unerlässlich ist (vgl. Neudecker 2011).
Das Ziel der Sprachaufnahmephase liegt in der Bedeutungsklärung neuer Begriffe. Des Weiteren sollte die zu erlernende Lexik in gesprochener sowie geschriebener Sprache vorgestellt werden, damit das Laut- und das Schriftbild ersichtlich sind (vgl. Nieweiler 2006: 177). Einige Didaktiker legen hierbei eine Reihenfolge fest (vgl. Doyé 1971: 34); andere (vgl. Nieweiler 2006: 177) verweisen lediglich auf die Bestandteile der Sprachaufnahmephase. In dieser Arbeit wird keine feste Abfolge der Komponenten der Sprachaufnahmephase berücksichtigt, da jede Vokabelpräsentation einmalig ist und die Aspekte situationsgerecht berücksichtigt werden sollen.
Relevant ist es im Prozess des Wortschatzerwerbs, dass nicht nur die Lehrperson die Vokabeln mündlich und schriftlich produziert. Die Schülerinnen und Schüler sollten dies ebenfalls, um mit den Wörtern vertraut zu werden und diese in ihren aktiven Wortschatz aufzunehmen (vgl. Wiechert 2007: 24-27). Manche Lehrkräfte integrieren die Produktion seitens der Lernenden schon in die Sprachaufnahmephase; andere verfolgen diese erst im weiteren Verlauf des Erwerbs. Basierend auf der Annahme des Unterrichts als Kontinuum (vgl. ebd.: 24) wird im Praxisteil lediglich analysiert, ob die grundlegenden Komponenten der Aufnahmephase, sei es seitens der Lehrkraft oder der Schülerinnen und Schüler, berücksichtigt wurden (vgl. Kapitel 3).
2.4 Berücksichtigung des mentalen Lexikons in der Wortschatzarbeit
Im Hinblick auf die in Abschnitt 2.3 beschriebene Aufnahmephase wird im Folgenden auf die Berücksichtigung des mentalen Lexikons in der Wortschatzarbeit eingegangen.
2.4.1 Das mentale Lexikon
Als mentales Lexikon wird „die Repräsentationsweise des Sprachwissens im Gedächtnis“ bezeichnet (Rössler 2009: 5). Diese metaphorische Bezeichnung beschreibt ein Netzwerk von vielfältig miteinander verknüpften Wörtern im Langzeitgedächtnis. Vermutlich sind diese Wörter nach syntaktischen und morphologischen Gesichtspunkten sowie als komplette Lexeme und Morpheme verankert. Beim Erlernen einer Fremdsprache entsteht wahrscheinlich kein zweites mentales Lexikon, sondern die fremdsprachlichen Vokabeln werden in die vorhandenen Subsysteme integriert. Ist ein Wort im aktiven oder passiven Wortschatz vorhanden, gilt es somit gleichzeitig als verankert im mentalen Lexikon.
Des Weiteren gibt es das episodische Gedächtnis, das als Vorstufe zum mentalen Lexikon gesehen werden kann. Ist die Bedeutung eines Wortes noch nicht im Gedächtnis gespeichert, ist es trotzdem möglich, dass die Schülerinnen und Schüler die entsprechende Vokabel wiedererkennen, ohne, dass sie die Bedeutung erinnern. Das kann eintreffen, wenn die Erstbegegnung mit einer Vokabel Aufmerksamkeit erregt hat, und eine Erinnerung an diese Situation in Verknüpfung mit dem Begriff gegeben ist. Das kann den Erwerb, das heißt die spätere Verankerung des Worts im Lexikon, positiv beeinflussen. Es ist zu beachten, dass Lexik jedoch nicht immer über das episodische Gedächtnis erworben wird (vgl. ebd.).[6]
2.4.2 Beispiele von Faktoren, die die Erstbegegnung mit Wörtern nachhaltig beeinflussen
Im nächsten Abschnitt werden basierend auf der Funktionsweise des mentalen Lexikons ausgewählte Faktoren präsentiert, die sich positiv auf eine möglichst nachhaltige, möglichst effektive Erstbegegnung mit zielsprachlichem Vokabular auswirken (vgl. ebd.). Diese müssen nicht nur in der Sprachaufnahmephase Anwendung finden, sondern können auch im weiteren Verlauf der Wortschatzarbeit berücksichtigt werden.
2.4.2.1 Die multisensorische Einführung
Eine multisensorische Einführung zielsprachlicher Lexik bedeutet, dass hierbei unterschiedliche Wahrnehmungskanäle wie das Hören, das Sprechen, das Tasten und das Sehen einbezogen werden. Die Schülerinnen und Schüler verwenden somit mehr als einen Wahrnehmungskanal, was eine effektivere Speicherung des Vokabulars ermöglichen soll (vgl. Rössler 2009: 6):
Lexikalisches Wissen ist nicht nur linkshemisphärisch, also begrifflich-abstrakt verankert, sondern auch in der rechten Hirnhälfte, also visuell, akustisch oder motorisch (ebd.: 5).
Beim Lernen durch das Hören können ungefähr 20 % der präsentierten Informationen behalten werden, durch Sehen rund 30%, durch Sprechen 70 % und durch Tasten mit den Händen ca. 90 % (vgl. Nodari 2006). Je nach Lerntyp[7] erhalten diese Wahrnehmungskanäle unterschiedliche Bedeutung. Um zu gewährleisten, dass bei allen Schülerinnen und Schülern die Erstbegegnung mit zielsprachlichen Wörtern möglichst nachhaltig verläuft, ist es sinnvoll, den Aspekt der multisensorischen Einführung zu berücksichtigen (vgl. ebd.).[8]
2.4.2.2 Das kontextualisierte und vernetzte Lernen
Als Kontext wird „der größere situative Zusammenhang, in dem Wörter in der Zielsprache verwendet werden“, bezeichnet (Rössler 2009: 5). Zielsprachliche Begriffe sollten nicht isoliert eingeführt, sondern in Verbindung mit anderen lexikalischen Einheiten präsentiert werden. So können die Lernenden diese später adäquat anwenden und im Gedächtnis speichern. Ebenfalls sollten neue Begriffe im nachfolgenden Verlauf der Wortschatzarbeit in weiteren Kontexten eingebettet sein,
um sie vielfältiger und damit nachhaltiger im mentalen Lexikon zu verankern und so peu à peu ihr Bedeutungsspektrum zu erschließen (…) Je reicher der Worteindruck, desto tiefer wird das Wort im Langzeitgedächtnis gespeichert (ebd.: 7).
Für die Verankerung im mentalen Lexikon gilt auch ein geordneter Aufbau der Präsentation, also dass die zu erlernenden Wörter nach verschiedenen Gesichtspunkten sortiert sind, als relevant. Drei Ordnungsprinzipien unterscheiden Henrici/Riemer (1996: 197). Zu den semantischen Aspekten gehören zum Beispiel Subordinationen, das heißt, Wörter, wie Gurke und Salat, die zu dem Oberbegriff Gemüse zählen. Kollokationen sind mit einem Substantiv verbundene Tätigkeiten wie Eis essen. Eine Koordination umfasst Begriffe eines Themenfelds. Eine weitere Ordnung sind grammatische Gesichtspunkte wie Pronomina und Modalverben. Die Einteilung nach thematisch-situativen Aspekten beinhaltet u.a. die Präsentation im Kontext. So sollte das Verb einkaufen nicht separiert eingeführt werden, sondern in Bezug zu thematischen Punkten wie Einkaufszentrum, Läden, Marken stehen (vgl. ebd.).
2.4.2.3 Die exzeptionelle und emotionale Darbietungsart
Eine exzeptionelle Darbietungsweise, die Präsentation von Vokabular in einer schüleransprechenden Form, führt zur Aktivierung des Gehirns. In Folge dessen können neue Wörter gut im mentalen Lexikon verankert werden. Auch die Herstellung eines Lernerbezugs zum Beispiel durch Aktivierung des Vorwissens und der Einbezug des persönlichen Interesses (zum Beispiel Berücksichtigung individuell bedeutsamer Wörter) können die Speicherung im Gedächtnis sowie die Motivation zum Weiterlernen positiv beeinflussen (vgl. Rössler 2009: 5-9).[9]
2.5 Von der Lehrperson bewusst gesteuerte Semantisierungen
Nach der Erläuterung der für eine Erstbegegnung mit Wörtern positiven Faktoren wird im Folgenden beispielhaft dargestellt, welche Semantisierungsmöglichkeiten es innerhalb der Sprachaufnahmephase gibt.
Bewusste Semantisierung bedeutet, dass die Lehrkraft deutlich auf die Bedeutungserklärung eines Begriffs hinweist. Hierbei können zwei Formen unterschieden werden: Die verbale, das heißt sprachliche Semantisierung und die nonverbale, also die nicht sprachliche Semantisierung (vgl. Thaler 2012: 227), die nachfolgend beispielhaft beschrieben werden.
2.5.1 Beispiele der nonverbalen Semantisierung
Mit Mimik, Gestik, Vormachen, Visualisierung und auditiven Hilfen können zielsprachliche Ausdrücke untermalt werden: Durch den Einsatz von mimischen Elementen wie Augen und Augenbrauen, Mund, Nase und Stirn können Emotionen offenbart werden (vgl. John/Vesenmayer o.J.). Möchte die Lehrperson das Adjektiv triste (dt. traurig) erklären, kann sie hierzu einen traurigen Gesichtsausdruck imitieren und dabei, um den Begriff in einen Satz einzubetten, den Ausdruck estoy triste (dt. ich bin traurig) verwenden. So können die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Bedeutung des Adjektivs triste (dt. traurig) herausfinden, sondern wissen auch, wie sie einen Gefühlszustand ausdrücken können.
Ähnlich verhält es sich mit gestischen Elementen, die zum Beispiel verbale Ausdrücke mit Armen, Händen und Fingern illustrieren können (vgl. ebd.). Soll den Lernenden erklärt werden, dass sie einen Text schreiben sollen, doch ihnen ist das Verb escribir (dt. schreiben) unbekannt, könnte die Lehrperson dieses mit einer entsprechenden Handbewegung untermalen.
Des Weiteren können neue Vokabeln durch Vormachen illustriert werden (vgl. Haß 2006: 119). Bei Einführung des Verbs correr (dt. laufen) kann die Lehrperson im Klassenzimmer umherlaufen und den Satz yo corro (dt. Ich laufe) sagen. Den Lernenden ist so neben der Bedeutung ebenfalls die erste Person Singular des Verbs geläufig.
Eine weitere nonverbale Semantisierungsmöglichkeit ist die Visualisierung (vgl. Rössler 2009: 6). Möchte die Lehrperson das Nomen el coche (dt. das Auto) einführen, ist es vorstellbar, dieses an die Tafel zu zeichnen, ein Bild oder ein entsprechendes Objekt (zum Beispiel ein Spielzeugauto) zu zeigen. Die Kollokation ir en coche (dt. mit dem Auto fahren) kann anschließend eine mögliche Verwendung des Nomens im Kontext aufzeigen.
Mit auditiven Hilfen ist es ebenfalls möglich, eine Vokabel zu erklären. Soll der Ausdruck el teléfono suena (dt. das Telefon klingelt) dargestellt werden, kann im Moment des Sprechens tatsächlich das entsprechende Geräusch zum Beispiel auf einer CD ertönen (vgl. Schmitz 2006: 10).
2.5.2 Beispiele der verbalen Semantisierung
Die verbale Semantisierung kann ein- oder zweisprachig stattfinden. Einsprachige Erläuterungen können zum Beispiel in Form von Definitionen, Umschreibungen, Charakterisierungen, Beispielen, Synonymen und Antonymen in den Unterricht einbezogen werden.
Soll das Nomen el almuerzo (dt. das Mittagessen) erklärt werden, bietet es sich an, das mittels einer Definition durchzuführen (vgl. Rössler 2009: 6). Die Lehrperson könnte sagen: El almuerzo es la comida que comemos al medio día (dt. Das Mittagessen ist das Essen, das wir mittags verzehren.).
Auch Umschreibungen sind möglich (vgl. Aufderstraße et. al. 2003: 27). Wird der Begriff el día festivo (dt. Feiertag) beschrieben, könnte die Lehrkraft folgenden Satz gebrauchen: En días festivos nadie trabaja y muchas veces hay celebraciones (dt. An Feiertagen arbeitet niemand und oftmals gibt es Feierlichkeiten.).
Des Weiteren können Charakterisierungen Bestandteil des Unterrichts sein (vgl. ebd.). In diesem Beispiel wird das Wort el león (dt. Löwe) eingeführt: El leónes un animal grande y salvaje.A él le gusta dormir y cazar otros animales cuando tiene hambre (dt. Der Löwe ist ein großes und wildlebendes Tier. Es gefällt ihm, zu schlafen und andere Tiere zu jagen, wenn er Hunger hat.).
Ebenfalls sind Beispiele denkbar (vgl. ebd.): Soll die Vokabel la capital (dt. die Hauptstadt) erklärt werden, könnte ein entsprechender Satz Madrid es la capital de España (dt. Madrid ist die Hauptstadt Spaniens.) sein.
Ist den Lernenden das Verb empezar (dt. beginnen) bekannt und sie stoßen in einem gegebenen Kontext auf das Verb comenzar (dt. anfangen), können diese als Synonyme eingestuft und die Bedeutung mittels des bekannten Verbs erschlossen werden (vgl. ebd.).
Ähnlich ist es mit Antonymen (vgl. ebd.). Stoßen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel im Themenfeld Kleidung auf das Adjektiv barato (dt. billig) und sie kennen schon bereits das Wort caro (dt. teuer), können diese Adjektive im Kontext als Antonyme gegenübergestellt werden.
Als zweisprachige Semantisierungsmöglichkeiten gibt es die Übersetzung in die Muttersprache. Hierbei ist es möglich, dass die Lehrperson oder sprachlich gute SuS Wörter oder Arbeitsanweisungen auf Deutsch übersetzen. In der Phrase El tiburón vive en el mar (dt. Der Haifisch lebt im Meer.) ist den Lernenden das Nomen el tiburón (dt. der Haifisch) unbekannt. Also könnte die Lehrperson sagen El tiburón, der Haifisch, vive en el mar. Bei dieser Methode sollte jedoch berücksichtigt werden, dass sie nicht permanent angewendet wird:
Die Folge ist, dass sich auch die Lernenden keine Mühe geben, die (…) Äußerungen zu verstehen, weil sie ja wissen, dass im Zweifelsfall doch alles in deutscher Sprache wiederholt wird (Solmecke 1998: 33).
In dem konkreten Beispiel bietet es sich eher an, el tiburón (dt. der Haifisch) durch eine Definition oder Visualisierung zu erläutern. Die Übersetzung in die Muttersprache könnte dagegen bei sehr komplexen Ausdrücken wie der Konjunktion por eso (dt. deswegen), die nur schwierig mittels anderer Methoden erklärbar ist, Anwendung finden.
Rössler (2009: 6) weist darauf hin, dass im Unterrichtsalltag nicht alle genannten Kriterien gleichermaßen berücksichtigt werden können. Des Weiteren ist auf die jeweilige neue Lexik zu achten - nicht alle Wortarten eignen sich für jede Präsentations- oder Semantisierungsart. Bei der Semantisierung durch Vormachen sollte diese bei nicht alltäglichen Aktivitäten und eventuell bestehender Verletzungsgefahr nicht angewendet werden (vgl. Haß 2006: 119). Ebenfalls ist der Einsatz von Mimik und Gestik begrenzt, wenn abstrakte Deiktika oder Synsemantika wie Konjunktionen erläutert werden müssen. In diesem Fall bietet sich primär die Übersetzung in die Muttersprache an, um die Schülerinnen und Schüler nicht lange die Bedeutung erraten zu lassen und eine eindeutige Klärung zu gewährleisten. Auch wenn die Lernenden nach mehrfachen Erläuterungen die Bedeutung einer Vokabel nicht erfassen können, sollte aus den genannten Gründen der Einsatz der Muttersprache erfolgen. Bei der Verwendung nonverbaler Techniken können Missverständnisse auftreten. Zeigt die Lehrperson die Abbildung eines Baums und möchte damit die Vokabel la haya (dt. die Buche) erklären, kann es sein, dass die Lernenden den Begriff nicht mit einer Buche, sondern mit einem Baum gleichsetzen. Hierbei kann eine anschließende Übersetzung ins Deutsche die falsche Auslegung klären (vgl. Butzkamm 2004: 98).
3. Die Gestaltung der Sprachaufnahmephase in der Schulpraxis
Im folgenden Abschnitt sind Unterrichtsausschnitte einzelner Lehrkräfte dargestellt, die ich an einem Hamburger Gymnasium begleitet habe. Bei einigen hospitierte ich ein halbes Jahr lang im Spanischunterricht; bei anderen nur wenige Stunden. Des Weiteren habe ich den Spanischunterricht zweier Lehrpersonen für ungefähr 20 Stunden übernommen. Verschiedene Situationen aus meinem gestalteten Unterricht sind ebenfalls nachfolgend dargestellt. Aufbauend auf den zuvor erläuterten theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2) wird in den nachfolgend beschriebenen Unterrichtsbeispielen die Umsetzung der Komponenten der Sprachaufnahmephase, insbesondere die Semantisierung neuer Lexik unter Berücksichtigung einiger für die Erstbegegnung von Wörtern relevanten Faktoren, analysiert.
3.1 Die Gestaltung der Sprachaufnahmephase seitens Lehrpersonen
In der 6. Klasse von Frau B. sollten die Schülerinnen und Schüler ihren Wortschatz erweitern. Bis zu meinem Unterrichtsbesuch absolvierten sie acht Spanischstunden und konnten bereits Angaben zu ihrer eigenen Person zielsprachlich formulieren. In der besuchten Stunde führte die Lehrkraft neue Lexik folgendermaßen ein: Sie legte ohne Vorankündigung eine Folie auf den Overheadprojektor, auf der sich ungefähr 10 verschiedene Abbildungen sowie die zugehörigen Vokabeln befanden. Diese umfassten Lexik von el perro (dt. der Hund) bis hin zu el sol (dt. die Sonne) und waren nicht nach Gesichtspunkten geordnet. Frau B. zeigte nacheinander auf die Darstellungen und fragte die Schülerinnen und Schüler jedes Mal ¿Qué es? (dt. Was ist das?). Diese mussten die entsprechende Vokabel im Chor vorlesen. Bei unangemessener Intonation wiederholte Frau B. den Begriff und die Lernenden mussten diesen erneut nachsprechen. Danach wandte sich Frau B. einem anderen Unterrichtsthema zu.
Positiv an dieser Vokabeleinführung sind die mehrkanalige Präsentation sowie die Berücksichtigung aller Komponenten der Sprachaufnahmephase. Durch die visuelle Verknüpfung von Wort und Bild können die Schülerinnen und Schüler das Schriftbild sowie die Bedeutung (diese war hier auf Grund der sehr aussagekräftigen Abbildungen eindeutig) erfassen und sich im Chor mit der Intonation vertraut machen. So eine multisensorische Einführung wirkt sich förderlich auf die Speicherung der Wörter im mentalen Lexikon aus (vgl. Abschnitt 2.4.2.1).
Unter Berücksichtigung der in Kapitel zwei beschriebenen Theorie sind einige Kriterien denkbar, um diese Form der Sprachaufnahmephase zu optimieren: Die Lehrperson sollte zunächst im Rahmen der Vorauswahl Vokabeln, die für den von ihr gestalteten Unterricht notwendig sind, herausfiltern und diese nach Gesichtspunkten sortieren (vgl. Teilkapitel 2.4.2.2). Fokussiert sie zum Beispiel das Ziel, dass die Lernenden ihre Ferien beschreiben sollen, könnte sie vorbereitend zum Thema las vacaciones (dt. die Ferien) passende Vokabeln auswählen, präsentieren sowie für die individuellen Ferienerlebnisse bedeutsame Lexik integrieren (vgl. Abschnitte 2.4.2.2/2.4.2.3). Diese Wörter könnten mit einem Kontext verbunden werden, so dass die Schülerinnen und Schüler entsprechende Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Soll zum Beispiel die Vokabel las gafas de sol (dt. die Sonnenbrille) im Kontext dargestellt werden, könnte mit Hilfe des Verbs llevar (dt. tragen) der Ausdruck llevar gafas de sol (dt. eine Sonnenbrille tragen) aufgezeigt werden. So wäre den Lernenden eine mögliche Verwendung bekannt. Mit Hilfe dieser Kriterien wird die Verankerung der Bedeutung der Wörter im mentalen Lexikon vereinfacht (vgl. Abschnitte von 2.4.2). Durch den hier erfolgten abrupten Einstieg in die Vokabellernphase, der Präsentation beliebiger ungeordneter Vokabeln sowie den fehlenden Lernerbezug schienen die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten zu haben, einen Zugang zu den präsentierten Begriffen zu finden. Auch wurde mir nicht deutlich, weshalb die Heranwachsenden genau diese Wörter erlernen sollten, da keine weitere Unterrichtsarbeit mit diesen bevorstand.
Eine andere Lehrperson, Frau K., begleitete ich ein halbes Jahr lang zunächst in der 7., nach den Sommerferien in der entsprechenden 8. Klasse, die seit 2 Jahren Spanisch erlernt. Bei ihr bestand die Sprachaufnahmephase stets darin, dass sie mit den Schülerinnen und Schülern thematisch ausgerichtete Texte des Lehrbuchs las (hier: el mobiliario dt. die Einrichtung). Danach wies sie auf einige Sätze mit neuen Vokabeln hin und übersetzte sie beziehungsweise die Lernenden auf Deutsch:
Frau K. - Aquí se dice “En el salón hay tres sillas”. ¿Qué significa silla?
Lernende - schweigen oder sagen Stuhl.
Positiv zu vermerken sind die kontexteingebettete Präsentation der Vokabel silla (dt. Stuhl) und der Bezug zu einem Themenfeld. Die Lexik kann unter dem Bereich Einrichtung im mentalen Lexikon verankert werden und eine mögliche Verwendung im Sprachgebrauch ist ebenfalls bekannt (vgl. Abschnitt 2.4.2.2). Auch sind hier alle Aspekte der Sprachaufnahmephase, d.h. das Schrift- und Lautbild sowie die Bedeutungserklärung des Nomens berücksichtigt worden (vgl. Teilkapitel 2.3).
Nachteilig scheint die nicht erfolgte Vorentlastung der Vokabeln, die in dieser Klassenstufe seitens der Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden könnte (vgl. Abschnitt 2.3). Auffallend war, dass die Lernenden viel Lexik nicht kannten und sie die zahlreichen Übersetzungen und den Textzusammenhang kaum erfassen konnten. Mit einer angemessenen Vorentlastung, die das globale Textverständnis sichert, könnte dem entgegengewirkt werden. Eine Übersetzung ins Deutsche ist nach Butzkamm (2000) zwar nicht abzulehnen, sollte jedoch nur in bestimmtem Maße erfolgen, um die Schülerinnen und Schüler nicht zur Bequemlichkeit zu erziehen (vgl. Abschnitt 2.5.2). Für die Bedeutungserklärung der Vokabel la silla (dt. der Stuhl) eignen sich beispielsweise nonverbale Techniken wie das Zeigen auf einen Stuhl im Klassenraum, die auch mit verbalen Möglichkeiten, wie z.B. der Definition Es un mueble para sentarse (dt. Das ist ein Möbelstück, um sich darauf zu setzen.) erweitert werden können, um das Nomen in einem weiteren Kontext zu präsentieren (vgl. Teilkapitel 2.5). Wie in Abschnitt 2.4.2.2 erwähnt, wirkt sich die Erfassung mehrerer Kontexte gut auf die Speicherung im Gedächtnis aus. Auch wäre so die vollständige Vokabel mit Artikel untergebracht.
Frau M., die ich ebenfalls ein halbes Jahr lang im Spanischunterricht begleitete, variierte in den Einführungsmöglichkeiten neuer Lexik. Um Arbeitsaufträge zu verdeutlichen, verwendete sie z.B. visuelle Hilfsmittel. In der 6. Klasse waren den Schülerinnen und Schülern die spanischen Begriffe für Einzel- (sp. trabajo individual) und Gruppenarbeit (sp. trabajo en grupos) unbekannt. Somit sagte sie die Vokabeln und zeigte den Lernenden dabei entsprechende Symbolkarten, auf denen ein einzelner beziehungsweise eine Gruppe von arbeitenden Schülerinnen und Schülern abgebildet war. Diese pinnte sie in den jeweiligen Arbeitsphasen an die Tafel, so dass sie für alle ersichtlich waren.
In der 8. Klasse, die Spanisch als dritte Fremdsprache neu aufnahm, verdeutlichte Frau M. den unbekannten Arbeitsauftrag rellenad la hoja (dt. vervollständigt das Arbeitsblatt), in dem sie bei Erwähnung des Verbs rellenad eine entsprechende Schreibbewegung mit der Hand vollzog und bei la hoja das Arbeitsblatt zeigte.
Als sie mit den Heranwachsenden ein Lied anhören wollte, sagte sie mit einer untermalenden Gestik, in dem sie ihr Ohr Richtung CD-Player drehte escuchamos (dt. wir hören) und kurz bevor sie das Lied abspielte una canción (dt. ein Lied). Die unbekannten Vokabeln waren auf den stets nachfolgend ausgeteilten Arbeitsaufträgen schriftlich ersichtlich.
Des Weiteren behandelte Frau M. in der 8. Klasse das Thema presentarse (dt. sich vorstellen). Die Schülerinnen und Schüler konnten schon ihren Namen und Wohnort zielsprachlich formulieren. Nach Rückgriff auf dieses Vorwissen erweiterte Frau M. den thematischen Bereich. Sie schrieb einige, in deutschen Schulen zu erlernende Sprachen an die Tafel (Koordination des Themenfelds Sprachen). Im Anschluss las sie diese vor und sagte hablo francés (dt. ich spreche französisch) und gab ein zielsprachliches Beispiel: bonjour, je m’appelle Lea (dt. Guten Tag, ich heiße Lea.). Ähnlich vollzog sie dies mit weiteren Sprachen. So wussten die Schülerinnen und Schüler, welche Sprache sich hinter der entsprechenden Vokabel verbarg. Um den Lernenden die Nomina profesor (dt. Lehrer) und alumno (dt. Schüler) zu verdeutlichen, verwendete Frau M. verbale Semantisierungen. Stellvertretend für den Beruf Lehrer nannte sie Namensbeispiele von Lehrern der Schule: Señor X es profesor, Señor Y es profesor… (dt. Herr X ist Lehrer, Herr Y ist Lehrer…) und charakterisierte die Vokabel: Un profesor trabaja en un instituto. Le gusta el trabajo con alumnos (dt. Ein Lehrer arbeitet in einer Schule. Ihm gefällt die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern.). Hier erfolgte die Überleitung zum Begriff alumno. Sie gab ebenfalls Namensbeispiele von Lernenden und setzte die Vokabel in Beziehung zum Lehrer. Anschließend konnte die Lerngruppe ausdrücken, dass sie Lernende sind. Das wurde an der Tafel notiert.
Positiv erschien in Frau M.s Unterricht die Berücksichtigung aller Komponenten der Sprachaufnahmephase (vgl. Teilkapitel 2.3). Das Schrift- und das Lautbild wurden bei den beschriebenen Situationen für die Lernenden deutlich. Sie führten die Anweisungen von Frau M. wie gewünscht aus. Aus diesem Verhalten kann zwar geschlossen werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der neuen Wörter verstanden haben. Fraglich ist jedoch, ob die Lernenden jeden verwendeten Begriff exakt erfasst haben. Sie könnten beispielsweise bei dem Auftrag rellenad la hoja (dt. vervollständigt das Arbeitsblatt) durch die gestische Handbewegung das Verb rellenar mit schreiben gleichsetzen. Zunächst erscheint das nicht fatal, da es hier darum ging, den Arbeitsauftrag zu verstehen, doch im weiteren Unterrichtsverlauf sollten die Schülerinnen und Schüler die exakte Bedeutung erfahren, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Hierfür bietet sich eine deutsche Übersetzung an (vgl. Teilkapitel 2.5.2).
Des Weiteren kann sich die mehrkanalige Einführung positiv auf die Speicherung der Wörter im mentalen Lexikon auswirken (vgl. Teilkapitel 2.4.2.1). Frau M. bediente sich stets des Schrift- und Lautbilds, das seitens der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrperson produziert wurde, der visuellen Darstellungen (Symbolkarten der Arbeitsformen) und Realien wie dem zu vervollständigen Arbeitsblatt sowie der akustischen Untermalung des Begriffs Lied. Ebenfalls war der Einbezug des Lieds schüleransprechend, da der Song ihrem Geschmack entsprach. Insofern könnten sie im episodischen Gedächtnis die für sie motivierende Situation in Verbindung mit der Vokabel erinnern (vgl. Abschnitt 2.4.1). Auch der Einbezug des Vorwissens bei der Präsentation der eigenen Person sowie die thematische Strukturierung dürften sich gut auf die Speicherung im mentalen Lexikon auswirken (vgl. Teilkapitel 2.4.2.2/2.4.2.3). Insofern wurden hier viele Kriterien einer erfolgreichen Sprachaufnahmephase im Unterricht vereint. Es bietet sich jedoch an, hin und wieder auf das Deutsche zurückgreifen, um die Bedeutung einzelner Vokabeln exakter klären zu können (vgl. Abschnitt 2.5.2)
3.2 Die eigene Gestaltung der Sprachaufnahmephase
In dem von mir gestalteten Spanischunterricht habe ich ebenfalls versucht, verschiedene Semantisierungen umzusetzen. In einer Unterrichtsstunde der 8. Klasse war zum Verständnis der meisten Arbeitsaufträge das Verb buscar (dt. suchen) relevant, welches die SuS nicht kannten. Sie bekamen z.B. Arbeitsblätter mit folgenden Phrasen: Tú eres Juana.Busca a tu amiga Julia. (dt. Du bist Juana. Suche deine Freundin Julia.) Folglich erhielt jeder der Lernenden für die bevorstehende Gruppenarbeit ein Pseudonym und sollte eine Person mit einem bestimmten Namen in der Lerngruppe finden. Bis auf das Verb buscar (dt. suchen) waren ihnen alle Vokabeln bekannt. Ich entschied mich dafür, den Arbeitsauftrag vorzuspielen. Im gegebenen Beispiel hieß ich folglich Juana und musste meine Freundin Julia suchen. Ich lief suchend durch die Klasse, was ich durch eine entsprechende Mimik verdeutlichte und sprach schließlich Schülerinnen und Schüler an: ᵢBuenos días! Me llamo Juana, ¿tú eres Julia? (dt. Guten Tag. Ich heiße Juana. Bist du Julia?). Diese Prozedur vollzog ich zwei Mal, bis ich auf eine Schülerin traf, die für diesen Part Julia hieß. Mittels des Vorspielens verstanden die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des zuvor unbekannten Verbs und konnten den beschriebenen sowie die nachfolgenden Arbeitsaufträge ohne erneute Erklärung umsetzen.
Für die Fortführung des Themas Mode mussten in der 7. Klasse weitere Adjektive zur Beschreibung von Kleidung sowie thematische Vokabeln zur bevorstehenden Modenschau eingeführt werden: Unter dem Oberbegriff describir la ropa (dt. Kleidung beschreiben) schrieb ich einige spanische Adjektive an die Tafel; bereits bekannte (anknüpfend an das Vorwissen) sowie neue. Zum Beispiel wussten die Schülerinnen und Schüler nicht, welche Bedeutung ancho (dt. weit) hat. Da ich an dem Tag eine etwas weitere Hose trug, zog ich an der Außenkante der Hosenbeine und sagte: Es un pantalón ancho (dt. Das ist eine weite Hose.). Auch war den SuS das Adjektiv estrecho (dt. eng) unbekannt. Somit band ich das Antonym zu ancho in die visuelle nonverbale Semantisierung mit ein und legte die abstehende Hosenseite ganz eng an mein Bein an und meinte: Es un pantalón estrecho (dt. Das ist eine enge Hose.).
Um das Nomen el/la modelo zu erklären, projizierte ich eine entsprechende Abbildung auf den Overheadprojektor und sagte zunächst mit Hilfe der visuellen Erklärung: es un modelo (dt. Das ist ein Modell.). Des Weiteren gab ich zur Begriffsverdeutlichung eine Definition: Un modelo es una persona que presenta la nueva moda (dt. Ein Modell ist eine Person, die neue Mode präsentiert.).
Ein Laufsteg (sp. la pasarela) war ebenfalls auf der Folie abgebildet. Hierfür wählte ich unter Einbezug der zuvor erklärten Vokabel eine Umschreibung: Los modelos caminan por la pasarela (dt. Die Models laufen auf dem Laufsteg.).
Bei allen beschriebenen Einführungen neuer Vokabeln waren die Schriftbilder den SuS entweder an der Tafel oder auf den nachfolgend ausgeteilten Arbeitsblättern ersichtlich.
Bei den Begriffseinführungen habe ich mich bemüht, die Kriterien der Sprachaufnahmephase zu berücksichtigen (vgl. Teilkapitel 2.3). So sind das Laut- und Schriftbild stets transparent gewesen und die Einbettung in einen Kontext gelang mir zum Beispiel bei den zwei letzten erwähnten Semantisierungen durch Verknüpfung der visuellen und verbalen Komponenten. Im Rahmen der Vorauswahl wurden für die Arbeit im Unterricht notwendige Vokabeln ausgewählt (vgl. Abschnitt 2.3) und zu einem Themenfeld (z.B. Mode) zugeordnet (vgl. Teilkapitel 2.4.2.2). Auch die mehrkanalige Einführung wurde im Zuge der visuellen und verbalen Darstellung berücksichtigt (vgl. Abschnitt 2.4.2.1). Besonders schüleransprechend wirkte das Vorspielen des Verbs buscar (dt. suchen), was ich an dem gebannten Interesse der Schülerinnen und Schüler bemerkte und mir zusätzlich durch die Lehrkraft bestätigt wurde. Da ich das Verb in den nachfolgenden Arbeitsaufträgen nicht erneut erklären musste, könnte es schon in den passiven Wortschatz übergegangen sein (vgl. Teilkapitel 2.4.2.3).
3.3. Das Verhältnis von Theorie und Praxis
4. Fazit und Ausblick
Die theoretische Einführung in das Thema Wortschatz verdeutlichte, welche Wortarten es gibt und, dass den Schülerinnen und Schülern ein aktiver, passiver und rezeptiver Wortschatz zu vermitteln ist (vgl. Abschnitt 2.1). Formen und Phasen der Wortschatzarbeit wurden im Teilkapitel 2.2 aufgezeigt. Auch wenn nach Wiechert (2007: 24) der Unterricht selber ein Kontinuum ist, erweist sich eine Differenzierung in Phasen für die Unterrichtsplanung als hilfreich (vgl. Abschnitt 2.2). Anschließend wurde erläutert, dass neue Lexik, die zum Verständnis von Arbeitsprozessen im Unterricht relevant ist, vorentlastend eingeführt werden kann (vgl. Abschnitt 2.3). Nach der Erwähnung der Komponenten der Sprachaufnahmephase, bestehend aus Laut- und Schriftbild sowie Bedeutungsklärung (vgl. Teilkapitel 2.3) wurden basierend auf der Funktionsweise des mentalen Lexikons Faktoren aufgezeigt, die sich positiv auf die Erstbegegnung mit Wörtern auswirken können (vgl. Abschnitt 2.4). Auch erklärte ich mögliche verbale und nonverbale Semantisierungen (vgl. Teilkapitel 2.5). Bei der praktischen Umsetzung ist zu beachten, dass nicht alle in der Theorie beschriebenen Möglichkeiten zur Einführung von Lexik für jedes Wort anwendbar sind und bei Verständnisschwierigkeiten auf eine Übersetzung in die Muttersprache zurückgegriffen werden sollte (vgl. Abschnitt 2.5). Die Praxis zeigte, dass Lehrpersonen trotz der begrenzten Vorbereitungszeit und gleichsamer Berücksichtigung anderer Aspekte des Bildungsplans im Unterricht viele in der Theorie beschriebenen Gesichtspunkte integrieren (vgl. Kapitel 3).
5. Literaturverzeichnis
Aufderstraße, Hartmut / Müller, Jutta / Storz, Thomas (2003): Delfin: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandbuch Bd. 3, Ismaning: Hüber.
Butzkamm, Wolfgang (2004): Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Eine neue Methodik für den Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Francke.
Doyé, Peter (1971): Systematische Wortschatzvermittlung im Englischunterricht, Braunschweig: Schrödel.
Falk-Frühbrodt, Christine (o.J.): “Lerntypen II” [http://www.iflw.de/wissen/lerntypen_II.htm, Stand: 25.09..2013].
Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung (2011): “Bildungsplan Gymnasium Sekundarstufe I Neuere Fremdsprachen” [http://www.hamburg.de/contentblob/2376246/data/neuere-fremdsprachen-gym-seki.pdf, Stand: 11.06.2013].