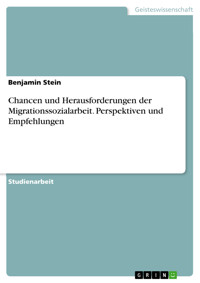Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Großstadt bricht ein Bus durch die Straßendecke hindurch in einen U-Bahn-Tunnel. Mehrere Menschen sterben. Zwei von ihnen - ein Mann Mitte dreißig und eine junge Frau - können erst nach Wochen geborgen werden. Unter dessen fristen die beiden eine Existenz in einem Reich zwischen Leben und Tod, Träumen und Ahnungen, Tanz und Taumel. Sie finden sich wieder in der dünnen Wand zwischen zwei Wohnungen, einem leeren Raum zwischen zwei fremden Leben, in dem nur sie sich bewegen können. Sie versuchen, den Abschied hinauszuzögern, den Abschied von ihren Irrtümern und sorgsam verborgenen Gefühlen, liebevollen und erschreckenden Erinnerungen. Und wenn sie auch nicht umkehren können, verändert sich auf dem letzten Stück Weg doch noch einmal ihr Leben und das der Menschen zu beiden Seiten der Wand - unbemerkt vom Rest der sie umgebenden Welt. "Ein anderes Blau" erschien 2008 nur in einer Kleinstauflage und ist seit Jahren vergriffen. Für diese Ausgabe hat Benjamin Stein den Text komplett überarbeitet und mit einem neuen Nachwort versehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benjamin Stein
Ein anderes Blau
Prosa für 7 Stimmen
In einer Großstadt bricht ein Bus durch die Straßendecke hindurch in einen U-Bahn-Tunnel. Mehrere Menschen sterben. Zwei von ihnen – ein Mann Mitte dreißig und eine junge Frau – können erst nach Wochen geborgen werden. Unterdessen fristen die beiden eine Existenz ineinem scheinbar zeitlosen Reich zwischen Leben und Tod, Träumen und Ahnungen, Tanz und Taumel. Sie finden sich wieder in der dünnen Wand zwischen zwei Wohnungen, einem leeren Raum zwischen zwei fremden Leben, in dem nur sie sich bewegen können. In Enge und mitunter in Furcht versuchen sie, sich noch einmal selbst zu begegnen und den Abschied hinauszuzögern, den Abschied von ihren Irrtümern und sorgsam verborgenen Gefühlen, liebevollen und erschreckenden Erinnerungen. Und wenn sie auch nicht umkehren können, verändert sich auf dem letzten Stück Wegs doch noch einmal ihr Leben und das der Menschen zu beiden Seiten der Wand – auf magische Weise und unbemerkt vom Rest der sie umgebenden Welt.
für Nadja
Nie war es schwieriger, Abschied zu nehmen, als jetzt.Doch die Zeit, Lebewohl zu sagen, ist gekommen.
Sag den verbotenen Küssen Adieu.Gib deiner Angst zum letzten Mal die Hand.Lass die Prinzessin noch einmal deinen Kopf ausgraben.Schau ihr lang ins Gesicht und liebe ihr Haar und ihr Augeund den stolzen Schwung ihrer Stirn.Sieh noch einmal hinein in den Rachen der Kinderträume.Gib dich noch einmal der Verlassenheit hinund lass deinen Atem stockenim Spinnenkessel der Nacht.
Du kannst das Loch nicht mit Wasser stopfen.Kein Kuss macht den Hunger wett.Atme aus und ein und öffne die Augenund jage die Herzvagabunden davon.
Sag: Adieu, die Zeit ist gekommen.Gib deiner Angst zum letzten Mal die Hand.
1
/Eva/ Dein Ausgehen am Morgen: ein Wort, ein Kuss; so flüchtig.
Während du über den Hof gehst, stehe ich am Fenster und winke. Doch du drehst dich nicht um, bemerkst mein Winken nicht und mein plötzliches Innehalten. Wie ich langsam die Hand sinken lasse und lächle, enttäuscht und entschuldigend zugleich, als hätte ich einen Fremden mit einem Freund verwechselt und ihn überschwänglich gegrüßt als jemanden, der er nie war.
Du hast die Hoftür geöffnet und bist fortgegangen. Du hast dich nicht umgedreht; und so ist dir all dies entgangen: mein Winken, mein Innehalten, mein stilles Aufgeben vor dem Tag, als ich die Gardine wieder vors Fenster zog und ins Dunkel des Zimmers zurücktrat.
Wo bist du, wenn ich mich mir entgegen beuge im großen Spiegel auf dem Flur? Wenn ich zu der Frau, die mir von dort entgegensieht, sage, dass sie sich kämmen soll; und niemand antwortet, und nichts geschieht?
Die Zigarette im Mundwinkel läufst du unruhig den Boulevard entlang. Am Bahnhof hast du die Aktentasche ins Schließfach gesperrt, den Mantel aufgeknöpft und die Haare aus der Stirn gestrichen.
Es ist Zeit.
Du steuerst auf das Café zu in der kleinen Passage, vor dem ich jeden Tag spiele, gegen Mittag. Ich werde noch vor dem Spiegel sitzen, wenn du dort ankommst, vor dem Spiegel sitzen mit Kamm und Schminke. Und so wirst du beschließen zu warten und einen Cognac bestellen.
Du weißt: Es kann nicht lange dauern, bis ich hinauskomme. Die Schminke ist ein gutes Alibi, noch Zeit verstreichen zu lassen. Doch auch diese Galgenfrist hat ein Ende. Das Rouge soll wirken.
Ich werde hinausgehen, den Klingelhut vor mir aufs Pflaster stellen und zu spielen beginnen. Von deinem Tisch aus wirst du mir lange zuschauen, genau auf all meine Gesten achten und die Regungen meines Gesichts: Was tut der Mund? Was die Augen?
Du wirst versuchen, dir alles genau einzuprägen, um es später vielleicht einmal wiederholen zu können. Das nennst du sprechen: Meinem Körper die Stimme ablauschen und sie kopieren. Du bestaunst meine Umarmung, meine Küsse ins Leere; und du glaubst, nicht zu wissen, wen ich küsse, doch dass ich liebe.
So kommst du, wie ausgehungert, jeden Tag. Abends sitzt du im zweiten Rang des Theaters, das Opernglas an die Augen gepresst, und mittags hier, an deinem Tisch im Café. Dein Zuschauen ist eine Art, von Liebe zu träumen, ohne an sie zu glauben: Sehen Sie meine Frau; mir genügt ihr Spiel. Und ich soll schweigen.
Nachher wirst du die Rechnung begleichen, das Café verlassen und eine Münze in meinen Hut werfen, um mir nichts schuldig zu bleiben, bevor Du heimkommst. Es beruhigt dich und schmerzt nur ein wenig.
Wie soll ich die Perücke herunterreißen, meine Rolle verlassen? Ich habe dir einen zweiten Cognac kommen lassen. Ich will die Münze nicht und dass du gehst ohne ein Wort. So steht es auf dem Zettel, den der Kellner dir reicht, mit einem Gruß von mir: Du solltest mich sehen, wenn ich dir winke. Du würdest erstaunt sein über dein Gefühl und umkehren.
Warum kommst du hierher? Was schaust du mir zu? Für dich ist doch all dies nur Geste, und ich bin nur Mimin, die die Schminke liebt, den Spiegel und die Flucht auf die Bühne. Du versuchst, meine Gesten zu deinen zu machen, und verzweifelst, weil es nie gelingt und dein Spielen nur ein ratloses Suchen ist.
Du hast nicht begriffen, dass ich um mehr spiele als um deine achtlos in meinen Hut geworfene Münze. Und nichts begriffen von der Vergeblichkeit meines Spiels und meines Winkens am Morgen. Du hast nichts begriffen.
Das ist ein Tag für dich: der Mantel offen, im Mundwinkel glimmt die Zigarette. Am Bahnhof liegt, gebändigt im Schließfach, die Aktentasche. Und du denkst: meine Frau, die Mimin, meine Frau, die die Schminke liebt und da ist, wenn ich komme und wenn ich gehe.
Das ist ein Tag für dich wie alle anderen.
Du bist fortgegangen und hast dich nicht umgedreht.
*
/Richard/ Es ist ein Kreisen, kein Punkt, kein Ort, an dem ich anhalten könnte, ausruhen für einen Augenblick, einen fliehenden Moment lang. Ich muss kreisen, unaufhaltsam, rastlos, bis zur Müdigkeit, bis zur Erschöpfung und über sie hinaus, muss kreisen, um das magische Zentrum eines Auges vielleicht, den Abgrund einer geweiteten Pupille, das lidlose Auge der Nacht.
Es ist ein Film. Jemand traktiert ein Klavier. Es ist ein Film, in dem ich mir selbst zusehe.
Erst ist da nicht mehr als eine graue, leicht gewellte Ebene und in ihr, sich schlängelnd, ein dunkles Band. Ein kleinblauer Fleck zittert im Rhythmus der weißen Hände über den Tasten des Klaviers. Tremolo.
Die Kamera fährt näher auf die Szene zu. Es ist eine Mühle an einem Bach, und ich bin mit Hanfseilen auf das Mühlrad gebunden, auf das von oben Wasser niederstürzt, ein stumpfsinnig gleichmäßiges Fallen. Das Rad dreht sich, hebt mich hoch, dreht sich, trägt mich hinab, dreht sich und taucht mich kopfüber ins Wasser.
Es ist ein Film. Jemand traktiert ein Klavier. Es ist ein Film, und die Leinwand reißt unter dem Aufprall des Lichts, kreuz und quer tausend Risse, haarfein. Der Projektor zerfällt zu einem Haufen von Kinderschuhen, Haaren und Zahnprothesen. Die weißen Hände verkrampfen sich, und das Klavier explodiert unter dem Aufschrei zerreißender Saiten.
Es ist ein Film. Jemand traktiert eine kleinblaue Mühle. Ich reite im Kreis um ein Auge, den Abgrund einer geweiteten Pupille, die lidlose Nacht.
*
/Daniel/ Ich merkte es sofort, als ich aus dem Haus trat. Etwas hatte sich verändert. Ohne das geringste Zeichen einer Vorankündigung war eine Grenze gezogen und das unmerkliche Ende von etwas dem schroffen Beginn von etwas anderem gewichen. Und dieses andere bestimmte nun den Gang der Dinge.
Es war der Schneegeruch, ein unbestechlicher Bote. Er hob sich ab von der Vielzahl der Gerüche dieses Morgens, hob sich heraus durch sein bloßes Dasein und ließ keinen Zweifel mehr zu. Es war Ende September. Der Sommer hatte endgültig ausgespielt, der Herbst unbarmherzig sein Regiment angetreten.
Gestern noch deutete nichts darauf hin. Es hatte keine Detonation gegeben. Still war sie vor sich gegangen, schleichend und so kaum wahrnehmbar, diese Veränderung der Natur. Doch nun war er da, der Schneegeruch. Schon sah ich Astskelette vor mir, zusammengefegte Berge faulender Blätter, kümmerliche Seiten eines Buches, die die Natur im letzten Vierteljahr mit den grellen Farben einer absurden Geschichte beschrieben hatte und unter die sich die Igel flüchten würden, um den Winter schlafend zu überleben.
Ich musste wach bleiben, konnte mich nicht zurückziehen in einen solchen Schlaf, lang, lang, ohne denken zu müssen, ohne etwas zu spüren und mich erst von den unverkennbaren Schwingungen des nahen Frühjahrs wieder wecken zu lassen.
Eines Tages, wusste ich, würde dieser Morgen kommen, mit der gleichen Unfehlbarkeit, mit der er jedes Jahr um diese Zeit gekommen war, vielleicht ein paar Tage früher oder später. Heute aber war es wie ein Überfall, traf mich so unerwartet, zu früh, zuunwiderruflich, mit solcher Strenge. Ich knöpfte den Mantel zu, zog den Hut tiefer und zündete eine Zigarette an, um den Schneegeruch nicht wahrnehmen zu müssen, ihn noch einmal loszuwerden, und sei es auch nur für den Augenblick. Das Unbeschwerte des Sommers hatte sich schon aus den Minuten verflüchtigt. Kälte würde einziehen in die Straßen, meine Kleider durchdringen, meine Haut, bis ins Innerste vordringen und mich lähmen.
Aufkreischend quält sich die Straßenbahn um die Ecke. Ich werfe meine Zigarette fort. Sie verglimmt auf dem Straßenpflaster. Ich möchte mein Gesicht verstecken, den Mantelkragen hochschlagen, damit niemand mein Gesicht sehen kann. Ich wünschte, es wäre aus Stein, verschlossen und reglos, damit keiner erfährt, dass ein Ereignis wie der Beginn einer neuen Jahreszeit mich verwirren kann.
Ich steige ein, finde einen freien Platz und sehe sofort angestrengt aus dem Fenster. Lass dich nicht ansehen, gib dich nicht preis, denke ich. Die Bahn füllt sich, an jeder Station steigen Leute ein, kaum einer aus. Ich wage ein erstes Mal, mich umzusehen.
Hatte ich erwartet, alle Augenpaare auf mich gerichtet zu finden? Niemand sieht mich an, keiner interessiert sich. Warum wundert es mich? Es ist doch nur wie jeden Morgen: Zeitungen,Bücher, hier und dort ein paar halblaute Gespräche. Wie mühelossie fertigbringen, worum ich mich an diesem ersten Herbstmorgen verzweifelt bemühe: mir nicht in die Seele blicken zu lassen, unerkannt zu bleiben, von Fragen und Antworten verschont.
Mir gegenüber sitzt eine junge Frau, ein Kind auf dem Schoß. Ich sehe sie an, dass ich fürchte, sie müsste es sofort bemerken,und es müsste ihr unangenehm sein, sodass sie sich abwendet. Aber sie wendet sich nicht ab. In ihren Zügen finden sich nicht die untrüglichen Zeichen der Unruhe, die mich überfallen hat, heute Morgen, als ich aus dem Haus trat, und die in meinen Augen glühen muss, ein Brennen. Da ist nichts.
Immer mehr Menschen steigen zu, deren Gesichter ich genau betrachte. Ich suche nach einer Unruhe wie der, die sich in meinem Innern eingenistet hat. Doch ich finde nichts als die Angst einiger vielleicht, zu spät zu kommen, weil sie die vorige Bahn verpasst haben. Der Herbst scheint sie nicht zu rühren. Sie nehmen ihn unbekümmert hin wie einen leichten Windstoß, wie alles, das, seit sie denken können, war, wie es ist: kein Grund zur Aufregung.
Die Straßenbahn hält, und ich steige aus. Von der Haltestelle bis zur Schule ist es nicht mehr weit, zweihundert Meter, eine von Kastanien gesäumte Allee entlang. Ich gehe langsam, den Kopf gesenkt. Es ist kalt.
Jemand ruft meinen Namen. Ich zucke zusammen. Ein Pflasterstein fliegt in die Krone einer Kastanie und prallt dumpf gegen einen Ast. Ich ziehe den Kopf ein, und der Stein landet vor meinen Füßen auf dem Pflaster. Es ist Kastanienzeit, und vor und nach der Schule treffen sich ein paar Jungen aus den mittleren Klassen in der Allee, um mit Stöcken und Steinen in die weit ausladenden Kronen nach Kastanien zu werfen. Meist brechen die stacheligen Gehäuse beim Herunterfallen auf, und man kann leicht die Kastanien herausnehmen. Sie werden dann ausgiebig poliert und verschwinden in den Hosen- und Jackentaschen der Jungen.
Manche Freundschaft hatte so begonnen. Besonders die Mädchen freuen sich, wenn ihnen in der Pause einer der Jungen heimlich eine solche warmbraune Frucht zusteckt. Sie betrachten die vielfach verschlungenen Linien auf der glänzenden Haut der Kastanie, sind glücklich und wissen zu danken, mit Blicken oder einer flüchtigen Berührung, die das Herz rasen macht und die Gesichter rot. Sie können verführerisch sein. Und die Jungen gehen immer wieder unter die Bäume, für einen Blick, für den kurzen Moment, den sie die Mädchenhaut spüren. Sie kennen keine Gefahr, und es hilft nichts, ihnen Strafe anzudrohen, ihnen zu versichern, dass die Kastanien in ein paar Wochen von selbst herunterfallen werden. Ein paar Wochen später wäre es nichts Besonderes mehr, eine Kastanie zu besitzen, und das Geschenk würde nicht mit der gleichen Dankbarkeit angenommen werden wie heute.
Ich habe die Jungen nicht erkannt, und es ist mir recht so. Durchgefroren betrete ich das Schulhaus, laufe, um schnell warm zu werden, die Treppe hinauf, mehrere Stufen auf einmal nehmend. Im Lehrerzimmer treffe ich Franziska. Sie lächelt mir zu.
Wie geht’s? fragt sie.
Danke gut, sage ich. Und beginne den Tag mit einer Lüge.
*
/Nina/ Ich hatte mich auf den Umzug gefreut, auf die neue Wohnung, mein erstes eigenes Zimmer. Wer weiß, wie viele Male ich es in Gedanken schon eingerichtet habe, auf immer andere Weise, wie lange ich schon davon träume, in dieses Zimmer einzuziehen.
Ich erinnere mich gut, wie oft sich meine Vorstellungen davon gewandelt hatten im Laufe der Zeit. Einmal stellte ich mir alte Möbel vor, ein anderes Mal ganz moderne, einmal Tapeten ohne Muster, ein andermal mit. Oder ich nahm mir vor, die Wände mit geometrischen Figuren zu bemalen. Ich hatte sogar überlegt, welche Bilder man kaufen könnte, und lange nach etwas Passendem gesucht. Gekauft habe ich nichts. Vielleicht, hatte ich dann immer gedacht, würde es ja ein dunkles Zimmer sein, in dem so ein Bild gar nicht zur Geltung käme. Aber vorgestellt, vorgestellt hatte ich mir mein Zimmer unzählige Male. Und immer hatte es ein anderes Gesicht.
Platz musste sein für das Klavier und die Bücher. Mehr wollte ich gar nicht. Es würde phantastisch sein. Ich könnte üben, ohne dass ständig Türen klappen, jemand umherläuft, Christa oder der Schauspieler, Geschlurfe, Geflüster, das einem den Nerv tötet, alle Konzentration raubt.
Früher ging es ja, als ich noch mit Christa allein war. Sie hat in der Küche gesessen und gearbeitet, wenn ich übte. Das machte ihr nichts. Aber seit der Schauspieler bei uns wohnt, ist es schlimm. Er heißt Henry, und sie schläft mit ihm. Sie lieben sich, sagen sie. Zumindest halten sie einander fest, seit sie sich kennengelernt haben. Das war vor einem halben Jahr. Vielleicht ist es auch ein wenig länger her.