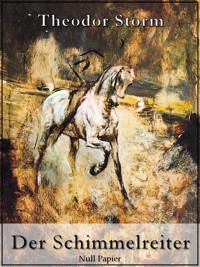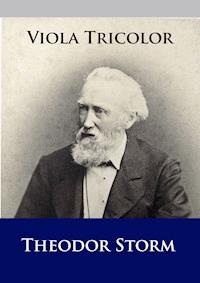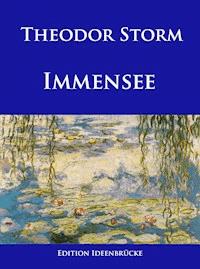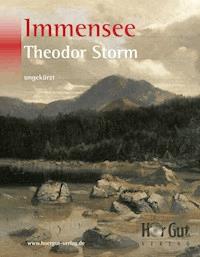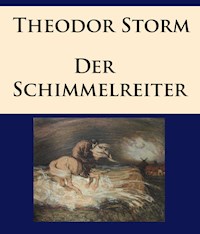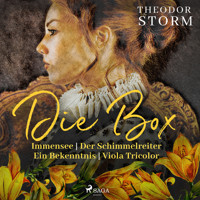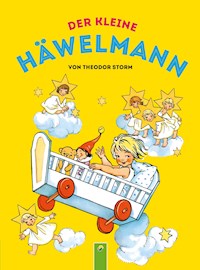1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In "Ein Doppelgänger" entwirft Theodor Storm ein vielschichtiges psychologisches Porträt des Menschen, das durch die Auseinandersetzung mit Identität und Selbstwahrnehmung geprägt ist. Die Erzählung folgt dem Protagonisten, der sich in einer Welt voller Ambivalenz und Verunsicherung mit seinem Doppelgänger konfrontiert sieht – einem Alter Ego, das seine innere Zerrissenheit und die unaufhörliche Suche nach dem eigenen Ich widerspiegelt. Storms literarischer Stil zeichnet sich durch eine prägnante, bildreiche Sprache und einen fließenden Erzählrhythmus aus, die dem Leser eine tiefgehende Reflexion über die menschliche Existenz ermöglichen. Der Kontext der Jahrhundertwende und der sich verändernden gesellschaftlichen Normen verleiht der Handlung zusätzliche Relevanz. Theodor Storm, einer der bedeutendsten Schriftsteller des deutschen Realismus, arbeitete in einer Zeit, die von tiefgreifenden sozialen und politischen Umwälzungen geprägt war. Seine persönlichen Erfahrungen – der Verlust naher Angehöriger und der Einfluss der Natur auf sein Schaffen – haben ihn nachhaltig geprägt und fließen in die psychologischen Aspekte seiner Werke ein. Storms Fähigkeit, das Innere seiner Figuren mit feinsinnigem Gespür für deren Emotionen darzustellen, wird in "Ein Doppelgänger" besonders deutlich. Dieses Buch ist nicht nur ein fesselndes Lesevergnügen, sondern bietet auch tiefgreifende Einblicke in die komplexe Natur des Selbst. Leser, die an Fragen der Identität und psychologischen Turbulenzen interessiert sind, finden in Storms Erzählung eine anregende und lohnenswerte Auseinandersetzung. "Ein Doppelgänger" ist ein zeitloses Werk, das sowohl literarische als auch psychologische Dimensionen miteinander verwebt und zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ein Doppelgänger
Inhaltsverzeichnis
Ein Doppelgänger
Vor einigen Jahren im Hochsommer war es und alle Tage echtes Sonnenwetter; ich hatte mich in Jena, wie einst Dr. Martinus, in der alten Gastwirthschaft zum Bären einquartiert, hatte mit dem Wirth schon mehr als einmal über Land und Leute geredet und mich mit Namen, Stand und Wohnort, welcher derzeit zugleich mein Geburtsort war, in das Fremdenbuch eingeschrieben.
Am Tage nach meiner Ankunft war ich nach Besteigung des Fuchsthurms und nach manchem andern Auf- und Absteigen spät nachmittags in das geräumige, aber leere Gastzimmer zurückgekehrt und hatte mich sommermüde vor einer Flasche Ingelheimer hinter dem kühlen Ofen in einen tiefen Lehnstuhl gesetzt; eine Uhr pickte, die Fliegen summten am Fensterglas, und mir wurde die Gnade, davon in den Schlaf gewiegt zu werden, und zwar recht tief.
Das erste, was vom Außenleben wieder an mich herankam, war eine sonore milde Männerstimme, welche, wie zum Abschied, gute Lehren gebend, zu einem Andern zu reden schien. Ich öffnete ein wenig die Augen: am Tische, unfern von meinem Lehnstuhl, saß ein ältlicher Herr, den ich nach seiner Kleidung als einen Oberförster zu erkennen meinte; ihm gegenüber ein noch junger Mann, gleichfalls im grünen Rock, zu dem er redete; ein röthlicher Abendschein lag schon auf den Wänden.
„Und dessen gedenke auch noch“, hörte ich den Alten sagen, „Du bist ein Stück von einem Träumer, Fritz; Du hast sogar schon einmal ein Gedicht gemacht; laß Dir so was bei dem Alten nimmer beikommen! Und nun geh’ und grüß’ Deinen neuen Herrn von mir; zur Herbstjagd werd’ ich mich nach Dir erkundigen!“
Als dann der Junge sich entfernt hatte, rüttelte ich mich völlig auf; der Alte stand am Fenster und drückte die Stirn gegen eine Scheibe, wie um dem Fortgehenden noch einmal nachzuschauen. Ich trank den Rest meines Ingelheimers, und als der Oberförster sich in das Zimmer zurückwandte, begrüßten wir uns wie nach abgethanen Werken, und bald, da Niemand außer uns im Zimmer war, saßen wir plaudernd neben einander.
Es war ein stattlicher Mann von etwa fünfzig Jahren, mit kurz geschorenem, schon ergrautem Haupthaar; über dem Vollbart schauten ein paar freundliche Augen, und ein leichter Humor, der bald in seinen Worten spielte, zeugte von der Behaglichkeit seines inneren Menschen. Er hatte eine kurze Jagdpfeife angebrannt und erzählte mir von dem jungen Burschen, welchen er einige Jahre in seinem Hause gehabt und nun zur weiteren Ausbildung an einen älteren Freund und Amtsbruder empfohlen habe. Als ich ihn, seiner Vorhaltung an den Jungen gedenkend, frug, was für Leides ihm die Poeten denn gethan hätten, schüttelte er lachend den Kopf.
„Gar keines, lieber Herr“, sagte er, „im Gegentheil! Ich bin ein Landpastorensohn, und mein Vater war selber so ein Stück von einem Poeten; wenigstens wird ein Kirchenlied von ihm, das er einmal als fliegendes Blatt hatte drucken lassen, noch heutigen Tages nach ‚Befiehl du deine Wege‘ in meinem Heimathdorf gesungen; und ich selber – als junger Gelbschnabel wußte ich sogar den halben Uhland auswendig, zumal in jenem Sommer, – “ er strich sich plötzlich mit der Hand über sein leicht erröthend Antlitz und sagte dann, wie im Stillen seine vorgehabte Rede ändernd: „wo am Waldesrand das Geißblatt wie zuvor in keinem andern Jahre duftete! Aber ein Rehbock, ein ander Mal – und das war schwer verzeihlich – die seltene Jagdbeute, eine Trappe, sind mir darüber aus dem Schuß gekommen! – Nun, mit dem Jungen ist es nicht so schlimm; nur der Alte drüben wird schon fuchswild, wenn wir gelegentlich einmal anstimmen: ‚Es lebe was auf Erden stolziert in grüner Tracht‘; Sie kennen wohl das schöne Lied?“
Ich kannte zwar das Lied – hatte nicht auch Freiligrath seinen patriotischen Zorn an dem harmlosen Dinge ausgelassen? – Aber mir lag die plötzliche Erregung des alten Herrn im Sinne: „Hat das Geißblatt auch in späteren Jahren wieder so geduftet?“ frug ich leise.
Ich fühlte meine Hand ergriffen und einen Druck, daß ich einen Schrei ersticken mußte. „Das war ja nicht von dieser Welt“, raunte der Mann mir zu, „der Duft ist unvergänglich, – – so lang sie lebt!“ setzte er zögernd hinzu und schenkte sich sein Glas voll hellen Weines und trank es in einem Zuge leer.
Wir hatten noch eine Weile weiter geplaudert, und manche anziehende Mittheilung aus seinem Forst- und Jagdleben hatte ich von ihm gehört, manches Wort, das auf einen ruhigen Lebensernst in diesem Manne schließen ließ. Es war fast völlig dunkel geworden; die Stube füllte sich mit andern Gästen, und die Lichter wurden angezündet; da stand der Oberförster auf. „Ich säße noch gern ein Weilchen“; sagte er, „aber meine Frau würde nach mir aussehen; wir beide bilden jetzt allein die Familie, denn unser Sohn ist auf dem Forstinstitut zu Ruhla.“ Er steckte seine Pfeife in die Tasche, rief einem braunen Hühnerhund, der, mir unbemerkt, in einem Winkel gelegen hatte, und reichte mir die Hand. „Wann denken Sie wieder fort von hier?“ frug er.
„Ich dachte, morgen!“
Er sah ein paar Augenblicke vor sich hin. „Meinen Sie nicht“, frug er dann, ohne mich anzublicken, „wir könnten unsere neue Bekanntschaft noch ein wenig älter werden lassen?“
Seine Worte trafen meine eigene Empfindung; denn auf meiner nun zweiwöchentlichen Reise hatte ich heute zum ersten Mal ein herzlich Wort mit einem Begegnenden gewechselt; aber ich antwortete nicht gleich; ich sann nach, wohin er zielen möge.
Und schon fuhr er fort: „Lassen Sie mich es offen gestehen: zu dem Eindruck Ihrer Persönlichkeit kommt noch ein Anderes dazu: es ist Ihre Stimme, oder richtiger die Art Ihres Sprechens, was diesen Wunsch in mir erregt; mir ist, als gehe es mich ganz nahe an, und doch …“ Statt des verständigenden Wortes aber ergriff er plötzlich meine beiden Hände. „Thun Sie es mir zu lieb’“, sagte er dabei, „meine Försterei liegt nur so reichlich eine Stunde von hier, zwischen Eichen und Tannen – darf ich Sie bei meiner lieben Alten als unsern Gast auf ein paar Tage anmelden?“
Der alte Herr sah mich so treuherzig an, daß ich gern und schon auf morgen zusagte. Er schüttelte mir lachend die Hände: „Abgemacht! Prächtig! Prächtig!“ pfiff seinem Hunde und, nachdem er noch einmal seine Kappe mit der Falkenfeder gegen mich geschwenkt hatte, bestieg er seinen Rappen und ritt in freudigem Galopp davon.
Als er fort war, trat der Wirth zu mir: „Ein braver Herr, der Herr Oberförster; dacht’ schon, Sie würden Bekanntschaft machen!“
„Und warum dachten Sie das?“ frug ich entgegen.
Der Wirth lachte. „Ei, da wissen’s der Herr wohl selbst noch gar nicht?“
„So sagen Sie es mir! Was soll ich wissen?“
„Ei, Sie und die Frau Oberförster sind doch gar Stadtkinder mit einander!“
„Ich und die Frau Oberförster? Davon weiß ich nichts; Sie sagen es mir zuerst; ich hab’ dem Herrn auch meine Heimath nicht genannt.“
„Nun“, sagte der Wirth, „da ging’s freilich nicht; denn’s Fremdenbuch hat er nicht gelesen; das ist grad’ keine Zeitung!“
Ich aber dachte: „Das war es also! Liegt der Heimathklang so tief und darum auch so unverwüstlich?“ Aber ich kannte daheim alle jungen Mädchen unseres Schlages innerhalb der letzten dreißig Jahre: ich wußte keine, die so weit gen Süden geheirathet hätte. „Sie irren sich vielleicht“, sagte ich zu dem Wirth, „wie ist denn der Jungfernname der Frau Oberförster?“
„Kann nicht damit dienen, Herr,“ entgegnete er, „aber mir ist’s noch just wie heute, als die seligen Eltern des Herrn Oberförsters, die alten Pfarrersleute, mit dem derzeit kaum achtjährigen Dirnlein hier vorgefahren kamen.“