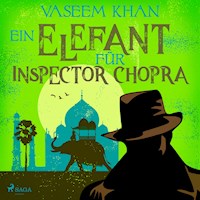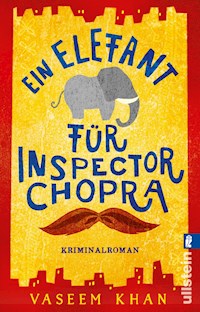
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Am Tag seiner Pensionierung stolpert Inspector Chopra gleich über zwei mysteriöse Ereignisse: Das erste ist der rätselhafte Fall eines ertrunkenen Jungen, dessen Tod niemanden zu kümmern scheint. Die zweite Überraschung ist ein Babyelefant. Chopra nimmt sich beider an. Ohne seine Polizeimarke, dafür aber mit tatkräftiger Unterstützung von Elefantenbaby Ganesha, sucht er jeden Winkel Mumbais nach dem Mörder des Jungen ab. Er muss bald feststellen, dass sowohl an seinem Fall als auch an seinem neuen Schützling mehr dran ist, als es auf den ersten Blick scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Einen Tag vor seiner Pensionierung erlebt Inspector Ashwin Chopra eine große Überraschung: Sein Onkel hat ihm einen Babyelefanten namens Ganesha vererbt. Chopra hat sich eigentlich nach dreißig Jahren Polizeiarbeit in Mumbai auf den wohlverdienten Ruhestand gefreut und wenig Lust, sich um ein so großes Tier zu kümmern. Doch mit der Ruhe wird es so bald eh nichts: Am Morgen seines letzten Arbeitstages stößt der Inspector vor der Polizeiwache auf eine Menschenmenge, die sich um eine hysterisch kreischende Frau versammelt hat. Von seinem Kollegen erfährt Chopra, dass die Frau um ihren Sohn trauert, der ertrunken sei und mit einer Whiskyflasche gefunden wurde. Als Todesursache wird ein tödlicher Unfall vermutet. Chopra hat Zweifel und beschließt, dass der Ruhestand noch etwas warten kann. Unterstützt wird er bei den Ermittlungen von seinem neuen tierischen Begleiter, der sich als echte Hilfe in jeder Lebenslage erweist.
Der Autor
Vaseem Khan, geboren 1973 in London, sah zum ersten Mal einen Elefanten auf offener Straße, als er 1997 nach Indien kam, um dort als Unternehmensberater zu arbeiten. Es erschien ihm damals höchst seltsam und diente als Inspiration für seinen ersten Kriminalroman. 2006 kehrte er nach England zurück und arbeitet seitdem am University College London für die Abteilung Sicherheits- und Kriminalwissenschaften.
VASEEM KHAN
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Friedrich
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1400-6
© für die deutsche Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017© Vaseem Khan 2015Titel der englischen Originalausgabe: The Unexpected Inheritance of Inspector Chopra(Mulholland Books, an imprint of Hodder & Stoughton, an Hachette UK Company)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Hodder & Stroughton, UK
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Buch ist meiner Familie gewidmet. Meiner verstorbenen Mutter Naweeda, deren Worte mich noch immer inspirieren. Meinem Vater Mohammed. Meinen Schwestern und Brüdern Shabana, Rihana, Irram und Addeel. Und Nirupama Khan, die mir ihr Mumbai zeigte.
INSPECTOR CHOPRA SETZT SICH ZUR RUHE
Am Tag, als er sich zur Ruhe setzen wollte, stellte Inspector Ashwin Chopra fest, dass er einen Elefanten geerbt hatte.
»Was soll das heißen, er schickt mir einen Elefanten?«, fragte er und wandte sich erstaunt vom Spiegel ab, in dem er den Kragen seiner Uniform gerichtet hatte. Seine Frau Archana, von Freunden und der Familie nur Poppy genannt, stand unschlüssig in der Tür.
»Hier, lies selbst«, sagte sie und hielt ihm den Brief hin. Dafür hatte Chopra jetzt jedoch keine Zeit. Es war sein letzter Tag im Büro, und Sub-Inspector Rangwalla wartete schon unten im Polizeijeep auf ihn.
Er wusste genau, dass die Jungs auf dem Revier eine Art Abschiedsfeier geplant hatten. Aber um ihnen die Überraschung nicht zu verderben, tat er seit einer Woche so, als würde er die Vorbereitungen, die überall um ihn herum stattfanden, nicht bemerken.
Chopra stopfte das Schreiben in die Tasche seiner Khakihose. Dann ging er, gefolgt von Poppy, zur Haustür. Ihr herzförmiges Gesicht verzog sich schmollend. Poppy war verärgert.
Ihrem Ehemann war nicht einmal aufgefallen, dass sie für seinen großen Tag einen neuen Seidensari angelegt hatte. Ebenso wenig hatte er die frischen Lotusblüten, die ihren glänzenden schwarzen Haarknoten zierten, oder das am Unterlid ihrer mandelförmigen Augen kunstgerecht aufgelegte Kajal bemerkt. Steile Falten bildeten sich nun über ihrer zierlichen Nase, und zwei rote Flecken glühten auf den milchweißen Wangen. Doch Chopra war in Gedanken schon auf dem Revier.
Zu diesem Zeitpunkt konnte er natürlich noch nicht wissen, dass der Tag eine weitere, völlig unerwartete Überraschung bereithalten würde – einen Mordfall, den letzten seiner langen und glanzvollen Karriere. Den Fall, der die Stadt Mumbai bis in die Grundfesten erschüttern und zur Gründung ihrer wohl außergewöhnlichsten Detektivagentur führen sollte.
»Heute bekommen wir vierzig Grad«, bemerkte Rangwalla, während sie über die mit Schlaglöchern übersäte Zufahrt des bewachten Wohnkomplexes ratterten, in dem Inspector Chopra lebte. Das konnte Chopra sich gut vorstellen. Das Hemd klebte ihm bereits jetzt am Rücken, und ein Rinnsal von Schweiß stahl sich unter der Schirmmütze hervor und tropfte ihm auf die Nase.
Es war der heißeste Sommer in Mumbai seit mehr als zwanzig Jahren. Und schon das zweite Jahr hintereinander verspätete sich der Monsun.
Wie üblich war die Strecke zum Revier verstopft. Motorrikschas sausten durch das staubige Labyrinth der City und brachten alles in Lebensgefahr, was sich bewegte. Eine tiefliegende schmierige Dunstschicht ließ die Hitze gerinnen und brannte in Chopras Nase, während er sich aus dem Jeep beugte, um mit zusammengekniffenen Augen nach oben zu spähen. Der Wahlkampf hatte begonnen, und überall in der Stadt wuchsen gigantische Plakatwände in den Himmel. Ein Arbeiter in Shorts und ausgefranstem T-Shirt balancierte auf einem schwankenden Bambusgerüst und malte gerade einen Schnurrbart in das grinsende Gesicht eines bekannten Politikers.
Chopra lehnte sich wieder zurück. Der örtliche Markt glitt vorbei, und die Luft wurde dick von flirrenden Gewürzpartikeln und dem Geruch nach fauligem Gemüse. Eine lange Reihe von Garküchen leistete einen zusätzlichen Beitrag zu der toxischen Dunstglocke. Bauarbeiter mit eisernen Mägen standen Schlange für ein Frühstück, das in riesigen Bratpfannen auf Butangasflaschen vor sich hin brutzelte.
Ein Stück weiter zockelte ein Elefant die Straße entlang. Der Mahut, der Elefantentreiber, auf seinem Rücken trug einen tief ins Gesicht gezogenen Sonnenhut aus Bambus. Chopra sah dem Tier nach, während es vorbeischwankte. »Ein Elefant!«, murmelte er in sich hinein. Die kurze Unterhaltung mit Poppy fiel ihm wieder ein. Das konnte doch nur ein Irrtum gewesen sein!
Auf dem Hof des Reviers erwartete den Inspector eine Menschenmenge. Erst dachte Chopra, es wäre die Überraschung, die die Jungs für ihn geplant hatten. Dann wurde ihm klar, dass es sich um einen dieser Aufläufe verschwitzter Menschen handelte, die sich immer wie durch Zauberhand bildeten, wenn es in den ungepflasterten Straßen von Mumbai Streit gab.
Tief aus dem Zentrum der aggressiven Menge erschallte eine aufgebrachte Stimme.
Chopra wühlte sich hindurch und stieß auf die untersetzte schweißüberströmte Gestalt von Constable Surat, der sich von einer kleinen plumpen Frau in einem graubraunen Sari heftig beschimpfen ließ.
»Mein Sohn ist tot, und die rühren keinen Finger!«, schrie sie. »Die sind nur hier, um den reichen Herrschaften zu dienen! Damit lasse ich sie nicht durchkommen!«
Vom Rand des Kreises war ermunterndes Murmeln aus den geschürzten Lippen einiger Damen zu hören, die wie Klone der erbosten Frau aussahen.
Chopra bemerkte sofort, dass ihre Augen rot und verquollen wirkten, als ob sie geweint hätte. Ein paar graumelierte Strähnen waren aus ihrem Haarknoten entwischt und hingen ihr in die schweißüberströmte Stirn. Das rote Bindi in der Mitte, der Punkt, der sie als verheiratete Hindufrau auswies, war verlaufen und verstärkte den Eindruck von Aufgelöstheit. Als die Frau Chopras Uniform und seiner strengen Miene ansichtig wurde, verstummte ihr Geschrei.
Chopra wusste, dass er eine respekteinflößende Figur machte. Er hatte sich gut gehalten, ein großer, breitschultriger Mann mit einem attraktiven Schopf pechschwarzer Haare, die lediglich an den Schläfen langsam ergrauten. Seine braune Haut war noch faltenlos. Dunkle, ausdrucksvolle Augen unter buschigen Brauen verliehen ihm eine seriöse Ausstrahlung. Und seine Nase hatte, wie seine Frau ihm versicherte, »Charakter«. Insgeheim war Chopra vor allem stolz auf seinen dichten, gepflegt zu beiden Seiten geschwungenen Schnurrbart.
»Was ist denn los, Madam?«, fragte er gemessen.
»Warum fragen Sie nicht ihn?« Sie deutete auf Rangwalla, der den Blick von ihrem anklagenden Zeigefinger abwandte und auf Chopra richtete.
»Seht nur!«, klagte die Frau zu ihrem Publikum gewandt. »Er hat dem Inspector-Sahib nicht einmal davon erzählt! Wenn ich in einem großen weißen Mercedes gekommen wäre, würden sie wie die Straßenköter um mich herumhüpfen! Aber für eine arme Frau und ihren armen Sohn gibt es keine Gerechtigkeit!«
»Jetzt reicht es!«, sagte Chopra. Er vermerkte befriedigt, dass alle verstummten, sogar die Frau. »Rangwalla, würden Sie mir bitte erklären, was hier los ist?«
»Was weiß denn der schon?!«, explodierte die Frau. »Ich erkläre es Ihnen! Mein Sohn, mein wunderbarer Junge, ist getötet worden! Seine Leiche liegt seit gestern Abend in Ihrem Polizeirevier. Kein einziger Beamter hat sich bei mir zu Hause blicken lassen, um meine Aussage aufzunehmen! Die ganze Nacht habe ich gewartet und um meinen verstorbenen Sohn geweint.«
»Rangwalla, stimmt das so?«
»Es ist richtig, dass wir einen Toten haben, Sir.«
»Wo ist er?«
»Hinten, Sir.«
»Meine Dame, ich muss Sie bitten, hier zu warten. Rangwalla, kommen Sie mit!«
Rangwalla folgte Chopra in den rückwärtigen Teil des Reviers, wo sich die Arrestzellen und Lagerräume befanden. In den Zellen schliefen ein paar Betrunkene ihren unruhigen Rausch aus, und ein ortsbekannter Dieb grüßte den vorbeigehenden Chopra mit einem »Salam aleikum«.
Im Lager ruhte auf einem Stapel Bananenkisten die Leiche.
Chopra zog das helle Tuch beiseite, mit dem sie bedeckt war, und betrachtete das aufgequollene, sich bereits gräulich verfärbende Gesicht. Der junge Mann musste einmal gutaussehend gewesen sein.
»Warum weiß ich nichts davon?«
»Es ist Ihr letzter Tag, Sir. Der Bursche war sowieso schon tot. Eindeutiger Fall von Ertrinken.«
»Die Welt bleibt nicht stehen, nur weil es Inspector Chopras letzter Tag ist«, wies Chopra ihn zurecht. »Wo hat man ihn aufgefunden?«
»In Marol, wo die Wasserpipeline endet. Er muss in die Abwasserrinne gefallen sein. So hat er jedenfalls gerochen.«
»Die Abwasserrinne liegt doch bestimmt beinahe trocken.« Chopra runzelte die Stirn. »Es hat seit Monaten nicht geregnet.«
»Anscheinend war der Mann betrunken. Neben ihm lag eine Whiskyflasche.«
»Und wer hat ihn gefunden?«
»Ein Anwohner. Er hat Alarm geschlagen, und sie haben einen kleinen Jungen losgeschickt, um uns Bescheid zu sagen. Ich ließ den Toten herschaffen und befahl Surat, sich ein wenig umzuhören, aber niemand hatte etwas bemerkt.«
Es war schon seltsam, dachte Chopra. In einer Zwanzig-Millionen-Stadt, wo es beinahe unmöglich war, auch nur einen Moment allein zu sein, brachten seine Mitbürger es immer wieder fertig, absolut gar nichts zu sehen.
»Warum wurde die Leiche überhaupt hierhergebracht?« Es war ungewöhnlich, dass ein Verstorbener auf dem Revier landete. Normalerweise hätte er direkt ins nächste Krankenhaus transportiert werden müssen.
»Wir haben im Hospital angerufen, aber dort gab es Probleme. Irgendwelche Verrückten hatten eine Straßensperre errichtet und terrorisierten jedes ankommende oder wegfahrende Fahrzeug. Ich hielt es für besser, die Leiche persönlich abzuholen und hier bis zum Morgen einzulagern.«
Chopra verstand. Durch die laufenden Wahlen war die Atmosphäre ziemlich aufgeheizt. Überall im Land erhoben die einfachen Bürger – die »Verrückten«, von denen Rangwalla gesprochen hatte – ihre Stimme. Es war eine ausgesprochen arbeitsreiche Phase für Mumbais Polizei. Die meisten Inder glaubten nicht an friedliche Demonstrationen.
»Haben Sie einen Panchnama?«
»Ja.« Der Panchnama war ein Dokument, das vom ersten Beamten verfasst wurde, der am Fundort einer Leiche eintraf. Er musste von zwei ortsansässigen Personen »von gutem Ruf« gegengezeichnet werden und bezeugte, dass eine Leiche aufgefunden und ordnungsgemäß der Polizei übergeben worden war. Da hatte Rangwalla saubere Arbeit geleistet, fand Chopra. Es gab einige Zonen in Mumbai, in denen es schwieriger war, zwei Bürger von gutem Ruf zu finden, als einen Mörder zu fassen.
»Wer hat den Toten identifiziert?«
»Er trug seinen Führerschein bei sich. Wir haben uns mit der Familie in Verbindung gesetzt. Die Mutter kam gestern Abend vorbei und hat seine Identität bestätigt. Sie machte uns eine entsetzliche Szene. Ich musste sie nach Hause schicken.«
Einen Sohn zu verlieren, dachte Chopra. Welch furchtbarer Schock! Kein Wunder, dass die arme Frau so außer sich war.
»Hören Sie, Sir, bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber … das wird bald Inspector Suryavanshs Problem sein. Soll er sich doch darum kümmern.«
Suryavansh war Chopras Nachfolger als Leiter des Reviers. Er zögerte kurz, bis ihm klar wurde, dass Rangwalla völlig recht hatte. Schließlich ging es auch ums Protokoll. Schon in ein paar Stunden würde er kein Polizeibeamter mehr sein. Nicht Inspector Chopra, sondern lediglich Ashwin Chopra, eines von vielen Mitgliedern des milliardenstarken Heers der Aam junta, der einfachen Bürger, die Indien so groß machten.
Plötzlich überfiel ihn ein tiefes Gefühl der Melancholie.
Der Tag verging schneller, als er es für möglich gehalten hätte.
Rangwalla nahm die Aussage der Frau auf, und sie willigte endlich ein, sich nach Hause fahren zu lassen. Anschließend setzte sich Chopra in den abgewetzten Holzstuhl hinter seinem Schreibtisch, um die verschiedenen Formalitäten seines Abschieds von der Polizei zu erledigen.
An der Decke wälzte ein quietschender Ventilator die heiße Luft im Raum um, während die Times of India-Wanduhr die letzten Sekunden seiner Karriere herunterzählte. Für Chopra klang es wie das Ticken einer Zeitbombe.
Zur Mittagszeit öffnete er seine Lunchbox und schnupperte an dem Essen. Das war ein Ritual. Chopra war stark allergisch gegen Ingwer, der bei ihm heftige Niesanfälle auslöste. Er hatte sich angewöhnt, das Essen erst zu überprüfen, obwohl er wusste, dass seine Frau seine Abneigung nur selten vergaß. Heute hatte Poppy ihm das Gemüsegericht Aloo Gobi mit Chapatis, den nordindischen Fladenbroten, eingepackt. In der mehrteiligen Box war alles noch warm. Doch er hatte keinen Appetit.
Er schob die Schalen gerade beiseite, als Poppy anrief, um ihn an seine Tabletten zu erinnern. Pflichtschuldig zog Chopra das Fläschchen aus der Tasche und ließ zwei Pillen herauskullern. Er schluckte sie mit einem Glas Wasser und schüttelte sich.
Dieses Ritual deprimierte ihn gewaltig.
Um fünfzehn Uhr erreichte Chopra überraschend ein Anruf von Assistant Commissioner Suresh Rao. Er war seit Jahren Chopras Vorgesetzter – das Sahar-Revier fiel als eines von dreien in seine Zuständigkeit. Sie hatten sich noch nie gut verstanden. Rao war früher der Leiter des nahegelegenen Chakala-Reviers gewesen, wo Chopra ihn als verlogenen Intriganten kennengelernt hatte. Er war ein mondgesichtiger, schmerbäuchiger kleiner Diktator, bekannt für seine Vetternwirtschaft und übertriebene Härte. Es war typisch für die Polizei von Groß-Mumbai, dass sie Rao befördert hatte, während Chopra auf seinem alten Posten klebenblieb.
Einen Moment lang fragte sich Chopra, ob Rao ihn vielleicht aus Schadenfreude anrief. Der Assistant Commissioner schwebte auf Wolke sieben, seit er wusste, dass Chopra gezwungen war, in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Doch Rao überraschte ihn, denn es ging ihm um etwas völlig anderes. »Chopra, mir ist zur Kenntnis gelangt, dass gestern Nacht in Marol eine Leiche aufgefunden wurde.«
»Ja«, antwortete Chopra. »Das ist richtig.« Er brachte es nicht fertig, seine Sätze mit einem »Sir« abzuschließen, wenn er mit dem Assistant Commissioner sprach.
»Könnten Sie mir bitte sagen, auf wessen Befehl hin der Tote auf Ihr Revier gebracht wurde statt ins Krankenhaus?«
Chopra zögerte, bevor er sagte: »Das erfolgte auf meine Anweisung hin.« Er wollte nicht, dass Rangwalla Schwierigkeiten bekam. »Wo liegt das Problem?«
»Nun, es entspricht nicht den Vorschriften, nicht wahr?«, beklagte sich der Assistant Commissioner. »Aber wie dem auch sei, sorgen Sie dafür, dass die Leiche unverzüglich in die Klinik geschickt wird. Denken Sie daran, Chopra, dies ist Ihr letzter Tag. Die Sache geht Sie nichts mehr an.«
»Die Angelegenheit geht mich exakt um 18.00 Uhr heute Abend nichts mehr an«, bemerkte Chopra.
»Sie immer mit Ihrer Starrköpfigkeit!« Rao verlor die Geduld. »Lassen Sie sich gesagt sein, Chopra, Ihre Tage des Ungehorsams sind gezählt.« Er holte tief Luft. »Schaffen Sie die Leiche ins Krankenhaus. Das ist ein Befehl!«
»Und die Autopsie?«
»Welche Autopsie?«
»An dem Tod des Jungen ist möglicherweise etwas faul. Ich muss eine Obduktion anordnen.«
»Sie tun nichts dergleichen!«, explodierte Rao. »Der Fall liegt völlig klar. Der Junge ist ertrunken. Eine Obduktion ist absolut überflüssig.«
Was geht denn da vor?, fragte sich Chopra. »Woher wissen Sie denn, dass der Junge ertrunken ist?«
Der Mann am anderen Ende der Leitung schien ins Stammeln zu geraten. Dann erwiderte er: »Ich sorge dafür, dass ich solche Dinge erfahre. Darum bin ich Assistant Commissioner und Sie nicht. Und jetzt hören Sie mir ganz genau zu. Es gibt keine Autopsie. Der Junge ist ertrunken. Fall abgeschlossen.«
»Vielleicht treffe ich diese Entscheidung lieber selbst«, gab Chopra hitzig zurück.
»Herrgott, Mann, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind!« Rao ging in die Luft. »Ich werde Ihnen Ihr Abzeichen …!« Er stockte, als ihm klar wurde, was er da sagte. »Schaffen Sie die Leiche einfach ins Leichenschauhaus.«
Er knallte den Hörer auf die Gabel.
Chopra starrte einen langen Augenblick die Wand an, bevor er sanft auflegte.
Das Ende des Tages rückte immer näher. Inspector Chopra begann, seine Sachen zusammenzuräumen. Er hatte einen Karton mitgebracht, in dem er den Inhalt seines Schreibtischs und der Schränke verstaute. Nach so vielen Jahren war es eigentlich recht wenig. Er hatte nie dazu geneigt, sein Büro mit persönlichem Schnickschnack zu verzieren. Es gab keine Fotos von Poppy oder irgendwelchen Kindern, keine Bilder seiner verstorbenen Eltern mit Trauerflor. Nur einen vergoldeten Schreibtischköcher mit Tintenfass, den seine Frau ihm einmal zum Geburtstag geschenkt hatte. Und die Plaketten, die er zum zehn-, zwanzig- und dreißigjährigen Dienstjubiläum erhalten hatte. Außerdem eine verstellbare Schreibtischlampe, in deren Licht er an den stillen Abenden zahllose Berichte verfasst hatte. Und dann war da noch die ausgestopfte Echse mit den Glasaugen, ein viele Jahre altes Juxgeschenk seines langjährigen Freundes Ashok Kalyan. Sie sollte ihn daran erinnern, wie er in ihrer beider Heimatdorf Jarul im Aurangabad-Distrikt von Maharashtra in den Brunnen gefallen war. Ashok hatte ihn gerettet, aber erst, nachdem Chopra sich vor Angst heiser geschrien hatte, weil unzählige Eidechsen in blinder Panik auf ihm herumgekrochen waren. Chopra hasste dieses Viehzeug. Bei Monsunwetter zogen sie sich in die Wohnungen zurück, lauerten hinter den Vorhängen und im Badezimmer. Jedes Mal huschten sie hervor, wenn er am wenigsten mit ihnen rechnete, und es lief ihm kalt über den Rücken.
Chopra war ein wenig enttäuscht, dass Ashok nicht angerufen hatte. Er war Parlamentsmitglied für den Bezirk von Mumbai, in dem Chopra wohnte. Er wusste natürlich, dass Ashok vom Wahlkampf extrem beansprucht war, trotzdem hatte er auf einen Anruf gehofft. Schließlich waren sie alte Freunde und hatten vor mehr als dreißig Jahren gemeinsam bei der Polizei von Mumbai angefangen.
Chopra zögerte kurz, als er das Foto betrachtete, das ihn selbst bei der Verleihung des Kirti Chakra, einer Tapferkeitsmedaille, durch den Deputy Commissioner of Police zeigte. Das war vor neun Jahren gewesen, nachdem er eine Razzia in einem Lagerhaus im nahegelegenen Industrieviertel durchgeführt hatte, in dem sich der berüchtigte Gangster Narendra »Kala« Nayak versteckte. Nayak war in ganz Mumbai gesucht worden, aber Chopra und seine Brigade aus örtlichen Beamten hatten ihn schließlich zur Strecke gebracht.
Chopra nahm das Bild von der Wand und legte es zu seinen sonstigen Habseligkeiten.
Alles in allem war es eine deprimierend magere Ausbeute.
Als er mit dem Packen fertig war, geschah etwas Eigenartiges. Eine seltsame Empfindung schien aus den Tiefen seines Magens aufzusteigen und sich seiner nach und nach zu bemächtigen. »Es ist doch nur ein Tag wie jeder andere«, murmelte er vor sich hin. Die Worte klangen selbst in seinen eigenen Ohren hohl und leer. Er hatte sich acht Monate lang auf diesen Augenblick vorbereiten können, seit der ärztlichen Diagnose, die seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt hatte. Und dennoch stellte er jetzt fest, dass er eben auch nur ein Mensch war.
Sogar Inspector Chopra, der sich nie von Gefühlen überwältigen ließ, der immer nüchtern und überlegt vorging, konnte ein Opfer der Sentimentalität werden.
Dann war es endlich Zeit zu gehen. »Rangwalla, bitte rufen Sie mir eine Rikscha.«
Rangwalla sah ihn entsetzt an. »Aber Sir, ich fahre Sie selbstverständlich im Jeep nach Hause!«
»Nein«, antwortete Chopra bestimmt. »Das wäre unangemessen. Von diesem Moment an bin ich kein Polizist mehr. Ich bin ein einfacher Bürger und daher nicht berechtigt, in einem Polizeijeep nach Hause gebracht zu werden. Und Sie müssen mich auch nicht länger ›Sir‹ nennen.«
»Jawohl, Sir.«
Chopra entging das feuchte Glitzern in Rangwallas Augenwinkeln nicht. Sie hatten zwanzig Jahre zusammengearbeitet. Das war in jeder Hinsicht eine lange Zeit. Wenn Chopra einen seiner Untergebenen als Freund bezeichnet hätte, wäre Rangwalla dieser Beschreibung am nächsten gekommen.
Er war ein hagerer Mann. Seine dunkle Gesichtshaut war von Aknenarben übersät, die er zum Teil hinter einem kurzgeschnittenen schwarzen Bart verbarg. Er war ein frommer Moslem und hatte sich im Lauf der Zeit als überaus fähige rechte Hand erwiesen. Sein Mangel an Schulbildung wurde durch eine harte Erziehung auf den Straßen von Bhendi Bazaar ausgeglichen, einer muslimischen Enklave im Süden Mumbais. Es kam selten vor, dass jemand, der nach der Aufnahmeprüfung zum Constable zur Polizei gestoßen war, bis zum Rang eines Sub-Inspector aufstieg. Doch Rangwalla verfügte über das, was Ashok Kalyan als »Straßenschläue« bezeichnet hätte. Das war eine Eigenschaft, die nach Chopras Einschätzung im heutigen Indien zunehmend unterschätzt wurde.
Die Motorrikscha traf ein. Constable Surat lud den Karton mit Chopras Habseligkeiten ein, und Chopra schüttelte dem Personal des Reviers einem nach dem anderen feierlich die Hand. Viele konnten ihre Gefühle nicht verbergen. Jeder hatte ihm ein Geschenk mitgebracht, das er ihm jetzt mit dem gebotenen Pathos überreichte. Constable Surat, ein übergewichtiger junger Mann, der leicht zu beeindrucken war, brachte Chopra so etwas wie Heldenverehrung entgegen. Er schenkte dem Inspector eine kleine Marmorstatue des Flöte spielenden Gottes Krishna, ohne dabei seine bitteren Tränen unterdrücken zu können.
Bevor er in die Rikscha kletterte, warf Chopra einen letzten Blick zurück auf die Polizeistation mit ihrer weißgetünchten Außenwand und den vergitterten Fenstern. Im Innenhof mit dem Terrakottapflaster wuchs eine mickrige Palme, und auf einem rissigen, sonnengebleichten und handgemalten Schild über den Schwingtüren des Eingangs stand der Name des Reviers … Zwanzig Jahre!, dachte er. Zwanzig Jahre auf demselben Posten!
Er kannte diesen Ort besser als seine eigene Wohnung. Bei diesem Gedanken stieg ihm ein Kloß in die Kehle.
DER ELEFANT TRIFFT EIN
Als er das Tor zu seinem Wohnkomplex erreichte, sah Chopra schon wieder eine Menschenmenge vor sich. Düster überlegte er, dass Massenaufläufe der Fluch von Mumbai waren.
Ein Tieflader, dessen Fahrer seelenruhig am Heck lehnte und auf einem Stück Zuckerrohr herumkaute, stand in der Einfahrt.
Chopra bezahlte den Rikschafahrer und betrat das Gelände.
Die Menge teilte sich respektvoll, und dann stand Chopra zwischen seiner Frau, einem kleingewachsenen Mann in Netzhemd und Dhoti-Beinkleid und einem Elefanten.
Einem jungen Elefanten, berichtigte er sich, und noch dazu einem ausgesprochen mickrigen.
Das Tier kauerte auf dem staubigen Boden und schien den Trubel um sich herum gar nicht wahrzunehmen. Die kleinen Ohren klatschten gelegentlich nach einer Fliege. Der Rüssel war unter dem Gesicht zusammengerollt. Um seinen Hals lag ein Stück rostiger Kette, die in der Hand des Mannes im Dhoti endete.
Chopra hätte sich am liebsten verdrückt. In der Hektik des Tages auf dem Revier hatte er die unerfreuliche Nachricht von dem Elefanten fast verdrängt. Sie hatte einfach zu unglaublich geklungen, wie einer der Streiche, für die sein Onkel zeitlebens berüchtigt gewesen war.
Aber es war nicht zu leugnen, dass ein lebendiger, atmender Dickhäuter auf Chopras Türschwelle gelandet war.
»Ah, Chopra, gut, dass Sie endlich kommen«, sagte Mrs Rupa Subramanium stirnrunzelnd. Sie war Präsidentin des Verwaltungsgremiums der kleinen Kolonie. »Wie ich Ihrer Frau gerade zu erklären versuchte, sind Haustiere auf dem Gelände nicht gestattet. Das ist eindeutig in Teil 3, Abschnitt 5, Paragraph 15.5.2 der Hausordnung geregelt, wie Ihnen sicher bekannt ist.«
»Das ist kein Haustier«, widersprach Poppy hitzig. »Das ist ein Familienmitglied.«
Mrs Subramanium war eine hochgewachsene, heuschreckenartige Gestalt im dunklen Sari, die einen strengen Chignon trug. Sie fand diese lächerliche Behauptung unter ihrer Würde und antwortete nicht.
Chopra seufzte innerlich. Mrs Subramanium hatte natürlich recht. Aber er wusste auch, dass seine Frau diese Tatsache niemals akzeptieren würde.
Poppy Chopra war der erste Mensch gewesen, der es je riskiert hatte, Mrs Subramanium als unangefochtener Herrscherin über den Wohnkomplex die Stirn zu bieten. Als sie vor fünf Jahren hier eingezogen waren, mussten sie schnell feststellen, dass die Bewohner in ständiger Furcht vor der alternden Witwe lebten. Mrs Subramaniums Dekrete wurden einfach widerspruchslos hingenommen. Es hatte noch nicht einmal jemand gewagt, um ein Exemplar jener legendären Hausordnung zu bitten, aus der sie unaufhörlich zitierte und die die Grundlage ihres unbarmherzigen Regimes darstellte.
Doch Poppy hatte, wie Chopra schon kurz nach ihrer Hochzeit feststellte, vor nichts und niemandem Angst.
Bald hatte sie selbst Komitees gegründet und die Nachbarn für ihre eigenen Zwecke um sich geschart.
Erst letztes Jahr war es ihr – sehr zu Mrs Subramaniums Verdruss – gelungen, den Verwaltungsrat davon zu überzeugen, die Dachterrassen der drei zwanzigstöckigen Hochhäuser auf dem Gelände für Feierlichkeiten wie Diwali, das hinduistische Lichterfest, oder Silvester zu öffnen. In Mumbai war das vielerorts eine Selbstverständlichkeit, doch Mrs Subramanium hatte jahrelang ihr Veto dagegen eingelegt. Ihre Begründung lautete, dass solche Feste das förderten, was sie als »unangemessenes Benehmen« bezeichnete.
Chopra sah zwischen den beiden Frauen hin und her, während sie sich anfunkelten. Er wusste, mit seiner Ehefrau war nicht zu reden, solange sie in dieser Stimmung war.
Am Ende einigte man sich darauf, dass der Elefant neben dem Wachhäuschen an der Rückseite des Komplexes angepflockt werden sollte. Jedenfalls so lange, bis Mrs Subramanium das Verwaltungsgremium einberufen konnte, um in der Sache eine Entscheidung zu fällen.
Chopra und Poppy wohnten im fünfzehnten Stock des ersten Hochhauses der Siedlung, den »Poomlai Apartments«. Die beiden anderen hießen »Meghdoot« und »Vijay«. Die drei Gebäude waren nach legendären Operationen der indischen Luftwaffe benannt. Der Mangel an Raum in Mumbai ließ der aufblühenden Mittelschicht keine Wahl, als in solchen Hochhausgefängnissen zu wohnen. Die Stadt war ein einziges Ameisengewimmel aus Bauprojekten. Wenn die Wohntürme weiter so in die Höhe schossen, würden sie bald wie ein gigantisches Stecknadelkissen aussehen, stellte Chopra sich vor. Der Gedanke missfiel ihm.
Als er die Wohnungstür öffnete, schlug ihm ein dichter Nebel von brennenden Räucherstäbchen und aromatisiertem Holzrauch entgegen. Ihm wurde schwindelig.
Vom Boden des geräumigen Wohnzimmers aus wandte sich ihm das Gesicht derjenigen Person zu, die er auf der Welt am wenigsten leiden konnte. Sie fixierte ihn mit dem üblichen Missfallen.
»Wo bleibst du denn so lange?«, schnappte Poornima Devi, Poppys Mutter. »Konntest du nicht wenigstens heute ein Mal pünktlich sein?« Die alte Frau – ein spinnenartiges Wesen mit grauem Dutt und weißem Witwensari – blickte ihn finster an. Ihre schwarze Augenklappe verströmte Feindseligkeit.
Chopra hatte sich nie mit seiner Schwiegermutter verstanden. Das schien vielen so zu gehen, und so hatte sie schon vor Jahren ihr Auge bei einer Meinungsverschiedenheit mit einem jungen Hahn verloren. In Chopras Fall lag es allerdings daran, dass er Poornima als Ehemann für ihre Tochter nie gut genug gewesen war.
Als sie angefangen hatte, die Bewerber um die Hand ihrer Tochter auf Herz und Nieren zu prüfen, erfuhr Poornima Devi, dass ein örtlicher Großgrundbesitzer ein Auge auf Poppy geworfen hatte. Dass er etwa dreißig Jahre älter war als sie, dazu noch Witwer und ein berüchtigter Trinker und Frauenheld, schien sie nicht weiter zu kümmern. Sie hätte ihm den Vorzug gegeben. Er war Landbesitzer, nur das zählte.
»Du hättest die Frau eines Jagirdar sein können, eines Gutsherren«, sagte die alte Frau gebetsmühlenartig zu ihrer Tochter. Gewöhnlich wartete sie damit absichtlich, bis Chopra in Hörweite war. Und seit sie nach dem Tod ihres Ehemanns Dinkar Bhonsle vor drei Jahren zu ihnen gezogen war, kam das natürlich immer häufiger vor.
Wie so oft dachte er darüber nach, dass der Tod doch sehr demokratisch war. Einen noblen, angesehenen und großmütigen Mann wie seinen Schwiegervater nahm er zu sich, während er die giftige Ehefrau zurückließ, über die noch nie jemand etwas Gutes zu sagen gewusst hatte.
Chopra hatte wiederholt versucht, Poppy zu überzeugen, dass ihre Mutter bei ihrem Sohn daheim im Dorf besser aufgehoben wäre. Schließlich war es die Aufgabe des Sohnes, für seine gebrechlichen Eltern zu sorgen, nicht die des Schwiegersohnes. Aber Poppy wollte nichts davon wissen.
»Du weißt doch, was für ein Tunichtgut Vikram ist«, sagte sie. »Er kann kaum auf sich selbst aufpassen, wie sollte er sich da um Mummiji kümmern?«
Chopra zog alarmiert die Stirn in Falten, als seine Schwiegermutter auf ihn zukam. Dann fiel ihm wieder ein, dass die alte Eiferin – mit aktiver Beihilfe seiner Frau – aus Anlass seiner Pensionierung eine spezielle religiöse Zeremonie vorbereitet hatte.
Chopra war von Natur aus kein gläubiger Mensch. Er war schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass die organisierte Religion die Hauptursache für die Spaltung dieses wunderbaren Landes war. Er betrachtete sich eher als andächtigen Säkularisten. Er behandelte alle Glaubensrichtungen mit demselben Respekt und derselben persönlichen Gleichgültigkeit. Diese noble Einstellung wurde durch die Tatsache kompliziert, dass Poppy ein großer Fan all der prunkvollen und pompösen Dinge war, die mit ihrem Glauben zu tun hatten.
Heute Abend zum Beispiel. Eine Pensionierung war eine Pensionierung, oder nicht? Was hatte Gott damit zu tun?
Chopra warf seiner Frau einen hilflosen Blick zu. Aber Poppy war bei dieser Tortur eine willige Komplizin und lächelte ihn ermutigend an.
Er blieb gerade lange genug, um sich von seiner Schwiegermutter heilige Asche auf die Stirn schmieren zu lassen. Sie stopfte ihm noch ein altbackenes Laddu, eine kugelförmige Süßspeise, so ungnädig in den Mund, dass ihm beinahe ein Zahn abgebrochen wäre. Erst dann gelang es ihm, sich zu entschuldigen.
Er ging hinunter in den Hof, wo sich eine Schar von Kindern um den Elefanten herum versammelt hatte. Er war inzwischen mit einem Vorhängeschloss an einem Metallpfosten neben dem Wachhäuschen hinter den Wohntürmen angekettet. Der Bereich war betoniert und fiel steil bis kurz vor der Ziegelsteinmauer ab, die den Komplex umgab. So entstand ein Graben, der während des Monsuns immer überflutet war. Zu dieser Jahreszeit mussten der bedauernswerte Bahadur und sein Kollege Bheem Singh knietief durch das wirbelnde Regenwasser waten, um zu ihrem Wachhaus zu gelangen.
Das Elefantenkalb hatte sich auf dem Boden zusammengekauert und sah die Kinder mit traurigen Augen von unten her an. Es wirkte erbarmungswürdig und irgendwie unterernährt, fand Chopra. Zerbrechlich war kein Wort, das man normalerweise mit einem Elefanten assoziiert hätte, aber der hier sah definitiv so aus, als müsste er ein bisschen Gewicht zulegen.
Chopra bemerkte, dass die Kleinen eine Reihe von farbigen Kreideringen um das Kalb gezogen hatten. Jetzt begannen sie unter Chopras Augen, es zu umkreisen und zu singen: »Jai, Bal Ganesha! Jai, Bal Ganesha!«
Eines der Kinder bückte sich plötzlich und malte dem Elefanten ein rotes Bindi auf die Stirn. Das Tier legte die Ohren an, schloss die Augen und rollte den Rüssel noch enger über dem Maul zusammen. Es sah so aus, als wollte das Kalb am liebsten in der Erde versinken. Chopra spürte das Elend des Geschöpfes.
»Kinder, ein Elefant ist kein Spielzeug!«, verkündete er entschieden. »Geht weg. Spielt woanders.«
Die Kleinen verdrückten sich und warfen enttäuschte Blicke zurück auf das zitternde Jungtier.
Das war der Moment, als Wachmann Bahadur angeschlendert kam. Chopra blickte ihm streng entgegen und sagte: »Bahadur, ich übergebe diesen Elefanten in Ihre Obhut. Keiner darf das arme Tier quälen. Haben Sie das verstanden?«
Bahadur richtete sich zu seiner ganzen, nicht gerade eindrucksvollen Größe auf. Irgendwie verlor er sich in seinem weiten Buschhemd und den Khakishorts. Er stammte von den Gurkhas ab, hatte ein rundliches Gesicht und orientalische Augen, und seinen wahren Namen konnte niemand aussprechen. Bahadur reckte die Hühnerbrust heraus. »Ji, Sahib!«
»Hat er schon etwas gefressen?«
»Nein, Sahib.« Bahadur deutete auf einen Haufen aus Bananen und gemischtem Gemüse, teils frisch, teils faulig, der unberührt neben dem Kalb lag.
»Ach übrigens, ist es ein Junge oder ein Mädchen?«
Bahadur öffnete schon den Mund, um zu antworten. Doch da wurde ihm klar, dass er es gar nicht wusste. »Einen Moment, Sahib.« Ohne weitere Umstände legte er sich auf den Boden und hob den Schwanz des Elefanten an, um sein Geschlecht festzustellen. »Es ist ein Junge, Sahib.«
Chopra kauerte sich hin und tätschelte dem Elefanten den Kopf. »Tja, mein junger Ganesha, was soll ich nur mit dir machen?«
In dieser Nacht erwachte Inspector Chopra mit dem federleichten Gefühl von Spinnweben auf dem Gesicht. Er setzte sich im Bett auf und wandte sich zu Poppy, die wie üblich tot für die Welt war. In jüngeren Jahren hatte er befürchtet, es könnte etwas Unnatürliches, vielleicht sogar Ungesundes an dem tiefen Schlummer sein, in den seine Frau jede Nacht fiel.
In einer Ecke des Schlafzimmers brummte die Klimaanlage vor sich hin. Er wünschte sich, Poppy würde aufwachen, damit er mit ihr reden konnte.
Er sah ein, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war, stand auf und ging auf Zehenspitzen am Zimmer seiner Schwiegermutter vorbei ins Wohnzimmer.
Chopra trat ans Fenster, schob den Vorhang beiseite und sah hinaus auf die Stadt.
Aus dem fünfzehnten Stock hatte er eine hervorragende Aussicht über die Bezirke Sahar und das angrenzende Marol. Nicht weit entfernt leuchtete das blaue Neonschild des legendären Leela-Kempinski-Hotels. Daneben ragten die riesigen verglasten Fassaden der Gebäude der multinationalen Konzerne auf, die die Andheri Kurla Road säumten. Ein Stück weiter nördlich begannen die Hütten des Slums, der an der Marol-Wasserpipeline lag.
Sein scharfer Blick folgte dem nächtlichen Straßenverkehr. Er strömte die Sahar Road entlang, bis er in den Western-Express-Highway mündete, der von den Vorstädten bis zum äußersten Rand der City verlief. Tollkühne Bettler schliefen auf der nur fünfundzwanzig Zentimeter breiten Brüstung der Hochstraße zum Flughafen. Sie schienen sich des vorbeirauschenden Verkehrs auf der einen und der tödlichen Tiefe auf der anderen Seite nicht bewusst zu sein.
Das war es, was die Einwohner von Mumbai zu den bewundernswertesten Indern des Landes machte, dachte Chopra. Dieser Glaube an die eigene Unverwundbarkeit.
Chopra liebte die Stadt.
Als er sie vor etwa drei Jahrzehnten zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ihn die schiere Masse der Menschen erdrückt. Es war ein richtiggehender Schock gewesen nach der leeren Weite um sein Dorf herum. Inzwischen konnte er sich kaum noch vorstellen, an einem Ort ohne den Lärm und die pure Energie zu leben, die zu jeder Tages- und Nachtzeit durch Mumbai pulsierte.
Seine Kollegen klagten oft über die zahlreichen Probleme der Stadt: die Slums, die Umweltverschmutzung, die lähmende Armut, die hohe Verbrechensrate. Chopra fand, dass sie dabei etwas übersahen. Wie ein berühmter Mann einmal gesagt hatte: Eine Stadt war wie eine Frau. Und wie bei einer Frau war es unmöglich, nur ihre Schönheit und Vorzüge zu lieben. Man liebte sie ganz oder gar nicht.
Und dennoch wachte er in letzter Zeit manchmal an einem sonnigen Morgen auf, sah aus dem Fenster und glaubte, an einem völlig fremden Ort zu sein. Mumbais glorreicher Marsch in die Zukunft verfälschte es für ihn bis zur Unkenntlichkeit. Die Goldmine des Outsourcings, das Erstarken der Hindutva-Hardliner in der Politik, die Verwestlichung von Bollywood … für ihn waren das alles Symptome einer erschreckenden Wandlung, die manche Narren einen »Boom« nannten. Und dabei wuchs die Stadt und wuchs und wuchs.
Chopra wusste, dass er Indien durch eine nostalgische rosarote Brille sah. Schließlich hatten die anscheinend unausrottbare Korruption, das Kastenwesen und die Armut historische Wurzeln. Und doch konnte er sich des Gefühls nicht erwehren, dass seine unrealistische Vorstellung von Indien das wahre Indien war. Das Indien, das er liebte und das wegen des Mantras vom Fortschritt immer schneller verschwand.
Ja, dachte Inspector Chopra, alles hat sich verändert. Nur ich nicht.
Plötzlich drang ein klagendes Tröten an sein Ohr. Er lehnte sich aus dem Fenster und sah hinab in den Hof.
Der Elefant lief neben dem Wachhaus in nervösen Kreisen um den Pflock herum, an dem er angekettet war. Der Anblick des Kalbs rief Chopra wieder die befremdliche Tatsache ins Gedächtnis, dass er jetzt der Besitzer dieses Tieres war – dank Onkel Bansi … Natürlich! Der Brief! Er hatte ihn völlig vergessen.
Chopra schlich sich ins Schlafzimmer, holte den Brief aus der Tasche seiner Uniform und zog sich in sein Arbeitszimmer zurück.
Er schaltete die Schreibtischlampe ein, setzte seine Brille auf und fing an zu lesen.
»Lieber Krishna«, begann Onkel Bansi. Chopra musste lächeln. Sein geliebter Onkel Bansi hatte ihn seit seinem zehnten Lebensjahr immer nur Krishna genannt. Damals hatte man den frühreifen Chopra dabei ertappt, wie er den Jungfrauen des Dorfes beim Bad im Fluss nachspionierte. Der göttliche Krishna war ja bekannt dafür, dass er schöne Maiden verführte, die im Fluss herumtollten. »Ich weiß, dass ich mich seit vielen Jahren nicht mehr bei Dir gemeldet habe«, ging es weiter, »aber nun möchte ich Dich um einen sehr großen Freundschaftsdienst bitten. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, und ich muss die nötigen Vorkehrungen treffen. Bald nachdem Du diesen Brief erhalten hast, wird bei Dir zu Hause ein Elefant eintreffen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Du diesen Elefanten bei Dir aufnimmst und Dich um ihn kümmerst. Er ist noch ein Baby, nicht einmal ein Jahr alt. Wollte ich Dir erzählen, unter welchen Umständen er zur Welt kam, Du würdest es mir nicht glauben, jedenfalls noch nicht. Lass mich nur so viel sagen: Dies ist kein gewöhnlicher Elefant. Denk daran, was real und was maya ist, eine Illusion, das ist nur eine Frage der Perspektive. Dein Onkel Bansi.«
Ein seltsamer Brief, dachte Chopra. Andererseits war Bansi, der ältere Bruder seines Vaters, immer schon ein merkwürdiger Mensch gewesen.
Chopras Vater hatte Bansi sehr gern gehabt, so viel wusste er. Er hatte dem jungen Chopra oft Geschichten von seinem Onkel erzählt, von denen eine unglaublicher war als die andere. Und so war die Legende von Bansi gewachsen.
Ein Ereignis hatte Chopra allerdings verifizieren können: Als Kleinkind war Bansi tatsächlich in den Korb eines reisenden Schlangenbeschwörers gefallen und völlig unversehrt wieder herausgeklettert.
Von da an hatte es als ausgemacht gegolten, dass Bansi eine spezielle Verbundenheit mit Tieren besaß. Vielleicht hatte sich das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickelt. Mit der Zeit stellte sich jedenfalls heraus, dass Bansi wirklich besonders gut mit allen Kreaturen umgehen konnte, mit denen der Mensch sich die Welt teilte. Er behauptete sogar, mit ihnen sprechen zu können, auch wenn selbst die leichtgläubigsten Dorfbewohner das bezweifelten.
Am Morgen seines achtzehnten Geburtstags war Bansi aus dem Dorf verschwunden.
Zehn lange Jahre hörte man nichts mehr von ihm, und jeder glaubte, dass er längst gestorben wäre.
Als er dann doch zurückkehrte, war er kaum wiederzuerkennen. Seine Haare waren frühzeitig weiß geworden. Er hatte einen langen verknoteten Bart, der ihm bis zum Bauch reichte. Und seine Augen schienen Dinge wahrzunehmen, die sich ein gewöhnlicher Mensch nicht einmal ansatzweise vorstellen konnte.
Aber Familie und Freunde stellten schnell fest, dass unter dem erschreckend veränderten Äußeren immer noch der Junge steckte, der das Dorf verlassen hatte – ein schelmischer und intelligenter Bengel.
Das war die Zeit, als Chopra, damals noch ein kleines Kind, seinen ruhelosen Onkel kennenlernte.
Bansi hatte ihn unter seine Fittiche genommen und ihm erlaubt, ihn auf zahlreichen Streifzügen in der Umgebung des Dorfes zu begleiten, die sie bis in die umliegenden Weiler führten. Dort galt Bansi als Sadhu, ein weiser Mann, dessen Segen man suchte. Zum Dank gab es immer ein paar Leckerbissen, ein Päckchen Palmzucker oder ein Stück Rohrzucker, die Bansi großzügig mit seinem jungen Neffen teilte.
Jetzt fielen Chopra auch die seltsamen Beschwörungsformeln wieder ein, die sein Onkel auf Bitten der leichtgläubigen Bauern gemurmelt hatte. Er hatte dabei heftig mit den Augenlidern geflattert und vor seinem ehrfürchtigen Publikum mehr als dick aufgetragen. »Sie lieben das Theater«, sagte er später grinsend. »Das heißt natürlich nicht, dass solche Dinge nicht möglich wären. Die großen Mysterien des Kosmos sind überall, in der Erde, im Himmel, in der Luft, die wir atmen. Wir müssen nur unsere Sinne dafür öffnen.«
Nachts, wenn sie unter den Sternen schliefen, erzählte ihm Bansi von seinen Reisen an exotische Orte wie Agra, Lucknow und Benares, die heiligste Stadt des Landes. Und auch das Dach der Welt hatte er besucht, die höchsten Höhen des Himalaja, wo die Flüsse Ganges und Brahmaputra ihren Ursprung nahmen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.