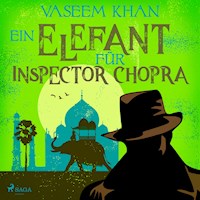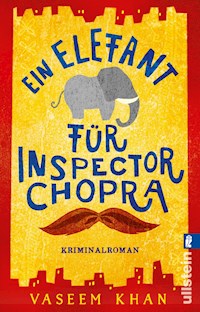8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Inspector Chopra und Elefant Ganesha sind wohl das ungewöhnlichste Ermittlerduo der Welt Zum ersten Mal seit Langem werden die britischen Kronjuwelen wieder in Indien ausgestellt. Ausgerechnet am Tag, als Inspector Chopra das Museum in Mumbai besucht, geschieht jedoch das Undenkbare: Die Krone von Königin Victoria mitsamt dem berühmt-berüchtigten Koh-I-Noor-Diamanten wird gestohlen. Der Juwelenraub sorgt sofort für eine aufgeheizte politische Stimmung. Inspector Chopra weiß, dass der Diamant so schnell wie möglich gefunden werden muss und begibt sich zusammen mit seinem Schützling, Jungelefant Ganesha, auf Spurensuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Nach der Aufklärung seines ersten spektakulären Falles als pensionierter Polizeibeamter führt Inspector Chopra das Detektivbüro zusammen mit Elefant Ganesha mit großem Erfolg. Doch auf die Dauer fehlt ihm bei der Beschattung von untreuen Ehemännern die intellektuelle Herausforderung. Diese bekommt er schneller, als ihm lieb ist, denn es gilt, einen kniffligen Fall von internationaler Tragweite zu lösen.
Zum ersten Mal seit langem werden die britischen Kronjuwelen wieder in Indien ausgestellt. Als Chopra das Museum besucht, wird der berühmt-berüchtigte Koh-i-Noor-Diamant mitsamt der Krone Königin Victorias aus einem eigens eingerichteten Hochsicherheitsraum gestohlen. Da der Diamant seit jeher ein Stein des Anstoßes und eine Belastung für die britisch-indischen Beziehungen war, heizt sich das politische Klima schnell auf. Unter dem Druck der nationalen und internationalen Empörung verhaftet die Polizei Chopras alten Bekannten Shekar Garewal, der für die Sicherheit des Museums zuständig war. Bei der Hausdurchsuchung finden die Beamten die Krone, doch der Diamant bleibt verschwunden. Ist Garewal wirklich der Drahtzieher der aberwitzigen Aktion, oder ist er nur der Sündenbock eines überforderten Polizeiapparates?
Der Autor
Vaseem Khan, geboren 1973 in London, sah zum ersten Mal einen Elefanten auf offener Straße im Jahr 1997, als er nach Indien kam, um dort als Unternehmensberater zu arbeiten. Es erschien ihm damals höchst seltsam und diente als Inspiration für seinen ersten Kriminalroman. 2006 kehrte er nach England zurück und arbeitet seitdem am University College London für die Abteilung Sicherheits- und Kriminalwissenschaften.
Von Vaseem Khan ist in unserem Hause bereits erschienen:
Ein Elefant für Inspector Chopra
VASEEM KHAN
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Friedrich
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1624-6
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Februar 2018
© für die deutsche Ausgabe
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
© Vaseem Khan 2016
Titel der englischen Originalausgabe:The Perplexing Theft of the Jewel in the Crownbei Mulholland Books, London 2016
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © Hodder & Stroughton, UK
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch ist meinen Nichten und Neffen gewidmet: Safiya, Aiza, Owais, Zayan, Faris, Zakaria, Aadam und dem Team in Indien, Arjun, Nupur und Aman. Wenn jeder Tiere so sehr lieben würde, wie Kinder es tun, wäre die Welt dann nicht ein besserer Ort?
BESUCH BEI EINEM DIAMANTEN
»Erheben Sie sich, Sir Chopra.«
Als die glänzende Klinge sich sanft auf Inspector (i. R.) Ashwin Chopras Schulter senkte, überwältigten ihn widersprüchliche Empfindungen. Stolz gehörte natürlich dazu, in diesem bedeutsamsten Augenblick seines Lebens. Aber auch ein großes Gefühl der Demut. Dass er, der Sohn eines Schulmeisters aus einem bettelarmen Dorf im Staate Maharashtra in Indien, einer solchen Ehre teilhaftig werden sollte, schien beinahe unvorstellbar.
Denn was hatte er letztlich geleistet?
Er war ein ehrlicher Mensch und hatte über dreißig Jahre lang mit makellosem Führungszeugnis die Uniform der Polizei von Mumbai getragen – bevor sein Herz ihn im Stich ließ und er in den vorzeitigen Ruhestand gehen musste. Im heutigen Indien war das tatsächlich etwas, worauf man stolz sein konnte.
Und dennoch, reichte die Tugend der Integrität allein aus, um eine derartige Auszeichnung verdient zu haben?
Gewiss gab es doch würdigere Kandidaten …
Was war zum Beispiel mit seinem alten Freund Assistant Commissioner Ajit Shinde? Er kämpfte gerade im Norden im entlegenen Gadchiroli gegen die maoistischen Naxaliten-Banditen und hatte die Spitze seines Ohrs durch die Kugel eines Heckenschützen verloren. Oder was war mit Inspector Gopi Moolchand, der noch wesentlich mehr verloren hatte, als er selbstlos in den Vihar-See in den Außenbezirken von Mumbai gesprungen war, um einen Betrunkenen vor dem Ertrinken zu retten? Nicht eines, sondern gleich drei Krokodile hatten die günstige Gelegenheit genutzt!
Plötzlich überkam Chopra ein Gefühl von Erhabenheit, als ob diese einzigartige Auszeichnung einen Höhepunkt in seinem Leben bedeutete, von dem an es nur noch abwärtsgehen konnte.
Er richtete sich von der niedrigen Bank auf, auf der er kniend den Ritterschlag empfangen hatte, und sah sich im Kreis der illustren Gäste nach seiner Gattin Poppy um.
Sie war eine strahlende Erscheinung in ihrem leuchtend pinkfarbenen Seidensari. Gerade unterhielt sie sich mit einer hochmütig wirkenden älteren Frau. Sie war ein Mitglied des britischen Oberhauses, doch Chopra konnte sich nicht an ihren Namen erinnern. Im Windschatten dieser abgetakelten alten Fregatte erblickte er seinen ehemaligen Sub-Inspector Rangwalla, der am Kragen seines schlechtsitzenden Anzugs zupfte. Und direkt neben Rangwalla stand Ganesha, der junge Elefant, den Chopras geheimnisumwitterter Onkel Bansi ihm sieben Monate zuvor mit der rätselhaften Botschaft »Dies ist kein gewöhnlicher Elefant« gesandt hatte …
Er runzelte die Stirn. Was hatte Ganesha hier zu suchen? Und Rangwalla? Waren Elefanten im Buckingham-Palast überhaupt zugelassen?
Chopra wandte sich wieder der Monarchin zu.
Plötzlich fiel ihm auf, dass sie eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit seiner Schwiegermutter besaß, der Witwe Poornima Devi, abgesehen von deren schwarzer Augenklappe. Doch sie hatte jenen Ausdruck scharfer Missbilligung, den Poppys Mutter für Chopra persönlich reserviert hatte, seit er ihr vor langer Zeit erstmals unter die Augen gekommen war.
Der Mund der Queen öffnete sich zu einem gähnenden finsteren Loch … Di-dah di-dah di-dah.
Chopras Bewusstsein trieb langsam an die Oberfläche zurück, während das Schrillen einer Alarmsirene seine Trommelfelle zu sprengen drohte.
Er hob benommen den Kopf vom roten Teppichboden und blickte sich orientierungslos um. Konfuse Bilder tanzten vor seinen Augen. Eine zerschmetterte Vitrine, die leblos herumliegenden Körper von gut gekleideten Männern und Frauen, helle Lampen, in deren Licht prachtvolle Schmuckstücke funkelten …
Bevor er mehr erkennen konnte, entstand Unruhe. Eine Horde von Männern in schwarzen Tarnuniformen kam in den Raum gestürmt.
Ohne viel Federlesens wurde er rüde hochgezerrt und im Polizeigriff aus dem Zimmer mit dem roten Teppich geführt. Man verfrachtete ihn über eine Marmortreppe zwei Stockwerke tiefer und durch ein befestigtes Tor hinaus in die Sonne des Spätnachmittags.
Jemand drückte ihm ein Glas Wasser in die Hand. Ein anderer hielt ihm Riechsalz unter die Nase. Seine Gedanken klärten sich ein wenig. Eine resolute Frau leuchtete ihm mit einer kleinen Stablampe in die Pupillen und fragte ihn, wie er sich fühlte.
Chopra blinzelte heftig. Er kam sich ziemlich wackelig vor, und sein Gedächtnis kehrte nur langsam zurück.
Er saß auf dem gepflegten Rasen vor dem Prince of Wales Museum. Auf einmal kamen die Erinnerungen, und er entsann sich wieder, warum er hergekommen war, nämlich um die Ausstellung mit den britischen Kronjuwelen zu sehen. Aber er war nicht allein gekommen! Wo war Poppy?
Seine Ehegattin war bei ihm im Raum mit den Juwelen gewesen. Er warf besorgte Blicke um sich.
Sie stand nur ein paar Meter entfernt im Gras und redete auf eine matronenhafte Frau in schwarzer Uniform ein.
Chopra rappelte sich auf und trottete auf sie zu. Als sie ihn entdeckte, wirbelte sie zu ihm herum und fiel ihm in die Arme. »Alles in Ordnung?«, erkundigte sie sich ängstlich.
»Ja«, erwiderte er mit erhobener Stimme, um die Alarmsirene des Museums zu übertönen, die immer noch schrillte. »Und du?«
»Mir geht es gut«, antwortete sie. »Sie wollen mir nicht sagen, was passiert ist.«
Chopra sah sich um.
Schwarz uniformierte Wachposten trabten in geordneten Formationen zu den Ein- und Ausgängen des Museums, um sie abzuriegeln. Andere Wachleute trieben rasch und effizient alle Personen zusammen, die sich auf dem Gelände aufhielten.
Im Gras neben Chopra wurden ein paar Museumsbesucher versorgt, die sich mit ihm in dem Zimmer aufgehalten hatten, in dem er gerade zu sich gekommen war.
Und plötzlich, mit der Klarheit eines Sonnenstrahls, der einen dunklen Raum durchschnitt, verstand Chopra, was geschehen war. Er erinnerte sich, was er gesehen hatte: die zerbrochene Vitrine, die leblos herumliegenden Körper. Er glaubte, eine sehr gute Vorstellung davon zu haben, worum es dabei gegangen war.
Jemand hatte versucht, die britischen Kronjuwelen zu stehlen.
Dreißig Minuten später wurden Chopra und die restlichen Besucher in das moderne Besucherzentrum des Museums getrieben. Man befahl ihnen, in einem Hinterzimmer zu warten. Begleitet von Protestrufen, bezogen bewaffnete Wächter vor der Tür Posten. Man teilte den Gefangenen in deutlichen Worten mit, dass sie nirgendwo hingehen würden, bevor sie nicht befragt worden waren.
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben.
Erst nach drei Stunden wurde Chopra in einen kleinen, hellerleuchteten Raum gebracht. Ein Mann namens Deodar Jha, der sich als Kommandant der Force One Unit von Mumbai vorstellte, verhörte ihn. Bei dieser Eliteeinheit handelte es sich um eine spezielle Anti-Terror-Gruppe, die im Anschluss an die Terrorangriffe von 2008 unter gewaltigem Medienrummel gegründet worden war. Seit damals hatte die Truppe faul im Hauptquartier in Goregaon herumgesessen und die M4-Sturmgewehre poliert, mit denen sie jetzt so eindrucksvoll herumfuchtelten.
Chopra wusste, dass die Force One Unit mit der Aufgabe betraut worden war, die Kronjuwelen während der Ausstellung im Prince of Wales Museum zu bewachen.
Anscheinend hatte sie versagt.
Jha war ein großer Mann mit rundem Gesicht und einem provokanten Schnurrbart. Er besaß eine arrogante Art und die Manieren eines Raubeins. Chopra, der als Polizeiveteran zahllose Vernehmungen durchgeführt hatte, beantwortete die Fragen des Commanders vollständig und präzise. Je schneller Jha seine Antworten bekam, desto früher konnten sie alle nach Hause gehen. Hinter dem Zorn des schweißgebadeten Jha spürte er wachsende Verzweiflung. Wahrscheinlich wurde dem Mann allmählich klar, dass das, was sich gerade im Museum ereignet hatte, das Ende seiner Karriere bedeutete.
Chopra vermutete, dass hier ein Rätsel verborgen lag, das sich mit den schonungslosen und brutalen Methoden von Force One allein nicht lösen ließ.
»Rekapitulieren wir die Sache noch einmal«, knurrte Jha. »Also: Berichten Sie mir genau, was geschehen ist.«
Was war denn tatsächlich passiert? Chopra versuchte, sich auf jedes Detail des Tages zu konzentrieren. Während er das tat, spulte sein Gedächtnis automatisch zurück bis ganz zum Anfang …
»Wir kommen noch zu spät!«
Inspector Chopra (i. R.) warf seiner Frau Archana – allen besser bekannt als Poppy – vom Steuer ihres Tata-Vans aus einen Seitenblick zu. Sie rutschte unruhig im Beifahrersitz hin und her.
Chopra liebte seine Frau von ganzem Herzen. Nur in speziellen Situationen wie gerade eben hatte er manchmal Mühe, sich an den Grund dafür zu erinnern.
Poppy hatte darauf bestanden, ausgerechnet um diese Zeit zum Prince of Wales Museum zu fahren. Chopra war klar gewesen, dass der Verkehr schrecklich sein würde. Aber Poppy hatte ihm schon seit der Ausstellungseröffnung vor zwei Wochen, volle zehn Tage, bevor Ihre Majestät die Queen zu ihrer historischen Visite eintraf, pausenlos in den Ohren gelegen.
Es war der erste Besuch der Queen in Mumbai, und das erste Mal seit zwei Jahrzehnten, dass sie überhaupt einen Fuß auf indischen Boden gesetzt hatte. Die Zeitungen sprachen von nichts anderem mehr.
Poppy war, wie der größte Teil der Bevölkerung, schnell der »königlichen Malaria« zum Opfer gefallen, wie man es nannte. Chopra dagegen war immun geblieben.
Als heimlicher Anglophiler war er insgeheim entzückt, dass die Queen beschlossen hatte, nach Mumbai zu kommen. Doch Chopra war ein nüchtern denkender und vernünftiger Mensch. Von seinem Vater – dem verstorbenen Shree Premkumar Chopra – hatte er die Bewunderung für die Briten und den Fortschritt geerbt, den sie dem Subkontinent gebracht hatten. Zugleich besaß er jedoch ein gesundes Gespür dafür, was die britische Herrschaft die Inder gekostet hatte. Er sah keinen Grund, Pfötchen zu geben, nur weil Ihre Majestät zu Gast war.
Natürlich war Poppy anderer Ansicht.
All ihre Freundinnen hätten die Ausstellung bereits gesehen, beschwerte sie sich. Sie könnten von nichts anderem mehr sprechen.
So war es unvermeidlich gewesen, dass Chopra irgendwann nachgab. Er hatte seiner Frau in den vierundzwanzig Jahren ihrer Ehe nur selten einen Wunsch abschlagen können. Poppy war eine Naturgewalt, kapriziös, romantisch und eine wahre Teufelin, wenn man sie ärgerte. Es war wesentlich einfacher, ihr nachzugeben, als der Spielverderber zu sein. Außerdem wusste er, dass es sich für den Ehemann im ewigen Kampf der Geschlechter ziemte, gelegentlich eine Schlacht verloren zu geben.
Der Trick dabei war, sich die richtige Schlacht auszusuchen.
Er warf seiner Frau einen Seitenblick zu.
Als ergebene Anhängerin der Mode hatte Poppy ihre langen dunklen Haare zu einer Bienenstockfrisur aufgetürmt. Das schien der letzte Schrei zu sein, seit dieser neue Bollywoodfilm in die Kinos gekommen war, der in den Sechzigern spielte. Ihre Wangen glühten von Rouge, und ein flaschengrüner Seidensari mit goldgesprenkeltem Besatz brachte ihre schlanke Figur zur Geltung.
Chopra selbst trug seinen besten – und einzigen – Anzug, ein schwarzes Kleidungsstück, über das seine Frau sich immer beschwerte, weil er darin angeblich aussah wie ein Leichenbestatter. Allerdings hatte er keinen Sinn darin gesehen, sich für einen schlichten Museumsbesuch einen neuen Anzug zuzulegen. Der jetzige hatte ihm fünfzehn Jahre lang gute Dienste geleistet, er taugte auch noch für ein paar Jährchen mehr.
Als Zugeständnis hatte er sich mit dem Rest seines Erscheinungsbildes Mühe gegeben. Die dichten schwarzen Haare – die an den Schläfen grau wurden – waren säuberlich gekämmt, und sein flotter Schnurrbart war makellos getrimmt. Er hatte dunkelbraune Augen und eine römische Nase, aber gegen die Falten, die sich in jüngster Zeit auf seiner walnussbraunen Stirn abzuzeichnen begonnen hatten, ließ sich leider nichts machen.
Chopra unterdrückte ein Seufzen und richtete den Blick auf den Horniman Circle, wo ein überforderter Constable versuchte, wieder Bewegung in das zum Stillstand gekommene Tohuwabohu aus Autos, Lastwagen, Motorrädern, Fahrrädern, Rikschas, Handkarren, Fußgängern und streunenden Tieren zu bringen.
Wenn es eine Hölle gibt, dachte er, dann kann sie nicht viel schlimmer sein.
Die Schlange am Ticketschalter zog sich um das ganze elegante, neue, edelstahlgetäfelte Besucherzentrum herum. Ausnahmsweise wurde der normalerweise nicht zu haltende Mob durch die Anwesenheit der streng dreinblickenden Mitglieder der Force One-Eliteeinheit im Zaum gehalten, die auf dem Gelände patrouillierten. Sie bildeten einen Kordon um das gesamte Museum und verliehen dem malerischen, formell gestalteten Park, in dem das Gebäude stand, eine düstere Atmosphäre.
Während die Schlange sich langsam vorwärtsschob, ergriff Chopra die Gelegenheit, das unlängst umbenannte Museum zu bewundern. Es war jetzt nach dem Kriegerkönig Shivaji benannt, dem Begründer des Reichs der Marathen.
Doch für Chopra würde es stets das Prince of Wales Museum bleiben.
Als er an der dreigeschossigen Fassade emporblickte, die mit Kurla-Stein verkleidet und von einer Mogul-Kuppel gekrönt war, spürte er, wie sein Herz vor Freude hüpfte. Dieses Gefühl überkam ihn jedes Mal, wenn er an die Schatzkammer voll uralter Relikte dachte, die diese Mauern beherbergten. Sie reichten zurück bis in die Indus-Kultur, von der die Gelehrten mittlerweile meinten, es könnte die älteste der Welt sein.
Chopra kam schon fast drei Jahrzehnte lang regelmäßig hierher, seit er als frischgebackener Constable aus seinem Heimatdorf im Landesinneren in die Millionenstadt gezogen war. Damals war er ein Siebzehnjähriger mit leuchtenden Augen gewesen, für den Bombay wie ein Traum erschien. In der Zwischenzeit hatte er viele Lektionen gelernt, von denen die schmerzhafteste war, dass nicht alles, was glänzte, unbedingt Gold sein musste.
Der unerbittliche Wandel der großen Stadt hatte ihm oft missfallen. Dieses ewige Streben in die Zukunft, als wäre die Vergangenheit nur ein Joch, das man abstreifen und in den Staub der Geschichte treten musste. Im Museum hatte er eine Zuflucht vor diesem unüberlegten Ansturm ins Ungewisse gefunden, Balsam für das Leiden seiner Nostalgie.
Chopra hielt sich für einen Historiker, einen Hüter des Erbes des alten Indien, und davon gab es immer weniger. Er wusste, dass sein Land vom Fortschritt berauscht war, von der Aussicht, eine Supermacht zu werden. Doch für Chopra gab es noch etliches zu lernen aus den Traditionen einer Kultur, die mehr als siebentausend Jahre überdauert hatte. Modernität war nicht alles. Technologie war nicht die Antwort auf alle Probleme.
Sie erstanden ihre Eintrittskarten und warteten geduldig, bis sie ins Besucherzentrum geleitet und von den Force One-Wachposten gründlich durchsucht wurden. Die Hauptsorge der Ausstellung galt der Sicherheit, und Chopra fügte sich entsprechend resigniert in die Prozedur. Er war nicht unvorbereitet gekommen und hatte keine Gegenstände mitgebracht, die auf der überall verbreiteten Verbotsliste standen. Andere waren nicht so klug gewesen.
Chopra sah, dass der große, breitschultrige Sikh vor ihm aufgefordert wurde, den zeremoniellen Kirpan abzuliefern, den Krummdolch, den viele gläubige Sikhs bei sich trugen. Zunächst weigerte sich der Mann, gab die Waffe jedoch schließlich ab. Einer wollte seinen Gutkha-Kautabakbeutel nicht herausgeben, doch der Stein des Anstoßes wurde ihm kurzerhand abgenommen.
Immerhin gehen die Posten gewissenhaft vor, dachte Chopra beifällig.
Die Besucher wurden gebeten, ihre Handys und Kameras zurückzulassen, da sie im Museum nicht gestattet waren. Nach der Sicherheitskontrolle wurden sie zum Haupteingang des Museums geleitet, wo sie sich anstellten, um einen Metalldetektor zu durchschreiten. Vor Chopra sträubte sich eine Frau dagegen, sich ihrer goldenen Hochzeitskette zu entledigen. Nachdem die Wachmänner sie inspiziert hatten, durfte sie damit weitergehen. Der große Sikh löste den Scanner mit seinem dicken Stahlarmband aus, ebenfalls ein wichtiges religiöses Objekt seines Glaubens. Diesmal, als er schon kurz davor stand, in die Luft zu gehen, erlaubte man ihm, den Gegenstand zu behalten. Ein korpulenter älterer Mann bat darum, seinen Asthma-Inhalator mit hineinnehmen zu dürfen. Die Wachposten musterten das Ding, drehten es in ihren schwieligen Händen hin und her und wechselten verständnislose Blicke.
Schließlich zuckten sie mit den Schultern und gaben es zurück.
Endlich konnten sie die Zentralgalerie des Museums betreten.
Chopra nahm erstaunt zur Kenntnis, dass die üblichen Ausstellungsstücke durch eine Sammlung von Artefakten aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft ersetzt worden waren. Normalerweise präsentierte die Galerie Exponate aus allen Zeitaltern der indischen Vergangenheit – einen juwelenbesetzten Dolch vom Hof von Shah Jahan, einen Terrakottalöwen aus dem Reich Ashokas des Großen, ein Tonsiegel der Harappa-Zivilisation mit der geheimnisvollen und bisher nicht entzifferten Schrift der Indus-Kultur.
Diesmal jedoch fiel Chopras Blick hier auf eine Gruppe geschmackloser Wachsfiguren, welche die britische Königsfamilie darstellten und den Ehrenplatz in der Galerie einnahmen. Ein plumper, nicht mehr ganz junger Mann, der die Sonnenbrille ins stark gegelte Haar hochgeschoben hatte, hatte den Arm ohne Scheu um die Taille der »Queen« gelegt, während seine Frau ihn anstrahlte. Chopras Miene verfinsterte sich.
Er hätte sich die Ausstellungsstücke aus der Kolonialzeit gern näher angesehen, aber Poppy zog ihn fort, nach oben.
Zusammen mit der restlichen Besucherherde trampelten sie die Marmortreppe hinauf, vorbei an Miniaturen und Kunstgegenständen aus dem Himalaja bis zur zweiten Etage. Dort war die Sir-Ratan-Tata-Galerie für die Kronjuwelen mit Beschlag belegt worden. Vier Force One-Männer hielten vor der neu eingebauten Panzerstahltür, die zur Galerie führte, Wache. Die Posten strafften sich, als die Besucher heranströmten, und ihre Finger glitten unwillkürlich zum Abzug ihrer Sturmgewehre.
Gleich nach der Ankündigung, dass die Kronjuwelen – zum ersten Mal in ihrer Geschichte – die Heimat verlassen und mit der Queen nach Übersee reisen würden, hatte Chopra gewusst, dass drakonische Sicherheitsvorkehrungen unvermeidlich waren. Er erinnerte sich noch gut an das Gezeter, das die britische Presse angesichts der Pläne angestimmt hatte. Sogar irgendein uraltes Gesetz hatte geändert werden müssen, um die Juwelen ins Ausland verschiffen zu können.
Tatsächlich waren am Ende nur ganz wenige Stücke auf die Reise geschickt worden. Die indische Regierung hatte außergewöhnliche Sicherheitsgarantien abgeben müssen. Der Premierminister persönlich hatte versprochen, keinerlei Kosten und Mühen zu scheuen, um die Unversehrtheit der unbezahlbaren Schätze zu gewährleisten, solange sie sich auf indischem Boden befanden.
Es war nie vollständig geklärt geworden, warum Ihre Majestät der Bitte der indischen Regierung nachgekommen war, die Juwelen auf dem Subkontinent auszustellen. Die Queen selbst hatte sich in der Angelegenheit wortkarg gegeben. Chopra hatte schon immer viel von der Monarchin gehalten. Für ihn war ihr Festhalten an Traditionen sinnbildlich für ein vergangenes Zeitalter, eine Ära, in der Diskretion und gute Manieren noch etwas gegolten hatten.
Nur zwanzig Besucher durften gleichzeitig die Tata-Galerie betreten.
Chopras Gruppe wartete ungeduldig, bis die vorherige unter enthusiastischem Gemurmel wieder herauskam.
Endlich betraten sie das klimatisierte Allerheiligste der Galerie, wo sie von zwei hochgewachsenen, kräftigen weißen Männern mit zeremoniellen Hellebarden empfangen wurden. Sie trugen die traditionelle rot-schwarze Uniform mit Rüschenkragen der Wächter im Tower von London. Chopra hatte gelesen, dass ihr Titel – Beefeater, Rindfleischesser – in Indien für Bestürzung gesorgt hatte, wo für einen Großteil der Bevölkerung die Kuh als Avatar Gottes galt.
Die Wächter traten beiseite, und ein beleibter Inder mit schlechtsitzender Nehrujacke, Nehrumütze und runder Brille tauchte auf. Auf Chopra wirkte er wie eine behäbigere Version des Freiheitskämpfers Subhash Chandra Bose.
Der Mann begrüßte die Gruppe mit einem strahlenden Lächeln und breitete die Arme aus, als wollte er alle zugleich umarmen. »Willkommen in der Ausstellung der Kronjuwelen.«
Chopra kniff die Augen zusammen, um das Namensschild des Mannes zu entziffern: ATUL KOCHAR.
Kochar strahlte Begeisterungsfähigkeit aus. Chopra überlegte, ob er eigentlich Schauspieler war, denn so lebhaft erzählte er die Geschichte der einzelnen Ausstellungsstücke.
Chopra hörte nur mit halbem Ohr zu. Wie bei den meisten Anwesenden in dem mit rotem Teppichboden ausgelegten Raum wurde seine Aufmerksamkeit vor allem von den Kronjuwelen angezogen, die in Vitrinen aus Panzerglas über die Galerie verteilt waren.
Er zog die Lesebrille aus der einen Tasche und setzte sie leicht verschämt auf. Aus der anderen holte er ein Exemplar des Ausstellungskatalogs, den er auf Poppys Verlangen im Besucherzentrum zu einem Wucherpreis erstanden hatte.
Während Kochar weiterredete, spähte Chopra in die nächstliegenden Vitrinen und schlug im Katalog die entsprechenden Einträge auf. Obwohl nur einige wenige der Schätze bis nach Indien gelangt waren, befanden sich dennoch ein paar atemberaubende Stücke darunter. Der Katalog erzählte bemüht glamourös die Geschichte, die sich hinter jedem einzelnen verbarg.
»Aber wie viel ist der ganze Krempel wert?«
Chopra blickte auf und sah, dass der plumpe Kerl, der der Wachsfiguren-Queen den Arm um die Taille gelegt hatte, Kochar mit streitlüsternem Ausdruck anblickte.
Der lächelte etwas gequält. »Man kann den Kronjuwelen keinen Geldwert beimessen. Sie sind der Inbegriff der Unbezahlbarkeit.«
»Unsinn«, blaffte der Mann arrogant. »Meine Familie stammt aus Marwar. Wir sind in der Edelsteinbranche. Alles hat seinen Preis. Kommen Sie schon, nur nicht so schüchtern. Nennen Sie ihn uns, Sir.«
Ein Chor der Zustimmung schallte Kochar entgegen.
Chopra spürte einen Stich von Traurigkeit. War das alles, was die Leute daran interessierte? Ein Schatz, ein Drachenhort, der in Dollar und Rupien aufgewogen werden konnte? Was war mit dem Gewicht der Geschichte, das in jedem dieser großartigen Kunstwerke steckte? Und der Kunstfertigkeit, die in ihre Herstellung eingeflossen war?
»Jetzt halten Sie mal die Klappe, Mann. Sind Sie hier, um den Anblick zu genießen, oder wollen Sie Schmuck kaufen?«
Chopra drehte sich um und sah, dass der große Sikh, den er aus der Kassenschlange kannte, den Marwari anfunkelte. Der Sikh war ein muskulöser Bursche mit einem schönen Vollbart, buschigen Augenbrauen und einem gewaltigen gelben Turban. Die Entgegnung, die dem Marwari auf der Zunge gelegen hatte, starb eines stummen Todes. Sein Gesicht lief rot an, doch er sagte nichts.
Der Sikh zeigte auf eine zweieinhalb Meter hohe Sandsteinstatue der Göttin Kali, die vermutlich deshalb in der Galerie zurückgeblieben war, weil sie mit der Rückseite an der Wand befestigt war. »Sie sind wohl die Art von Narr, der nicht einmal Respekt vor unserer eigenen Geschichte hat?«
Chopra empfand sofort eine Geistesverwandtschaft mit dem aufgebrachten Sikh.
»Ja«, stimmte eine hübsche junge Frau in einem hellblauen Sari und mit roter Brille zu. »Wir sollten lernen, unser kulturelles Erbe zu schätzen. Erst dann wissen wir ein fremdes richtig zu würdigen.«
Die Menge witterte sogleich, woher der Wind wehte, und wechselte den Kurs in Richtung moralischer Überheblichkeit. Plötzlich gab es einen Chor zustimmender Kommentare zu dem großen Sikh. »Die indische Kultur ist die größte, daran besteht kein Zweifel!« »Ihre Kronjuwelen können Sie vergessen, Sir! Die Moguln haben kostbarere Schätze als Almosen an die Armen verteilt!« Es wurde zusehends einsamer um den Marwari, als die Leute von ihm abrückten. Er lief knallrot an.
Kochar ersparte dem Unglückseligen weitere Peinlichkeiten, indem er geschickt die Aufmerksamkeit auf das Prunkstück der Ausstellung lenkte – die Krone von Queen Elizabeth, der Mutter der heutigen Königin, in die der Koh-i-Noor eingebettet war.
Die Präsenz des Koh-i-Noor auf indischem Boden hatte für einigen Wirbel gesorgt.
Seit der legendäre Diamant vor mehr als hundertfünfzig Jahren Queen Victoria als »Geschenk« überreicht worden war, hatte es Kontroversen darum gegeben. Viele Inder fanden, dass die Engländer den Koh-i-Noor gestohlen hatten und es höchste Zeit wurde, von der ehemaligen Kolonialmacht seine Rückgabe zu verlangen. Die Nachrichten waren voll gewesen von Demonstrationen und bürgerlichem Protest, vor allem seitens der »India First«-Lobby. Um der Regierung potenzielle Verlegenheiten zu ersparen, hatte der Polizeipräsident von Mumbai während des königlichen Besuchs ein Demonstrationsverbot verhängt. Auch dieser Akt war kritisiert worden, da er als grundsätzlich verfassungswidrig galt.
Kochar strahlte sein hingerissenes Publikum an und ging zu einer lebendigen Beschreibung dessen über, was er als »die finstere und blutige Geschichte des Koh-i-Noor« bezeichnete. Anschließend verkündete er abrupt, dass ihnen jetzt noch fünfzehn Minuten blieben, um die Kronjuwelen zu betrachten, bevor sie der nächsten Gruppe Platz machen mussten.
Die Leute verteilten sich im Raum.
Chopra bückte sich, um sich den Koh-i-Noor-Diamanten genauer anzuschauen.
»Vorsicht, Sir! Kommen Sie nicht zu nahe heran, sonst schlagen die Sensoren Alarm. Sie sind sehr empfindlich.«
Er blickte auf und sah, dass Kochar ihm zulächelte. Dabei bemerkte er einen nicht mehr jungen Mann mit ergrauendem Haar und beachtlichem Schmerbauch, der die Krone von der anderen Seite der Vitrine her anstarrte. Der Mann runzelte verdutzt die Stirn, und Chopra bekam mit, dass er trotz der Klimaanlage stark schwitzte.
Er schien seinen prüfenden Blick zu bemerken und sah mit einem beinahe schuldbewussten Zusammenzucken auf.
Chopra legte die Stirn in Falten.
Es kam ihm so vor, als hätte er diesen Gentleman schon einmal gesehen. Doch bevor er ihn einordnen konnte, hatte der sich bereits abgewandt und schlenderte weiter zu den Ausstellungsstücken, die die Wände der Galerie säumten.
Chopra widmete sich wieder der Krone, die in ihrer ganzen Pracht auf einem Samtkissen ruhte. Automatisch glitt sein Blick zum Koh-i-Noor. Die Beleuchtung der Vitrine war so eingerichtet, dass sie die Brillanz des legendären Diamanten besonders hervorhob. Chopra fand, dass er seinen Namen wahrlich verdient hatte: Koh-i-Noor – der »Berg des Lichts«.
Und plötzlich stieg etwas in ihm auf, wie ein Flüstern im Blut. Hier lag ein lebendiges Bindeglied zu dem alten Indien, das er so in Ehren hielt. Er fragte sich, wie es sich anfühlen musste, diesen riesigen Edelstein in der Hand zu halten, wie die größten Herrscher des Subkontinents es einst getan hatten. Würde er den Geist von Babur spüren, der ihm über die Schulter sah? Würde er Shah Jahans Trauer fühlen, während er sehnsüchtig das Schmuckstück betrachtete, das ihm von seinem eigen Fleisch und Blut genommen worden war? Der Koh-i-Noor, um dessen Besitz jahrhundertelang Mann gegen Mann, König gegen König, Legion gegen Legion gekämpft hatte …
Ein lauter Knall riss ihn aus der Versenkung.
Instinktiv schaute er sich nach der Quelle des Lärms um. Er hörte einen weiteren Schlag, dann noch einen. Schrecken durchfuhr ihn, als er sah, wie eine dichte weiße Rauchwolke sich rasend schnell im Raum ausbreitete und mit ihrem erstickenden Gestank alles verschlang. Die Welt begann sich um ihn zu drehen und glitt davon in eine sanfte, seufzende Dunkelheit. Es folgte ein anderes Geräusch, das knapp oberhalb der Hörgrenze lag, ein dünnes hohes Heulen, das er nicht identifizieren konnte.
Während Inspector (i. R.) Chopra zu Boden und in die Bewusstlosigkeit glitt, war das Letzte, was er sah, der Koh-i-Noor-Diamant, der sich im Herzen einer weißen Wolke drehte, während Lichtstrahlen in alle Richtungen schossen und alles verbrannten, was sich ihnen in den Weg stellte …
Chopra beendete seine Aussage und sah Jha an.
Der Kommandeur der Force One war aufgestanden und tigerte in dem kleinen, stickigen Raum auf und ab. Jha hatte bewusst die Klimaanlage ausgeschaltet – eine alte und überholte Verhörtaktik –, so dass es so heiß war wie in einer Sauna. Dem hageren Kommandeur lief der Schweiß in Strömen übers Gesicht und tränkte seinen Schnurrbart, aber er machte keine Anstalten, ihn wegzuwischen. Er hatte drängendere Sorgen.
Jha wirbelte zu Chopra herum und fing an, ihn erneut mit Fragen zu bombardieren. Was für einen Grund hatten Sie, die Ausstellung ausgerechnet heute zu besuchen? Um welche Zeit sind Sie angekommen? Kannten Sie noch weitere Personen im Ausstellungsraum?
All das hatte Chopra schon beantwortet, doch er wusste, dass die ständige Wiederholung zum Arsenal eines Verhörexperten gehörte. Jha versuchte, Chopra dazu zu bringen, seine Aussage zu variieren, sich in Widersprüche zu verstricken, um einer eventuellen Lüge auf die Spur zu kommen. Leider übersah er dabei das auf der Hand liegende Manko dieser Technik: Wenn der Befragte die Wahrheit sagte, blieben seine Antworten stets dieselben, egal, wie oft man ihn fragte.
Während Jha ziellos im Trüben fischte, gingen Chopra selbst einige Fragen durch den Kopf, ausgelöst durch ein paar Dinge, die der Kommandeur unabsichtlich im Lauf des Verhörs preisgegeben hatte. Wie war es den Dieben gelungen, das Gas ins Museum zu schmuggeln, mit dem sie Chopra und die anderen Besucher außer Gefecht gesetzt hatten? Wie hatten sie es geschafft, das angeblich unzerstörbare Panzerglas der Vitrine zu zertrümmern? Wie hatten sie das Wunder zustande gebracht, mit ihrem gestohlenen Schatz aus dem stark besuchten und schwer bewachten Museum zu entkommen?
Als Jha endlich genug hatte und ihn gehen ließ, war Chopra insgeheim zu dem Schluss gelangt, dass dies ein Rätsel war, das zu lösen Jhas Fähigkeiten überstieg. Ein Rätsel, das sich in Windeseile zu einem internationalen Skandal ausweiten konnte.
Was würde die indische Regierung dann tun?
POPPY’S BAR & RESTAURANT
Ein paar Stunden später hatte Chopra Poppy in der Anlage abgesetzt, in der sie wohnten. Als er anschließend im Restaurant eintraf, fand er es im üblichen Zustand eines organisierten Chaos vor. Nach den strapaziösen Erlebnissen des Nachmittags brauchte er ein wenig Ruhe, um seine Gedanken zu ordnen. Daher war er hierhergefahren, wie fast jeden Tag um diese Zeit.
Im Gastraum mit seinen karierten Tischdecken und den glitzernden Leuchtern dominierten angeregte Unterhaltungen und verlockende Düfte. Er schob sich zwischen den dicht besetzten Tischen hindurch und grüßte die Stammgäste, von denen viele alte Freunde aus seinen Tagen bei der Polizei waren, setzte sich aber nicht zu ihnen, um mit ihnen zu plaudern.
Eilig ging er weiter zu seinem Büro im hinteren Teil des Lokals, das er nach dem erzwungenen Ausscheiden aus dem Polizeidienst eröffnet hatte.
Im Büro schaltete er die Klimaanlage ein, musste jedoch mit anhören, wie sie gurgelnd und keuchend den Geist aufgab.
Schimpfend griff er zum Telefon und bestellte sich in der Küche ein Limettenwasser und ein feuchtes Handtuch.
Er ließ sich auf dem gepolsterten Stuhl zurücksinken und gestattete seinen Gedanken, zu den tumultartigen Ereignissen im Prince of Wales Museum zurückzukehren. Er ging die Einzelheiten noch einmal durch, die Jha ihm während seines ungeschickten Verhörs unabsichtlich verraten hatte.
Der Coup war perfekt abgelaufen.
Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, hatten die Gangster alle, die sich in der Tata-Galerie aufhielten, mit einem Gas betäubt. Irgendwie war es ihnen anschließend gelungen, das Panzerglas der Vitrine mit der Krone von Queen Elizabeth aufzubrechen und auch einige der umliegenden Schaukästen zu zerschmettern. Erstaunlicherweise hatten sie lediglich die Krone mitgenommen und waren mit dem unersetzlichen Schmuckstück durch eine aufgebrochene rückwärtige Tür entkommen. Diese führte zu einem Gang, der die Tata-Galerie mit der Jahangir-Galerie im Ostflügel verband. Man nahm an, dass die Diebe die unbewachte Feuertreppe auf halber Strecke des Korridors ins Erdgeschoss genommen und sich dann in Luft aufgelöst hatten.
Offensichtlich hatte der Ring aus Force One-Posten, die die Außengrenze des Museums sicherten, niemanden vom Tatort fliehen sehen. Das Aufbrechen der Panzerglasvitrine hatte sofort die Warnsirene ausgelöst und jedes Mitglied der Spezialeinheit in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nicht einmal Houdini hätte durch die Maschen des Netzes schlüpfen können. Das Museum war augenblicklich abgeriegelt worden. Man hatte jede einzelne Person im Gebäude aufgespürt und durchsucht, ebenso wie jeden Winkel des Museumsgeländes.
Nichts.
Die Fehlzündung eines Lastwagens auf der Hauptstraße holte Chopra in die Gegenwart zurück.
Er stand auf und ging durch die Küche des Restaurants zum Hinterhof.
Das Gelände wurde von einer einzelnen gelben Leuchtstoffröhre erhellt, um die eine Wolke von Mücken schwirrte. Auf drei Seiten umschloss den Hof eine bröckelnde Backsteinmauer, deren Oberkante mit bunten Splittern aus Flaschenglas bestückt war. Eine schmale Gasse verlief an der Seite des Lokals entlang zur Guru Rabindranath Tagore Road.
Das Geräusch des spätabendlichen Verkehrs drang herein, durchsetzt von vereinzelten markerschütternden Schreien, wenn ein Fußgänger den vorbeirauschenden Fahrzeugen zu nahe gekommen war.
Chopra begab sich in den hinteren Teil des Hofs und ließ sich in einen Rattansessel sinken, der unter der Neonröhre stand. Die Lampe hing an einer Leine zwischen einem einzelnen Mangobaum und der Fernsehantenne auf dem Dach des Restaurants. Sie schwankte sanft in einer unerwarteten Brise, die die schwüle Dezemberhitze milderte.
Eine Welle der Zuneigung erfasste Chopra, als Ganesha den Rüssel hob und ihm sanft mit der Spitze ins Gesicht stupste. »Wie geht’s, mein Junge?«, flüsterte er.
Der Augenblick ging schnell vorbei, und der Elefant wandte sich schnaubend ab, um sich wieder in seinem Schlammbad zu suhlen.
Chopra spürte, dass Ganesha mit ihm unzufrieden war. Das war nur eines von vielen Anzeichen, dass sich die Persönlichkeit des Kalbs entwickelte.
Als sein Onkel Bansi Chopra das Elefantenbaby geschickt hatte, hatte der zunächst keine Ahnung gehabt, was er damit anfangen sollte. Was wusste er schon als Polizist im Ruhestand, wie man für einen Elefanten sorgte? Erst nach und nach, während Ganesha ihn bei den Ermittlungen im Fall eines ermordeten Jungen begleitet und ihm schließlich aktiv bei der Lösung geholfen hatte, war ihm klargeworden, dass das kleine Wesen etwas Geheimnisvolles und Einzigartiges an sich hatte. Dabei waren ihm die Worte seines Onkels aus dem Brief eingefallen, der das ungewöhnliche Geschenk angekündigt hatte: »Vergiss nicht … dies ist kein gewöhnlicher Elefant.«
Aus dem Skeptiker Chopra war ein Gläubiger geworden.
Ganeshas Außergewöhnlichkeit machte es Chopra unmöglich, ihn in die säuberlichen kleinen Schubladen von Vernunft und Logik einzusortieren, die sein Leben bestimmten. Der Elefant besaß eine Tiefgründigkeit, die auszuloten ihm bisher nicht gelungen war. Und dann war da natürlich noch seine ungeklärte Herkunft, in die er nicht das geringste Licht hatte bringen können.
Ganesha: Ein Rätsel in einem Geheimnis, das sich in einem Elefanten verbarg.
Wenn er in Ganeshas sanfte braune Augen sah, glaubte er oft, seinen Onkel Bansi darin zu erkennen. Denselben spitzbübischen Onkel, der aus einem Wildfang von Jungen zu einem weißbärtigen, umherziehenden Sadhu geworden war. Manchmal war er jahrelang aus ihrem Heimatdorf in Maharashtra verschwunden gewesen, um danach voller Erzählungen von magischen Begegnungen in fernen Ländern zurückzukehren. Geschichten, die er seinem unbedarften Neffen und anderen leichtgläubigen Verwandten gern auftischte.
Chopra hatte vor, dieser Frage eines Tages auf den Grund zu gehen. Aber vorerst, wie seine Frau nicht müde wurde, ihn zu erinnern, musste er einfach dankbar sein. Schließlich hatte nicht nur sein Restaurant einen fliegenden Start hingelegt, sondern auch das zweite Vorhaben, das er nach der Pensionierung angepackt hatte.
Chopra hatte mehr als dreißig Jahre im Polizeidienst verbracht. Dreißig Jahre lang hatte er am Morgen seine Khakiuniform angezogen, war mit dem Polizeijeep zum nahe gelegenen Revier Sahar gefahren und hatte sich in dem Bewusstsein an den Schreibtisch gesetzt, seine Pflicht zu tun. Dreißig Jahre lang hatte sein Leben einen Sinn und Zweck gehabt, der seiner Veranlagung und seinen Fähigkeiten entsprach.
Und dann hatte er eines Tages aus heiterem Himmel einen Herzanfall erlitten. Ein Arzt hatte ihm mitgeteilt, dass er an einer Krankheit litt, die sich »instabile Angina pectoris« nannte, und der nächste Anfall tödlich enden könnte. Zu seiner Verzweiflung hatte Chopra den Polizeidienst quittieren müssen und sollte in Zukunft jegliche Anstrengung meiden.
Das war leichter gesagt als getan.
Mit dem Mord, den Chopra gleich im Anschluss aufgeklärt hatte, hatte er in Mumbai in ein Wespennest gestochen. Wie sich herausstellte, waren hochrangige Politiker und Polizisten in einen landesweiten Fall von Menschenhandel verstrickt gewesen. Der Skandal hatte dem neu gegründeten »Baby Ganesh Detektivbüro« ungeahnte Berühmtheit verschafft, und Chopra konnte sich seitdem vor Aufträgen kaum retten.
Und dennoch … die Fälle, mit denen er es jetzt zu tun bekam, waren nicht vergleichbar mit denen, die er als Chef des Reviers in Sahar bearbeitet hatte.
Man musste sich nur die letzten Monate ansehen. Chopra hatte endlose Tage damit zugebracht, untreue Ehemänner und straffällig gewordene Jugendliche zu beschatten. Er hatte verschwundene Testamente aufgespürt. Firmen nahmen seine Dienste in Anspruch, um den Hintergrund zweifelhafter Angestellter zu durchleuchten. Politische Parteien beauftragten ihn, die Leichen in den Kellern ihrer potenziellen Kandidaten zu finden. Sogar besorgte Eltern traten an ihn heran, um diskret die Zuverlässigkeit – und Kreditwürdigkeit – möglicher Schwiegersöhne zu überprüfen.
Es war alles anständige Arbeit.
Doch wenn er ehrlich war: Es fehlte ihm, dass sich bei solchen Fällen der Pulsschlag nicht beschleunigte wie bei einer soliden Polizeiermittlung. Man hatte nicht das Gefühl, für ein übergeordnetes Wohl zu kämpfen.
Chopra hatte immer an das Ideal der Gerechtigkeit geglaubt. Er wusste, dass das ein dehnbarer Begriff war, vor allem in Indien, wo Macht und Geld die entsprechenden Prozesse beeinflussten. Das änderte jedoch nichts an seiner Überzeugung, dass die Bücher des Kosmos nur dann ausgeglichen werden konnten, wenn das Gute das Böse bekämpfte und das Gute siegte.
Er setzte sich bequemer auf seinem Rattanstuhl zurecht. Die rechte Hüfte tat ihm weh, wo er im Prince of Wales Museum auf den Boden geknallt war.
»Komm schon, Ganesha, sei vernünftig«, sagte er zu dem Elefanten. »Ich konnte dich ja schlecht mitnehmen. Die hätten dich nie in die Ausstellung gelassen.«
Ganesha schnaubte geräuschvoll und schob sich weiter von ihm weg.
Chopra seufzte. Schlimm genug, mit einer temperamentvollen Frau gesegnet zu sein, dachte er, aber auch noch die Stimmungsschwankungen eines einjährigen Elefanten zu ertragen, hätte selbst die Geduld eines Heiligen strapaziert.
Er beschloss, Ganesha lieber in Frieden zu lassen, bis er seinen Anfall von Übellaunigkeit überwunden hatte.
Er zog einen Stapel Papiere aus seiner ledernen Dokumentenmappe. Dann holte er eine Meerschaumpfeife aus der Tasche und steckte sie sich in den Mundwinkel.
Chopra rauchte nicht. Die Pfeife war nur ein Spleen, um besser nachdenken zu können. Er war ein unverbesserlicher Sherlock-Holmes-Fan – besonders von dessen Verkörperung durch Basil Rathbone in den Filmen der 1940er Jahre. Die Meerschaumpfeife gab ihm das Gefühl, in die Fußstapfen des berühmten Detektivs zu treten.
Er setzte die Brille auf und begann zu lesen.
Bald war er ganz in die Arbeit vertieft. Ein Moskito summte um sein Ohr herum, und er schlug danach, ohne den Blick zu heben. Gerüche und Geräusche drangen aus der Küche des Restaurants zu ihm. Der köstliche Duft von gebratenen Zwiebeln und geröstetem Knoblauch, der Chiligeruch von zahllosen exotischen Gewürzen, das Spritzen und Zischen von Chef Lucknowwallahs riesigen Kupferpfannen, das Prasseln des tönernen Tandoor-Ofens.
Er musste niesen, als ihm ein Hauch von Ingwer in die Nase stieg – er hatte schon immer sehr allergisch auf das Zeug reagiert.
In die Küchenaromen mischte sich ein Unterton von Elefantendung aus dem Hinterhof. Ein wenig abgemildert wurde der Geruch durch den süßen Duft reifer Mangos und der Jacarandablüten auf dem benachbarten Grundstück der Sahar International Cargo & Freight Company, einem Transportunternehmen. An- und abschwellend mit der wechselnden Brise wehte der Klang eines »Raga« aus einem alten Bollywoodstreifen daher, der in einem nicht weit entfernten Radio spielte.
Nach einer Weile stellte Chopra fest, dass Ganesha sich umgedreht hatte und ihm bei der Arbeit zusah. Er spähte seinen jungen Schützling über den Brillenrand hinweg an. »Heute ist etwas Außergewöhnliches geschehen. Im Museum gab es einen Raubüberfall. Sie haben den Koh-i-Noor gestohlen. Es wird einen Riesenskandal geben. Hör auf meine Worte.«
Zu Ganeshas Gunsten musste gesagt werden, dass er jedem Wort zu lauschen schien. Chopra streckte die Hand aus und tätschelte ihm den buckeligen Kopf.
Bei seiner Ankunft war Ganesha völlig unterernährt gewesen, der schwächlichste Elefant, der Chopra je unter die Augen gekommen war. In seinem Begleitschreiben hatte Onkel Bansi keinerlei Hinweis darauf gegeben, woher Ganesha stammte oder aus welchen Gründen er ihn nach Mumbai zu Chopra geschickt hatte.
Er hatte lange gebraucht, um das Vertrauen des kleinen Elefanten zu gewinnen.
Er war von Natur aus kein sentimentaler Mensch, doch das Band, das zwischen ihnen gewachsen war, bedeutete ihm genauso viel wie eine menschliche Beziehung. In gewissem Sinn war Ganesha das Kind, das er und Poppy nie hatten bekommen können. Poppy jedenfalls behandelte ihren Schützling wie ein Familienmitglied. Sie war regelrecht vernarrt in ihn und verwöhnte ihn mit Leckerbissen aus ihrem schier unerschöpflichen Vorrat an Cadbury’s Vollmilchschokolade, nach der Ganesha süchtig war.
Das Elefantenkalb hatte etwas Einnehmendes an sich, dessen Wirkung sich niemand entziehen konnte. Chopras Freunde und das gesamte Personal des Restaurants liebten Ganesha sehr. Die Ausnahme bildete auffallenderweise Poppys gehässige Mutter.
Chopra wandte sich wieder seinen Papieren zu. Sie enthielten handschriftliche Notizen zu verschiedenen Fällen, die er als Chef und einziger Ermittler des Baby Ganesh Detektivbüros derzeit bearbeitete. Sie alle waren Kleinkram im Vergleich zum Diebstahl des Koh-i-Noor. Das war mal ein Fall! Er spürte einen jähen Stich von Neid auf den Beamten, der sich diese Untersuchung unter den Nagel reißen würde. Neid, aber gleichzeitig Mitgefühl. Die ganze Welt würde dem armen Kerl über die Schulter blicken.
Die Hintertür der Küche schwang auf, und das Fliegengitter klappte heftig gegen die weiß gestrichene, schindelgetäfelte Wand.
Chopra sah Irfan auf den mondbeschienenen Hof heraustreten.
Eine Sekunde lang blieb der Junge auf der knarrenden Veranda unter dem geneigten Vordach stehen. Unterhalb der Veranda veranstalteten die Ochsenfrösche ihren nächtlichen Klagegesang. Der Junge kniete sich hin und zündete eine Moskitospirale an, die mit ihrem stechenden Geruch die Duftpalette im Hof anreicherte. Dann richtete er sich auf und trottete über den unebenen Rasen, während der Blecheimer in seiner Hand schepperte.
Ganesha begrüßte Irfan mit einem begeisterten Trompeten.
Der Junge stellte den Eimer ab, rieb dem Elefanten die hohe Stirn und kitzelte ihn hinter den Ohren. Ein Lächeln überzog das Gesicht des Burschen. Ganesha schlang ihm den Rüssel ums Bein und versuchte, ihn von den Füßen zu heben. Irfan lachte lauthals.
Chopra sah ihrem Herumgealbere zu und fühlte sich seltsam glücklich. Ganesha und Irfan waren enge Freunde geworden, und das tat beiden gut.
Er erinnerte sich gut an den Tag vor sechs Monaten, nur eine Woche, nachdem er das Restaurant eröffnet hatte, als Irfan in sein Büro gekommen war.
Chopra hatte bis zum Hals in Papierkram gesteckt. Wer hätte gedacht, dass ein Geschäft eine so sorgfältige Buchführung erforderte – zumindest ein ehrliches Geschäft! Er hatte aufgesehen, als der Knirps, offensichtlich ein Straßenjunge, von der anderen Seite des Schreibtischs über die Tischplatte spähte. Irfan war für ihn nur eines von einer Million Straßenkindern in Mumbai. Seine ganze Kleidung bestand aus einem zerrissenen Unterhemd und uralten Shorts. Die schwarzen Haare, vom ständigen Aufenthalt in der Sonne mit blonden Strähnen durchsetzt, waren ein ungekämmtes Durcheinander. Er hatte sich farbige Schnüre – improvisierte Bettelarmbänder – um die Handgelenke geschlungen. Die haselnussbraunen Augen wirkten milchig, und seine magere Gestalt war das Resultat von jahrelanger Unterernährung. Dennoch hatte der Junge etwas an sich gehabt, einen Anflug von unbezwingbarem Lebensmut, der aus seinem festen Blick und seiner zuversichtlichen Haltung leuchtete.
Chopra hatte in die Tasche gegriffen, eine Ein-Rupie-Münze hervorgezogen und sie dem Jungen hingehalten.
»Ich bin nicht wegen Bakschisch hier, Sir.«
Chopra war überrascht. »Und warum dann?«
»Ich will Kellner werden.«
Chopra hatte gelächelt. »Du bist zu jung für einen Kellner.«
»Wie alt muss man dafür sein?«
Chopra wollte zu einer Antwort ansetzen, merkte jedoch, dass es keine gab.
»Okay, wie alt bist du denn?«
Der Junge zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Alt genug, um Kellner zu sein.«
Wieder huschte ein Lächeln um Chopras Mundwinkel. »Wo wohnst du?«
Der Knirps zuckte abermals die Schultern. »Überall. Nirgends. Ganz Mumbai ist mein Zuhause.«
Da wusste er, dass der Junge zu der namenlosen und gesichtslosen Masse von Menschen gehörte, die auf Mumbais überfüllten Straßen lebten. Unter Überführungen, über die der Verkehr rauschte, in düsteren Gassen, die nach menschlichen Exkrementen stanken, in Slumhütten, die aus Abfällen und Altmaterial zusammengenagelt waren, oder in den Mündungen aufgelassener Abwasserrohre aus Beton.
»Wo sind deine Eltern?«
»Ich habe keine Eltern.«
»Wer kümmert sich um dich?«
Der Junge tippte sich gegen die Brust. »Ich kümmere mich um mich.« Dann deutete er zur Decke. »Und Er.«
Chopra staunte über die heitere Gelassenheit des Jungen. »Wie heißt du?«
»Irfan, Sir.«
Er musterte den Jungen von Kopf bis Fuß und ließ den Blick über seine unterernährte Gestalt gleiten. Die Prellungen an den Armen des Jungen waren unübersehbar – sie glichen den Spuren, die die hölzernen »Lathi«-Schlagstöcke der Polizei hinterließen. Brandmale von Zigaretten bildeten eine Konstellation dunkler Sterne auf seinen Schultern. Chopra fiel die verkrümmte linke Hand des Jungen auf, die anscheinend ein Geburtsfehler war. »Wie willst du mit einer Hand Kellner sein, Irfan?«, fragte er sanft.
»Sir, Gandhi hat die Briten mit bloßen Worten besiegt. Warum sollte ich nicht mit einer Hand Kellner sein?«
Chopra spürte unwillkürlich einen Kloß im Hals. Er überlegte, ob jemand dem Burschen von seiner Vorliebe für Gandhi erzählt haben konnte.
Inspector Ashwin Chopra (i. R.) lebte nach Mohandas Gandhis Lehren und dem persönlichen Vorbild an Barmherzigkeit und menschlicher Güte, das er seinen Landsleuten gegeben hatte. Wahrscheinlich hätte der große Staatsmann ihm, wäre er hier und jetzt bei ihm gewesen, ein paar deutliche Worte gesagt … Wieso zögerte er noch? Wenn je ein Kind einen Vertrauensvorschuss verdient hatte, dann doch sicher dieser Junge mit dem unbeugsamen Geist, der vor ihm stand.
Nun sah er zu, wie Irfan den Eimer unter Ganeshas Rüssel stellte. Er enthielt seine Abendration an Milch. Chopras Nasenlöcher blähten sich. Er roch einen großzügigen Schuss Kokosmilch und Ghee – Butterschmalz –, mit denen Chef Lucknowwallah die Milch angereichert hatte. Der Koch glaubte, dass Ganesha mehr Fleisch auf die Rippen bekommen musste, und versetzte deshalb die Milch mit üppigen Zutaten. Die luxuriöse Diät schien Ganesha zu schmecken, denn er wurde zusehends rundlicher.
»Chopra, Sir, Ihnen habe ich auch etwas mitgebracht.« Irfan griff in seine auffällige pinkfarbene Kellnerjacke – die er gemäß Poppys Anweisung mit ebenso knalligen rosafarbenen Shorts trug – und reichte ihm einen Stapel Umschläge und mit einer Schnur zugebundene Kartonmappen.
Chopra fühlte, wie ihm das Herz sank.
Sein frisch gegründetes Detektivbüro war noch kein Jahr im Geschäft, und schon hatte er mehr Arbeit, als er sich je hätte vorstellen können. Er hatte natürlich gewusst, dass Mumbai eine Brutstätte des Verbrechens war, aber nicht, dass es auch der Schauplatz derart vieler familiärer Notfälle war. Anscheinend fand jeder, der ein Haustier vermisste oder dessen Ehemann fremdging, den Weg zu Chopras Tür. In den letzten Monaten hatte er viele Fälle ablehnen müssen. Der Tag hatte einfach nicht genügend Stunden.
Chopra schätzte sich glücklich, dass der junge Irfan, wie sich herausgestellt hatte, einen rasiermesserscharfen Verstand besaß, und außerdem ein beinahe fotografisches Gedächtnis. Obwohl der Junge quasi Analphabet war – Poppy versuchte verzweifelt, ihn dazu zu überreden, etwas gegen dieses Manko zu unternehmen –, war er aus reiner Notwendigkeit sozusagen zu Chopras Assistenten geworden. Inzwischen verwaltete er sachkundig den wachsenden Aktenberg von Fällen, bei denen sie im Rückstand waren. Er beruhigte erboste Klienten, die endlich Berichte haben wollten, und half Chopra ganz allgemein dabei, mit der sich immer schneller drehenden Tretmühle zurechtzukommen.
Schuldbewusst legte Chopra die Aktenmappen mit den laufenden Fällen zur Seite und konzentrierte sich stattdessen auf die Korrespondenz.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.