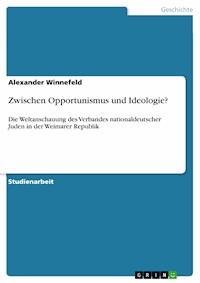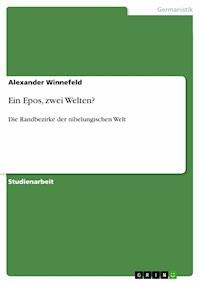
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für deutsche Philologie), Veranstaltung: Aufbauseminar Germanistische Mediävistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit untersucht die 'Topographie' des Nibelungenliedes und setzt sich dabei kritisch mit dem von Jan-Dirk Müller herausgearbeiteten Gegensatz von 'höfischer' und 'heroischer' Welt auseinander. Sie untersucht die Angaben zu geographischer Position und gesellschaftlicher Ordnung in Bezug auf die Randorte Isenstein, Niderlant und Nibelungenland und hinterfragt, inwiefern sich die Beschaffenheit der Länder tatsächlich in die von Müller entworfene 'Untergangsstruktur' integrieren lässt. Einleitung: Die Welt des Nibelungenliedes zerfällt, so Jan-Dirk Müller in seiner Studie „Spielregeln für den Untergang“, in zwei Zonen: zum einen die höfische, die Worms und Xanten ebenso wie Bechelaren und Etzelnburc umfasse; und auf der anderen Seite in jene „fremdartige“, heroische Welt, wie sie dem Leser auf Isenstein oder im Nibelungenland begegne. Diese Welten seien klar abgrenzbar und würden nur zwei mal überschritten werden - einmal, als Isenstein quasi kolonisiert, in die höfische Zone überführt werde, und dann ein zweites mal, als die mythische Welt zurückschlage und die höfische ‚überwuchere’ und schließlich ins Verderben ziehe . Bei allem Wert, den Müllers Werk als Plädoyer gegen den Ausschließlichkeitsanspruch sagengeschichtlicher Herangehensweisen hat, so scheint er mir an dieser Stelle doch genau in die Falle der Sinnunterstellung hereinzulaufen, vor der Joachim Heinzle gewarnt hat. Es ist richtig, dass nicht jede Ungereimtheit im Nibelungenlied ein Fehler ist, dass uns die „nibelungische“ Art des Erzählens z.T. einfach sehr fremd ist; Müller scheint mir jedoch vor allem im Detail dem Bearbeiter (oder den Bearbeitern) des Nibelungenliedes eine zu sehr an neuzeitlichen Maßstäben orientierte Verfügungsgewalt über den Stoff zuzuschreiben, wenn er den aus verschiedenen Traditionen zusammengeflossenen Text als bis ins Kleinste durchorganisiertes Zeichensystem liest. Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, die Länder des Nibelungenliedes nach Lage wie nach Sitten, unabhängig von einer Gesamtdeutung des Epos, zu beschreiben, und aufzuzeigen, ob und wie sich die nibelungische Welt im Detail aufgliedert. In Anbetracht des beschränkten Umfanges geschieht dies hauptsächlich mit Blick auf die ‚Randzonen’ der Erzählung, allerdings mit der Gegenfolie der im Mittelpunkt der Erzählung stehenden Höfe von Worms und Etzelnburc.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Ein Epos, zwei Welten?
1. Einleitung: Ein Epos, zwei Welten?
1.1 Das „Wuchern“ des Nibelungennamens
2. Nibelungische Randorte
2.1 Ez was ein küneginne gesezzen über sê – Island
2.2 Nidene bî dem Rîne – Niderlant
2.3 Ze Norwaege in der marke – Das Nibelungenland
2.4 Das Verschwimmen der Randzonen: Das Nibelungenland und Niderlant ab der 12. Aventiure
2.5 Andere Randgebiete
3. Abschlussbetrachtung - Eine alternative Topographie des Nibelungenliedes
4. Literaturverzeichnis
4.1 Textausgaben
4.2 Sekundärliteratur
1. Einleitung: Ein Epos, zwei Welten?
Die Welt des Nibelungenliedes zerfällt, so Jan-Dirk Müller in seiner Studie „Spielregeln für den Untergang“, in zwei Zonen: zum einen die höfische, die Worms und Xanten ebenso wie Bechelaren und Etzelnburc umfasse; und auf der anderen Seite jene „fremdartige“, heroische Welt, wie sie dem Leser auf Isenstein oder im Nibelungenland begegne[1]. Diese Welten seien klar abgrenzbar und würden nur zwei mal überschritten werden - einmal, als Isenstein quasi kolonisiert, in die höfische Zone überführt werde, und dann ein zweites mal, als die mythische Welt zurückschlage und die höfische ‚überwuchere’ und schließlich ins Verderben ziehe[2].
Bei allem Wert, den Müllers Werk als Plädoyer gegen den Ausschließlichkeitsanspruch sagengeschichtlicher Herangehensweisen hat, so scheint er mir an dieser Stelle doch genau in die Falle der Sinnunterstellung hereinzulaufen, vor der Joachim Heinzle gewarnt hat[3]. Es ist richtig, dass nicht jede Ungereimtheit im Nibelungenlied ein Fehler ist, dass uns die „nibelungische“ Art des Erzählens z.T. einfach sehr fremd ist; Müller scheint mir jedoch vor allem im Detail dem Bearbeiter (oder den Bearbeitern) des Nibelungenliedes eine zu sehr an neuzeitlichen Maßstäben orientierte Verfügungsgewalt über den Stoff zuzuschreiben, wenn er den aus verschiedenen Traditionen zusammengeflossenen Text als bis ins Kleinste durchorganisiertes Zeichensystem liest. Auch scheint er mir zu oft komplizierte semiotische Deutungen pragmatischen Erwägungen vorzuziehen – als Beispiel sei hier ein Detail genannt, das maßgeblich Müllers These der zwei trennbaren Welten im Nibelungenlied stützt: das „Wuchern“ des Nibelungennamens im zweiten Teil des Epos[4].
1.1 Das „Wuchern“ des Nibelungennamens
In der Tat erscheint es höchst rätselhaft, dass der Nibelungenname im zweiten Teil plötzlich auf die Burgonden übergeht[5]. Müller deutet dies als einen Einbruch der heroischen Sphäre in die gewöhnliche, höfisch geprägte Welt. Nachdem das fremdartige zuvor domestiziert worden sei, bräche es nun erneut in die Welt des Epos ein und führe diese in den Untergang. Doch diese Deutung ist alles andere als zwingend.
Betrachtet man stofflich mit dem Nibelungenlied verwandte Lieder der älteren Edda[6], fällt auf, dass dort zum einen der Nibelungenname (hier Niflungen genannt) nicht mit dem Hort – und somit auch nicht mit der mythischen Welt - verknüpft ist; der Hort erscheint hier als ein Zwergenschatz, der Erbstreit ist ein Konflikt zwischen den Brüdern Reginn und Fafnir (ein Zwerg, der Drachengestalt angenommen hat). Der Hortgewinn ist hier mit dem Drachenkampf verknüpft[7]. Dagegen trägt die Sippe Gunnars (also Gunthers) hier den Namen der Niflungen[8]. Eine zweite Auffälligkeit betrifft die Variabilität der Namensgebungen. So werden beispielweise im „Atlilied“ Gunnar und Högni (Hagen) nicht nur als Könige der Goten[9], sondern auch als Niflungen und Burgunden bezeichnet. In anderen Liedern kommt auch noch der Sippenname Gjukungen vor[10]. Ein ähnlicher Befund lässt sich auch für Sigurd (Siegfried) feststellen, der als Däne[11] oder Wölsunge[12], aber auch als „Hunnischer König“ und „Hunnischer Heerfürst“[13] bezeichnet wird. Zugleich bleibt aber auch Atli (Etzel) Hunne, und Brynhilt (Prünhilt) wird in der nordischen Überlieferung zu seiner Schwester und ebenfalls zur Hunnin. Was aber sagt nun dieser Befund aus? Wohl kaum kann diese Variation der Namenszuweisungen in jedem Fall mit wohldurchdachter Planung einhergegangen sein. Der Interpret muss sich die Möglichkeit vor Augen halten, dass es ähnliche Probleme bei der Namenszuweisung auch im deutschsprachigen Raum gegeben haben könnte, und dass der Übergang des Nibelungennamens auf die Burgonden im zweiten Teil des Epos ein Produkt einer solchen Konfusion sein könnte.