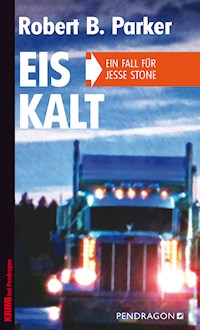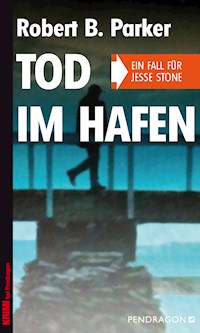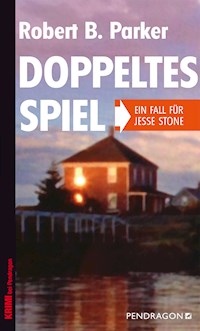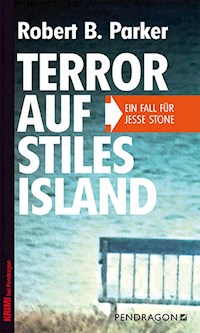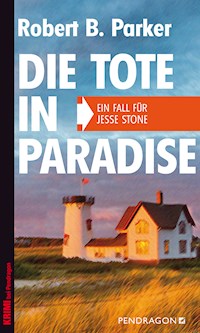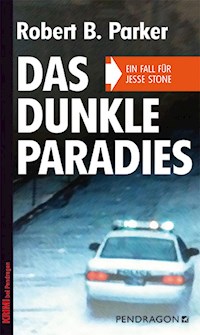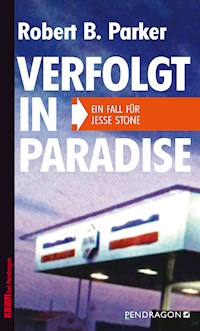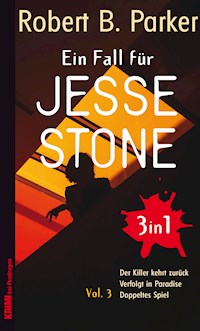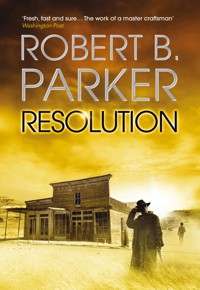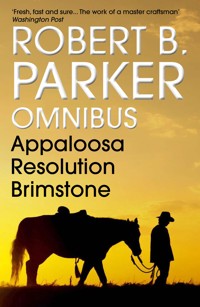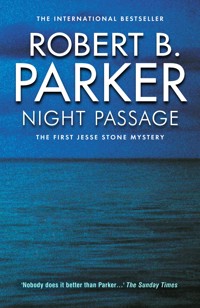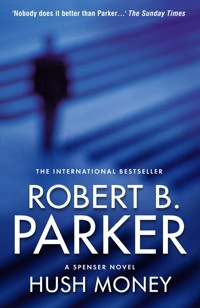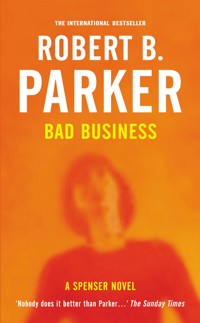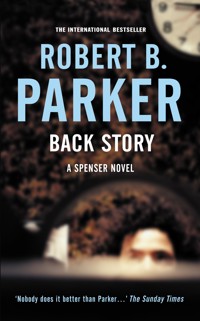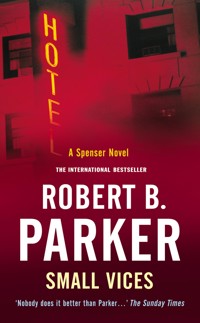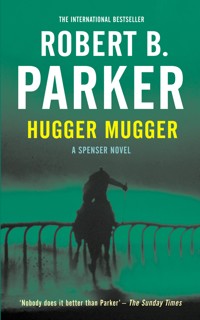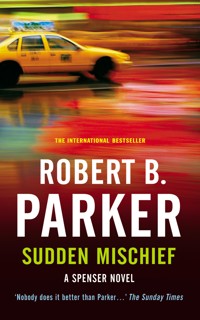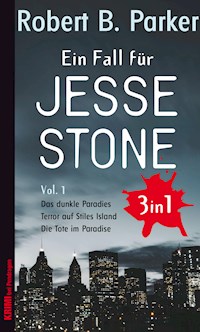
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DAS DUNKLE PARADIES Jesse Stone muss sich entscheiden: Seine Ehe liegt in Trümmern und sein Alkoholproblem droht übermächtig zu werden. Der Cop tritt die Flucht nach vorn an - nur weg aus Los Angeles. Dass er auf Anhieb einen Posten als Polizeichef in dem kleinen Städtchen mit dem verheißungsvollen Namen Paradise erhält, überrascht niemanden mehr als Stone selbst. Doch schon bald merkt er: Die Neu-England-Idylle trügt. Mehrere brutale Morde erschüttern Paradise. Bei seinen Ermittlungen stößt Stone auf politische Verstrickungen und korrupte Beamte, die ihm das Leben schwer machen. Den kaltblütigen Machenschaften steht Jesse Stone ganz allein gegenüber, denn in Paradise kann er niemandem trauen. (Übersetzt von Robert Brack) TERROR AUF STILES ISLAND Jesse Stone, der Cop aus Los Angeles, hat in der beschaulichen Kleinstadt Paradise in Massachusetts ein neues Zuhause gefunden. Aber noch immer trinkt er zu viel und denkt zu oft an seine Exfrau, die plötzlich in der Stadt auftaucht und als neue Wetterfee für den lokalen Fernsehsender arbeitet. Während Stone eine kurze Affäre mit einer Immobilienmaklerin hat und sich auch schlecht von der attraktiven Staatsanwältin lösen kann, ahnt er nicht, dass eine Gangsterbande einen raffinierten wie hinterhältigen Plan schmiedet. Das Ziel sind die Reichen und Schönen auf Stiles Island. Doch da haben sie die Rechnung ohne Jesse Stone gemacht. (Übersetzt von Bernd Gockel) DIE TOTE IN PARADISE Dieser Fall geht Polizeichef Jesse Stone an die Nieren. An einem See in der Nähe der US-Kleinstadt Paradise wird die stark verweste Leiche einer jungen Frau gefunden. Niemand scheint sie zu kennen oder zu vermissen. Erst durch einen Ring kann die Identität des Opfers festgestellt werden. Doch der Name wirft mehr Fragen auf als Jesse Stone lieb ist. Was hatte das Mädchen mit einem stadtbekannten Mafioso zu tun? Warum wird sie sogar von ihren eigenen Eltern verleugnet? Und wie passt ein Bestseller-Autor in das Szenario? (Übersetzt von Bernd Gockel)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
*Bundle Vol1* 9783865326317 Veröffentlicht im Pendragon Verlag Günther Butkus, Bielefeld 2018 Coverfoto: © luke-stackpoole *Das dunkle Paradies* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag Günther Butkus, Bielefeld 2013 © by Pendragon Verlag Bielefeld 2013 © by Robert B. Parker 1997 Alle Rechte vorbehalten *Terror auf Stiles Island* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag Günther Butkus, Bielefeld 2013 © by Pendragon Verlag Bielefeld 2013 Alle Rechte vorbehalten *Die Tote in Paradise* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag Günther Butkus, Bielefeld 2014 © by Pendragon Verlag Bielefeld 2014 Alle Rechte vorbehaltenRobert B. Parker
Ein Fall für Jesse Stone BUNDLE (3in1) Vol.1
Die Bücher der Jesse-Stone-Reihe zählen zu den besten Krimis, die Robert B. Parker in seiner langen Karriere geschrieben hat. Die Romane wurden überaus erfolgreich mit Tom Selleck in der Hauptrolle verfilmt.
Inhalt
Terror auf Stiles Island
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Urheberrecht
Das dunkle Paradies
Titelblatt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
Nachwort
Urheberrecht
Die Tote in Paradise
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Rbert B. Parker | Jesse Stone
Robert B. Parker · Terror auf Stiles Island
Robert B. Parker wurde 1932 geboren. Nach seinem M.A. in amerikanischer Literatur promovierte er 1971 über die »Schwarze Serie« in der amerikanischen Kriminalliteratur.
Seit seinem Debüt »Spenser und das gestohlene Manuskript« im Jahr 1973 hat er über 50 Bücher veröffentlicht. 1976 erhielt er für den Titel »Auf eigene Rechnung« den Edgar-Allan-Poe-Award für den besten Kriminalroman des Jahres. Neben den überaus erfolgreichen »Spenser«- und »Jesse-Stone«-Reihen veröffentlichte Parker auch einzelne Krimis, darunter »Wildnis«. Am 18. Januar 2010 verstarb Robert B. Parker in Massachusetts. www.robertbparker.de
Robert B. Parker
Terror auf Stiles Island
Ein Fall für Jesse Stone
Übersetzt von Bernd Gockel
PENDRAGON
1
Wenn er nicht schlafen konnte – was zum Glück immer seltener der Fall war –, setzte sich Jesse Stone hinters Steuer seines schwarzen Ford Explorers und kurvte durch das nächtliche Paradise, Massachusetts. Als er sich aus L.A. verabschiedet hatte, um hier seinen Job als Polizeichef anzutreten, hatte er in diesem Wagen die gesamten USA durchquert. Er liebte die Nächte, in denen der Regen wie ein Messer durch die Dunkelheit schnitt und die Straßen im Scheinwerferlicht glänzten. In einer Nacht wie dieser, ging es ihm durch den Kopf, wäre er auch gerne Marshall im Wilden Westen gewesen. Er hätte sich die Öljacke übergezogen, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, hätte sich in den Sattel geschwungen und das Pferd einfach ziellos laufen lassen.
Er rollte langsam am Rathausplatz vorbei, am weißen Gemeindehaus im Kolonialstil, auf dessen Dach der Regen nun schon seit 200 Jahren trommelte. Das blaue Schimmern der altmodischen Straßenlampen, deren Lichtkegel im Regen zu verschwimmen schienen, hatte eine beruhigende Wirkung auf ihn. Es gab – die Scheinwerfer seines Explorers ausgenommen – keine andere Lichtquelle in diesem Teil der Stadt. In den gepflegten Häusern mit ihren großzügigen Rasenflächen, geschmackvoll um das Gemeindehaus gruppiert, war es dunkel und still. Nirgendwo eine Bewegung. Die Stadtbücherei schien ausgestorben, ebenso die High School mit ihren roten, im Regen glänzenden Backsteinen. Als er auf den Parkplatz bog, wirkten die pechschwarzen Fenster selbst im Licht seiner Scheinwerfer abweisend und undurchdringlich. Er hielt für einen Augenblick an und schaltete das Fernlicht ein. Im Scheinwerferlicht war die Raute des Baseballplatzes zu erkennen, das verrostete Abfanggitter hinter dem Catcher, der Gummibelag auf dem Hügel des Pitchers, selbst die Kuhle vor dem Gummi: Anscheinend gab es hier genügend ambitionierte High-School-Kids, die sich mit ihrer Wurftechnik an großen Pitcher-Idolen wie Nolan Ryan orientierten. Als er selbst in der Zweiten Profi-Liga gespielt hatte, war er auf der Position des Shortstop die ideale Besetzung: Er hatte einen mordsmäßigen Arm, kräftiger sogar als der von Rick Burleson, und konnte den Ball selbst aus weitester Entfernung punktgenau werfen. Er war auch als Läufer nicht übel, war fangsicher und hatte für einen Feldspieler einen passablen Schlag. Aber es war sein Wurfarm, der Großes zu versprechen schien. Seine Eintrittskarte zur großen Karriere. Jesse rieb sich seine rechte Schulter und starrte aufs Baseballfeld hinaus. Er erinnerte sich noch genau an den Augenblick, als ihn der Schmerz traf wie ein Blitz. Es war zu Beginn eines Double Play und er schaffte es locker, die beiden gegnerischen Spieler auszuschalten. Aber es sollte das Ende seiner Karriere bedeuten …
Jesse ließ den Wagen wieder rollen, wendete und fuhr auf die Main Street zurück, diesmal Richtung Meer. An einem leeren Parkplatz beim Paradise Beach hielt er erneut an, ließ den Motor aber auch diesmal laufen. Der Regen schien den Geruch des Wassers noch zu verstärken. Im Licht der Scheinwerfer donnerten die Wellen heran, schwollen an, bildeten Schaumkronen, um dann krachend in sich zusammenzubrechen. Im Vergleich zum schwarzen Ozean war selbst der prasselnde Regen nur eine Bagatelle. Eine Thermosflasche mit Piña Colada wäre jetzt keine schlechte Idee, dachte er, dazu vielleicht noch etwas Musik.
Unweigerlich wanderten seine Gedanken zu Jenn. Sie war ein Naturtalent, was die romantischen Momente betraf. Wenn sie jetzt neben ihm säße, würde sie sich mit geschlossenen Augen zurücklehnen, würde mit ihm sprechen und ihm zuhören, würde die nächtliche Stunde und den Regen und das Rauschen des Meeres in vollen Zügen genießen. Und sie würde dieses Gefühl auch bereitwillig mit ihm teilen. Manchmal dachte er, dass es diese Momente waren, die er am meisten vermisste. Selbst zehn Jahre in der L.A.-Mordkommission hatten seiner romantischen Ader letztlich nichts anhaben können. Sicher, all seine bisherigen Erfahrungen führten zu der Schlussfolgerung, dass die große Liebe wohl eher Seltenheitswert hatte. Aber gerade ihre Unbegreiflichkeit hatte Jesse davon überzeugt, dass die Hoffnung auf Liebe das letzte Bollwerk gegen Selbstzweifel und Verzweiflung war.
Gut möglich, dass es Jenn ähnlich erging. Obwohl ihre Scheidung nun schon länger zurücklag, waren sie in Kontakt geblieben. Als sie im letzten Jahr gehört hatte, dass es ihm schlecht ging, war sie umgehend an die Ostküste geflogen. Dabei war es kein Problem, bei dem sie ihm wirklich helfen konnte – und das wusste sie auch. Aber offensichtlich hatte sie das nicht davon abgehalten, trotzdem zu kommen. Sie war sogar geblieben und hatte sich hier niedergelassen. Aber nun? Was zum Teufel sollte aus ihnen beiden werden? Er legte den Gang ein, manövrierte aus der Parklücke und fuhr langsam auf der Strandpromenade Richtung Downtown. Er war sich bewusst, dass weder Alkohol noch seine Ex gut für ihn waren. Er sollte besser nicht so oft an sie denken.
Die Anzeigetafeln am Kino waren dunkel, ebenso die Geschäfte in der Innenstadt. Die Ampeln sprangen von Rot auf Gelb auf Grün, ohne dass jemand Notiz davon nahm. Er fuhr zum Indian Hill hinauf, parkte am höchsten Punkt des Hawthorne Park, schaltete die Scheinwerfer ab und ließ seinen Blick über den Hafen gleiten. Zur Linken ging der Hafen ins offene Meer über, nach rechts bildete der Damm zwischen Paradise und Paradise Neck eine natürliche Begrenzung. Die Mole lag auf der anderen Seite des Hafens, eine dunkle Landzunge mit dem Leuchtturm an ihrem nördlichen Ende. Nicht einmal 100 Meter hinter dem Leuchtturm lag Stiles Island. Der vordere Teil bildete einen Schutzwall zum Hafeneingang, während das hintere Ende ins offene Meer ragte. Jesse wusste, dass der Kanal zwischen Insel und Mole – dort, wo das Wasser von beiden Seiten in die Zange genommen wurde – für seine Strudel berüchtigt war. Doch hier oben war von den tückischen Strömungen nichts zu sehen. Bedächtig glitt das Leuchtfeuer über die Dächer der Häuser, dann hinüber zu der Bogenbrücke, die vom Leuchtturm zur Insel führte. Alles andere versank im Dunkel der Nacht.
Jesse saß still in der Dunkelheit und blickte auf das Meer und den Regen. Auf der Digitaluhr am Armaturenbrett sah er, dass es 4 Uhr 23 war. Bei wolkenlosem Himmel würde im Osten nun die erste Morgenröte zu sehen sein – in einer halben Stunde wäre es bereits hell. Jesse schaltete die Scheinwerfer an, wendete den Wagen und fuhr den Hügel hinunter. Er musste duschen und sich umziehen. Und sich seine Polizeimarke an die Jacke klemmen.
2
Macklin war gerade mal eine Woche aus dem Knast, hatte aber bereits einen Mercedes klargemacht, den er in der Parkgarage der Alewife Station geknackt hatte, und eine 9 mm Halbautomatik, die er von einem Typen namens Desmond bekommen hatte, mit dem er zusammen im Bau war. Macklin hatte die Neuner gleich sinnvoll eingesetzt, um einen Schnapsladen in der Nähe des Wellington Circle auszunehmen. Mit dem Geld aus dem Überfall war er zu Desmonds Neffen Chick gegangen, der bei der Kfz-Zulassung arbeitete, ihm einen Fahrzeugbrief auf den Namen Harry Smith ausstellte und gleich auch ein legales Nummernschild in die Hand drückte. Als er den Wagen umspritzen ließ, hatte er sich für »British-Racing-Grün« entschieden. Dann hatte er je eine Flasche Belvedere Wodka und Stock Wermut gekauft und sich auf den Weg zu Faye gemacht.
Er hatte kaum ihr Apartment betreten, als sie sich auch schon aus ihrem Bademantel schälte. Fünf Minuten später lagen sie im Bett und waren voll dabei. Als es vorbei war, stand Faye auf, schüttete ihnen einen Martini ein und brachte die Gläser zum Bett.
»Hab’s mir eineinhalb Jahre für diesen Augenblick aufgespart«, sagte Macklin.
»Hab ich gemerkt«, sagte Faye.
Sie hatten es sich auf den pink- und fliederfarbenen Kissen in Fayes Doppelbett bequem gemacht. Die Martinis standen auf dem Nachttisch, gleich neben Macklins Revolver. Die Wände waren ebenfalls in einem hellen Lila gestrichen, während die Decke verspiegelt war. Ihre Wohnung befand sich im alten Charlestown Navy Yard und aus dem Fenster des ersten Stocks konnte man auf der anderen Seite des Hafens die Skyline von Boston sehen.
»Du dir auch?«, fragte Macklin.
»Ich mir was?«, sagte Faye.
Sie hatte sich über ihrer rechten Hüfte zwischenzeitlich eine Rose tätowieren lassen.
»Hast du’s dir auch eineinhalb Jahre aufgespart?«
»Klar doch«, sagte sie.
Macklin nippte an seinem Martini. Die Überzüge auf Fayes Bett waren fliederfarben.
»Gab’s keinen anderen?«
»Absolut niemanden«, sagte Faye.
Sie sah zur verspiegelten Decke hoch und mochte, was sie sah. Er war schlank und geschmeidig. Und so blond, dass seine Haare fast schon weiß wirkten. Er sah insgesamt vielleicht ein bisschen blass aus, aber sie wusste, dass er an seinem Teint arbeiten würde. Sie liebte den Kontrast von seinen blonden Haaren und dem gebräunten Körper. Sie überprüfte ihr eigenes Aussehen: Die Titten waren noch gut in Schuss, die Beine auch. Konnte man schließlich auch erwarten. Täglich 45 Minuten auf dem verdammten StairMaster! Sie drehte sich auf die Seite und checkte ihren Hintern. Proper. StairMaster sei Dank.
»Kontrollierst du das Equipment?«, fragte Macklin.
»Hm.«
»Scheint noch alles zu funktionieren«, sagte Macklin.
Sie kicherte.
»Und wie sieht’s mit deinem aus?«, fragte sie.
»Sollte bald wieder einsatzbereit sein.«
Sie tranken ihre Martinis aus und schwiegen.
»Und was machen wir nun?«, fragte Faye schließlich.
»Noch mal das Gleiche, dachte ich«, sagte Macklin.
»Aber vielleicht könnten wir es diesmal auf dem Stuhl versuchen.«
Faye kicherte wieder. »Das mein ich nicht«, sagte sie. »Ich meine, was wir jetzt mit unserem Leben anfangen werden.«
»Vom Vögeln abgesehen?«
»Vom Vögeln abgesehen.«
Macklin grinste. Er richtete sich im Bett auf und schüttete ihnen einen weiteren Martini ein.
»Nun«, sagte Macklin. »Morgen werden wir mal nach Paradise fahren und uns über die Immobilien auf Stiles Island informieren.«
»Was ist denn Stiles Island?«
»Eine kleine Insel vor Paradise Harbor. Sie ist mit dem Rest von Paradise nur durch eine schmale Brücke verbunden. Die Brücke wird von privatem Sicherheitspersonal überwacht. Wer dort lebt, hat seine Schäfchen im Trockenen. Sie haben sogar eine Bank nur für die Anwohner dort.«
»Und wie kommst du gerade auf diese Insel?«
»Lester Lang, ein Typ aus dem Knast, hat mir die ganze Zeit davon vorgeschwärmt. Sagte, es sei die reinste Goldgrube.«
»Warst du schon mal da?«
»Nee.«
»Und wir wollen dort ein Haus kaufen?«, fragte Faye.
»Nee.«
»Warum schauen wir uns denn dann Immobilien an?«
»Um den Ort mal unter die Lupe zu nehmen.«
»Wofür?«
»Für den größten Beutezug aller Zeiten«, sagte Macklin.
Faye legte ihren Kopf an seine Schulter und lachte. »Darauf trink ich gern«, sagte sie und prostete ihm zu.
3
Der Mann, der auf dem Revier nur als »Suitcase Simpson« bekannt war, trat durch Jesses offene Bürotür, ohne sich mit Klopfen aufzuhalten. »Jesse«, sagte er, »war das etwa deine Ex, die ich gestern im Fernsehen gesehen habe?«
»Keine Ahnung, Suit«, sagte Jesse. »Was hast du denn gesehen?«
»Die Nachrichten auf Channel 3. Sie haben eine neue Wetterfee – Jenn Stone.«
Sie benutzte also nicht ihren Mädchennamen.
»Wetterfee?«, sagte Jesse.
»Ja, sie sprachen darüber, dass sie aus Los Angeles komme und sich bestimmt erstmal akklimatisieren müsse, um über das Schmuddelwetter an der Ostküste berichten zu können.«
»Und sie sah wie Jenn aus?«
»Absolut. Ich hab sie ja nur einmal gesehen, aber du weißt am besten, dass sie eine Frau ist, die man so leicht nicht vergisst.«
»Nein«, sagte Jesse. »Mit Sicherheit nicht.«
»Arbeitete sie in L.A. auch als Wetterfee?«, fragte Simpson.
»Nein, sie war Schauspielerin.«
»Vielleicht spielt sie ja nur die Wetterfee.«
»Kann gut sein«, sagte Jesse. »Hast du sie in den Nachrichten um sechs oder um elf gesehen?«
»Um sechs«, sagte Simpson.
»Ich werd heut Abend mal die Augen offenhalten«, sagte Jesse.
»Möchte wetten, dass sie nicht wieder nach L.A. zurückkehrt«, sagte Simpson.
»Sieht ganz danach aus«, entgegnete Jesse.
Simpson stand für einen Moment unschlüssig rum, als wolle er noch etwas sagen, fand aber nicht die richtigen Worte. »Nun ja«, sagte er schließlich. »Ich dachte mir, es würde dich interessieren.«
»Tut es. Danke, Suit.«
Simpson konnte sich noch immer nicht aufraffen zu gehen, nickte dann aber, als wolle er damit eine ungestellte Frage beantworten, drehte sich um und verließ das Büro.
Sie benutzt also noch immer unseren gemeinsamen Namen. Jesse wirbelte auf seinem Drehstuhl herum, legte die Füße auf die Fensterbank und starrte hinaus. Es muss Jenn sein, dachte er. Eine andere Erklärung gab es nicht. Im sicheren Abstand von 5 000 Kilometern hatte er seine Gefühle unter Kontrolle gebracht. Keine Frage: Er liebte sie noch immer – was aber nicht bedeutete, dass er mit ihr zusammenleben musste. Und auch nicht, dass er keine andere Frau lieben konnte. Jedenfalls war er davon überzeugt, als sie noch 5 000 Kilometer von ihm entfernt lebte und mit einem Filmproduzenten ins Bett stieg. Aber hier …?
Molly Crane trat in sein Büro.
»Jesse«, sagte sie. »Das Feuer heute Morgen in 59 Geary Street? Anthony glaubt, dass es Brandstiftung war und du mal vorbeischauen solltest.«
Jesse drehte sich auf seinem Stuhl langsam um.
»Geary Street«, sagte er.
»Sie haben das Feuer soweit unter Kontrolle«, sagte Molly, »aber Anthony ist noch dort, zusammen mit dem Chef der Feuerwehr.«
Jesse nickte.
»Sie warten auf dich, Jesse.«
Jesse musste grinsen. Molly war die geborene Gouvernante.
»Bin schon unterwegs«, sagte er.
Er schaltete die Sirene nicht ein. Eine seiner kategorischen Verhaltensregeln für das Polizeirevier besagte: keine Sirene, kein Blaulicht, wenn es nicht wirklich ein Notfall war.
Die Geary Street stieß an ihrem Ende auf die Preston Road und bildete dort – zwei Straßen vom Strand entfernt – ein Dreieck; 59 Geary befand sich genau an der Spitze des Dreiecks und grenzte an ein unbebautes Grundstück. Als Jesse dort eintraf, waren Geary und Preston bereits abgeriegelt. Pat Sears war damit beschäftigt, den Verkehr umzuleiten.
Jesse hielt neben ihm an. »Soll ich noch ein paar Leute schicken, damit du den Verkehr geregelt kriegst?«, fragte er.
Pat blies auf seiner Trillerpfeife und gestikulierte wild zu dem Fahrer eines Buick Station Wagon, der hinter Jesses Wagen angehalten hatte.
»Wär keine schlechte Idee«, sagte er zu Jesse. »Wir brauchen jemanden am anderen Ende der Straße – und hier oben auch noch einen Mann.« Er nickte zu der Autokolonne hinüber, die sich hinter dem Wagen des Einsatzleiters gebildet hatte und sich schon bis in die LaSalle Street staute.
»Ich ruf Molly an«, sagte Jesse und fuhr zum Brandort weiter.
Ein halbes Dutzend Löschfahrzeuge war im Einsatz, die beiden aus Paradise sowie vier weitere aus benachbarten Dienststellen.
Jesse parkte seinen Wagen und stieg aus. Arleigh Baker, der Chef der Feuerwehr, stand auf dem Rasen. Als Chef der »Öffentlichen Sicherheit« war Jesse theoretisch auch für die Feuerwehr zuständig, aber da er von Brandbekämpfung wenig verstand, fungierte Arleigh als Einsatzleiter. Er war klein, rundlich und sah mit seinen Stiefeln, Helm und Regenmantel wie ein kleiner Napoleon aus.
»Gut schaust du aus, Arleigh«, sagte Jesse.
»Ich seh in diesem Aufzug wie ein gottverdammtes Arschloch aus«, sagte Arleigh.
Jesse grinste und schaute auf die Ruinen des qualmenden Hauses. Die tragenden Wände standen noch, doch im Dach klaffte ein riesiges Loch. Alle Fensterscheiben waren geborsten und ein Teil der Hausfront war von den Flammen völlig zerstört worden. Im Innern sah man Asche und verkohlte Balken.
»Ein verdächtiger Brandherd?«, fragte Jesse.
»Schau’s dir selbst an«, sagte Arleigh und marschierte zum Hauseingang.
Das Feuer hatte vor allem im Wohnzimmer gewütet, das sich im rechten Teil des Hauses befand. Der Fußboden war fast vollständig verschwunden, ebenso die hintere Wand, hinter der sich die Küche befand. Auf der Wand zur Linken, die vergleichsweise unbeschädigt war, hatte jemand in großen Lettern das Wort SCHWUCHTELN gesprayt.
»Pass auf, wo du hintrittst«, sagte Arleigh.
Jesse trug nur Turnschuhe und der Boden war an einigen Stellen tatsächlich noch warm. Überall lagen Holzplanken herum, aus denen zum Teil spitze Nägel ragten. Während Arleigh in seinen Stiefeln ungerührt durch die Trümmer stampfte, setzte Jesse vorsichtig einen Fuß vor den anderen.
Ein weiteres SCHWUCHTELN zierte den Treppenaufgang und auch im ersten Stock, wo das Feuer vorwiegend Rauchspuren hinterlassen hatte, war das Wort mehrfach in schnörkeliger Schrift auf die Wände gesprayt worden.
»Nicht gerade einfallsreich, der Bastard«, sagte Jesse.
»Der Feuer-Inspektor für Massachusetts will sich den Brandort noch anschauen«, sagte Arleigh. »Vielleicht kann der uns Genaueres sagen. Ich würde mal behaupten, das Feuer wurde mitten auf dem Fußboden des Wohnzimmers gelegt. Was eher ungewöhnlich ist. Jemand muss das Benzin auf den Teppich geschüttet und dann den Kanister angezündet haben.«
Er war hochrot im Gesicht und schwitzte unter seinem schweren Mantel.
»Und wenn der Brand gelegt wurde, kann man wohl mit einigem Recht vermuten, dass es die gleichen Leute waren, die auch SCHWUCHTELN auf die Wand geschrieben haben.«
»Leute? Plural?«
»Ja«, sagte Jesse. »Mindestens zwei Leute haben gesprayt.«
»Wie zum Teufel willst du das wissen?«, sagte Arleigh.
»Wenn du für eine Weile in South Central L.A. gearbeitet hast, lernst du die Handschrift dieser Graffiti-Jungs kennen«, sagte Jesse. »Wissen wir schon, wer hier wohnt?«
»Nein.«
»Dann sollten wir das rauskriegen.«
4
»Das sieht nicht gut aus«, sagte Macklin, als er auf die Bremse des Mercedes trat. Der Verkehr vor ihm auf der LaSalle Street war zum Erliegen gekommen. »Wir müssten da vorne rechts.«
»Da steht ein Verkehrspolizist«, sagte Faye, »und er lässt niemanden nach rechts abbiegen.«
»Muss ein Brand sein«, sagte Macklin. »Siehst du den Feuerwehrwagen, der dort raussteht? Der verursacht den ganzen Stau.« Er schüttelte den Kopf. »Feuerwehrleute und Cops«, sagte er. »Parken ihren Arsch immer dort, wo es ihnen gerade Spaß macht. Denen ist es doch völlig schnurz, ob sie den ganzen Verkehr lahmlegen.«
Macklin hatte das Solarium in Fayes Appartmentkomplex besucht und hatte inzwischen eine gesunde Hautfarbe. Er trug einen grauen Anzug im Palm-Beach-Stil, ein blaues Hemd mit gelber Seidenkrawatte und gelbem Brusttuch. Sein 9 mm Revolver lag im Handschuhfach.
»Wie viel Schweiß hätte es ihn wohl gekostet«, sagte er, »wenn das Arschloch auf dem Seitenstreifen geparkt hätte?«
Faye lächelte. Sie trug ein unauffälliges hellbraunes Ensemble mit einem langen Jackett und kurzen Rock und hatte ihre Haare hochgesteckt. Der Wagen rollte ein Stückchen weiter.
»Sieht aus, als würde ein Haus brennen«, sagte Faye. »Ich sehe Feuerwehrwagen am Ende der Straße.«
»Und sie können das Feuer nicht löschen, ohne einen Stau bis nach Lynn auszulösen?«, knurrte Macklin.
»Ich glaube, das Feuer ist schon unter Kontrolle«, sagte Faye.
»Sie tun einfach so, als stünden sie über dem Gesetz – als gäbe es ein Gesetz für sie und ein Gesetz für den Rest von uns«, sagte Macklin.
Faye drehte sich zu ihm um und sah ihn mit einem breiten Lächeln an.
»Es gibt ein Gesetz für uns?«, sagte sie. »Jimmy, du bist ein Gangster. Dir geht das Gesetz doch am Arsch vorbei.«
Macklin passierte den Polizisten, der den Verkehr regelte, rollte langsam am Wagen des Einsatzleiters vorbei und drückte wieder aufs Gas. Lautlos lachte er vor sich hin.
»Da ist was dran«, sagte er.
Am Kino bogen sie nach rechts ab, fuhren über die Ocean Avenue an der noch immer gesperrten Geary Street vorbei und bogen dann auf den Damm nach Paradise Neck ein. Die großen alten Schindelhäuser, von Bäumen und großzügigen Grünflächen umgeben, waren von der Straße aus kaum zu erkennen. Sie passierten den Jachtclub, ein protziges weißes Gebäude mit Blick auf den Hafen, fuhren um den Leuchtturm herum und kamen schließlich zu der eleganten Bogenbrücke, die über das aufgewühlte Wasser nach Stiles Island führte. Am Ende der Brücke befand sich das Häuschen mit dem Wachpersonal. Macklin hielt an und ließ das Fenster herunter. Ein großer, grauhaariger Mann mit Brille trat heraus und kam näher. Er trug einen blauen Blazer und hatte ein Klemmbrett in der Hand. Auf der Jacke befand sich ein blaues Personalschild mit den Worten STILES ISLAND SECURITY, darunter sein Name J.T. McGonigle.
»Hi«, sagte Macklin. »Wir haben einen Termin bei Mrs. Campbell.«
»Ihr Name, Sir?«
»Ich weiß, es klingt etwas abgedroschen«, sagte Macklin, »aber ich heiße tatsächlich Smith.«
Der Wachmann schaute auf sein Klemmbrett. »Mr. und Mrs.?«
»Genau.«
»Gleich da drüben, Sir. Bitte parken Sie auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz.«
»Ich danke Ihnen.«
Als sie die Schranke passierten, notierte der Wachmann ihr Nummernschild. Gleich zur Rechten befand sich ein flaches Gebäude mit verwitterten Schindeln und blauen Fensterläden. Neben der Tür hing ein unauffälliges blaues Schild mit goldenen Lettern: STILES ISLAND IMMOBILIEN. Ein Lexus stand vor der Tür, daneben ein freier Parkplatz für BESUCHER.
»Stiles Island ist zu edel, um Kunden zu haben«, sagte Macklin.
»Wie heißen wir denn mit Vornamen«, fragte Faye.
»Ich bin Harry«, sagte Macklin. »Wer möchtest du gerne sein?«
»Wie wär’s mit einem dieser vorsintflutlichen Namen, die von den stinkreichen Säcken hier in Neuengland noch immer benutzt werden – wie Muffy oder Choo Choo?«
»Herr im Himmel«, sagte Macklin. »Du kannst doch nicht erwarten, dass ich hier rumlaufe und dich Muffy nenne.«
»Rocky vielleicht?«
»Rocky?«, sagte Macklin.
Faye nickte. Macklin streckte seine geballte Faust aus und Faye schlug mit der ihren vorsichtig dagegen.
»Volltreffer, Rocky«, sagte er.
Sie stiegen aus dem Wagen.
»Und aus welcher Stadt kommen wir?«, fragte Faye.
»Wird mir noch rechtzeitig einfallen«, sagte Macklin. »Du weißt, wie sehr ich es hasse, jedes Detail zu planen.«
Das Immobilienbüro war mit Möbeln im Kolonialstil dekoriert; an den Wänden hingen Kunstdrucke mit maritimen Motiven. Mrs. Campbell war eine hochgewachsene Frau mit platinblonden Haaren, reichlich Make-up und einer attraktiven Figur. Sie war vielleicht schon etwas vollreif, dachte Macklin, aber im Bett sicher noch eine gute Partie.
»Ich bin Harry Smith«, sagte Macklin. »Meine Frau Rocky.«
»Darf ich fragen, aus welcher Gegend Sie kommen?«, sagte Mrs. Campbell.
Sie trug einen blauen Hosenanzug und ein weißes Herrenhemd, das am Kragen geöffnet war.
»Concord«, antwortete Macklin.
»Und Sie interessieren sich also für eine Immobilie auf Stiles Island?«
»Ja, Ma’am.«
»Nun, wir haben einige Häuser, die zum Verkauf stehen, aber natürlich könnten wir Ihnen auch Grundstücke anbieten, auf denen Sie selbst bauen können.«
»Was meinst du, Schatz?«, sagte Macklin.
»Ich denke, wir sollten uns zunächst einmal die Insel in Ruhe ansehen«, sagte Faye. »Wissen Sie, wir wollen ja hier nicht nur ein Stück Land erwerben, sondern uns auch in diese Gemeinschaft einbringen.«
»Ein wichtiger Punkt«, sagte Mrs. Campbell. »Warum machen wir uns nicht einfach auf den Weg? Ich fahre Sie etwas herum und wir können alles Weitere unterwegs besprechen. Darf ich fragen, ob Sie den Kaufpreis selbst finanzieren werden?«
»Ja, in bar«, sagte Macklin.
»Und sind Sie mehr an einem Grundstück oder an einem fertigen Haus interessiert?«
»Wir sind für beides offen«, sagte Faye. »Oder nicht, Harry?«
»So sieht’s aus, Rocky.«
Mrs. Campbell ging um den Schreibtisch, um ihre Handtasche zu holen. Macklin konnte nicht umhin zu bemerken, dass ihr Hosenanzug straff über dem Hintern saß. Und da war auch dieses gewisse Etwas in der Art, wie sie ging. Fickt garantiert wie ein Kaninchen, dachte Macklin. Er war sich nicht sicher, warum er das wusste. Aber die Art, wie sie stand, wie sie ging, wie sie sich ihres Körpers sehr wohl bewusst war, ließ keinen Zweifel zu. Vielleicht war es ja Zauberei, aber er lag in diesen Dingen mit seiner Einschätzung selten daneben. Er speicherte die Information in seinem Hinterkopf ab.
5
Die beiden Männer, denen das Haus in der Geary Street gehörte, saßen zusammen in Jesses Büro. Einer war groß und dünn, hatte einen kahl geschorenen Schädel und trug eine Fliegerbrille mit goldenem Gestell. Sein Begleiter war gedrungener, hatte seine blonden Haare getrimmt und trug einen Schnurrbart. Beide Männer waren älter als Jesse – 42 oder 43, schätzte er. Der größere Mann hieß Alex Canton.
»Wir waren für ein paar Tage in Provincetown, als es passierte«, sagte Canton. »Einer unserer Nachbarn rief uns an. Wir sind sofort zurückgekommen.«
»Es war Brandstiftung«, sagte Jesse. »Die Graffiti an der Wand waren ein erstes Indiz, aber auch die Art und Weise, wie der Fußboden durchgebrannt ist. Das Büro der überregionalen Brandinspektion hat unsere Vermutung inzwischen bestätigt: Eine brennbare Flüssigkeit, vermutlich Benzin, wurde auf den Teppich gekippt und dann angezündet.«
»Wir wissen, wer es war«, sagte Canton. »Howard und ich sind uns absolut sicher.«
Jesse schaute auf seinen Notizblock. Howards Nachname war Brown.
»Wer?«, sagte Jesse.
»Alex, uns fehlen die Beweise«, sagte Brown.
»Wir wissen, dass sie es waren«, sagte Canton.
»Wer?«, fragte Jesse noch einmal.
»Die verdammten Hopkins-Kinder«, sagte Canton.
»Vollständige Namen?«
»Earl«, sagte Canton. »Ich glaube, er ist der Ältere. Und Robbie.«
»Alter?«
»Vielleicht 15 oder 14, schätze ich. Sie fahren jedenfalls noch kein Auto.«
»Gab’s früher schon Ärger mit ihnen?«, fragte Jesse.
Er kannte die Antwort schon, bevor er die Frage stellte. Natürlich hatte es früher schon Ärger gegeben. Zwei offenkundig schwule Männer in einer hundertprozentig heterosexuellen Nachbarschaft, dazu eine Menge verwöhnter Kids, die sich tagsüber zu Tode langweilten. Warum machen wir uns nicht mal den Spaß und schikanieren die schwulen Säcke?
»Nichts Weltbewegendes«, sagte Brown. »Wenn sie am Haus vorbeikamen, machten sie halt entsprechende Bemerkungen.«
»Wie etwa?«
»Irgendwelche dummen Reime wie ›Mister Brown mag’s lieber braun‹. Ich bin schon lange schwul und habe Schlimmeres gehört.«
»Sonst noch was?«
Brown und Canton schauten sich an, während sie nachdachten.
»Nein«, sagte Canton.
»Mr. Brown?«
»Nein, nichts.«
»Und woher wissen Sie, dass die Jungs das Feuer gelegt haben?«
Canton blickte zu Brown. »Erzähl du’s ihm bitte, Howard.«
»Ich stand in der Toreinfahrt und schaute mir an, was vom Haus übrig geblieben war, als sie mit dem Fahrrad vorbeikamen – die beiden Hopkins-Jungs und ihr Freund. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht, aber die Jungs nennen ihn Snapper. Sie grinsten übers ganze Gesicht und fuhren vor unserem Haus im Kreis. Dann fährt Earl, der Ältere, freihändig an mir vorbei und sagt: ›Hey, Mister Brown‹, und als ich zu ihm hinsehe, macht er eine Bewegung, als würde er ein Streichholz anzünden und Richtung Haus werfen. Und alle grinsen und feixen dazu.«
Brown schüttelte seinen Kopf. »Ich hätte die kleinen Wichser am liebsten umgebracht.«
Er schüttelte erneut den Kopf. Trauer und Wut halten sich so ziemlich die Waage, dachte Jesse.
»Aber natürlich macht jemand wie ich keinen Mucks, sondern setzt sich schweigend ins Auto und fährt los«, sagte Brown.
»Sind Sie je bedroht worden?«, fragte Jesse.
»Nicht bis zu diesem Vorfall«, antwortete Canton.
Brown schüttelte wieder seinen Kopf.
»Nun, wir werden uns mit ihnen mal unterhalten«, sagte Jesse.
»Unterhalten? Die kleinen Bastarde fackeln unser Haus ab – und Sie wollen sich mit ihnen unterhalten ?«
»Polizisten drücken sich manchmal etwas merkwürdig aus«, sagte Jesse. »Wir werden sie aufs Revier holen und verhören.«
»Können Sie sie nicht gleich festnehmen?«, fragte Brown.
»Nicht auf Basis der Informationen, die wir bisher haben«, antwortete Jesse.
»Sie haben doch praktisch zugegeben, dass sie’s getan haben«, sagte Brown.
»Vielleicht hatten sie auch nur ihren Spaß daran, es ihnen unter die Nase zu reiben, während die Tat von einem anderen begangen wurde«, sagte Jesse.
»Wenn Sie da gewesen wären und gesehen hätten, wie dreist die drei gegrinst haben …«, sagte Brown.
»Ich war aber nicht da«, sagte Jesse. »Und der Staatsanwalt auch nicht. Mit dem, was Sie mir liefern, kann ich niemanden verhaften.«
»Dann werden sie also ungeschoren davonkommen«, sagte Canton im Tonfall eines Mannes, der seine Vorurteile wieder einmal bestätigt sah.
»Vielleicht auch nicht«, sagte Jesse. »Wir haben durchaus ein paar Pfeile im Köcher.«
»Nun«, sagte Canton, »eines kann ich Ihnen jetzt schon versprechen: Ich werd mir eine Knarre zulegen. Ich warte nicht, bis die Flegel komplett Oberwasser bekommen.«
»Sprechen Sie mit Molly hier im Revier«, sagte Jesse. »Sie kümmert sich um die Registrierung.«
»Das heißt, Sie haben nichts dagegen?«
»Sie haben das von der Verfassung garantierte Recht, Waffen zu besitzen und auch zu tragen«, sagte Jesse.
»Jesus«, sagte Canton. »Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich darauf einmal zurückgreifen muss.«
»Ist die Hopkins-Familie reich?«, fragte Jesse.
»Ich denke schon«, sagte Brown. »Warum?«
»Falls die Jungs es getan haben, könnten Sie eine Zivilklage gegen die Familie einreichen. Oder Ihre Versicherung tut es.«
»Mein Gott, daran hab ich noch gar nicht gedacht«, sagte Canton. »Sollten wir mal mit unserem Versicherungsagenten reden?«
»Wäre vielleicht sinnvoller, zunächst einmal mit einem Anwalt zu sprechen«, sagte Jesse.
»Können Sie einen empfehlen?«
»Es gibt hier in der Stadt eine Frau«, sagte Jesse. »Abby Taylor. Sie war früher mal im Gemeinderat. Sie könnte den Fall selbst übernehmen oder einen Kollegen vorschlagen.«
»Aber was passiert, wenn Sie denen nichts nachweisen können?«, sagte Canton.
»Sie können noch immer eine Klage anstrengen«, sagte Jesse. »Im Zivilrecht ticken die Uhren anders.«
»Würden Sie uns den Namen der Anwältin aufschreiben?«, fragte Brown.
Jesse schrieb Abbys Namen auf seinen Notizblock, dazu ihre Telefonnummer, die er nur allzu gut kannte. Brown nahm das Papier, faltete es und steckte es in seine Hemdtasche.
»Darauf läuft es also hinaus?«, sagte Canton.
»Darauf läuft was hinaus?«, fragte Jesse.
»Ist das die Empfehlung der Obrigkeit: sich einen Anwalt zu nehmen und zu klagen?«
Jesse lehnte sich im Stuhl zurück und schaute Canton für einen Augenblick an.
»Sie sind schwul«, sagte er dann. »Und schäumen vor Wut. Für Sie ist es unvorstellbar, dass sich heterosexuelle Cops wirklich anstrengen, Ihre Probleme zu lösen. Aber vielleicht sollten Sie mich nicht voreilig einen intoleranten Schwätzer nennen, bevor ich nicht die Gelegenheit habe, mich mit dem Fall zu beschäftigen.«
»Ich finde, das ist nur fair, Alex«, sagte Brown. »Wir haben keinen Anlass zu der Vermutung, dass er Vorurteile gegen Schwule hat.«
»Vielleicht«, sagte Canton. »Aber dann ist er einer der wenigen, die ich kenne.«
Er starrte Jesse noch immer mit hochrotem Kopf an.
»Da bin ich mir nicht mal so sicher«, sagte Jesse.
»Es gibt vermutlich eine Menge Cops, denen es völlig schnurz ist, was zwei Erwachsene in ihren vier Wänden treiben, solange beide Parteien aus freien Stücken handeln.«
»Sie sind aber auch nie schwul gewesen«, sagte Canton.
»Da liegen Sie völlig richtig«, antwortete Jesse. »Aber Sie sind ja nicht hierhergekommen, um mit mir über die Toleranz oder Intoleranz der Polizei zu sprechen. Ich kann Ihnen nur versichern, dass jeder in dieser Stadt ein Recht auf den Schutz der Polizei hat. Und solange ich hier Polizeichef bin, wird er ihn bekommen. Auch Sie.«
»Alex, er müsste seine Homophobie uns gegenüber erst einmal unter Beweis stellen, bevor wir ihn vorschnell verurteilen.«
»Und das wird er aller Wahrscheinlichkeit nach früher oder später auch tun«, sagte Canton. »Ich werde den Waffenschein jedenfalls beantragen. Kann mir nicht vorstellen, dass ich’s mir noch mal anders überlege.«
Jesse lächelte still vor sich hin.
»Ich glaube auch nicht, dass Sie’s nicht tun«, sagte er.
6
Macklin und Faye saßen auf dem Holzdeck des »Gray Gull«-Restaurants mit Blick über den Hafen. Sie hatten Cosmopolitans bestellt – Faye trank ihn pur aus einem großen Martini-Glas, während Macklin ihn on the rocks bevorzugte. Es war später Nachmittag und die Sonne war schon so weit hinter den Häusern verschwunden, dass die Hafenmeisterei und die Segelwerkstatt lange Schatten aufs Wasser warfen.
»Faye«, sagte Macklin, »du spielst die Frau eines steinreichen Knackers überzeugender als all die wirklichen Millionärsgattinnen, die ich kenne.«
»Was wohl nicht viel zu bedeuten hat«, antwortete Faye. »Wie viel Millionärsgattinnen willst du denn gekannt haben?«
»Und wenn ich nur eine gekannt hätte – sie hätte so ausgesehen wie du«, sagte Macklin.
Er hatte seine Krawatte geöffnet und das Jackett abgelegt. Er saß breitbeinig auf dem Stuhl und lehnte sich zurück. Vom Meer kam eine leichte Brise.
»Du hast der Frau erzählt, dass wir aus Concord kämen«, sagte Faye.
»Richtig«, sagte Macklin. »Ich hab dort ein paar Jahre gelebt.«
»In Concord?«
Macklin grinste. »In der JVA Concord. Das Gefängnis.«
Faye lachte. »Jimmy, du hast wirklich ein Rad ab.«
»Man sollte die Scheiße einfach nicht zu ernst nehmen«, sagte Macklin.
Eine Bedienung ging vorbei und Macklin bestellte einen weiteren Drink.
»Und vielleicht … Was haben Sie denn heute? Frittierte Muscheln? Dann bringen Sie uns einmal frittierte Muscheln. Aber die Drinks vorab. Warten Sie nicht auf die Muscheln.«
»Ja, Sir.«
Macklin beobachtete sie, als sie sich vom Tisch entfernte. Hübscher Hintern. Noch jung. Wahrscheinlich eine Studentin, die hier im Sommer jobbte.
»Was haben wir also heute über Stiles Island gelernt?«, fragte Faye.
»Gut einen Kilometer lang«, sagte Macklin und schaute über den Hafen zum vorderen Teil der Insel. »Etwa 400 Meter breit. 50 Anwesen bisher, mit Platz für weitere 50. Das billigste kostet 875 000 Dollar. Nur Erwachsene. Keine Kinder. Keine Hunde.«
»Die meisten Leute, die sich Häuser für 875 000 Dollar leisten können, sind ohnehin zu alt zum Kinderkriegen«, sagte Faye.
Macklin nickte.
»Der einzige Zugang führt über die Brücke«, sagte er. »Alle Stromleitungen liegen unter der Brücke, ebenso die Telefonleitungen und die Wasserrohre.«
Die Kellnerin brachte ihnen zwei Cosmopolitans. Die pinkfarbenen Getränke passten perfekt zum Ambiente, dachte Macklin und ließ seinen Blick über das Deck des verwitterten Schindelhauses bis hinunter zum Hafen schweifen. Macklin mochte es, wenn die Dinge zusammenpassten.
»Es gibt eine Niederlassung der Paradise Bank«, sagte er. »Mit Schließfächern. Zur Hafenseite hin gibt es einen privaten Jachtclub – der einzige Platz, wo man mit einem Boot anlegen kann. Es gibt einen Fitnessclub mit angeschlossenem Drugstore und Kosmetiksalon sowie ein Restaurant mit einem großen Panoramafenster zur Meerseite. Dann haben wir den privaten Sicherheitsdienst: einen Mann rund um die Uhr am Wachhäuschen sowie eine zweiköpfige Patrouille, die ebenfalls 24 Stunden am Tag im Dienst ist. Alle Anwohner haben CB-Funk, durch den sie mit der Security-Zentrale hinter dem Immobilienbüro und auch mit der Polizei in Paradise verbunden sind.«
Faye hielt ihr Glas mit den Fingerspitzen beider Hände. Sie schaute ihn über den Rand hinweg an, während er sprach. Als er seine Ausführungen abgeschlossen hatte, flötete sie ihm liebevoll zu: »Und ich dachte schon, dass sich deine Beobachtungen allein auf den Arsch von Mrs. Campbell konzentriert hätten.«
Macklin grinste. »Man muss eben auch die Details im Auge behalten.«
Eine Möwe flog vorbei, landete direkt neben ihnen auf der Balustrade und wartete. Die Kellnerin brachte das Besteck, Servietten und ein Körbchen mit den frittierten Muscheln. Sie stellte die Muscheln in die Mitte und zwei Schalen mit Remoulade daneben.
»Ketchup?«, fragte sie.
»Nein, vielen Dank«, sagte Macklin.
Die Möwe richtete ihren undurchdringlichen Blick auf die Muscheln. Macklin entrollte das Besteck und steckte sich die Serviette ins Hemd. Er griff zum Messer und machte in Richtung der Möwe eine Bewegung, als wolle er sie zum Fechten herausfordern. »Solltest du dich den Muscheln auch nur nähern wollen, bist du tot, Vogel«, sagte er.
Faye griff sich mit den Fingern eine Muschel, tauchte sie in die Soße und steckte sie sich in den Mund. Während sie kaute, wischte sie sich die Finger sorgsam mit der Serviette ab.
Als sie den Bissen runtergeschluckt hatte, sagte sie: »Und wie sieht dein Plan denn nun aus?«
»Nun«, sagte Macklin, »ich dachte mir, dass ich zunächst einmal Mrs. Campbell etwas Süßes ins Ohr flüstern könnte …«
»Untersteh dich«, sagte Faye. »Gaffen ist eine Sache. Du bist nun mal ein Mann und kannst nicht anders. Aber wenn du meinst, du könntest sie anbaggern, dann schneid ich dir die Eier ab.«
»Faye, könnte ich dich je betrügen?«
»Wie gesagt: Du bist ein Mann.«
»Das ist zynisch«, sagte Macklin.
»Nur realistisch«, antwortete Faye. »Abgesehen davon weißt du sehr wohl, wovon ich spreche: Wie willst du vorgehen, um das Ding hier auf der Insel ins Rollen zu bringen?«
»Zunächst einmal werde ich mir eine gute Landkarte besorgen«, sagte Macklin.
»Und dann fang ich damit an, eine Crew zusammenzustellen.«
»Wie willst du in der Zwischenzeit Geld ranschaffen?«
»Ich hab noch was«, sagte Macklin.
»Das hoffe ich. Hast du schon Leute im Auge, die du für die Crew verpflichten willst?«
»Ja. Das ist einer der Vorteile, schon mehrfach im Knast gewesen zu sein – man hat reichlich Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen.«
»Hast du es auf die Bank abgesehen?«
»Honigpferdchen«, sagte Macklin. »Ich nehm die ganze Insel aus.«
7
Jesse hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, nach Arbeitsende um fünf kurz in der Bar des »Gray Gull« reinzuschauen. Auch diesmal würde er sich zwei Drinks genehmigen, mit dem Barmann oder ein paar Stammgästen plaudern und dann zum Abendessen nach Hause fahren. Es war sicherer als daheim mit dem Trinken anzufangen. Er kam ein wenig unter Leute – und hatte außerdem hier weniger Probleme, nach zwei Drinks Schluss zu machen. Als Polizeichef hatte er nun mal gewisse Pflichten – und Jesse glaubte zu wissen, dass Trunkenheit in der Öffentlichkeit nicht dazu zählte.
»Black Label und Soda, Doc«, sagte er zum Barmann. Er machte mit seinen Händen eine eindeutige Bewegung. »Großes Glas.«
Der Barmann machte den Drink fertig, stellte ihn vor Jesse auf den Tresen und ging dann zum Ende der Bar, wo eine Kellnerin mit einer Bestellung auf ihn wartete. Er mixte zwei pinkfarbene Drinks – einen straight, den anderen on the rocks – und stellte sie mit dem Kassenbon auf den Tresen. Dann kam er zurück, um sich mit Jesse zu unterhalten.
»Den ganzen Tag für die Gerechtigkeit gekämpft?«, fragte Doc.
»Und die Bürger vor dem Bösen beschützt«, sagte Jesse. »Was sind das denn für pinkfarbene Dinger?«
»Cosmopolitans«, sagte Doc. »So was wie Martini für den Sommer.«
»Sehen lecker aus«, sagte Jesse.
»Sind sie auch«, sagte Doc. »Willst du einen probieren? Geht aufs Haus.«
»Danke, Doc. Scotch reicht mir zu meinem Glück.«
Jesse nippte an seinem Drink. Die Bar war nur halb voll. Es war mitten in der Woche und die arbeitende Bevölkerung war bislang noch nicht aufgekreuzt. Jesse mochte Bars, wenn sie noch leer und ruhig waren. Er mochte sie besonders am Nachmittag, wenn außer der Klimaanlage kein Geräusch zu hören war, wenn die Weichen für den Abend noch nicht gestellt waren, wenn man alte Carl-Perkins-Nummern in der Jukebox spielen konnte und neue Gäste dabei beobachtete, wie sie aus dem hellen Sonnenlicht hereinstolperten und sich erst mal an das schummrige Licht gewöhnen mussten. Er sah sich gerne die verschiedenfarbigen Flaschen an, die in einer guten Bar vor einer verspiegelten Wand standen und das rückwärtige Licht reflektierten. Es mochte nicht der perfekte Ort auf dieser Welt sein, aber immer noch ein verdammt angenehmer. Zumindest für zwei Drinks.
Im Spiegel hinter der Bar sah er, wie Abby Taylor mit einem hochgewachsenen Mann im Seersucker-Anzug hereinkam. Jesse musste grinsen. So was gab’s nur hier. Bis vor einem Jahr hatte er noch nie einen Seersucker-Anzug gesehen. Sie suchten sich einen Tisch hinter ihm aus und setzten sich. Als Abby ihn erkannte, flüsterte sie ihrem Begleiter etwas zu und kam zu ihm herüber. Sie trug ein olivgrünes Kostüm mit einem kurzen Rock.
»Jesse«, sagte sie, »wie geht’s?«
Sie schüttelten die Hände und als Abby ihm eine Wange entgegenstreckte, küsste er sie behutsam.
»Alles bestens«, sagte Jesse. »siehst toll aus.«
Hinter ihr konnte Jesse sehen, wie der Mann im Seersucker-Anzug Drinks bei der Kellnerin orderte. Die wenigen Haare, die er noch auf dem Kopf hatte, waren kurz geschnitten.
»Danke, du auch. Wie läuft’s denn zwischen dir und Jenn?«
Jesse zuckte mit den Schultern. »Sie kam zurück, weil es mir schlecht ging. Inzwischen geht es mir wieder gut. Ich hab nicht viel von ihr gesehen. Suit erzählte mir, dass sie jetzt bei Channel 3 den Wetterbericht präsentiert.«
»Also seid ihr nicht zusammen?«
»Gott bewahre«, sagte Jesse.
»Aber völlig auseinander seid ihr auch nicht, oder?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte Jesse.
»Ist das dein neuer Boyfriend?«
»Chip? Vielleicht. Wir gehen seit einer Weile zusammen aus.«
»Chip?«, fragte Jesse.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Abby, »aber er ist trotzdem ein netter Kerl. Er weiß auch, dass zwischen uns was gelaufen ist. Soll ich ihn dir vorstellen?«
»Nein«, sagte Jesse.
Die Kellnerin mit den knappen Shorts kam aus der Küche und ging mit einem Körbchen voller Muscheln aufs Deck hinaus. Jesse folgte ihr mit den Augen.
Abby lächelte. »Freut mich, dass dein Interesse noch nicht völlig erloschen ist.«
»Kann mir nicht vorstellen, dass das je passieren wird«, sagte Jesse.
»Nun …« Abby machte eine Pause und suchte nach Worten. »Ich hoffe, dass du es mit Jenn geregelt kriegst – was immer für euch beide das Beste ist.«
»Als wir uns scheiden ließen, dachte ich, es sei alles geregelt«, sagte Jesse.
»Kann ich gut nachvollziehen«, sagte Abby und tätschelte seine Hand, die auf dem Tresen lag. »Pass auf dich auf.«
»Du auch«, sagte Jesse.
Er beobachtete, wie sie zurück zum Tisch ging und sich zu Chip setzte. Chip schaute zu ihm hinüber und nickte freundlich in seine Richtung. Fick dich, Chip!
»Schenk mir besser noch einen ein, Doc«, sagte Jesse.
Der zweite Drink schmeckte noch besser als der erste. Jesse hielt ihn gegen das Licht. Die Eiswürfel bildeten Kristalle, der Scotch glänzte golden inmitten der Kohlensäure.
»Kennst du eine Familie Hopkins hier in der Stadt?«
»Ja, ich glaube, er ist so was wie ein Finanzberater.«
»Kinder?«
»Zwei«, sagte Doc. »Sind ausgemachte Arschlöcher.«
»Davon gibt’s einige«, sagte Jesse.
»Schon richtig. 15-jährige Kids sind wahrscheinlich alle Arschlöcher«, sagte Doc, »aber diese beiden schießen den Vogel ab. Du weißt doch, dass ich ein Hummerboot habe.«
Jesse nickte.
»Einmal hab ich sie dabei erwischt, wie sie Hummer aus meinem Boot klauten, als ich mal kurz ins Büro der Hafenaufsicht musste.«
»Vielleicht wollten sie ja am Strand eine Party mit einem großen Fischeintopf veranstalten«, sagte Jesse.
»Sie haben sie nicht mal mitgenommen! Sie haben sie auch nicht zurück ins Meer geworfen, sondern einfach achtlos aufs Deck eines anderen Bootes geschmissen.«
»Die Lobster krepieren, der Typ muss sein Boot schrubben, du verlierst Geld – und der einzige Kick, den die Burschen bekommen, besteht darin, dass sie sich der Welt als ausgewachsene Wichser präsentieren«, sagte Jesse.
»Jesse, du solltest deinen Job als Cop an den Nagel hängen und Kinderpsychologe werden«, sagte Doc. »Ich wollte die Arschlöcher einfach nur ersäufen.«
»Was du aber nicht getan hast.«
Doc zuckte mit den Schultern. Seine Hemdärmel waren hochgerollt und zeigten die gebräunten Arme eines Mannes, der in seinem Leben vor körperlicher Arbeit nicht zurückgeschreckt war.
»Sie sind zu alt, um ihnen einen Schrecken einzujagen, und zu jung, um die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Ich hab sie weggejagt, bin auf das Deck geklettert und hab mir die Hummer zurückgeholt.«
»Hast du die Eltern informiert?«
»Nein.«
Doc ging zum Ende der Bar, zapfte zwei Gläser Harplager, gab den Betrag in die Registrierkasse ein, legte die Quittung auf den Tresen und kam zu Jesse zurück.
»Warum fragst du?«, sagte er.
»Will nur ein bisschen plaudern«, sagte Jesse.
Doc warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Ja, du bist der große Dampfplauderer vor dem Herrn.«
»Ich tu mein Bestes«, sagte Jesse.
Er stieg vom Barhocker, ging zu der öffentlichen Telefonzelle und rief im Revier an.
»Anthony? Jesse hier. Du hast doch von diesen Hopkins-Kindern gehört, die das Haus an der Geary Street angesteckt haben? Gut. Ich möchte, dass ein Streifenwagen für jeweils eine halbe Stunde vor ihrem Haus parkt – in jeder Schicht, beginnend heute Abend. Nein, sag nichts und unternimm auch nichts. Sorg nur dafür, dass eine Patrouille dort jeweils für eine halbe Stunde parkt. Genau. Ich will sie nur etwas nervös machen.«
8
Es war 2 Uhr 15 am Nachmittag, als sich Macklin in einer Sport-Bar an der Huntington Avenue einen Ketel-One-Martini gönnte. Er trug eine weit geschnittene, olivgrüne Hose mit drei Absteppern über dem Gesäß, ein schwarzes T-Shirt aus Seide und Alligator-Slipper ohne Socken. In seinem Portemonnaie befanden sich zehn 100-Dollar-Noten, die Faye von ihrem Sparbuch abgehoben hatte. Weitere 120 Dollar steckten in seiner Tasche – der Rest vom Überfall auf den Schnapsladen.
Außer Macklin waren noch vier weitere Personen anwesend: ein Paar, das an einem Tisch Chicken Wings verspeiste, ein weißhaariger Mann am Ende der Bar, der auf einem überdimensionalen Bildschirm ein Fußballspiel verfolgte sowie der Barmann, der gerade Limonen in Scheiben schnitt.
»Ruhiger Nachmittag«, sagte Macklin.
»Nichts Ungewöhnliches«, sagte der Barmann. »Ist an einem Werktag um diese Zeit eigentlich normal.« Er war noch jung, mittelgroß und trug einen fetten Schnurrbart.
»Und Fußball hebt auch nicht gerade die Stimmung«, sagte Macklin.
»Einige Leute mögen’s«, sagte der Barmann. »Mich persönlich reißt das auch nicht vom Hocker.«
»Was mögen Sie denn?«, fragte Macklin.
»Football«, sagte der Mann hinter der Bar.
»Da kommen wir der Sache schon näher«, sagte Macklin. »Wetten Sie auch auf den Spielausgang?«
»Klar«, sagte der Barmann. »In der letzten Saison hab ich 150 Dollar gemacht.«
Er war mit den Limonen fertig, legte sie in einen Glasbehälter und stellte den Behälter in den Kühlschrank. Er machte ein paar Schritte auf Macklin zu und zeigte auf sein Glas.
»Darf ich Ihnen einen ausgeben?«
»Wäre bescheuert, wenn ich da Nein sagen würde«, antwortete Macklin.
Der Mann schüttete Eis in seinen Shaker. Ohne sich mit dem Abmessen aufzuhalten, gab er großzügig Wodka und einen Schuss Wermut hinzu.
»Wer bei diesen Wetten einen Schnitt macht, muss sich schon auskennen«, sagte Macklin.
Der Barmann schüttelte den Martini und gab ihn in ein eisgekühltes Glas.
»Hab auf der High School selbst gespielt«, sagte er. »Und ich halt mich auf dem Laufenden.«
Er rieb eine Limonenscheibe über den Glasrand und schnipste sie dann in den Martini.
»Das Spiel wird gleich viel interessanter, wenn man eine kleine Wette am Laufen hat«, sagte Macklin.
»Da gibt’s kein Vertun.«
Macklin nippte an seinem frischen Martini. »Kompliment!«, sagte er zum Barmann.
Der Barmann grinste und ging zu dem weißhaarigen Mann am anderen Ende der Bar. Macklin holte den 100-Dollar-Schein aus der Hosentasche und legte ihn auf den Tresen. Der Barmann goss dem Mann einen doppelten Jack Daniel’s ein und servierte ihn auf einer Serviette. Als er zurück zu Macklin kam, schien er den 100-Dollar-Schein geflissentlich zu übersehen.
»Ich bin von außerhalb«, sagte Macklin. »Und tödlich gelangweilt. Wissen Sie vielleicht, wo ich in ein kleines Kartenspiel einsteigen kann?«
»Woher kommen Sie?«
»Dannemora, New York«, sagte Macklin.
»Und Sie wollen eine Runde pokern?«
»Genau. Gutes Spiel. Immer gut, wenn etwas Geld die Hand wechselt.«
»Keine Frage«, sagte der Barmann. »Ich mach mal einen Anruf.«
Er ging ans andere Ende der Bar und tippte ein paar Nummern ins Telefon. Er sprach für einen Moment, legte wieder auf und kam zu Macklin.
»Kennen Sie das Lincolnshire Hotel?«
Macklin schüttelte den Kopf.
»Sie können von hier aus zu Fuß gehen. Wenn Sie in der Lobby sind, rufen Sie Tommy King an. Sagen Sie ihm, Lennie Seltzer habe Sie geschickt. Man wird Ihnen die Zimmernummer geben – und schon sind Sie im Spiel.«
»Sind Sie Lennie?«
»Nein, Lennie ist der Typ, den ich angerufen habe.«
»Bestens«, sagte Macklin. »Wie komm ich hin?«
Er trank seinen zweiten Martini aus, während der Barmann ihm den Weg beschrieb. Dann stand er auf, ließ den Hunderter auf dem Tresen und ging zur Tür. »Wünschen Sie mir Glück«, rief er.
Der Barmann gab ihm das Daumen-hoch-Zeichen und Macklin ging von der Huntington Avenue hinüber zum Copley-Place-Parkhaus, wo er seinen Wagen abgestellt hatte. Er nahm die 1 000 Dollar aus dem Portemonnaie, zerknüllte sie und steckte sie in seine Hosentasche. Er entriegelte das Handschuhfach und nahm die 9 mm heraus. Dann zog er die Hose runter. Statt der üblichen Shorts trug er eine Unterhose in Übergröße, in die vorne eine flache Schale eingelassen war. Er schob die Pistole hinter die Schale, nahm eine Rolle Klebeband aus dem Handschuhfach und klebte den Pistolenknauf an seinem Bauch fest, noch deutlich unter dem Bauchnabel. Dann stieg er aus, steckte das Hemd in die Hose und schloss den Reißverschluss. Er verriegelte den Wagen und machte sich auf den Weg zum Hotel. An einem Ledergeschäft hielt er noch einmal an und überprüfte sein Spiegelbild im dunklen Schaufenster. Von der Pistole war nichts zu sehen – genauso wenig wie heute Morgen, als er zu Hause einen Probelauf unternommen hatte.
Es war ein perfekter Sommertag, als Macklin durch die Back Bay zum Hotel spazierte. Er brauchte keine Wegbeschreibung, da er genau wusste, wo sich das Lincolnshire Hotel befand. In der plüschigen Lobby angekommen, rief er Tommy King auf dem Haustelefon an.
»Hoyle mein Name«, sagte Macklin. »Lennie Seltzer schickt mich.«
»Zimmer 418.«
»Bin gleich da«, sagte Macklin.
Im Fahrstuhl roch es nach Flieder. Der Korridor war mit einem roten Teppich ausgelegt, die Wände mit cremefarbenen Holzpaneelen verkleidet, die Nummern an den Zimmern glänzten in Gold. Bei Zimmer 418 hielt Macklin an. Der Notausgang war zwei Zimmer weiter – durch eine Tür hindurch, dann nach links. Er drückte auf die kleine, beleuchtete Klingel neben der Tür. Als geöffnet wurde, betrat er ein kleines Vorzimmer: Zimmer 418 war eine Suite mit zwei Schlafzimmern.
Vor ihm stand ein groß gewachsener Mann mit riesigen Pranken.
»Mr. Hoyle?«
»So heiße ich«, sagte Macklin.
»Sorry, Sir, aber wir müssen Sie kurz abtasten. Reine Routine.«
Ein gedrungener Mann im weißen Seidenhemd stand hinter dem Riesen. Sein dünnes schwarzes Haar schien an seinem nackten Schädel zu kleben.
»Sergeant Voss ist ein Polizeibeamter außer Dienst«, sagte der schwergewichtige Mann. »Nur um sicherzustellen, dass es keine Überraschungen gibt.«
»Prima Idee«, sagte Macklin. »Gibt mir das Gefühl, dass ich hier sicher bin.«
Er streckte seine Arme aus und stand kerzengerade, als Sergeant Voss mit beiden Händen seine Achselhöhlen und Arme abtastete, dann die Taille um den Gürtel herum, schließlich die Beine bis zu den Füßen. Wie Macklin erwartet hatte, kam Voss seinem Schwanz nicht zu nahe. Als er die Untersuchung abgeschlossen hatte, trat Sergeant Voss einen Schritt zurück und nickte.
»Tommy King ist mein Name«, sagte der Riese. »Kommen Sie rein.«
Die Spieler saßen im Wohnzimmer. Fünf Männer hockten an einem runden Tisch, der sechste Stuhl war für Macklin freigehalten worden. Eine Frau mit ausladenden Brüsten und einem kurzen schwarzen Rock kümmerte sich um die Bar und ein kleines Büffet, das in einer Ecke des Zimmers aufgebaut war.
»Drink?«, fragte King.
»Ein Bier reicht mir«, sagte Macklin. »Vielleicht noch einen Krevetten-Cocktail.«
»Kein Problem. Tiffany kümmert sich drum.«
Macklin setzte sich. Er zog die zerknitterten 1 000 Dollar aus der Hosentasche, bemühte sich gar nicht erst, sie glatt zu streichen und legte sie vor sich auf den Tisch.
»Der Gentleman mit den Bartstoppeln ist Tony, mein Kartengeber.«
Macklin nickte ihm zu.
»Die anderen können sich selbst vorstellen«, sagte King.
»Bill«, sagte der erste Spieler und blickte zum nächsten.
»Chuck.«
»Mel.«
»John.«
»Sully.«
Macklin lächelte freundlich und nickte. Tiffany brachte ihm sein Bier und den Krevetten-Cocktail und berührte dabei mit einer Brust seine Schulter.
»Fünf Karten«, sagte King. »Buben oder höher. 100 Dollar Minimum.«
Macklin nickte und legte seine Hundert in den Pott. Tony begann auszuteilen. Er war ein hagerer Mann mit vollen schwarzen Haaren, die er glatt nach hinten gekämmt hatte. Die Karten schienen sich in seinen schmalen Händen zu bewegen, als seien sie zum Leben erweckt worden. Macklin bekam ein Paar Dreien. Chuck eröffnete, dann zog Macklin drei Karten. Sein Blatt wurde nicht besser. Er stieg aus. Chuck gewann mit drei Königinnen. Tiffany stellte sicher, dass alle Spieler mit Essen und Getränken versorgt waren. Und sorgte dafür, dass sie allen Spielern mit ihren Brüsten über die Schulter strich – Tony ausgenommen. Tony aß und trank nichts. Sergeant Voss befand sich im Vorzimmer und lehnte sich gegen eine Wand. Gelegentlich sprang Tommy King als Kartengeber für Tony ein. Macklin war durchaus ein ausgebuffter Spieler, aber sein Interesse am Spiel hielt sich in Grenzen. Spielen war etwas für Verlierer. Es gab bessere Wege, um an Geld zu kommen. Und es gab auch bessere Wege, es zu verschleudern – für Frauen zum Beispiel. Trotzdem bemühte sich Macklin um den Eindruck, als würde er verbissen spielen, behielt dabei aber genau das Geld im Auge, das über den Tisch wanderte.
Nach eineinhalb Stunden war sei Guthaben auf 200 Dollar geschmolzen.
»Entschuldigen Sie mich für ’ne Minute«, sagte er. »Das scheiß Bier macht sich bemerkbar.«
Er stand auf, ging durch eines der Schlafzimmer ins Bad und schloss die Tür hinter sich ab. Er ließ die Hose runter, zog das Klebeband vom Knauf und holte die Pistole aus dem provisorischen Holster. Er legte sie auf den Deckel der Spülung und nahm auch gleich die Gelegenheit wahr, sich zu erleichtern. Authentisch sollte es schon sein. Er zog den Reißverschluss hoch, wusch und trocknete seine Hände, nahm die Pistole, entsicherte sie und ging durch das Schlafzimmer zurück. Vom Bett griff er sich eines der Kissen, streifte den Kissenbezug ab und nahm ihn in die linke Hand, während seine rechte die 9 mm hielt. Als er aus der Schlafzimmertür heraustrat, schoss er zunächst Sergeant Voss in die Brust. Voss stöhnte auf, fiel auf seine linke Seite, zuckte noch ein paar Mal und war dann still. Alle anderen Anwesenden waren erstarrt. Macklin winkte beiläufig mit der Pistole zum Spieltisch hinüber. Tiffany begann zu weinen, doch Macklin ignorierte sie.
»Jeder von euch kann der Nächste sein«, sagte er, »es sei denn, die gesamte Knete wandert zu mir.«
Niemand sagte einen Ton.
»Alle legen ihre Hände hinter den Kopf.«
Sie taten, wie ihnen befohlen.
»Kein Problem«, sagte Tommy King. »Sie kriegen Ihr Geld.«
»So sieht’s wohl aus«, sagte Macklin. »Und nun wird jeder seine Tasche leeren und den Inhalt in den Kissenbezug stecken, angefangen mit Ihnen, Tommy. Und dann werden sich alle auf den Boden legen, Gesicht nach unten.« Er fuchtelte mit seiner Pistole. »Dort rüber.«
Sie folgten seinen Anweisungen. Macklin raffte das Geld auf dem Tisch zusammen und drückte es Tiffany in die Hand.
»Halt das«, sagte er.
Er ließ seine Augen noch einmal durch das ganze Zimmer schweifen.
»In einer Minute werde ich euch filzen, einen nach dem anderen. Sollte ich feststellen, dass jemand noch Geld in den Taschen hat, werden ich ihm eine Kugel durch den Hinterkopf jagen.«
Er schwieg für einen Moment.
»Will jemand noch was anmelden?«
Niemand rührte sich. Macklin grinste. »Okay, ich glaub euch sogar. Komm, Tiffany.«
Er nahm sie am Arm und zog sie an dem Toten im Vorzimmer vorbei zur Eingangstür. Nach links, zwei Zimmer den Flur entlang, dann links zum Notausgang. Tiffany weinte noch immer. Er ließ sie los.
»Wenn ich dich zurückgelassen hätte, hätten sie dir das Geld sofort wieder abgenommen«, sagte er. »Aber jetzt musst du sehen, wie du alleine klarkommst.«
Sie hatte noch immer die Geldscheine in ihren Händen und schluchzte. Macklin öffnete die Tür zum Notausgang und lief die vier Stockwerke hinunter. Unten angekommen, sicherte er seine Pistole, warf sie in den Kissenbezug und trat auf die Straße hinaus.
9
»Jetzt bist du also einer dieser Wetter-Propheten«, sagte Jesse.