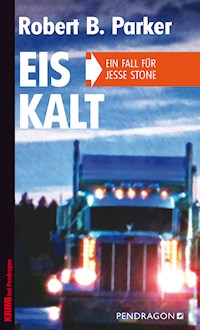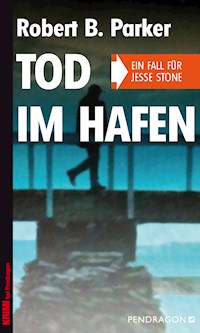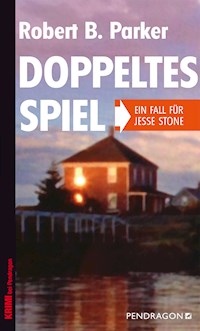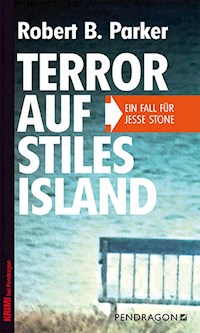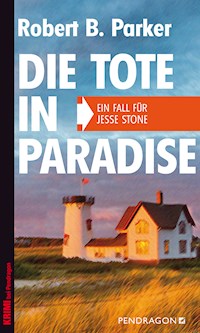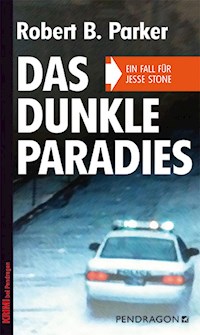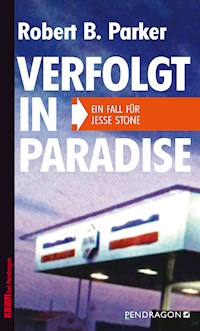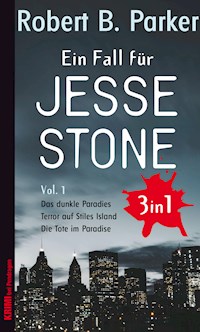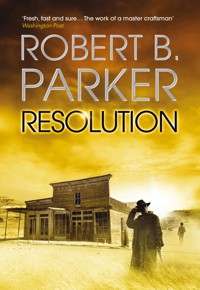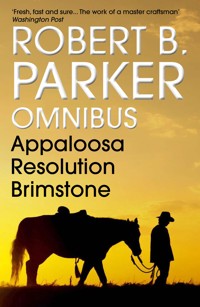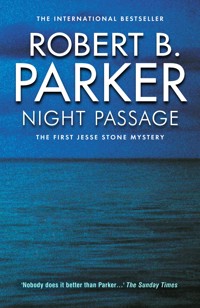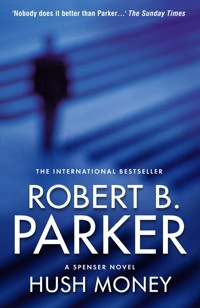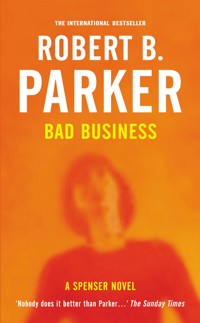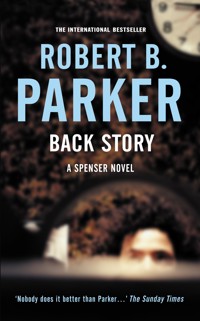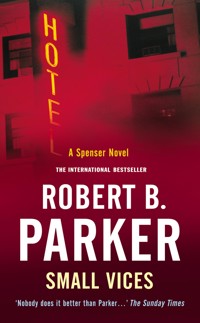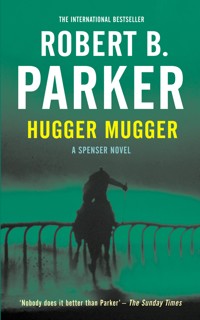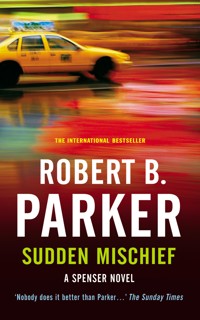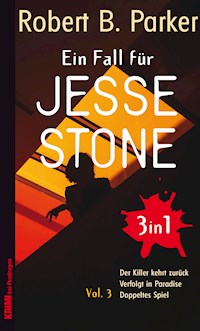
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DER KILLER KEHRT ZURÜCK Aufruhr in Paradise: Eine Schule für lateinamerikanische Einwandererkinder soll in einem Nobelviertel der Stadt gebaut werden. Die Anwohner fürchten eine Zunahme der Kriminalität durch Latino-Gangs. Polizei-Chef Jesse Stone hat alle Hände voll zu tun, um die erhitzten Gemüter zu beschwichtigen. Plötzlich taucht der Killer Wilson Cromartie - genannt Crow - in Paradise auf. Vor zehn Jahren ist er Stone als einziger Gangster bei einem brutalen Überfall mit einem Haufen Geld entwischt. Was will er in Paradise? (Übersetzer: Bernd Gockel) VERFOLGT IN PARADISE Ein Spanner, der sich Nachtfalke nennt, terrorisiert die Bewohnerinnen der beschaulichen Kleinstadt Paradise. Zunächst gibt er sich noch damit zufrieden, die Frauen zu beobachten. Aber im Laufe der Zeit verliert er zunehmend die Kontrolle und wird immer rücksichtsloser. Als er schließlich eine Frau mit Waffengewalt dazu zwingt, sich vor ihm auszuziehen, weiß Polizeichef Jesse Stone, dass der Stalker weitere Grenzen überschreiten wird. Stone muss die tickende Zeitbombe stoppen, bevor die Situation eskaliert, und stellt ihm eine riskante Falle … (Übersetzer: Bernd Gockel) »Unterhaltsam, spannend und gewürzt mit trockenem Humor. Jesse Stone ist ein Cop der alten Schule: unbestechlich, mutig und schlagfertig. Obwohl er Frau und Job verloren hat und alkoholabhängig ist, bleibt er standhaft. In Kombination mit dem gut durchdachten Plot ein rundum gelungener Kriminal-Roman.« Florian Hilleberg | Literra DOPPELTES SPIEL Cheryl ist von zu Hause abgehauen. Für eine 18-Jährige nichts Ungewöhnliches. Gefährlich wird es, als die junge Frau aus gutem Hause Zuflucht bei der »Kirche der Erneuerung« sucht. Der charismatische Sektenführer verspricht seiner Gefolgschaft das Paradies auf Erden. Zwischenzeitlich haben Cheryls Eltern die Privatdetektivin Sunny Randall damit beauftragt, ihre Tochter aufzuspüren und nach Hause zu bringen, aber Cheryl möchte nicht zurück. Doch dann geht dem Guru das Geld aus, und er zwingt die jungen Frauen zur Prostitution. Hier kommt Jesse Stone ins Spiel. Zugleich hat er es mit zwei geheimnisvollen Zwillingen zu tun, die der besseren Gesellschaft angehören. Aber warum passieren so viele Verbrechen in ihrer Nähe? (Übersetzer: Bernd Gockel)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
*Bundle 3* Veröffentlicht im Pendragon Verlag © by Pendragon Verlag Bielefeld 2018 Coverfoto: © artem-gavrysh *Der Killer kehrt zurück* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag © by Robert B. Parker 2008 © für die deutsche Ausgabe by Pendragon Verlag Bielefeld 2015 *Verfolgt in Paradise* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag © by Robert B. Parker 2009 © für die deutsche Ausgabe by Pendragon Verlag Bielefeld 2016 *Doppeltes Spiel* Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag © by Robert B. Parker 2010 © für die deutsche Ausgabe by Pendragon Verlag Bielefeld 2016Robert B. Parker
Ein Fall für Jesse Stone BUNDLE (3in1) Vol. 3
Die Bücher der Jesse-Stone-Reihe zählen zu den besten Krimis, die Robert B. Parker in seiner langen Karriere geschrieben hat. Die Romane wurden überaus erfolgreich mit Tom Selleck in der Hauptrolle verfilmt.
Inhalt
Der Killer kehrt zurück
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Verfolgt in Paradise
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Doppeltes Spiel
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Robert B. Parker | Jesse Stone
Robert B. Parker · Der Killer kehrt zurück
Robert B. Parker wurde 1932 geboren. Nach seinem M.A. in amerikanischer Literatur promovierte er 1971 über die »Schwarze Serie« in der amerikanischen Kriminalliteratur.
Seit seinem Debüt »Spenser und das gestohlene Manuskript« im Jahr 1973 hat er über 50 Bücher veröffentlicht. 1976 erhielt er für den Titel »Auf eigene Rechnung« den Edgar-Allan-Poe-Award für den besten Kriminalroman des Jahres.
Am 18. Januar 2010 verstarb Robert B. Parker in Massachusetts. www.robertbparker.de
Im Pendragon Verlag erscheinen von Robert B. Parker die beiden überaus erfolgreichen Reihen »Spenser« und »Jesse Stone«.
In der Jesse-Stone-Reihe sind bereits erschienen:
»Das dunkle Paradies« (2013)
»Terror auf Stiles Island« (2013)
»Die Tote in Paradise« (2014)
»Eiskalt« (2014)
»Tod im Hafen« (2014)
»Mord im Showbiz« (2015)
»Der Killer kehrt zurück« (2015
Robert B. Parker
Der Killer kehrt zurück
Ein Fall für Jesse Stone
Übersetzt von Bernd Gockel
1
Molly Crane steckte ihren Kopf in Jesses Büro.
»Jemand, der dich sprechen will«, sagte sie. »Behauptet, er heiße Wilson Cromartie.«
Jesse blickte hoch. Seine Augen fixierten Molly. Keiner von ihnen sagte ein Wort.
Jesse stand auf. Sein Revolver steckte in dem Holster, das auf dem Aktenschrank hinter ihm lag. Er nahm die Waffe heraus, legte sie in die rechte obere Schublade und ließ die Schublade halb offen.
»Bring ihn rein«, sagte er.
Molly ging und kam Sekunden später mit dem Mann zurück.
Jesse nickte mit dem Kopf.
»Crow«, sagte er.
»Jesse Stone«, sagte Crow.
Jesse zeigte auf einen Stuhl. Crow setzte sich. Er schaute zum Aktenschrank.
»Leeres Holster«, sagte er.
»In der Schublade«, sagte Jesse.
»Und die Schublade steht vorsichtshalber offen«, sagte Crow.
»Mhm.«
Crow grinste. Er schien völlig entspannt. Gleichzeitig hatte man den Eindruck, als stünde die komprimierte Energie, die in seinem wuchtigen Körper steckte, kurz vor der Explosion.
»Es gibt keinen Grund zur Nervosität«, sagte Crow.
»Dann bin ich ja beruhigt«, sagte Jesse.
»Aber die Schublade schließen wir trotzdem nicht.«
»Nein.«
Crow grinste erneut. Man konnte es nicht präzisieren, dachte Jesse, aber irgendwas in seinen Gesichtszügen – und seiner Aussprache – deutete auf indianische Vorfahren hin. Vielleicht war er ja wirklich ein Apache.
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«, sagte Crow.
»Als ich Sie beim letzten Mal sah, machten Sie sich gerade mit einem Rennboot und einem Haufen Geld aus dem Staub«, sagte Jesse.
»Lange her«, sagte Crow. »Länger als die Verjährungsfrist.«
»Werd ich mal überprüfen«, sagte Jesse.
»Hab ich schon gemacht«, sagte Crow. »Zehn Jahre.«
»Aber nicht für Mord.«
»Sie haben keinen Beweis, dass ich was mit dem Mord zu tun hatte.«
»Wie wär’s mit Totschlag bei der Durchführung eines Kapitalverbrechens?«, sagte Jesse.
»Kann mir nicht vorstellen, wie Sie das nachweisen wollen«, sagte Crow. »Sie wissen nur, dass ich mit ein paar Leuten zusammen war – und dass ich mit einem Boot abgehauen bin, bevor es zu einer Schießerei kam.«
»Nur dumm, dass der Bootsbesitzer dran glauben musste, bevor das leere Boot gefunden wurde.«
»Dazu kann ich leider keine sachdienlichen Informationen liefern«, sagte Crow. »Ich war schon fünf Meilen vorher von Bord gegangen.«
»Dann sind Sie also nicht gekommen, um ein freies Zimmer im Knast zu beziehen?«
»Ich bin geschäftlich in Paradise«, sagte Crow. »Ich wollte Ihnen meinen Vorstellungsbesuch abstatten, damit wir uns nicht unnötig in die Quere kommen.«
»Zwei meiner Cops mussten dran glauben, als die Brücke nach Stiles Island in die Luft gesprengt wurde«, sagte Jesse. »Ein paar Leute von der Insel ebenfalls.«
»Ja«, sagte Crow, »Macklin war schon ein übler Bursche.«
»Und Sie?«
»Ein zahmes Kätzchen«, sagte Crow.
»Wie lange werden Sie in der Stadt bleiben?«, fragte Jesse.
»Eine Weile.«
»Warum sind Sie hier?«, fragte Jesse.
»Ich suche jemanden.«
»Warum?«
»Wurde von einem Typen engagiert«, sagte Crow.
»Warum gerade Sie?«
»Ich kenn mich in solchen Sachen halt aus«, sagte Crow. »Der Typ vertraut mir.«
Er grinste Jesse an.
»Und außerdem bin ich mit der Gegend ja bestens vertraut.«
»Ich aber auch«, sagte Jesse.
»Ich weiß«, sagte Crow, »und mein Job wäre erheblich unerquicklicher, wenn wir nicht einen Weg fänden, wie Erwachsene miteinander umzugehen. Und genau deshalb wollte ich mal reinschauen.«
»Wen suchen Sie denn?«
»Hab keinen Namen«, sagte Crow.
»Haben Sie ihn je in natura gesehen?«
Crow schüttelte den Kopf.
»Ein Foto?«
»Kein allzu aussagekräftiges«, sagte Crow.
»Kann ich’s mal sehen?«
»Nein.«
»Wie wollen Sie ihn denn finden?«
»Mir wird schon was einfallen«, sagte Crow.
»Was passiert, wenn Sie ihn finden?«
»Ich werd meinen Auftraggeber informieren«, sagte Crow.
Jesse nickte langsam. »Eines verspreche ich Ihnen: So lange Sie hier in der Stadt rumlaufen, werd ich alles versuchen, um Sie vor den Kadi zu zerren.«
»Davon ging ich aus«, sagte Crow. »Aber ich würde mal behaupten wollen, dass Ihnen das nicht gelingen wird.«
»Verjährung ist eine komplizierte Geschichte«, sagte Jesse. »Wir hatten einen Banküberfall, wir hatten Kidnapping – und das sind Vergehen, für die bundesstaatliche Gesetze gelten. Ich werde morgen einen Assistenten des Staatsanwalts befragen. Mal schauen, was er mir erzählen kann.«
»Nach zehn Jahren sind praktisch alle Sachen verjährt«, sagte Crow.
»Wir werden Sie auf Schritt und Tritt verfolgen, solange Sie in der Stadt sind«, sagte Jesse.
»Aber Sie wollen mich doch wohl nicht grundlos schikanieren?«
»Wenn wir einen Prozess gegen Sie anstrengen können, werden wir Sie verhaften.«
»Und bis dahin?«
»Werden wir warten und Sie im Auge behalten«, sagte Jesse.
Crow nickte. Beide blieben stumm, bis Crow wieder zu reden anfing.
»Soweit ich weiß, haben Sie seinerzeit doch Erkundigungen über mich eingezogen«, sagte er.
»Stimmt. Als Sie uns beim letzten Mal beehrt haben, hab ich mich schlau gemacht«, sagte Jesse.
»Und – was hat man Ihnen erzählt?«
»Dass man im Umgang mit Ihnen äußerste Vorsicht walten lassen sollte.«
Crow grinste.
»Macklin war aber auch nicht übel«, sagte er.
Jesse nickte.
»Ich hatte meine Zweifel, ob ihn überhaupt jemand zur Strecke bringen konnte«, sagte Crow.
»Außer Ihnen?«
»Außer mir.«
»Nun wissen Sie’s«, sagte Jesse.
Crow nickte. Sie schwiegen wieder. Beide Männer bewegten sich nicht und schauten sich nur stumm an.
»Sie haben die Geiseln laufen lassen«, sagte Jesse.
Crow nickte.
»Es waren ausnahmslos Frauen«, sagte er.
»Waren es«, sagte Jesse.
Sie starrten sich immer noch an. Jesse hatte das Gefühl, als sei der Raum elektrisch aufgeladen – wie ein anrollendes Gewitter, das sich in Kürze entladen würde. Doch ohne weitere Ankündigung erhob sich Crow langsam von seinem Stuhl.
»In jedem Fall wissen wir beide nun, wo wir stehen«, sagte er.
»Schaun Sie rein, wann immer Sie Lust haben«, sagte Jesse.
Crow lächelte und trat auf den Flur, vorbei an Suitcase Simpson und Molly Crane, die rechts und links neben der Tür standen.
Crow nickte ihnen zu.
»Herrschaften«, sagte er.
Und verließ ohne Eile das Revier.
2
Molly und Suit kamen in sein Büro.
»Ich erinnere mich noch gut an ihn«, sagte Simpson.
»Ich hab Suit auf der Streife angefunkt und ihn herkommen lassen«, sagte Molly. »Dachte mir, dass Verstärkung nicht schaden könne.«
»Was wollte er denn?«, fragte Suit.
Jesse erzählte es ihnen.
»Ganz schön impertinent, einfach hier reinzumarschieren«, sagte Simpson.
Molly und Jesse schauten ihn an.
»Impertinent?«, sagte Molly.
Suit grinste.
»Ich hab wieder nen Abendkurs belegt«, sagte er.
Molly wandte sich zu Jesse. »Und du hast keine Ahnung, wen genau er hier sucht?«
Jesse schüttelte den Kopf. »Ich bin mir nicht mal sicher, ob Crow es weiß«, sagte er.
»Hat er denn eine Andeutung gemacht, was er tun wird, wenn er die betreffende Person findet?«, fragte Molly.
»Er meinte, er würde seinen Auftraggeber informieren.«
»Wenn ein Mann wie Crow nach jemandem sucht, hat der Gesuchte wenig zu lachen«, sagte Simpson.
»Sicher nicht«, sagte Jesse.
»Glaubst du, dass er ihn finden wird?«, fragte Molly.
»Ja.«
»Und du hast eigentlich keine Handhabe, ihm in die Parade zu fahren. Ist ein hartes Brot, mit einem zehn Jahre alten Fall wieder zum Staatsanwalt zu laufen.«
Jesse nickte.
»Hat er nicht indianisches Blut in den Adern?«, fragte Simpson.
»Er behauptet, Apache zu sein«, sagte Jesse.
»Und, nimmst du ihm das ab?«
»Irgendwas ist wohl dran«, sagte Jesse.
»Vor allem ist er ein Prachtexemplar von Mann«, sagte Molly.
»Ein was?«, fragte Simpson.
»Das perfekte Mannsbild«, sagte Molly.
»Und ich dachte immer, er wäre ein Killer. War da nicht was, Jesse?«, fragte Simpson.
»Hab ich auch läuten hören«, sagte Jesse. »Ist vielleicht Teil seiner faszinierenden Ausstrahlung.«
»Nicht auszuschließen«, sagte Molly. »Macht es irgendwie noch prickelnder.«
»Vor allem für den, den er gerade umbringen will«, sagte Jesse.
»Du weißt schon, was ich meine«, sagte Molly. »Er strahlt halt diese innere Ruhe aus, er ist so komplett und rund und robust.«
»Autorität«, sagte Jesse.
»Ja«, sagte Molly, »er riecht nach Autorität.«
»Ich sollte wohl noch ein paar Abendkurse belegen«, sagte Simpson. »Ich hab keine Ahnung, wovon ihr sprecht.«
»Er ist ein bisschen wie du, Jesse«, sagte Molly.
»Mit dem Unterschied, dass ich zwar auch rieche, aber nicht ganz so streng.«
»Doch, du hast genau den gleichen schweigsamen, unerbittlichen Kern. Es gibt nichts, das dich von deinem Weg abbringt. Wie nennen es die Psychiater noch gleich … Auto …?«
»Autonomie?«, sagte Jesse.
»Genau, ihr seid beide völlig autonom«, sagte Molly. »Mit dem einzigen Unterschied, dass du ein paar Skrupel hast.«
»Die hat er vielleicht auch«, sagte Jesse.
»Ich will’s nicht hoffen«, sagte Molly. »In meiner Fantasie kann er ruhig der böse Bube bleiben.«
»Fantasie?«, fragte Simpson. »Molly, wie lange bist du schon verheiratet?«
»15 Jahre.«
»Und wie viele Kinder hast du?«
»Vier.«
»Und du hast Sex-Fantasien über einen indianischen Killer?«
Molly lächelte ihn an.
»Worauf du Gift nehmen kannst«, sagte sie.
3
»Ich möchte damit nichts zu tun haben«, sagte Mrs. Snowdon, als Molly ihr ein Foto von Crow zeigte.
»Haben Sie ihn denn jemals gesehen?«
»Nein.«
Sie befanden sich in dem weitläufigen Wohnzimmer der Snowdon-Villa auf Stiles Island. Mrs. Snowdon saß auf dem Sofa, die Füße auf dem Boden und die Knie zusammengedrückt. Ihre zusammengepressten Hände lagen auf dem Schoß. Suit stand an der gläsernen Tür, die hinaus auf die Terrasse führte, während sich Molly auf ein Fußkissen vor Mrs. Snowdon niedergelassen hatte.
Sie sieht einfach zu zierlich aus für den riesigen Revolvergurt, dachte Suit, aber ich weiß, dass der Eindruck täuscht.
»War er mit den anderen Männern hier, die damals die Insel ausgeraubt haben?«, fragte Molly. »War er nicht derjenige, der Sie und Ihren Ehemann im Badezimmer einsperrte?«
»Verstorbenen Ehemann«, sagte Mrs. Snowdon.
Ihre grauen, leicht bläulich gefärbten Haare waren wie aus Stein gemeißelt. Sie trug ein rot-schwarzes Kleid mit Blumenmustern, einen roten Schal und einen überdimensionalen, mit Diamanten besetzten Ehering.
»War der Mann hier auf dem Foto einer der Männer?«, fragte Molly.
»Ich möchte über das Thema nicht sprechen«, sagte Mrs. Snowdon.
»Haben Sie Angst?«
»Mein Ehemann ist verschieden«, sagte Mrs. Snowdon. »Ich bin eine alleinstehende Frau.«
»Für Ihre Sicherheit tun Sie am meisten, wenn Sie uns einen Grund geben ihn zu verhaften.«
»Ich weigere mich, über Ihren Vorschlag auch nur nachzudenken«, sagte Mrs. Snowdon. »Es war ein Augenblick in meinem Leben, den ich nicht noch einmal zu durchleben gedenke.«
»Hat er Sie vielleicht unlängst bedroht?«
»Bedroht? Ist er etwa hier? In Paradise?«
»Ja.«
»Mein Gott. Warum nehmen Sie ihn denn nicht fest?«
Suitcase, der noch immer an der Terrassentür stand, konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
»Dazu müssten Sie uns erst helfen«, sagte Molly.
»Ich bin kein Polizist«, sagte sie. »Es ist Ihre Aufgabe, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen.«
»Natürlich, Ma’am«, sagte Molly, »aber wir können nicht wahllos Leute verhaften. Im Moment besteht unsere einzige Hoffnung darin, ihn mit einem Schwerverbrechen in Verbindung zu bringen. Anderenfalls ist der Fall bereits verjährt.«
»Das heißt, er muss eigenhändig jemanden ermordet haben?«
»Er muss zumindest Teil einer kriminellen Operation sein, durch die eine Person zu Tode kam«, sagte Molly.
»Oh Gott«, sagte Mrs. Snowdon. »So ein Geschwafel. Es kamen bekanntlich diverse Personen zu Tode, oder etwa nicht?«
»Aber wir müssen eindeutig nachweisen können, dass dieser Mann daran beteiligt war«, sagte Molly.
»Nun, ich werde Ihnen die Arbeit nicht abnehmen. Warum macht eine junge Frau überhaupt so was? Sollten Sie nicht zu Hause sein und sich um Mann und Kinder kümmern?«
»Tu ich nebenbei auch noch«, sagte Molly.
Sie starrten sich eine Weile wortlos an. Molly schaute zu Suit. Suit zuckte mit den Schultern.
»Ich glaube nicht, dass Sie sich ernsthaft Sorgen machen müssen«, sagte Molly. »Der Mann scheint keinerlei Interesse an den Personen zu haben, die beim letzten Vorfall beteiligt waren.«
Mrs. Snowdon saß bewegungslos auf dem Sofa und sagte nichts. Molly atmete einmal tief durch und stand auf.
»Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Zeit«, sagte sie. »Wir finden schon alleine den Weg hinaus.«
Mrs. Snowdon antwortete nicht. Bewegungslos saß sie auf dem Sofa, umhüllt von eisener Stille.
4
Jesse hatte Marcy Campbell zum Abendessen ins »Gray Gull« eingeladen. Es war Juni. Sie saßen draußen auf der Terrasse, von der man einen wundervollen Blick auf den Hafen hatte. Es war noch so hell, dass man das rege Treiben im Hafen beobachten konnte.
»Was ist los?«, fragte Marcy. »Läuft’s mal wieder nicht mit deiner Ex?«
Sie hatte platinblonde Haare und war in Makeup-Fragen ein absoluter Profi. Marcy war schon älter als Jesse, aber immer noch attraktiv – und sich ihrer sexuellen Reize wohlbewusst. Jesse hatte selbst seine diesbezüglichen Erfahrungen gemacht, wusste aber schon vorher, dass sie sexuell sehr aktiv war. Er fragte sich immer, an welchen Signalen er diese Eigenschaft erkannte. Er wusste es nie genau zu artikulieren, aber offenbar gab es Frauen, die sich ihres Körpers so bewusst waren, dass sie dieses Bewusstsein instinktiv kommunizierten. Und Marcy war eine Meisterin ihres Faches.
»Glaubst du etwa, ich meld mich nur, wenn ich ein Problem mit Jenn habe?«
»Genau das glaube ich«, sagte sie und lächelte ihn an. »Glücklicherweise passiert es so oft, dass ich das Vergnügen habe, dich regelmäßig zu sehen.«
»Die Wege der Liebe sind unergründlich.«
»Zwischen dir und mir? Oder zwischen dir und Jenn?«
»Wahre Liebe? In beiden Fällen.«
»Zu schön, um wahr zu sein«, sagte Marcy.
»Ich liebe dich aber, Marcy, das weißt du doch.«
»Wie man halt seine Schwester liebt«, sagte Marcy.
»Na ja, nicht ganz«, sagte Jesse.
»Nein«, sagte Marcy, »da hast du Recht. Wie eine Schwester liebst du mich nicht.«
Die Kellnerin brachte Marcy einen Weißwein und Jesse einen Eistee. Marcy schaute auf sein Glas.
»Wieder mal auf Entzug?«, fragte sie.
»Ich hab keinen festen Plan«, sagte Jesse. »Heute Abend wollt ich’s einfach mal mit Eistee versuchen.«
»Gibt’s denn Pläne für die Nacht?«, fragte Marcy.
»Schaun wir doch mal, wie’s so läuft«, sagte Jesse.
»Okay, schaun wir mal.«
Sie studierten die Speisekarte. Marcy orderte einen zweiten Wein, Jesse einen weiteren Eistee. Die Kellnerin nahm ihre Essenswünsche entgegen und ging zur Küche. Die Geräusche aus dem Trockendock neben dem »Gray Gull« waren inzwischen verstummt. Im Hafen kehrten die letzten planmäßig verkehrenden Boote an ihren Anlegeplatz zurück.
»Du erinnerst dich doch sicher noch daran, was vor zehn Jahren auf Stiles Island passierte«, sagte Jesse.
Für den Bruchteil einer Sekunde schien Marcy innerlich zu verkrampfen.
»Als mich diese Bande von Mördern fesselten, knebelten und aufschlitzen wollten? Meinst du das?«
»Du erinnerst dich also«, sagte Jesse.
»Ich wünschte mir, ich könnt es vergessen. Aber wo du mich schon gewaltsam daran erinnerst, fällt mir auch wieder ein, dass du es warst, der mir damals das Leben gerettet hat.«
Jesse nickte. Die Bedienung kam mit ihren Salaten zurück. Sie schwiegen, während die Kellnerin ihnen die Teller auf den Tisch stellte und wieder ging.
»Erinnerst du dich vielleicht noch an einen von ihnen?«, fragte Jesse. »Einen Indianer, der auf den Namen Crow hörte?«
Marcy hatte wieder ihren inneren Krampf, der diesmal aber länger dauerte als beim ersten Mal.
»Mein Beschützer«, sagte sie.
»Er hat die Verjährungsfrist hinter sich gebracht. Aber wenn ich ein, zwei Zeugen finde, die bestätigen, dass er an einem Schwerverbrechen beteiligt war, das in einem Mord endete – selbst wenn er nicht selbst der Mörder war –, könnte ich vielleicht die Verjährungsfrist umgehen.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Du würdest nicht aussagen?«
»Nein.«
»Weil er dein Beschützer war?«
»Ja«, sagte Marcy, »Stockholm-Syndrom, Dankbarkeit – nenn es, wie du willst. Ich lag dort auf dem Rücken, Hände und Füße gefesselt, den Mund zugeklebt – und war fünf Finstermännern ausgeliefert, die alle lebenslänglich in den Knast gewandert wären, wenn man sie geschnappt hätte.«
Jesse nickte. »Sie hatten eh nichts zu verlieren.«
»Absolut nichts«, sagte Marcy. »Ich war ihnen ausgeliefert – und sie hätten alles Mögliche mit mir anstellen können. Ich konnte mich nicht wehren, ich konnte nicht mal sprechen. Kannst du dir vorstellen, was dann in deinem Kopf vor sich geht?«
»Nein«, sagte Jesse.
»Klar«, sagte Marcy, »du kannst es nicht. Ich wünschte mir, ich könnte es auch nicht. Ich wünschte mir, ich könnte die ganze Geschichte vergessen.«
»Aber sie rührten dich nicht an«, sagte Jesse.
»Nein, weil sie wussten, dass sie es dann mit Crow zu tun bekommen würden. Und vor dem hatten sie alle Angst, selbst Harry Smith.«
»Macklin«, sagte Jesse.
»Ich weiß. Aber in meiner Erinnerung ist er nun mal Harry Smith geblieben.«
»Wenn es für ihn von Vorteil gewesen wäre, hätte Crow dich wie eine Fliege zerdrückt.«
»Nein«, sagte Marcy, »ich sehe in ihm noch immer meinen Beschützer. Anderenfalls wäre ich nicht in der Lage, mir den Vorfall überhaupt in Erinnerung zu rufen.«
Jesse öffnete den Mund, sagte aber nichts. Er streckte seinen Arm aus und tätschelte ihre Hand.
»Ist schon okay«, sagte er. »Du hast es überlebt, weil Crow dich unter seine Fittiche nahm.«
»Crow und du.«
»Ich vielleicht auch, aber das kam ja erst später«, sagte Jesse.
Sie aßen schweigend ihren Salat. Die Kellnerin räumte die Teller ab und brachte das Hauptgericht. Marcy schaute über den Tisch zu Jesse. Sie trommelte mit den Fingerspitzen einer Hand gegen ihr Kinn.
»Er kam mich besuchen«, sagte sie, »vor zwei Tagen.«
Jesse nickte.
»Hat er dir gedroht?«
»Überhaupt nicht«, sagte Marcy, »er war sehr angenehm. Fragte, ob alles okay mit mir sei, und erzählte, dass er geschäftlich in der Stadt sei. Er wolle nur mal schauen, wie’s mir ging.«
»Glaubst du das?«
»Ich glaube, was ich glauben muss«, sagte sie. »Wenn ich ihn nicht mehr so in Erinnerung behielte, wie ichs tue, könnte ich mit der Erinnerung nicht leben. Ich könnte nicht mehr die Marcy sein, die du kennst. Kannst du das verstehen?«
»Ja«, sagte Jesse, »kann ich.«
5
Molly saß vor Jesses Schreibtisch.
»Niemand auf Stiles Island will sich zu Mr. Cromartie äußern«, sagte sie.
»Marcy auch nicht«, sagte Jesse.
»Obwohl du sie die ganze Nacht lang befragt hast?«
Jesse sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Ich bin Polizistin«, sagte sie, »ich habe meine Quellen.«
Jesse nickte.
»Sie ist davon überzeugt, dass er ihr das Leben gerettet hat«, sagte Jesse.
»Genau das Gleiche sagen die anderen Geiseln auch.«
»Ausnahmslos Frauen«, sagte Jesse.
»Ich hab dir doch gesagt, dass er ein Prachtkerl ist.«
»Vielleicht haben sie ja Recht«, sagte Jesse.
»Dass er ihre Leben gerettet hat?«
»Ja.«
»Vielleicht«, sagte Molly. »Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass viele Leute umkamen, nicht zuletzt auch zwei unserer Kollegen.«
»Aber von ihm wissen wir eigentlich nur, dass er die Frauen rettete«, sagte Jesse.
»Die Leute in der Bank, die Hausbesitzer, einige Geschäftsleute – sie wollen nicht mal die Aussage machen, dass er überhaupt an der Aktion beteiligt war. Sie wollen nicht wieder in den Fall verwickelt werden, weil sie nackte Angst vor ihm haben.«
»Ich kann ihnen nicht mal einen Vorwurf machen«, sagte Jesse.
»Dann haben wir also keinen Fall?«
»Nein«, sagte Jesse. »Ich hab mit Healy gesprochen. Es liegt kein Haftbefehl vor. Ich hab auch Travis angerufen, meinen Freund in Tuscon. Nichts. Crow scheint sich in den letzten zehn Jahren an keinem Verbrechen beteiligt zu haben.«
»Genug Geld für einen beschaulichen Ruhestand hat er ja«, sagte Molly.
»Dann frag ich mich nur, warum er gerade jetzt aus dem Ruhestand zurückkehrt«, sagte Jesse.
»Nun, genau genommen ist er das ja noch nicht«, sagte Molly. »Bisher ist er nur vorbeigekommen und hat Hallo gesagt.«
»Bisher«, sagte Jesse.
Suitcase Simpson klopfte am Türrahmen und kam mit einem großen Styropor-Becher Kaffee herein.
»Hast du die Verbrecher wieder bis zu unserem Donut-Laden gejagt?«, fragte Jesse.
»Der Laden wird von mir kontinuierlich überwacht«, sagte Suit. »Ich hab aber eine Neuigkeit aus einer ganz anderen Ecke.«
Jesse wartete.
»Wilson Cromartie hat gerade eine Wohnung beim Strawberry Cove gemietet. Und weißt du, wer der Makler war?«
»Marcy Campbell«, sagte Jesse.
Suit sah ihn enttäuscht an.
»Wusstest du das etwa schon?«, fragte er.
»Nein, aber welchen anderen Makler kennt Crow hier in der Stadt?«
Molly lächelte zu Jesse hinüber.
»Das hat sie dir doch bestimmt schon letzte Nacht erzählt«, sagte sie.
»Nein.«
»Seltsam«, sagte Molly.
Jesse nickte.
»Du hast Marcy letzte Nacht gesehen?«, fragte Suit.
»Sie wird gegen Crow nicht aussagen«, sagte Jesse.
»Trotz eines intensiven Kreuzverhörs«, sagte Molly.
»Sehr intensiv«, sagte Jesse.
Suit schaute von Einem zum Anderen und entschloss sich nicht weiter nachzuhaken.
»Sieht jedenfalls ganz so aus, als würde er sich für eine Weile hier niederlassen«, sagte er.
»Gibt uns mehr Zeit, ihn niet- und nagelfest zu machen«, sagte Jesse.
»Falls wir das schaffen«, sagte Molly.
»Früher oder später schaffen wir’s schon«, sagte Jesse.
6
Jesse machte sich den ersten Drink des Abends. Der Scotch glänzte golden und seidig, als er über die Eisbrocken glitt. Jesse füllte das Glas mit Soda auf, wartete, bis sich die Kohlensäure verzogen hatte und drehte mit seinem Zeigefinger das Eis im Glas herum. Jenn pflegte in diesen Momenten zu sagen, er solle doch einen Löffel benutzen, aber er machte es nun mal so, wie er’s schon immer gemacht hatte. Er nahm einen Schluck und spürte die Wirkung auf seinen Körper. Er schaute auf das Foto von Baseball-Legende Ozzie Smith, das hinter der Bar an der Wand hing. Er fragte sich, ob Ozzie wohl dem Alkohol zugesprochen hatte? Wahrscheinlich eher nicht. Eine Schnapsnase könnte den Salto rückwärts wohl nicht so schlagen, wie Ozzie Smith es konnte. Er prostete dem Foto zu.
»Wenn ich’s gepackt hätte, würd ich auch einen Salto schlagen«, sagte er laut.
Seine Stimme klang fremd – was sie im leeren Zimmer eigentlich fast jedes Mal tat. Ohne die Schulterverletzung hätte er vielleicht wirklich den Sprung zu den Baseball-Profis geschafft. Er trank noch einen Schluck. Ohne Alkohol wäre er vielleicht auch noch mit Jenn zusammen – wenn Jenn nicht die Neigung hätte, sich durch alle Betten in den siebten Himmel zu vögeln. Wenn er etwas klüger gewesen wäre, hätte er Jenn lieber sausen lassen und sich Sunny Randall geangelt – vorausgesetzt natürlich, Sunny hätte sich wirklich von ihrem geschiedenen Mann lösen können. Wenn …
Er ging zu der Glastür, die zum kleinen Balkon führte und einen Blick auf den Hafen bot. Er machte sich keine Illusionen, was Crow betraf. Was immer seine Gründe gewesen waren, die Frauen laufen zu lassen und Marcy unter seine Fittiche zu nehmen – wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte Crow keine Sekunde gezögert, sie alle in die ewigen Jagdgründe zu schicken.
Jesse schaute in sein Glas und stellte fest, dass es bereits leer war. Er ging zur Bar zurück und holte eine Handvoll Eiswürfel aus dem Kühlschrank. Er schüttete den karamellfarbenen Whiskey darüber und füllte das Glas mit Soda auf. Er rührte die Eiswürfel ein paar Mal mit dem Zeigefinger um und ging dann zurück zur Terrassentür.
Aber Mollys Argumente waren auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Er war sich zwar nicht sicher, ob er und Crow nun wirklich aus dem gleichen Holz geschnitzt waren, aber irgendwie hatte er zu Crow tatsächlich einen intuitiven Draht. Crow war hundertprozentig Crow – und sonst nichts. Er war in sich gefestigt. Wahrscheinlich war er auch der Typ, der nichts gegen einen Drink einzuwenden hatte. Und der nicht gleich nach dem ersten oder zweiten aufhörte. Wahrscheinlich war er nicht der Typ, der unter Druck durchdrehte oder gleich die Hasskappe aufzog. Oder sich vor Angst in die Hose machte. Jesse nahm einen Schluck und starrte über den Hafen, der nun schnell dunkel wurde. Wahrscheinlich auch nicht der Typ, der zu Liebe fähig war.
»Was noch am ehesten zu verschmerzen ist«, sagte er laut.
Doch während die Worte aus seinem Mund kamen, wusste er bereits, dass sie nicht der Wahrheit entsprachen. Wäre er wirklich glücklicher, wenn er Jenn nicht lieben würde? Er wäre vielleicht nicht so unglücklich – aber war das wirklich dasselbe? Was würde an den Platz des prickelnden Hochgefühls treten, wenn er an sie dachte – was fast immer der Fall war?
Jesse mixte sich einen weiteren Drink. Die nächtliche Dunkelheit hatte sich inzwischen über den Hafen gelegt. Es gab kaum noch etwas, das er von der Terrassentür aus beobachten konnte. Als er seinen Drink gemacht hatte, blieb er deshalb lieber gleich an der Bar hocken.
In gewisser Weise hatte seine Liebe zu Jenn gar nichts mit Jenn zu tun. Es ging mehr um die Person, in die er sich selbst verwandelte, wenn er in sie verliebt war. Warum ließ er sie nicht einfach gewähren? Warum konnte er sie nicht all die Dinge tun lassen, die scheinbar wichtig für sie waren – und sie trotzdem lieben? Was ging es ihn an, mit welchen Männern sie ins Bett stieg? Soll sie doch ihr Ding durchziehen – für mich macht’s keinen Unterschied. Er hörte ein tiefes, animalisch klingendes Geräusch in seinem Apartment – und wusste sofort, dass es von ihm kam. Er sah zu Ozzies Foto hoch und zuckte mit den Schultern. Okay, dann macht es eben einen Unterschied. Ging es vielleicht mehr um ihn als um sie? Kam er von Jenn nicht los, weil er im Unterbewusstsein nicht auf das Dauer-Drama ihrer Beziehung verzichten wollte? Er wusste, dass er sie liebte. Er wusste, dass sie ihn liebte. Er wusste aber auch, dass sie es einfach nicht schafften, diese Liebe umzusetzen.
»Im Moment«, sagte er laut und nahm noch einen Schluck.
7
Als Jesse das »Daisy’s« betrat, saß Crow an einem Ecktisch und aß gerade ein Eiklar-Omelett mit Früchten.
»Möchten Sie auch was?«, fragte Crow.
»Danke«, sagte Jesse.
Daisy brachte ihm Kaffee.
»Willst du einen Happen essen?«, fragte sie.
Jesse schüttelte den Kopf. Daisy ließ die Kaffeekanne auf dem Tisch und rauschte davon. Crow folgte ihr mit den Augen.
»Daisy Dyke«, sagte er.
»So nennt sie sich selbst«, sagte Jesse.
»Und warum?«
Jesse grinste.
»Sie wollte sogar ihr Restaurant ›Daisy Dyke’s‹ nennen, aber der Stadtrat legte sein Veto ein«, sagte er.
»Ist doch äußerst positiv, wenn jemand aus seinem Lesbentum kein Geheimnis macht«, sagte Crow.
Jesse nickte und trank einen Schluck Kaffee.
»Sieht so aus, als könnte ich Ihnen aus dem alten Fall keinen Strick drehen«, sagte er.
»Dann ist der Groschen also endlich gefallen?«, sagte Crow.
Jesse zuckte mit den Schultern.
»Was nicht heißt, dass ich’s nicht weiterhin versuchen werde«, sagte er.
»Ich hoffe, Sie sagen mir Bescheid, wenn’s so weit ist«, sagte Crow.
»Zunächst einmal muss ich wissen, was genau Sie hier treiben.«
Crow nickte.
»Guter Ansatz«, sagte er. »So würd ich an Ihrer Stelle auch vorgehen.«
»Sie könnten es mir natürlich auch gleich erzählen«, sagte Jesse. »Würde uns beiden viel Zeit sparen.«
Crow schüttelte den Kopf.
»Wir werden Ihnen rund um die Uhr an den Fersen kleben«, sagte Jesse.
»Wie viele Leute haben Sie?«, fragte Crow.
»Zwölf«, sagte Jesse. »Plus Molly, die das Revier am Laufen hält, und ich.«
»Vier Mann pro Schicht«, sagte Crow und lächelte.
»Wir können ganz schöne Quälgeister sein«, sagte Jesse.
»Davon bin ich überzeugt«, sagte Crow. »Das konnte ich ja schon beim letzten Mal feststellen.«
»Rechnen Sie damit, eine längere Zeit hier zu bleiben?«, fragte Jesse.
»Vielleicht.«
Jesse schüttete sich frischen Kaffee nach. Die beiden Männer schauten sich an.
»Uns beiden ist doch bewusst, dass Sie mich hier nicht rausekeln werden«, sagte Crow.
Jesse nickte.
»Ich war auch nicht davon ausgegangen«, sagte Jesse. »Einen Versuch war’s aber trotzdem wert.«
»Ich glaube nicht, dass Sie deswegen gekommen sind«, sagte Crow.
»Warum bin ich gekommen?«
»Sie wollen ein Gefühl dafür bekommen, wie ich ticke«, sagte Crow.
»War das auch der Grund, warum Sie mich im Revier besucht haben?«
»Genau.«
Jesse trank von seinem Kaffee. Crow aß den Rest seines Omeletts und wischte sich sorgfältig den Mund ab.
»Und jetzt?«, fragte Jesse nach einer Weile.
»Sie wissen, dass ich nicht den Schwanz einklemme«, sagte Crow, »und ich weiß, dass Sie’s auch nicht tun werden.«
Jesse fiel auf, dass die Tischdecke vor Crow noch jungfräulich weiß war – keine Krümel, keine Flecken. Er sah fast so aus, als habe hier niemand gegessen.
»Ja«, sagte Jesse, »so sieht’s wohl aus.«
8
Er war ein klein gewachsener Mann mit grauem Krauskopf, rosiger Gesichtsfarbe und einer altmodischen Fliege.
»Walter Carr ist mein Name«, sagte er. »Ich bin Professor für innerstädtische Planungen an der Taft University.«
Jesse nickte.
»Und das hier ist Miriam Fiedler«, sagte Carr, »die Geschäftsführerin des ›Westin Charitable Trust‹.«
»Wie gehts?«, fragte Jesse.
Miriam Fiedler nickte. Sie war groß und hager und hatte Zähne, die an ein Pferdegebiss erinnerten.
»Und vielleicht kennen Sie diesen Gentleman ja bereits«, sagte Carr. »Austin Blake?«
»Wir hatten bisher noch nicht das Vergnügen«, sagte Jesse.
»Ich bin Anwalt«, sagte Blake, »sozusagen als inoffizieller Berater anwesend.«
»Das ist Molly Crane«, sagte Jesse und nickte zu Molly hinüber, die neben seinem Schreibtisch saß und einen Notizblock auf ihrem Schoß hatte.
Carr räusperte sich. »Wir repräsentieren eine Gruppe von Nachbarn, um Sie auf ein Problem aufmerksam zu machen.«
Jesse nickte.
»Sie sind doch daran interessiert, oder?«, sagte Miriam.
»Natürlich, Ma’am.«
»Wie Sie vielleicht wissen«, sagte Carr, »gibt es Überlegungen, die frühere Crowne-Villa auf Paradise Neck in eine Sonderschule für problematische Schüler umzufunktionieren.«
»Überwiegend Latinos aus Marshport«, sagte Jesse.
»Paradise Neck ist nun mal ein sehr eigener Ort. Die Straßen sind eng und der Ozean nimmt uns von beiden Seiten in die Zange.«
Jesse nickte.
»Es gibt keine Möglichkeit, die bestehende Infrastruktur zu erweitern«, sagte Carr.
»Richtig«, sagte Jesse.
Blake hatte eine gesunde Hautfarbe und längere, schneeweiße Haare, die er glatt nach hinten kämmte. Es saß ruhig auf seinem Stuhl, hatte ein Bein übers andere geschlagen und beschränkte sich aufs Zuhören. Es war eine Haltung, die Jesse ungemein schätzte. Mrs. Fiedler hingegen war offensichtlich gereizt und ungeduldig.
»Um Gottes Willen, Walter, der Punkt ist doch einfach der: Die Gemeinde kann nicht ganze Busladungen von Problemkindern verkraften, die auf so engem Raum kommen und gehen.«
»Wie sähe es denn mit unproblematischen Kindern aus?«, fragte Jesse.
Blake lächelte unmerklich.
»Wie bitte?«, sagte Mrs. Fiedler.
»Dreht es sich um die Anzahl der Busse«, fragte Jesse, »oder um die Insassen?«
»Die Busse werden ein gravierendes Verkehrsproblem heraufbeschwören«, sagte Mrs. Fiedler.
Sie schaute zu Molly, die sich gerade Notizen machte.
»Was macht sie denn da?«, fragte Mrs. Fiedler.
»Das ist Kommissarin Crane«, sagte Jesse.
»Wer immer sie auch sein mag: Was macht sie da?«
Jesse lächelte.
»Ich weiß es nicht«, sagte er. »Molly, was machst du da?«
»Ich bin eine Frau«, sagte Molly, »ich habe einfach das natürliche Bedürfnis, gleich neben meinem Chef zu sitzen und Notizen zu machen.«
»Notizen?«, sagte Mrs. Fiedler. »Dies ist ein informelles Gespräch. Es gibt nichts, was einen Weg in offizielle Unterlagen finden sollte.«
»Von welchen Unterlagen reden wir denn hier?«, fragte Jesse.
»Nun spielen Sie mal nicht den Schlauberger«, sagte sie. »Ich möchte jedenfalls nicht, dass von unserem Gespräch Notizen angefertigt werden.«
»Versteh ich ja«, sagte Jesse, »aber ohne Erinnerungsstützen werd ich die Hälfte vergessen.«
»Dann möchte ich einmal hören, was sie bisher aufgeschrieben hat«, sagte Mrs. Fiedler.
»Miriam«, sagte Blake beschwichtigend.
»Nein, ich bestehe darauf«, sagte Mrs. Fiedler. »Was haben Sie geschrieben, junge Frau?«
Molly blätterte durch ein paar Seiten ihres Stenoblocks und blieb dann an einer Stelle hängen: »Keine schmierigen Mexikaner in Paradise Neck«, sagte sie.
Blake schaute betreten auf den Boden, Jesse starrte unbewegt in die Luft, doch Mrs. Fiedler geriet in Rage.
»Wie … in Gottes Namen … wagen Sie es …?«
Walter Carr erhob sich.
»Diese Worte sind nie über unsere Lippen gekommen«, sagte er.
Sein rosiges Gesicht hatte inzwischen ein kräftiges Pink angenommen. Er schaute zu ihrem Anwalt.
»Ist das justiziabel, Austin?«
Blakes Gesicht blieb ernst, doch in seinen Augen glaubte Jesse einen Hauch von Belustigung zu erkennen.
»Viele Dinge im Leben sind justiziabel, Walter«, sagte er. »Allerdings glaube ich nicht, dass uns der Gang zu Justitia in diesem Fall allzu weit führen wird.«
»Sie hat uns beleidigt«, sagte Mrs. Fiedler.
»Ich glaube, sie hat dich nur ein wenig auf die Schippe genommen, Miriam.«
»Ich habe es als Beleidigung wahrgenommen«, sagte Mrs. Fiedler.
Sie drehte sich zu Jesse um.
»Ich erwarte, dass sie ernsthaft verwarnt wird«, sagte sie.
»Davon können Sie ausgehen«, sagte Jesse. »Wie viele Kinder sollen diese Schule denn besuchen?«
»Zwölf«, sagte Carr.
»Ein Schulbus wird sie also morgens abliefern und nachmittags wieder einsammeln?«, fragte Jesse.
Niemand antwortete.
»Zwölf Schüler«, sagte Jesse. »In welchem Alter?«
»Vorschule«, sagte Carr.
Jesse nickte.
»Das sind die schlimmsten«, sagte er.
Carr reagierte nicht.
»In der Tat«, sagte Mrs. Fiedler, »die Spitze des Eisbergs. Man muss diese Entwicklung im Keim ersticken, bevor der Wert von Paradise Neck ins Bodenlose fällt.«
»Sie meinen die Immobilien-Preise?«, sagte Jesse.
»Alles, absolut alles«, sagte Mrs. Fiedler.
Es war für einen Moment still im Büro.
»Nun?«, sagte Mrs. Fiedler.
»Zwölf Vorschul-Kinder und ein einziger Schulbus scheinen mir eigentlich noch kein Sicherheitsproblem darzustellen«, sagte Jesse.
»Das haben Sie nicht zu entscheiden«, sagte Mrs. Fiedler.
»Ich fürchte, das fällt genau in meinen Entscheidungsbereich«, sagte Jesse.
»In einer Demokratie entscheidet die Bevölkerung«, sagte Mrs. Fiedler. »Und Sie arbeiten für uns.«
»Was für eine erschreckende Vorstellung«, sagte Jesse.
»Heißt das, dass Sie nichts unternehmen werden?«
»Im Moment jedenfalls nicht«, sagte Jesse.
Mrs. Fiedler erhob sich.
»Sie werden noch von uns hören«, sagte sie.
»Damit hatte ich gerechnet«, sagte Jesse.
Mrs. Fiedler verließ wortlos das Zimmer. Die beiden Männer folgten ihr. Carr blickte starr geradeaus, während Blake beim Herausgehen Molly zuzwinkerte.
Jesse und Molly saßen für einen Augenblick wortlos auf ihren Stühlen. »Soso, keine schmierigen Mexikaner in Paradise Neck«, sagte er schließlich.
»Sie trieb mich einfach auf die Palme«, sagte Molly.
»Hatte ich fast schon vermutet«, sagte Jesse.
»Wirst du mich jetzt verwarnen?«, fragte Molly.
»Mehr noch – ich sehe mich gezwungen, dich mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen.«
»Wirklich?«
»Ja«, sagte Jesse. »Für den Rest des Tages ist es dir strikt untersagt, mir noch einen deiner schlüpfrigen Witze zu erzählen.«
»Oh mein Gott«, sagte Molly, »wie soll ich das nur überleben?«
9
Jesse und Suitcase saßen in Simpsons Streifenwagen, den sie am Paradise Beach geparkt hatten. Jesse trank einen Kaffee, während sich Simpson zum Lunch eins der extralangen Sub-Sandwiches gekauft hatte. Vorsichtig biss er hinein und achtete darauf, dass die Soße nicht auf seine Uniform tropfte.
»Ist schon komisch«, sagte er. »Wann immer man am Meer ist, hat man auch das Bedürfnis, aufs Wasser zu schauen.«
Jesse nickte.
»Irgendwie spür ich dann immer den Hauch des Schöpfers«, sagte Simpson.
Jesse nickte.
»Ich frag mich, warum das so ist«, sagte Simpson.
»Übersteigt meinen Horizont«, sagte Jesse.
»Kriegst du denn auch so was wie religiöse Gefühle?«, sagte Simpson.
»Mhm.«
Für eine Weile starrten sie wortlos aufs Wasser. Die Flut war gerade auf ihrem höchsten Stand und hatte den größten Teil des Strandes überschwemmt. Ein paar Leute in Badekleidung hockten auf dem Sandstreifen, der noch aus dem Wasser ragte.
»Crow weiß, dass wir ihn beobachten«, sagte Simpson.
»Alles andere wäre auch verwunderlich«, sagte Jesse. »Wer ist denn momentan an seinen Fersen?«
»Eddie.«
»Und – macht Crow irgendetwas, das uns interessieren könnte?«
»Nicht die Bohne.«
Simpson aß den letzten Bissen des Sandwiches und wischte sich den Mund sorgfältig ab. Er steckte die Serviette in die Tüte, aus der das Sandwich gekommen war.
»Meistens schlägt er nur die Zeit tot«, sagte er. »Mittags geht er oft zu Daisy Dyke, abends gerne mal auf einen Drink ins ›Gray Gull‹. Jeden Morgen besucht er den Paradise Health & Fitness Club – und zwischendurch schaut er sich die Stadt an.«
»Zu Fuß oder im Auto?«, fragte Jesse.
»Beides. Er fährt kreuz und quer, parkt den Wagen und geht dann zu Fuß weiter. Warum?«
»Könnte uns vielleicht bei der Frage helfen, wen oder was er sucht«, sagte Jesse. »Wo geht er denn zu Fuß hin?«
»Einkaufscenter, auch einzelne Geschäfte. Manchmal kommt er aber auch zum Strand. Klappert die ganzen Läden auf der Paradise Row ab. Schaut sich gelegentlich auch ein Tennis-Match bei der Highschool an.«
»Hat er sich am Bahnhof für die Pendlerzüge interessiert?«, fragte Jesse.
Simpson zuckte mit den Schultern. Er holte einen kleinen Notizblock aus seiner Hemdtasche und blätterte ihn durch.
»Nichts dergleichen«, sagte er, »wir haben jedenfalls keine Erkenntnisse dazu. Ich gleiche nämlich meine Beobachtungen mit denen der Kollegen ab.«
Jesse lächelte.
»Der Chef-Ermittler bei der Arbeit«, sagte er.
»Wenn schon, denn schon«, sagte Simpson. »Es macht doch Sinn, gleich den Überblick zu haben.«
»Suit«, sagte Jesse. »Wenn wir das Budget hätten, würd ich dir glatt eine Gehaltserhöhung geben.«
»Aber wir haben das Budget nun mal nicht«, sagte Suit.
»In der Tat«, sagte Jesse. »Ist er vielleicht manchmal zum Hafen gekommen?«
»Nein.«
»Zum Softball-Platz?«
»Nein.«
»Vielleicht ist es ja eine Frau, die er sucht«, sagte Jesse.
»Wegen der Lokalitäten, die er besucht?«
»Richtig. Es ist vielleicht eine voreilige Schlussfolgerung, aber er scheint sich vor allem an Plätzen aufzuhalten, wo man Frauen findet.«
»Ich glaube, in unserem liberalen Städtchen darfst du solche Gedanken gar nicht erst äußern«, sagte Simpson.
»Warum?«, fragte Jesse. »Weil’s politisch nicht korrekt ist?«
»Paradise ist nun mal stolz auf seine Toleranz«, sagte Simpson.
»Hauptsache, die schmierigen Latinos bleiben draußen«, sagte Jesse.
Simpson grinste.
»Ja, Molly hat mir von der Geschichte erzählt.«
»Mrs. Fiedler stand neulich am Damm nach Paradise Neck und registrierte mit einem Zählgerät die Anzahl der Autos«, sagte Jesse.
»Und um wie viele Kinder handelt es sich noch mal?«, fragte Simpson.
»Zwölf«, antwortete Jesse, »Vorschul-Alter.«
»Das wäre wohl ein Mini-Bus«, sagte Simpson, »einmal morgens, einmal nachmittags.«
Jesse nickte. Sie schauten wieder aufs Meer hinaus.
Plötzlich ging ein breites Grinsen über Simpsons Gesicht.
»Das sind die Leute, die man mit aller Gewalt aufhalten muss«, sagte er.
10
Jesses ehemalige Gattin steckte den Kopf ins Büro. »Hallo, Süßer, hast du ’ne Minute für mich?«, fragte sie.
Jesse spürte die elektrische Spannung, die seinen Körper durchzuckte, wie immer wenn er sie sah.
»Klar hab ich ’ne Minute«, sagte er.
Jenn trat ein und war wie immer picobello gekleidet. Sie gab ihm einen feuchten, aber doch flüchtigen Kuss. Die elektrische Spannung stieg noch kurz weiter an, sackte dann aber rapide in sich zusammen: Der Kuss signalisierte die Abwesenheit jeglicher Leidenschaft.
»Man hat mich auf ein Thema angesetzt, für das ich etwas recherchieren muss«, sagte sie.
»Was recherchiert Channel Three denn diesmal?«, fragte Jesse. »Die Rückkehr des Plateauschuhs?«
»Willst du mir etwa einreden, unsere Nachrichten-Redaktion sei nicht für ihre seriöse Arbeit geachtet?«
»Genau das war meine Absicht«, sagte Jesse.
»Dieses Mal ist es aber wirklich ein brisantes Thema, das angemessen recherchiert werden muss«, sagte Jenn.
Jesse nickte. Er spürte noch immer den Knoten in seinem Magen, der erst verschwinden würde, wenn Jenn längst gegangen war.
»Wie wir von unseren Quellen erfahren haben, sind kriminelle Latino-Gangs auf dem Sprung nach Paradise«, sagte sie.
Jesse starrte sie an.
»Latino-Gangs«, sagte er nur.
»Die entsprechenden Graffiti nehmen jedenfalls in erschreckendem Ausmaß zu«, sagte Jenn.
Sie öffnete ihre Handtasche, holte ein paar Fotos heraus und legte sie auf Jesses Tisch.
»Das sind Aufnahmen, die uns unsere Informanten zugänglich gemacht haben«, sagte sie.
Zwei von ihnen erkannte Jesse sofort. Ein Graffito befand sich seit einem Jahr an dem Bahnhof, der für den Nahverkehr nach Boston zuständig war. Ein anderes prangte auf der Rückseite eines Lebensmittelgeschäfts in der Shopping Mall. Zwei weitere hatte er allerdings noch nicht gesehen.
»Kannst du mir deine Quellen nennen?«
Jenn schüttelte den Kopf.
»Sagt dir der Name Miriam Fiedler irgendetwas?«
Sie lächelte.
»Walter Carr?«
Jenn lächelte erneut, antwortete aber nicht.
»Jenn«, sagte Jesse, »seit ich in dieser Stadt lebe, hat es noch kein Verbrechen gegeben, das in irgendeinem Zusammenhang mit kriminellen Banden steht.«
»Aber ist das nicht seltsam?«, sagte Jenn. »Marshport ist gleich in der Nähe – und dort gibt’s doch Gangs.«
»Mehrere sogar«, sagte Jesse.
»Glaubst du nicht, dass sie gerne mal in Paradise Fuß fassen möchten – wo doch hier weit mehr betuchte Leute wohnen?«
Jesse lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Jenn hatte ein Bein übers andere geschlagen. Ihre Hose war so eng, dass die Konturen ihrer Oberschenkel deutlich sichtbar waren.
»Ich hab zwar nie in einem Slum gelebt«, sagte Jesse, »aber lange genug in den Slums von L.A. gearbeitet. Die Leute in der begrünten Vorstadt glauben oft, dass Slum-Bewohner nur davon träumen, eines Tages mit ihnen tauschen zu können. Dabei leben viele, die ich kannte, durchaus gerne in ihrer Nachbarschaft im Slum. Die Eintönigkeit und Langeweile einer Vorstadt würde sie nur in den Wahnsinn treiben.«
»In meinen Ohren klingt das wie eine Entschuldigung, nichts gegen Slums zu unternehmen«, sagte Jenn.
»Da ist sicher was Wahres dran«, sagte Jesse.
»Womit ich nicht sagen wollte, dass du diese Meinung vertrittst. Aber glaubst du wirklich, dass sich keiner von diesen Gangs nach Paradise verirrt?«
»Gelegentlich schon«, sagte Jesse. »In den meisten Fällen wahrscheinlich, um den Highschool-Kids Drogen zu verkaufen.«
»Kannst du sie nicht aufhalten?«
»Ob ich die Kids vom Dope fernhalten kann?«, fragte Jesse.
Jenn nickte.
»Oder vom Dealen?«, sagte Jesse.
Jenn nickte erneut.
»Nein«, sagte Jesse.
»Du kannst es nicht?«
»Nein«, sagte Jesse, »aber ich lass mir deswegen nicht gleich graue Haare wachsen. Niemand schafft das – nirgendwo.«
»Willst du andeuten, dass wir das Problem einfach ignorieren sollten?«
Jesse schwieg für eine Weile und schaute sie an.
»Sind wir hier etwa mitten in einem Interview?«, sagte er dann.
»Oh Gott, tut mir leid, Jesse. Ich wollte dir nicht auf den Zahn fühlen. Das ist einfach die Journalistin in mir: Stell immer gleich die Folge-Frage. Verstehst du?«
Jesse nickte.
»Trotzdem möchte ich gerne meine Nase in diese Gang-Geschichte stecken«, sagte Jenn.
Sie lächelte. Die Wirkung ihres Lächelns war geradezu körperlich. Jesse hatte immer das Gefühl, als müsse er in dieser Situation laut aufstöhnen.
»Es wäre meiner Karriere sicher nicht förderlich, wenn ich meinem Chef erzähle, dass mir mein Ex die Story ausgeredet hat.«
»Sicher nicht«, sagte Jesse.
»Bist du jetzt stinkig, dass ich dich etwas in die Mangel genommen habe?«
»Nein.«
»Du weißt ja, wie viel mir mein Job bedeutet.«
»Ich weiß.«
»Er bedeutet mir so viel wie dir deiner.«
»Ich weiß.«
»Was mich vielleicht manchmal zu einem Quälgeist macht«, sagte Jenn.
»Ich denke, dass dich jeder Job bis zum gewissen Grad prägt«, sagte Jesse. »Aber keine Angst: Ein Quälgeist wirst du nie werden.«
Jenn lächelte ihn an.
»Selbst dein Job prägt dich?«, fragte sie.
Jesse nickte.
»In welcher Form hat dich dein Job bislang geprägt?«, fragte Jenn.
Jesse dachte eine Weile nach.
»Ich denke mal, dass er meinen Erwartungshorizont eingeschränkt hat«, sagte er schließlich.
Jenn starrte ihn mit aufgerissenen Augen an und hob ihre Augenbrauen.
»Vielleicht willst du darüber sprechen?«, fragte sie.
»Nicht wirklich«, sagte Jesse.
»Bitte!«, sagte Jenn. »Ich bin jetzt auch nicht mehr die neugierige Reporterin, sondern deine Exfrau, die dich noch immer liebt.«
Jesse spürte die innere Unruhe, die er in ihrer Anwesenheit eigentlich immer empfand: Er versuchte die Kontrolle über sich zu behalten und all die Emotionen die er so sorgfältig verpackt und abgespeichert hatte nicht wieder aufkommen zu lassen. Unbewusst richtete er sich im Stuhl auf und streckte die Schultern.
»Es fällt mir halt schwer, noch an die ewigen Wahrheiten zu glauben«, sagte er. »Man kann Verbrechen nicht verhindern. Man würde sogar die meisten Fälle nicht lösen, wenn die Verbrecher so schlau wären, anschließend ihre Klappe zu halten. Man kann eigentlich nur versuchen, sein Eckchen so sauber wie möglich zu halten.«
»Aber trotzdem hängst du dich ganz schön rein«, sagte Jenn.
»Irgendwas muss man schließlich tun«, sagte Jesse.
»Ich persönlich glaube ja, dass du zu oft und zu intensiv mit menschlichen Gefühlen konfrontiert wirst«, sagte Jenn. »Die Leute lügen doch wie gedruckt – sie lügen dich an, aber auch sich selbst. Es gibt nur wenige Menschen, auf die man wirklich bauen kann. Die meisten Leute tun doch das, was sie angeblich tun müssen – und nicht das, was sie wirklich tun sollten.«
»Du hast diese Erfahrung wohl auch gemacht«, sagte Jesse.
»Ich arbeite schließlich beim Fernsehen, Jesse.«
»Oh«, sagte Jesse, »wie konnte ich’s vergessen.«
Sie schwiegen.
Durchs Fenster sah Jesse auf die Einfahrt der Feuerwehr, wo einige Feuerwehrleute ihre Löschzüge putzten. Von weitem hörte er das Telefon am Empfang und kurz darauf Mollys Stimme.
»Auf wen kann man sich überhaupt noch verlassen?«, fragte Jenn.
»Auf uns?«
»Darauf läuft’s wohl am Ende des Tages hinaus«, sagte Jenn.
»Wo wir beide doch immer einen Mordsspaß miteinander haben«, sagte Jesse.
11
Der Osten von Marshport ging nahtlos in den Westen von Paradise über. Marshport war eine ältere Industriestadt, der die Industrie aber inzwischen gänzlich abhanden gekommen war. Im Südwesten gab es eine große ukrainische Bevölkerungsgruppe, doch der Rest der Stadt wurde überwiegend von Latinos bewohnt. Es gab ein paar halbherzige Initiativen, Teile der Stadt wieder auf Vordermann zu bringen, doch letztlich wurden dabei nur alte Slums gegen neue getauscht.
Jesse parkte vor einem Gebäude, das früher einmal eine Grundschule beherbergt hatte und nun als Büro für die wenigen Aktivitäten diente, die in Marshport tatsächlich noch Büroräume benötigten. Er war mit seinem Privatwagen gekommen und trug auch keine Uniform, sondern hatte sich Jeans und ein weißes Hemd angezogen. Ein blauer Blazer verdeckte das Holster mit seinem Revolver.
Auf der Tür zu Nina Pineros Büro war mit einem schwarzen Filzstift das Wort INTEGRATIONSFÖRDERUNG geschrieben worden. Jesse trat ein. Das Büro war ein früheres Klassenzimmer im ersten Stock. Aus dem Fenster konnte man auf den Hinterhof sehen, wo ein paar Kids auf einem Asphaltplatz rumlungerten und ziemlich apathisch Basketball spielten. Der Korb bestand aus dünnen Metallkettchen und der Spielplatz war mit Flaschen, Zeitungen, Fast-Food-Verpackungen und undefinierbaren Gegenständen zugemüllt.
Die Schultafel hing noch an der Wand, ebenso eine Pinnwand, die mit verschiedenfarbenen Memos und Pins gut gefüllt war. Ein paar alte Aktenschränke standen an der Wand – und auch Nina Pineros Schreibtisch wirkte wie ein Relikt aus früheren Schultagen. Es standen drei Telefonapparate auf ihrem Tisch.
»Nina Pinero?«, fragte Jesse.
»Ich bin Nina«, sagte sie.
Es befand sich sonst niemand in ihrem Büro.
»Mein Name ist Jesse Stone. Ich hatte mich telefonisch bei Ihnen gemeldet.«
»Mr. Stone«, sagte Nina. Sie nickte zu einem Stuhl an ihrem Schreibtisch. »Setzen Sie sich doch.«
Jesse nahm Platz.
»Erzählen Sie mir doch bitte von Ihren Plänen, die alte Crowne-Villa in Paradise pädagogisch zu nutzen«, sagte Jesse.
»Damit Sie einen Weg finden, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen?«, sagte Nina Pinero.
»Damit wir unnötigen Aggressionen aus dem Weg gehen können«, sagte Jesse.
»Setzen Sie Latinos automatisch mit Aggressivität gleich?«
»Ich dachte da eher an die Leute in Paradise«, sagte Jesse.
Nina war schlank und scheinbar topfit, als würde sie regelmäßig an ihrer Kondition arbeiten. Sie hatte kurze Haare, die sie nach hinten bürstete.
»Oh«, sagte sie lächelnd, »entschuldigen Sie meine voreiligen Schlussfolgerungen.«
Jesse nickte.
»Wenn ich’s recht verstanden habe, sind es momentan nur eine Handvoll Kinder, die dort mit Förderprogrammen auf die Schule vorbereitet werden sollen.«
»Ja«, sagte sie, »es ist so was wie ein Pilot-Projekt.«
»Das heißt, dass es später mehr Kinder werden sollen?«
»Wenn sich das Projekt positiv entwickeln sollte – vielleicht.«
Jesse nickte.
»Die Bevölkerung in Ihrem Wahlkreis beschwört jetzt sicher den Beginn einer Völkerwanderung«, sagte sie.
»In der Tat«, sagte Jesse.
»Von Verkehrsproblemen ganz zu schweigen«, sagte sie.
Nina Pinero trug eine weiße Hose und ein ärmelloses schwarzes Oberteil, in dem sie eine ausgezeichnete Figur machte.
»Auch das«, sagte Jesse.
»Nehmen Sie ihnen die Argumente ab?«
»Nein. Sie haben nur Angst, dass die Preise ihrer Immobilien in den Keller rauschen, wenn potenzielle Käufer davon erfahren, dass es in der Nachbarschaft eine Schule für Lateinamerikaner gibt.«
»Wie ich weiß, haben sie schon versucht, die Bauaufsichtsbehörde auf ihre Seite zu ziehen«, sagte sie.
»Der Gemeinderat hat mir erklärt, dass es in Paradise keine Nutzungspläne gibt, die der Errichtung einer Schule im Weg stehen. Reguliert werden nur die Aktivitäten neben einer existierenden Schule. Für den Neubau gibt es keine Vorgaben.«
»In der Tat.«
»Sie haben Ihre Hausaufgaben offensichtlich gemacht«, sagte Jesse.
»Hab ich.«
»Haben Sie einen juristischen Beistand?«
»Ich bin selbst Anwältin«, sagte sie.
»Obwohl Sie noch so jung und hübsch sind«, sagte Jesse.
»Meine einzige Ausrede besteht darin, dass ich mit meinem Beruf keinen Heller verdiene.«
Jesse nickte.
»Wie alt sind die Kinder denn?«, fragte er.
»Vier, fünf, ein paar schon sechs.«
»Und es sind vermutlich die vielversprechendsten Kids ihres Jahrgangs?«
»Richtig.«
»Wie reagieren die Kinder denn auf die Möglichkeit, eine Schule in Paradise besuchen zu können?«, fragte er.
»Sie haben Angst.«
»Was sie aber nicht vom Schulbesuch abhalten wird?«
»Marshport ist kein guter Ort für Kinder«, sagte Nina Pinero. »Viele von ihnen sind ohnehin verängstigt. Mit dieser Schule schaffen wir es vielleicht, zumindest eine Handvoll von ihnen zu retten.«
»Nicht alle?«
»Um Gottes willen, nein«, sagte sie, »nicht mal die Mehrzahl von ihnen. Aber besser ein paar als gar keins.«
»Klingt fast so wie die Aufgabenstellung eines Cops«, sagte Jesse.
»Man tut, was man kann«, sagte sie.
Sie schwiegen für eine Weile. Die Fenster waren geöffnet, da der Raum keine Klimaanlage hatte. Jesse hörte das dumpfe Geräusch des Basketballs auf dem Asphalt.
»Und am Montag wollen Sie Ihren ersten Versuch wagen?«, fragte Jesse.
»Ja. Erwarten Sie Ärger?«
»Wahrscheinlich nicht. Ob die Kids wohl Probleme haben, wenn ich mit ihnen im Bus fahre?«
»Sie?«
»Ich und Molly Crane, eine Kollegin«, sagte Jesse. »Ich werde Uniform tragen und meine Polizeimarke auf Hochglanz polieren.«
»Dann glauben Sie also doch, dass es Ärger geben wird.«
»Nicht wirklich«, sagte Jesse. »Vielleicht gibt’s das eine oder andere Protestschild, aber ich möchte es eigentlich für die Kinder tun.«
»Damit sie sich in Ihrer Anwesenheit sicherer fühlen?«
»Genau.«
»Wobei die meisten natürlich Angst vor der Polizei haben«, sagte Nina Pinero.
»Vielleicht schaffen Molly und ich es ja, ihnen die Furcht zu nehmen.«
Nina Pinero nickte nachdenklich.
»Ja«, sagte sie, »ich kann mir sogar vorstellen, dass Sie das tatsächlich schaffen.«
12
Crow saß im »Gray Gull« und vertiefte sich gerade in seinen Johnnie Walker Blue, als sein Handy klingelte. Er schaute auf die Telefonnummer und beantwortete den Anruf, während er nach draußen vor die Tür trat.
»Das Mädel hat sich mit Kreditkarte einen großen Fernseher gekauft«, sagte die Stimme am anderen Ende.
»Von Ihrem Konto?«
»Ja, sie hat eine von diesen Nebenkarten: Ihr Name steht auf der Karte, aber die Rechnung geht an mich.«
»Ihr richtiger Name?«
»Ja.«
»Weiß sie, dass die Rechnung bei Ihnen eintreffen wird?«
»Weiß der Teufel, was sie weiß. Ihr ganzes Leben lang sind ihre Rechnungen bei mir gelandet. Wahrscheinlich hat sie nie einen Gedanken daran verschwendet, wer die Rechnungen zahlt. Vielleicht hat sie noch nie gehört, dass Rechnungen überhaupt bezahlt werden müssen.«
In der Dunkelheit der Terrasse konnte sich Crow ein Grinsen nicht verkneifen.
»Wo hat sie den Fernseher denn gekauft?«, fragte er.
»In einem Laden namens ›Images‹ in Marshport/Massachusetts.«
»Dann ist sie offensichtlich wirklich in dieser Gegend«, sagte Crow.
»Hab ich Ihnen doch gesagt.«
»Was für ein Modell?«, fragte Crow.
»Ich hab’s irgendwo aufgeschrieben«, sagte die Stimme. Es war eine angenehme Stimme, doch die Ungeduld und Gereiztheit darin war unüberhörbar – als wolle jemand schreien, müsse es sich aber verkneifen.
»Mitsubishi 517«, sagte die Stimme. »140 Zentimeter Durchmesser.«
»Dann hat sie ihn also nicht selbst transportiert«, sagte Crow.
»Würde sie ohnehin nie tun«, sagte die Stimme.
»Vielleicht erzählen sie mir in dem Laden ja, wohin der Fernseher geliefert wurde«, sagte Crow.
»Vielleicht«, sagte die Stimme.
Die Verbindung wurde abgebrochen. Crow klappte sein Handy zu und steckte es weg. Für eine Weile schaute er über den Parkplatz zum Hafen.
»Und wenn ich sie finde«, sagte er, »was dann?«
13
Der kleine Bus war gelb, hatte eine Registrierung als Schulbus und auch die übliche Warnung, dass beim Blinken der Warnlichter der Bus nicht mehr überholt werden darf. Der Fahrer war ein weißhaariger Lateinamerikaner, dessen Englisch so lückenhaft war, dass eine Unterhaltung wenig sinnvoll erschien. Jesse stand neben dem erhöhten Fahrersitz, während Molly mit Nina Pinero in der letzten Reihe saß. Sowohl Molly als auch Jesse trugen ihre Uniform. Jesse hatte sogar seinen mit Borten besetzten Hut rausgekramt, der ihn als Polizeichef von Paradise auswies. Die Kleider der Kinder waren frisch gewaschen und gebügelt worden. Die Kinder selbst waren mucksmäuschenstill. Jesse bemerkte, dass einige von ihnen nervös schluckten. Und obwohl alle eine braune Hautfarbe hatten, sahen sie sehr bleich aus.
Der Bus passierte Paradise Beach – und niemand schenkte ihnen Beachtung. Die Kinder schauten zum Hot-Dog-Stand hinüber. Der Bus fuhr auf die Dammstraße, die den geschäftigen Hafen vom offenen Meer trennte. Die Kinder starrten aus dem Fenster. Die Stille im Bus lag so schwer in der Luft, dass man sie mit dem Messer hätte schneiden können. Jesse bemühte sich gar nicht erst, die Kinder aufzumuntern. Er wusste, dass es unter den gegenwärtigen Umständen sinnlos war. Am Ende des Damms bog der Bus in die Sea Street ein, passierte den Paradise Yacht Club und hielt an einer Natursteinmauer, die sich vor einer hügeligen Rasenfläche befand. Auf der anderen Straßenseite parkte ein weißer Van mit überdimensionierter Satellitenschüssel und dem Schriftzug ACTION NEWS 3. Ein riesiges, mit Schindeln beschlagenes Haus thronte auf der Spitze des Hügels. Durch eine Öffnung in der Mauer führte eine breite, mit hellem Kies bedeckte Auffahrt zum Haus hinauf. Am Toreingang hatten sich rund 20 sommerlich gekleidete Personen versammelt. Jenn, die mit ihrem großen Hut und dem eleganten Sommerkleid nicht zu übersehen war, stand neben einem Kameramann mit Safari-Weste.
Nina Pinero erhob sich und kam nach vorne zum Fahrer. Jesse gab ihm ein Zeichen, die Türen zu öffnen. Jesse stieg aus. Die anwesenden Passanten starrten ihn an. Walter Carr und Miriam Fiedler, beide Flugblätter in der Hand, standen gleich vorne in der ersten Reihe. Jesse fragte sich, für wen sie die Flugblätter wohl gemacht hatten.
»Hallo«, sagte Jesse. »Ich bin gekommen, um Sie vor den Eindringlingen zu schützen.«
»Was erzählen Sie da?«, sagte Carr ungläubig.
»Zusammen mit Kommissarin Crane möchte ich sicherstellen, dass keiner dieser Wilden Ihr Leben oder den Wert Ihrer Immobilie gefährdet.«