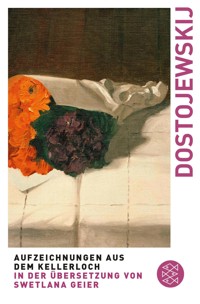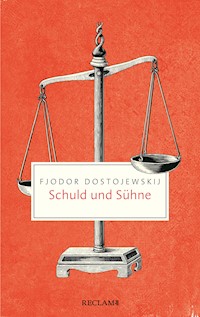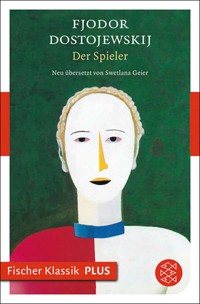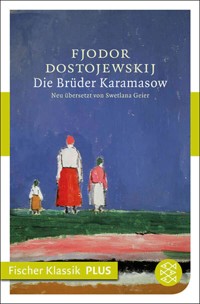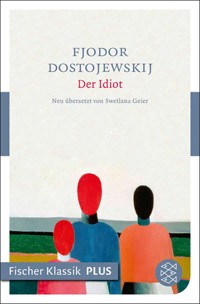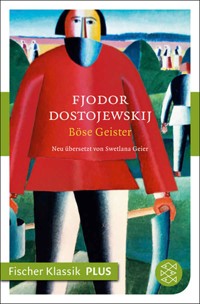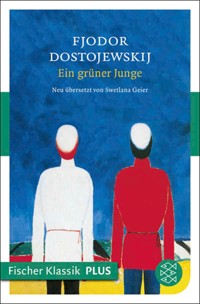
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fjodor M. Dostojewskij, Werkausgabe
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. ›Ein grüner Junge‹, der unbekannteste der späten Romane von Dostojewskij: ein Entwicklungsroman und die Geschichte von Vater und Sohn aus der Großstadt Sankt Petersburg, die ihre Bewohner zerreißt. In der Neuübersetzung von Swetlana Geier wird ›Ein grüner Junge‹ zu einer literarischen Wiederentdeckung ersten Ranges: »Seine Lektüre kann endlich zur glanzvollen Premiere werden« (Neue Zürcher Zeitung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1233
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Fjodor Dostojewskij
Ein grüner Junge
Roman
Aus dem Russischen von Swetlana Geier
FISCHER E-Books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
Erster Teil
Erstes Kapitel
I
Ich habe es doch nicht länger ausgehalten und habe mich nun hingesetzt, um diese Geschichte meiner ersten Schritte auf dem Schauplatz des Lebens niederzuschreiben, wiewohl ich das eigentlich auch lassen könnte. Eines weiß ich bestimmt: Niemals werde ich mich noch einmal hinsetzen, um meine Autobiographie zu schreiben, und sollte ich auch hundert Jahre alt werden. Man muß schon allzu erbärmlich selbstverliebt sein, um über die eigene Person schreiben zu können, ohne sich zu schämen. Ich kann mich nur damit entschuldigen, daß ich nicht deshalb schreibe, weshalb alle schreiben, das heißt, nicht, um vom Leser gelobt zu werden. Wenn ich plötzlich darauf gekommen bin, Wort für Wort alles niederzuschreiben, was mir in diesem letzten Jahr widerfuhr, so bin ich darauf gekommen aus einem inneren Bedürfnis: So tief hat mich alles Geschehene betroffen. Ich schreibe nur die Ereignisse nieder und vermeide nach Möglichkeit alles Nebensächliche und vor allem – alles literarische schmückende Beiwerk; ein Literat schreibt dreißig Jahre lang und weiß zu guter Letzt überhaupt nicht mehr, weshalb er so viele Jahre geschrieben hat. Ein Literat bin ich nicht, ich will kein Literat sein und würde es für Erbärmlichkeit und Niedertracht halten, wollte ich das Innerste meiner Seele und eine gefällige Beschreibung meiner Gefühle auf ihrem Literaturmarkt feilbieten. Verdrossen ahne ich jedoch voraus, daß sich auf eine Schilderung von Gefühlen und Reflexionen (vielleicht sogar trivialen) nicht gänzlich verzichten läßt: So verderblich wirkt sich jede literarische Betätigung auf den Menschen aus, selbst wenn sie ausschließlich zu privaten Zwecken ausgeübt wird. Die Reflexionen können allerdings sehr wohl trivial sein, weil das, was man am höchsten schätzt, für den Außenstehenden absolut wertlos sein kann. Aber dies alles sei nur am Rande bemerkt. Überdies reicht es für eine Vorrede; mehr von dieser Art wird es nicht geben. Zur Sache; wiewohl es nichts Kniffligeres gibt, als zur Sache zu kommen – vielleicht gilt das sogar für jede Sache.
II
Ich beginne, das heißt, am liebsten möchte ich meine Notizen mit dem neunzehnten September des vorigen Jahres beginnen, das heißt genau mit dem Tag meiner ersten Begegnung mit …
Aber wenn ich einfach so, ohne weiteres, erklären würde, wem ich begegnete, bevor auch nur ein einziger Mensch etwas weiß, wäre es trivial; ich glaube sogar, schon dieser Ton ist trivial: Nachdem ich mir geschworen habe, alles literarische Beiwerk zu vermeiden, verfalle ich von der ersten Zeile an diesem schmückenden Beiwerk. Außerdem scheint es mir, daß der bloße Vorsatz, vernünftig zu schreiben, nicht ausreicht. Ferner sei bemerkt, daß es sich in keiner europäischen Sprache so mühsam schreiben läßt wie in der russischen. Ich habe gerade durchgelesen, was ich vorhin geschrieben habe, und sehe, daß ich viel klüger bin als das Geschriebene. Wie kommt es nur, daß bei einem klugen Menschen das Ausgesprochene viel dümmer ist als das, was in ihm zurückbleibt? Ich habe das mehr als einmal an mir selbst und in meinem sprachlichen Umgang mit anderen Menschen während dieses ganzen letzten, verhängnisvollen Jahres beobachtet und sehr darunter gelitten.
Wiewohl ich mit dem neunzehnten September beginnen will, möchte ich dennoch ein paar Worte darüber vorausschicken, wer ich bin, wo ich bis dahin war, wie es, wenigstens andeutungsweise, in meinem Kopf an jenem Vormittag des neunzehnten September ausgesehen hat, um mich dem Leser und vielleicht auch mir selbst verständlicher zu machen.
III
Ich habe die Gymnasiumsjahre hinter mir und stehe schon in meinem einundzwanzigsten Lebensjahr. Mein Familienname ist Dolgorukij, mein gesetzlicher Vater, Makar Iwanowitsch Dolgorukij, einstiger leibeigener Bedienter der Herren Werssilow. Auf diese Weise bin ich ehelich geboren, wiewohl ich ein mit Sicherheit unehelicher Sohn bin und meine Herkunft nicht dem geringsten Zweifel unterliegt. Die Sache verhielt sich so: Vor zweiundzwanzig Jahren war der Gutsherr Werssilow, das heißt mein eigentlicher Vater, damals fünf- undzwanzig Jahre alt, auf seiner Besitzung im Gouvernement Tula aufgetaucht. Ich nehme an, daß er zu jener Zeit keine ausgeprägte Persönlichkeit war. Es ist interessant, daß dieser Mann, der auf mich seit meiner frühesten Kindheit einen derart kapitalen Eindruck gemacht hat, meine seelische Konstitution und vielleicht sogar für lange Zeit meine Zukunft infiziert hat, daß dieser Mann, selbst heute noch, in vielerlei Hinsicht für mich ein völliges Rätsel geblieben ist. Aber dies soll erst später an die Reihe kommen. Es läßt sich nicht einfach so erzählen. Von diesem Menschen wird ohnehin in meinem ganzen Heft die Rede sein.
Er war damals, das heißt in seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr, gerade verwitwet. Verheiratet war er mit einer Fanariotowa gewesen, die, wenn auch nicht besonders reich, zu den besten Kreisen gehörte und die ihm einen Sohn und eine Tochter geschenkt hatte. Meine Kenntnisse von dieser ihm allzu früh verstorbenen Gattin waren recht unvollständig und sind in meinen Papieren untergegangen; außerdem sind mir sehr viele Details aus Werssilows Privatleben einfach entgangen, so stolz, so hochmütig, so verschlossen und herablassend hat er mich immer behandelt, trotz der verblüffenden Sanftmut, mit der er in manchen Augenblicken mir gegenübertrat. Ich erwähne im voraus, zum besseren Verständnis, daß er im Laufe seines Lebens drei Familienvermögen durchgebracht hat, und zwar sogar sehr bedeutende, im ganzen über vierhunderttausend Rubel, vielleicht sogar mehr. Jetzt besitzt er natürlich nicht eine Kopeke mehr …
Auf sein Gut war er damals gekommen, »Gott mag wissen, warum«, jedenfalls hat er sich mir gegenüber später so geäußert. Seine kleinen Kinder hatte er, wie üblich, nicht mitgebracht, sie waren bei Verwandten. So pflegte er in seinem ganzen Leben mit seinen Kindern zu verfahren, den legitimen und den illegitimen. Das Gesinde auf diesem Landgut war besonders zahlreich; dazu gehörte auch der Gärtner, Makar Iwanowitsch Dolgorukij. An dieser Stelle möchte ich einfügen, damit es ein für alle Male gesagt ist: Selten dürfte jemand seinen Familiennamen so gehaßt haben wie ich den meinen, lebenslang. Natürlich war das dumm, aber es war so. Jedesmal, ob ich nun irgendwo in eine Schule eintrat oder Personen begegnete, denen ich aufgrund meiner Jugend eine Antwort schuldig war, kurz, jeder noch so kümmerliche Gymnasiallehrer, Hauslehrer, Schulinspektor, Pope – alle, jeder beliebige hielt es für unbedingt nötig, sobald er nach meinem Familiennamen gefragt und gehört hatte, daß ich ein Dolgorukij sei, aus irgendeinem Grunde hinzuzufügen:
»Fürst Dolgorukij?« und jedesmal war ich verpflichtet, diesem müßigen Frager zu erklären:
»Nein, einfach Dolgorukij.«
Dieses einfach brachte mich schließlich beinahe um den Verstand. Hier sei bemerkt, als eine Art Phänomen, daß ich mich an keine einzige Ausnahme erinnere: So haben alle gefragt. Einigen war es offensichtlich völlig egal; und ich weiß auch gar nicht, warum zum Teufel es für irgend jemand nicht hätte egal sein sollen? Aber alle haben so gefragt, einer wie der andere. Hatte nun der Frager gehört, daß ich einfach ein Dolgorukij sei, maß er mich gewöhnlich mit einem stumpfsinnigen und gleichgültigen Blick, dadurch gleichsam bestätigend, daß er selbst nicht wußte, wozu er gefragt hatte, und ließ mich stehen. Die Mitschüler fragten am kränkendsten. Wie fragt der Schüler einen Neuen? Der eingeschüchterte und verlegene Neue ist am ersten Tag in der neuen Schule (in welcher auch immer) das allgemeine Opfer: Ihm wird befohlen, er wird geneckt, er wird wie ein Lakai behandelt. Ein vor Gesundheit strotzender fetter Bengel pflanzt sich plötzlich vor seinem Opfer auf und heftet eine Weile lang einen strengen und hochmütigen Blick beobachtend darauf. Der Neue steht schweigend vor ihm da, schielt, wenn er kein Feigling ist, aus den Augenwinkeln nach ihm und wartet, was kommen wird.
»Wie heißt du?«
»Dolgorukij.«
»Fürst Dolgorukij?«
»Nein, einfach Dolgorukij.«
»Aha, einfach Dolgorukij! Schwachkopf!«
Und er hat recht: Es gibt nichts Dümmeres, als Dolgorukij zu heißen, ohne Fürst zu sein. Und diese Dummheit haftet an mir ohne eigene Schuld. Später, als ich mich bereits darüber erboste, antwortete ich auf die Frage »Bist du Fürst?« stets:
»Nein, ich bin der Sohn eines Gesindeknechts, eines ehemaligen Leibeigenen.«
Später noch, als meine Wut bereits den Siedepunkt erreicht hatte, antwortete ich einmal auf die Frage »Sind Sie Fürst?« mit fester Stimme:
»Nein, einfach Dolgorukij, unehelicher Sohn meines einstigen Gutsherrn, des Herrn Werssilow.«
Ich hatte mir das bereits in der sechsten Klasse des Gymnasiums zurechtgelegt, und obwohl ich mich sehr bald von meiner zweifellosen Dummheit überzeugt hatte, gab ich dennoch meine dumme Floskel nicht so bald auf. Ich erinnere mich, daß einer der Lehrer – übrigens blieb er der einzige – meinte, ich sei »von einer rachsüchtigen sozialen Idee erfüllt«. Im allgemeinen wurde dieser Einfall mit einer kränkenden Nachdenklichkeit quittiert. Schließlich sagte mir einer meiner Mitschüler, ein Junge mit einer sehr spitzen Zunge, mit dem ich mich höchstens einmal im Jahr unterhielt, mit ernster Miene, aber den Blick an mir vorbeigerichtet:
»Solche Gefühle machen Ihnen natürlich Ehre, und Ihr Stolz ist zweifellos nicht unbegründet; aber ich an Ihrer Stelle hätte trotzdem nicht so feierlich verkündet, daß ich ein unehelicher Sohn bin … Als hätten Sie Namenstagsfeier!«
Darauf hörte ich auf, mit meiner illegitimen Herkunft zu prahlen.
Ich wiederhole, daß es ausgesprochen schwer ist, russisch zu schreiben: Nun habe ich drei Seiten darüber vollgeschrieben, wie ich mich mein Leben lang über meinen Familiennamen ärgerte, währenddessen der Leser bestimmt den Schluß gezogen hat, ich ärgere mich gerade darüber, daß ich nicht Fürst, sondern einfach Dolgorukij bin. Eine nochmalige Erklärung und Rechtfertigung betrachte ich als erniedrigend.
IV
Also, unter dem Hofgesinde, das, wie erwähnt, sehr zahlreich war, befand sich außer Makar Iwanowitsch auch eine Magd, die bereits in ihrem achtzehnten Lebensjahr stand, als der fünfzigjährige Makar Dolgorukij plötzlich die Absicht kundtat, sie zu ehelichen. Die Ehen des Hofgesindes durften, wie bekannt, zur Zeit der Leibeigenschaft nur mit Billigung der Gutsherrschaft und mußten gelegentlich auch auf deren Befehl geschlossen werden. Auf dem Gut lebte damals nur die Tante; das heißt, sie war keineswegs meine Tante, sondern ebenfalls eine Gutsbesitzerin; aber aus irgendeinem Grunde wurde sie von allen ihr Leben lang Tante genannt, nicht nur von mir, sondern allgemein, auch seitens der Familie Werssilows, mit dem sie tatsächlich über sieben Ecken verwandt war. Das ist Tatjana Pawlowna Prutkowa. Damals besaß sie im selben Gouvernement und im selben Kreis fünfunddreißig eigene Seelen. Sie hatte als Nachbarin Werssilows Gut (mit fünfhundert Seelen) nicht eigentlich verwaltet, sondern als gute Nachbarin ein Auge darauf gehabt, und dieses Ein-Auge-darauf-Haben soll, wie ich hörte, der Aufsicht eines professionellen Verwalters in nichts nachgestanden haben. Übrigens gehen mich ihre Kenntnisse überhaupt nichts an; ich will nur, den leisesten Gedanken an Schmeichelei oder Lobhudelei von mir weisend, hinzufügen, daß diese Tatjana Pawlowna ein edel gesinntes und sogar originelles Wesen ist.
Und nun hatte Tatjana Pawlowna die Heiratsabsichten des düsteren Makar Dolgorukij (er soll damals düster gewesen sein) keineswegs abgelehnt, sondern sie, ganz im Gegenteil, im höchsten Maße gefördert. Sofja Andrejewna (diese achtzehnjährige Gesindemagd, das heißt meine Mutter) war schon seit einigen Jahren Vollwaise: Ihr seliger Vater, der für Makar Dolgorukij höchste Achtung empfunden haben muß und ihm auch zu Dank verpflichtet zu sein schien, ebenfalls Hofknecht, hatte vor sechs Jahren, wie man sich erzählte, als er auf seinem Totenbett lag, eine Viertelstunde bevor er den Geist aufgab (man hätte seine Worte auch für die Phantasien eines Sterbenden halten können, zumal ihm als Leibeigenem keinerlei Verfügungsgewalt zustand), Makar Dolgorukij zu sich gerufen und ihm vor dem versammelten Gesinde und dem Geistlichen laut und deutlich, mit Blick auf seine Tochter, gesagt: »Zieh sie groß und heirate sie.« Alle haben das gehört. Und was Makar Iwanowitsch betrifft, so weiß ich nicht, in welchem Sinne er später heiratete, ob mit Vergnügen oder nur aus Pflichterfüllung. Wahrscheinlich hat er einen völlig ungerührten Eindruck gemacht. Er war ein Mensch, der sich auch schon damals »darstellen« konnte. Nicht, daß er bibelkundig und im Lesen und Schreiben besonders bewandert gewesen wäre (obwohl er sich in der Liturgie gut auskannte, wie auch im Leben einiger Heiliger, letzteres aber mehr vom Hörensagen), nicht, daß er die Rolle eines Gesinde-Raisonneurs spielte, er war einfach ein hartnäckiger Charakter, der vor keinem Risiko zurückschreckte, er drückte sich ambitiös aus, urteilte stets unwiderruflich und führte ein, nach seinen eigenen erstaunlichen Worten, »ehrwürdiges Leben« – so war er damals. Natürlich wurde er allgemein hochgeschätzt, war aber, wie es heißt, für alle ziemlich unerträglich. Das soll sich, als er den Hof verlassen hatte, geändert haben: Von da an wurde von ihm nicht anders als von einem Heiligen und Dulder gesprochen. Darüber bin ich genauestens unterrichtet.
Über den Charakter meiner Mutter läßt sich nur sagen, daß sie bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr unter der Obhut von Tatjana Pawlowna in deren Nähe gelebt hatte (obwohl der Gutsverwalter ständig darauf drängte, sie nach Moskau in eine Lehre zu schicken) und die ihr einiges an Erziehung angedeihen ließ, das heißt, sie lehrte sie Nähen und Zuschneiden, die Manieren eines jungen Mädchens und sogar ein wenig Lesen. Ordentlich Schreiben hat meine Mutter niemals gelernt. In ihren Augen war diese Ehe mit Makar Dolgorukij eine längst beschlossene Sache, und alles, was mit ihr damals geschah, fand sie wunderbar und das Beste; vor den Traualtar trat sie mit der ruhigsten Miene, die man bei einer solchen Gelegenheit nur haben kann, so daß selbst Tatjana Pawlowna sie damals einen Fisch schalt. Dies alles über den damaligen Charakter meiner Mutter vernahm ich aus dem Munde von Tatjana Pawlowna persönlich. Werssilow besuchte das Gut genau ein halbes Jahr nach der Hochzeit.
V
Ich sage nur, daß es mir niemals gelang, definitiv zu erfahren oder auch zu erraten, womit es eigentlich zwischen ihm und meiner Mutter angefangen hat. Ich bin vollkommen bereit, ihm das zu glauben, was er mir im vergangenen Jahr persönlich gestanden hat, schamrot, obwohl er das alles im ungezwungensten und »geistreichsten« Plauderton erzählte, nämlich, daß es einen Roman überhaupt nicht gegeben habe und daß alles einfach so gekommen sei. Ich glaube ihm, daß es stimmte, und dieses kleine russische Wort »so« ist einfach reizend; dennoch hätte ich schon immer gern gewußt, wie das alles ausgerechnet zwischen ihnen geschehen konnte. Ich selbst habe alle diese Widerwärtigkeiten mein ganzes Leben lang gehaßt und hasse sie immer noch. Selbstverständlich handelt es sich in meinem Fall nicht nur um schamlose Neugier. Ich möchte bemerken, daß ich meine Mutter bis zum vergangenen Jahr kaum gekannt habe; von meiner frühesten Kindheit an bin ich unter fremden Menschen gewesen, um Werssilows Komfort willen, wovon übrigens später die Rede sein wird; deshalb kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie ihr Gesicht damals gewesen sein könnte. Wenn sie aber nicht besonders schön gewesen wäre, wie hätte damals ein solcher Mann wie der damalige Werssilow sich in sie verlieben können? Diese Frage ist für mich deshalb so bedeutend, weil dieser Mann sich darin von einer außerordentlich interessanten Seite zeigt. Deswegen frage ich, nicht aus Lüsternheit. Er selbst, dieser düstere und verschlossene Mensch, sagte mir mit jener reizenden Treuherzigkeit, die er weiß der Teufel woher nahm (wie aus der Rocktasche), sobald er merkte, daß es sich nicht vermeiden ließ – er sagte mir, daß er damals ein ziemlich »dummer junger Hund« gewesen sei, nicht einmal sentimental, nur so und unmittelbar vorher »Anton Goremyka« und »Polinka Sachs« gelesen habe, zwei literarische Werke, die einen immens zivilisierenden Einfluß auf die damals heranwachsende Generation ausgeübt haben. Er fügte jedesmal hinzu, daß es vielleicht an »Anton Goremyka« gelegen habe, daß er damals sein Landgut aufsuchte – und fügte dies sehr ernst hinzu. In welcher Form also hat dieser »dumme junge Hund« mit meiner Mutter beginnen können? Ich stelle mir heute vor, daß ein Leser, wenn ich auch nur einen einzigen haben sollte, bestimmt in lautes Lachen ausbrechen müßte, wie über den lächerlichsten grünen Jungen, der, immer noch im Besitz seiner törichten Unschuld, sich zu Überlegungen und Entscheidungen über Dinge versteigt, von denen er keine Ahnung hat. Ja, tatsächlich, ich habe keine Ahnung, obwohl ich das keineswegs aus Überheblichkeit zugebe, denn ich weiß, wie töricht ein solcher Mangel an Erfahrung bei einem zwanzigjährigen langen Lulatsch ist: Allerdings würde ich einem solchen Herrn entgegnen, daß er selbst keine Ahnung hat, und ich kann es ihm beweisen. Stimmt, von Frauen verstehe ich gar nichts, und ich will auch nichts von ihnen verstehen, weil ich mir geschworen habe, mir aus ihnen, solange ich lebe, nichts zu machen. Aber eines weiß ich gewiß, daß manche Frau durch ihre Schönheit, oder wodurch auch immer, in einem einzigen Augenblick einen Menschen berücken kann; an einer anderen dagegen muß man ein halbes Jahr lang herumkauen, um zu verstehen, was in ihr steckt; um sie zu durchschauen und sich in sie zu verlieben, genügt es nicht, sie nur anzusehen, und auch nicht die Willfährigkeit zu allem, was sie wünscht, sondern man müßte darüber hinaus noch eine besondere Gabe besitzen. Davon bin ich überzeugt, ungeachtet dessen, daß ich ahnungslos bin, und wenn dies nicht stimmte, müßte man sämtliche Frauen umgehend auf die Stufe einfacher Haustiere zurückversetzen und sie nur in dieser Form um sich dulden. Vielleicht hätten sehr viele nichts dagegen.
Ich weiß von verschiedener Seite positiv, daß meine Mutter keine Schönheit war, auch, wenn ich ihr Porträt aus jenen Jahren, das noch irgendwo existiert, noch nicht gesehen habe. Also, von Liebe auf den ersten Blick konnte nicht die Rede sein. Für die einfache »Liebelei« hätte Werssilow eine andere Wahl treffen können, und eine solche hatte sich damals geboten, sogar eine Unverheiratete, Anfissa Konstantinowna Saposchkowa, ein Stubenmädchen. Und ein Mensch, der mit »Anton Goremyka« gekommen war, wäre in einen heftigen Konflikt mit sich selbst geraten, wenn er aufgrund seiner Gutsherrenrechte gegen das Sakrament der Ehe gefrevelt hätte, auch wenn es dabei um den eigenen Gesindeknecht gegangen wäre, weil er, ich wiederhole, von diesem »Anton Goremyka« höchstens vor ein paar Monaten, also nach über zwanzig Jahren, noch mit größtem Ernst gesprochen hat. Aber diesem Anton hatte man ja nur das Pferd genommen, hier aber ging es um die Ehefrau! Es mußte also etwas Ungewöhnliches vorgelegen haben, weshalb Mademoiselle Saposchkowa das Spiel verlor (meiner Meinung nach – gewann). Ich habe im vergangenen Jahr bei günstiger Gelegenheit (weil eine Unterhaltung mit ihm nur bei günstiger Gelegenheit möglich war) ihm mit allen diesen Fragen in den Ohren gelegen und dabei gemerkt, daß er, ungeachtet seiner weltmännischen Allüren und der zwanzigjährigen Distanz, irgendwie unübersehbar das Gesicht verzog. Aber ich gab nicht nach. Jedenfalls hatte er mit der vornehmen Herablassung, die er damals mir gegenüber an den Tag legte, irgendwie eigentümlich genuschelt: Meine Mutter habe zu der Sorte der Unbehüteten gehört, in die man sich nicht eigentlich verliebt – o nein, ganz im Gegenteil –, die einen aber plötzlich irgendwie dauert, sei es um ihrer Sanftmut willen oder vielleicht aus einem anderen Grunde? – das bliebe immer für jeden ein Rätsel, aber sie dauert einen lange; und schließlich werde aus dem Bedauern eine Beziehung … »Kurz, mein Lieber, manchmal kommt es auch so, daß man sich nicht wieder entziehen kann.« Das war es, was er mir sagte; und wenn das wirklich so gewesen wäre, sähe ich mich gezwungen, ihn keinesfalls für einen solchen dummen jungen Hund zu halten, als den er sich damals selbst bezeichnete. Und das war es ja, was ich brauchte.
Übrigens begann er im selben Augenblick, mir zu versichern, daß meine Mutter ihn aus »Unterwerfung« liebgewonnen habe: Es fehlte nicht viel, und er hätte alles durch die Leibeigenschaft erklärt! Er gab es vor, um des Chics willen, er gab es vor, gegen sein eigenes Gewissen, gegen Ehre und Anstand!
Das alles hört sich natürlich so an, als wollte ich meine Mutter loben und preisen und habe doch bereits erklärt, daß ich sie, wie sie damals war, überhaupt nicht gekannt habe. Mehr noch, ich kenne gerade die Borniertheit jenes Milieus und jener kargen Anschauungen, in denen sie in ihrer Kindheit verdorren und die sie ihr Leben lang beibehalten mußte. Aber das Unheil trat dennoch ein. Übrigens muß ich mich korrigieren: In meinen Wolken schwebend, habe ich eine Tatsache außer acht gelassen, die im Gegenteil als erste hervorgehoben werden mußte, nämlich: Angefangen hat es bei ihnen direkt mit dem Unheil (ich hoffe, der Leser wird nicht so tun, als ob er nicht sofort begriffe, was ich meine). Mit einem Wort, angefangen bei ihnen hatte es gerade nach Gutsherrenart, ungeachtet dessen, daß Mademoiselle Saposchkowa verschmäht worden war. Aber da möchte ich für mich eintreten und sogleich erklären, daß ich mir keineswegs widerspreche. Denn worüber hätte in jener Zeit ein solcher Mann wie Werssilow (oh, mein Gott!) mit einer solchen Frau wie meiner Mutter reden können, selbst im Falle unbezwingbarer Neigung? Ich habe von den lasterhaftesten Menschen gehört, daß ein Mann, der mit einer Frau zusammenkommt, sehr oft in völligem Schweigen zu Werke geht, was natürlich der Gipfel des Monströsen und Ekelhaften ist; und doch hätte Werssilow bei bestem Willen, glaube ich, mit meiner Mutter nicht anders anfangen können. Sollte er denn mit einer Auslegung von »Polinka Sachs« anfangen? Und überdies ging es ihnen überhaupt nicht um russische Literatur; im Gegenteil, nach seinen eigenen Worten (an diesem Tag war er gesprächig) versteckten sie sich in dunklen Ecken, warteten im Treppenhaus aufeinander, prallten wie Gummibälle puterrot auseinander, wenn jemand vorbeikam, und der »Tyrann« von Gutsherr zitterte vor der letzten Scheuermagd, ungeachtet aller seiner Herrschaftsrechte. Wenn auch der Anfang nach Gutsherrenart verlief, so geriet doch alles ganz anders, es blieb eigentlich trotzdem völlig unerklärlich. Und in ein noch tieferes Dunkel gehüllt. Allein das Ausmaß, in dem sich ihre Liebe entwickelte, ist ein Rätsel, weil die erste Bedingung Werssilows und seinesgleichen darin bestand, sich sofort aus dem Staub zu machen, sobald das Ziel erreicht war. Aber dazu kam es nicht. Eine Affäre mit einer hübschen, willfährigen Magd (und meine Mutter war keine willfährige Magd) war für einen liederlichen »jungen Hund« (und sie waren alle liederlich, einer wie der andere, sowohl die Progressisten als auch die Regressisten) nicht nur möglich, sondern sogar unvermeidlich, insbesondere in der romantischen Stimmung eines jungen Witwers und seines Müßiggangs. Aber eine Liebe fürs ganze Leben – das war zuviel. Ich will mich nicht dafür verbürgen, daß er sie geliebt hat, aber daß er sie sein ganzes Leben lang überallhin mitgeschleppt hat – das stimmt.
Die Fragen, die ich gestellt habe, waren sehr zahlreich, aber es gibt eine Frage, die allerwichtigste, die ich, zugegeben, nicht direkt an meine Mutter zu stellen wagte, ungeachtet dessen, daß wir beide seit dem vergangenen Jahr uns so nahegekommen sind und daß ich darüber hinaus als ein grober und undankbarer junger Hund, der überzeugt war, daß man vor ihm schuldig war, mit ihr überhaupt keine Umstände machte. Folgende Frage: Wie hat sie es fertiggebracht, sie selbst, die bereits seit einem halben Jahr in einer Ehe lebte, und auch noch erdrückt von all den Begriffen von der Rechtmäßigkeit der Ehe wie eine kraftlose Motte, sie, die ihren Makar Iwanowitsch nicht weniger als eine Gottheit verehrte, wie hatte sie es fertiggebracht, in ein paar Wochen eine solche Sünde auf sich zu nehmen? Sie war doch kein loses Frauenzimmer, meine Mutter? Im Gegenteil, ich kann jetzt vorwegnehmend behaupten, daß eine reinere Seele, und zwar das ganze folgende Leben hindurch, kaum vorstellbar ist. Eine Erklärung könnte man höchstens darin finden, daß sie diesen Schritt gleichsam außer sich getan hat, allerdings nicht in dem Sinne, wie jetzt die Anwälte von ihren Mandanten, Mördern und Dieben, behaupten, sondern im Bann eines überwältigenden Eindrucks, der bei einer gewissen Naivität des Opfers sich verhängnisvoll und tragisch auswirkt. Vielleicht hatte sie sich unsterblich in den … Schnitt seiner Kleider verliebt, den Pariser Scheitel, sein Französisch, gerade das Französisch, von dem sie kein Wort verstand, in jene Romanze, die er selbst am Klavier begleitete, sie hatte sich in etwas verliebt, das sie noch nie gesehen und noch nie gehört hatte (überdies war er auch noch sehr schön), und schon liebte sie, vor Liebe vergehend, alles zusammen, ihn ganz, samt Façon und Romanzen. Ich habe gehört, daß so etwas manchmal den Mädchen aus dem Gesinde zustieß, noch zur Zeit der Leibeigenschaft, und sogar den allerehrbarsten. Ich kann das verstehen und halte jeden für einen Schurken, der so etwas allein durch die Leibeigenschaft und das »Unterwerfen« erklären will! Also mußte doch diesem jungen Mann eine so unwiderstehliche Verführungsmacht innewohnen, daß er ein bis dahin reines Wesen anzog, ein vor allem so völlig andersartiges Wesen, so ganz und gar aus einer anderen Welt und von einem anderen Planeten, um es in ein sicheres Verderben mitzureißen? Daß es ein Verderben war – das hat meine Mutter hoffentlich ihr ganzes Leben lang gewußt; höchstens damals, als sie zu ihm ging, da gab es für sie kein Verderben; aber so sind sie immer, diese »Unbehüteten«: Sie wissen um das Verderben und lassen sich doch nicht beirren.
Nachdem sie gesündigt hatten, haben sie sofort gestanden. Er erzählte mir nicht ohne Witz, wie er an Makar Iwanowitschs Schulter geschluchzt habe, den er zu diesem Anlaß in sein Kabinett bestellt hätte. Und sie – sie lag währenddessen halb ohnmächtig in ihrer Gesindekammer …
VI
Doch genug der Fragen und peinlichen Details. Werssilow kaufte meine Mutter von Makar Iwanowitsch frei, verreiste bald darauf und, wie bereits oben erwähnt, schleppte sie überallhin, mit Ausnahme jener Gelegenheiten, da er besonders lange wegblieb; dann vertraute er meine Mutter der Fürsorge der Tante an, das heißt Tatjana Pawlowna Prutkowa, die stets in solchen Fällen zur Stelle war. Er lebte mit meiner Mutter bald in Moskau, bald auf verschiedenen anderen Gütern und Städten, sogar auch im Ausland und schließlich in Petersburg. Davon später, wenn es sich denn lohnt. Hier sei nur zu bemerken, daß ich ein Jahr nach dem Abschied von Makar Iwanowitsch das Licht der Welt erblickte, ein Jahr darauf meine Schwester und dann erst – nach zehn oder elf Jahren – ein kränklicher Knabe, mein jüngster Bruder, der nach wenigen Monaten starb. Die schwere Geburt dieses Kindes kostete meine Mutter ihre Schönheit – so wurde mir jedenfalls erklärt: Sie kränkelte und alterte zusehends.
Aber die Beziehung zu Makar Iwanowitsch riß niemals ab. Wo sich die Werssilows auch aufhielten, ob sie mehrere Jahre an einem Ort blieben oder umzogen, Makar Iwanowitsch ließ in jedem Falle der »Familie« eine Nachricht zukommen. Es bildete sich ein seltsames Verhältnis heraus, das zum Teil feierlich und beinahe ernst zu nehmen war. Im gutsherrschaftlichen Alltag hätte dieses Verhältnis einen komischen Beigeschmack erhalten, das weiß ich; aber hier war das nicht der Fall. Die Briefe trafen zweimal jährlich ein, nicht öfter und nicht seltener, und waren alle außerordentlich ähnlich. Ich habe sie gesehen; sie enthielten kaum etwas Persönliches; im Gegenteil, sie beschränkten sich nach Möglichkeit auf feierliche Schilderungen allgemeinster Ereignisse und allgemeinster Gefühle, wenn man Gefühle so nennen darf: Sie begannen mit der Schilderung der eigenen Gesundheit, dann folgten Fragen nach unserem Wohlbefinden, dann gute Wünsche, feierlichste Grüße und Segenswünsche – das war alles. Aber gerade diese Allgemeinheit und das Unpersönliche bedeuteten, schien es, den höchsten Anstand und die wahre Kenntnis der Umgangsregeln in seinem Milieu. »Unserer höchst liebenswerten und ehrsamen Gattin sende ich unseren ergebensten Gruß« … »Unseren liebenswerten Kindlein sende ich den väterlichen Segen, der in alle Zeit währt«. Die »Kindlein« wurden alle namentlich aufgeführt, in der Reihenfolge ihres Erscheinens, und fingen mit mir an. Hierbei sei angemerkt, daß Makar Iwanowitsch klug genug war, niemals »Sein Hochwohlgeboren, unser ehrenwerter Herr Andrej Petrowitsch«, seinen »Wohltäter« zu nennen, wiewohl er in jedem Brief ihm unablässig seinen ergebensten Gruß sandte und ihn um seine Wohlgeneigtheit bat, für ihn selbst aber Gottes Segen herbeiflehte. Die Briefe Makar Iwanowitschs wurden von meiner Mutter postwendend beantwortet, und zwar immer auf die gleiche Art. Es war selbstverständlich, daß sich Werssilow an diesem Briefwechsel nicht beteiligte. Die Briefe Makar Iwanowitschs kamen aus den verschiedensten Gegenden Rußlands, aus Städten und aus Klöstern, in denen er sich manchmal länger aufhielt. Er war ein Strannik, das heißt ein Pilger, geworden. Er hatte nie um irgend etwas gebeten, pflegte aber alle drei Jahre einmal zu Hause zu erscheinen, das heißt bei meiner Mutter, die, wie es sich so ergab, in einer eigenen Wohnung logierte, separat von der Wohnung Werssilows. Darüber werde ich später etwas zu sagen haben. Hier will ich nur erwähnen, daß Makar Iwanowitsch es sich niemals im Salon auf dem Sofa bequem machte, sondern einen bescheidenen Platz, irgendwo in einem Kämmerchen, bezog. Er blieb nicht lange – manchmal fünf Tage, manchmal eine Woche.
Ich vergaß zu sagen, daß er seinen Familiennamen »Dolgorukij« über alles liebte und achtete. Selbstverständlich, das war lächerlich und dumm. Das Dümmste war, daß ihm sein Familiennamen gerade deshalb gefiel, weil es das Fürstenhaus Dolgorukij gab. Eine seltsame Vorstellung, richtig auf den Kopf gestellt!
Auch wenn die ganze Familie, wie ich gesagt habe, immer beisammen blieb, war ich die Ausnahme. Ich war der Ausgestoßene und wurde fast gleich nach meiner Geburt bei fremden Menschen untergebracht. Dahinter steckte aber keine besondere Absicht, es geschah irgendwie so, gleichsam von selbst. Als meine Mutter mich zur Welt brachte, war sie noch jung und schön, folglich brauchte er sie, und ein schreiender Säugling wäre häufig nur lästig gewesen, ganz besonders auf Reisen. Und so geschah es, daß ich bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr meine Mutter kaum gesehen habe, höchstens bei zwei, drei flüchtigen Gelegenheiten. Das lag nicht an den Gefühlen meiner Mutter, sondern an Werssilows Hochmut gegenüber den Menschen.
VII
Jetzt von etwas ganz anderem.
Vor einem Monat, das heißt einen Monat vor dem neunzehnten September, habe ich in Moskau beschlossen, mich von ihnen allen loszusagen und mich nun endgültig auf meine Idee zurückzuziehen. Ich halte auch an diesem Ausdruck fest: »Mich auf meine Idee zurückziehen«, weil diese Worte für meinen Hauptgedanken beinahe vollständig zutreffen – für das Eigentliche, um dessentwillen ich auf der Welt bin. Worin diese »eigene Idee« besteht, wird später noch oft zur Sprache kommen. Schon in der Zurückgezogenheit meines verträumten und langjährigen Moskauer Lebens ist sie in mir aufgekeimt, bereits in der sechsten Gymnasialklasse, und hat mich seither nicht einen einzigen Augenblick verlassen. Sie hat mein ganzes Leben absorbiert. Auch vorher hatte ich nur in meinen Träumen gelebt; ich lebte seit meiner Kindheit in einem Traumland besonderer Art; aber mit dem Auftauchen dieser beherrschenden, alles absorbierenden Idee bekamen meine Träume eine Festigkeit, sie schmolzen mit einem Schlag zu einer bestimmten Form: Die törichten verwandelten sich in vernünftige. Das Gymnasium stand den Träumen nicht im Wege; es stand auch der Idee nicht im Wege. Ich muß jedoch hinzufügen, daß ich im letzten Gymnasialjahr schlecht abgeschnitten habe, während ich bis zur siebten Klasse stets zu den Besten gehört hatte, was auf dieselbe Idee zurückzuführen ist, auf eine vielleicht falsche Schlußfolgerung, die ich aus ihr zog. Auf diese Weise verhinderte also nicht das Gymnasium die Idee, sondern die Idee verhinderte das Gymnasium. Und sie verhinderte auch die Universität. Nach dem Verlassen des Gymnasiums habe ich mir sofort vorgenommen, nicht nur mit allen radikal zu brechen, sondern, falls erforderlich, sogar mit der ganzen Welt, ungeachtet des Umstands, daß ich erst neunzehn war. Ich schrieb an den richtigen Adressaten, über die richtige vermittelnde Adresse in Petersburg, daß man mich endgültig in Ruhe zu lassen, mir nicht weiter das Geld für meinen Unterhalt zu schicken und mich endgültig zu vergessen habe (selbstverständlich nur, wenn man sich überhaupt an mich erinnerte), und schließlich, daß ich ein Universitätsstudium »um keinen Preis« zu beginnen gedenke. Ich stand vor einem unausweichlichen Dilemma: Wenn Universität und weitere Ausbildung, dann verschöbe sich die Verwirklichung der Idee um weitere vier Jahre; ohne zu zögern, entschied ich mich für die Idee, die für mich eine nahezu mathematische Überzeugungskraft besaß. Werssilow, mein Vater, den ich nur ein einziges Mal in meinem Leben, im Alter von nur zehn Jahren, einen Augenblick lang gesehen und der auf mich in diesem Augenblick einen überwältigenden Eindruck gemacht hatte, dieser Werssilow antwortete auf meinen Brief, der übrigens gar nicht an ihn gerichtet war, mit einem eigenhändigen Schreiben, in dem er mich aufforderte, nach Petersburg zu kommen, und mir eine private Anstellung versprach. Die Aufforderung dieses trockenen und stolzen, mir gegenüber hochmütigen und nachlässigen Mannes, der, nachdem er mich in die Welt gesetzt, fremden Menschen überlassen und mich überhaupt nicht gekannt hatte, sogar ohne dies je zu bereuen (und, wer weiß, ohne eine klare und genaue Vorstellung von meiner Existenz, denn es sollte sich in der Folge herausstellen, daß das Geld für meinen Unterhalt nicht er selbst, sondern andere zahlten), die Aufforderung dieses Mannes, sage ich, der sich so plötzlich an mich erinnerte und mich eines eigenhändig geschriebenen Briefes würdigte – diese Aufforderung schmeichelte mir und entschied mein Schicksal. Eigentümlicherweise gefiel mir unter anderem ganz besonders an seinem kurzen Briefchen (ein einziger Bogen kleinen Formats), daß er mit keinem Wort die Universität erwähnte oder mir zuredete, meinen Entschluß zu ändern, und mir keine Vorwürfe machte, daß ich nicht studieren wollte, kurz, auf sämtliche üblichen elterlichen Sprüche, die in ähnlichen Fällen unvermeidlich sind, verzichtete; indessen war es gerade schlimm, weil sich darin seine Fahrlässigkeit mir gegenüber um so deutlicher ausdrückte. Ich hatte mich noch aus einem weiteren Grund für Petersburg entschieden, und zwar, weil ich glaubte, daß es meinem Haupttraum nicht schaden könnte. “Mal sehen, wie es wird”, überlegte ich, “in jedem Fall werde ich eine Bindung mit ihnen nur vorübergehend eingehen, vielleicht nur auf eine ganz kurze Zeit. Aber sollte ich merken, daß dieser Schritt, und sei er noch so bedingt und klein, mich von der Hauptsache abhält, werde ich alles stehen- und liegenlassen und mich in meinen Panzer zurückziehen.” Das ist es: Panzer! “Ich ziehe mich in den Panzer zurück, wie eine Schildkröte.” Dieser Vergleich gefiel mir sehr. “Ich werde künftig nicht mehr allein sein”, sinnierte ich, während ich in meinen letzten Moskauer Tagen rastlos durch die Stadt streifte, “ich werde niemals mehr allein sein wie während der vielen schrecklichen Jahre bisher: Mit mir wird immer meine Idee sein, der ich niemals untreu werde, selbst wenn sie mir dort alle sehr gut gefallen, mir Glück bringen sollten und ich mit ihnen sogar zehn Jahre lang zusammenleben könnte!” Diese Stimmung, es sei im voraus gesagt, eben dieses Zwiespältige meiner Pläne und Ziele, das sich bereits in Moskau abgezeichnet hatte und in Petersburg keinen Augenblick von mir wich (denn ich weiß nicht, ob es je einen einzigen Tag in Petersburg gegeben hat, an dem ich mir keine endgültige Frist gesetzt hätte, um mit ihnen zu brechen und zu verschwinden) – dieses Zwiespältige, sage ich, war, wie es mir heute scheint, eine der Hauptursachen, warum ich mich in diesem Jahr so oft unbedacht, ekelhaft, sogar oft gemein und, selbstverständlich, dummdreist benommen habe.
Natürlich, plötzlich hatte ich einen Vater, den es früher niemals gab. Dieser Gedanke berauschte mich während der Reisevorbereitungen in Moskau und während der Eisenbahnfahrt. Daß er mein Vater war, das war nur halb so schlimm, auf Zärtlichkeiten legte ich keinen Wert, aber dieser Mann wollte von mir nichts wissen, er hatte mich erniedrigt, während ich im Laufe aller dieser Jahre von ihm träumte, ohne abzusetzen (wenn es erlaubt ist, diese Metapher für ein anhaltendes Träumen zu benutzen). Jeder meiner Träume seit meiner frühesten Kindheit umschwebte ihn, war ein Echo und endete zu guter Letzt bei ihm. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebte oder haßte, aber seine Person erfüllte meine ganze Zukunft und meine gesamten Lebenspläne – das geschah ganz von selbst und begleitete mein Heranwachsen.
Es gab auch noch einen weiteren Grund für meinen Aufbruch aus Moskau, eine übermächtige Versuchung, die bereits damals, das heißt drei Monate vor meinem Aufbruch (folglich zu einem Zeitpunkt, als von Petersburg noch gar keine Rede war), mein Herz höher schlagen ließ! Mich zog dieser unerforschte Ozean auch noch deshalb an, weil ich dort unmittelbar als Herr und Gebieter fremder Geschicke erscheinen konnte, und welcher Geschicke! Aber es waren großmütige und keineswegs despotische Gefühle, die in mir brodelten – das sei vorausgeschickt, damit meine Worte nicht mißverstanden werden. Überdies hätte Werssilow denken können (falls er sich überhaupt herabließ, an mich zu denken), es würde ein Knabe kommen, frisch von der Schulbank, ein grüner Junge, voll Staunen über die ganze Welt. Aber ich kannte sein tiefstes Geheimnis und hielt bereits ein Dokument von immenser Bedeutung in Händen, das ihm (jetzt weiß ich es sicher) Jahre seines Lebens wert gewesen wäre, wenn ich ihm damals Einblick gewährt hätte. Nun fällt mir übrigens auf, daß ich in Rätseln rede. Gefühle jedoch lassen sich ohne Fakten nicht beschreiben. Außerdem wird davon mehr als genug an der gehörigen Stelle die Rede sein, deshalb habe ich ja zur Feder gegriffen. Aber so zu schreiben – das ist ja wie im Delirium oder in einer Nebelwolke.
VIII
Und nun, um mit dem Neunzehnten endgültig anzufangen, will ich zunächst in wenigen Worten und gleichsam nebenbei erzählen, daß ich sie alle, das heißt Werssilow, meine Mutter und meine Schwester (letztere sah ich zum ersten Mal in meinem Leben), in einer bedrückenden Lage, beinahe völlig verarmt oder am Vorabend der völligen Verarmung antraf. Davon hatte ich bereits in Moskau gehört, aber keineswegs mit dem gerechnet, was ich nun vor Augen hatte. Seit meinen Kindertagen war ich gewohnt, diesen Mann, meinen »künftigen Vater«, fast in einer Aureole zu sehen und ihn mir nicht anders vorzustellen als stets und überall in der ersten Rolle. Werssilow pflegte niemals die Wohnung mit meiner Mutter zu teilen, sondern stets eine separate zu mieten: Natürlich tat er das nach den üblichen, so niederträchtigen »Anstandsregeln«. Aber nun wohnten sie alle zusammen, in einem Hinterhaus, einem Holzgebäude, in einer Nebengasse des Semjonowskij-Polk. Alles Hab und Gut war bereits versetzt, so daß ich meiner Mutter, heimlich vor Werssilow, sogar meine verheimlichten sechzig Rubel zugesteckt habe. Sie waren tatsächlich verheimlicht, von meinem Taschengeld, von den mir monatlich zugeschickten fünf Rubeln, im Laufe von zwei Jahren zusammengespart; mit dem Sparen begann ich seit dem ersten Tag meiner »Idee«, deshalb durfte Werssilow von diesem Geld nichts wissen. Der bloße Gedanke daran ließ mich zittern.
Diese Hilfe war nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Meine Mutter arbeitete, auch meine Schwester übernahm Näharbeiten; Werssilow lebte müßig dahin, ließ seinen Launen freien Lauf und behielt weiterhin seine vielen, ziemlich kostspieligen Gewohnheiten bei. Er nörgelte schrecklich, besonders bei Tisch, und sein ganzes Gehabe war absolut despotisch. Aber Mutter, Schwester, Tatjana Pawlowna und die gesamte Familie des seligen Andronikow (eines vor etwa drei Monaten verstorbenen höheren Beamten, der nebenher Werssilows Vermögen verwaltet hatte), die aus zahlreichen Frauen bestand, beteten ihn an wie einen Götzen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Es sei bemerkt, daß er vor neun Jahren unvergleichlich eleganter gewesen war. Ich sagte bereits, daß er in meinen Träumen in einer Aureole erschien, und nun konnte ich nicht begreifen, wie es nur möglich war, nach nur neun Jahren so alt und so verbraucht auszusehen: Es wurde mir sofort schwer ums Herz, er tat mir leid, und ich schämte mich für ihn. Sein Anblick gehörte zu den schwersten meiner Eindrücke seit meiner Ankunft. Übrigens war er noch keineswegs ein alter Mann, er war erst fünfundvierzig; bei genauerem Betrachten entdeckte ich in seiner Schönheit sogar etwas Fesselnderes, als in meinen Erinnerungen lebte. Weniger von dem früheren Glanz, weniger Äußerlichkeit, sogar weniger Eleganz, aber das Leben schien in dieses Gesicht etwas weit Interessanteres eingeprägt zu haben als früher.
Indessen war die bittere Armut nur ein zehnter oder zwanzigster Teil seines Mißgeschicks, und ich wußte das nur allzu gut. Außer der bitteren Armut war es noch etwas ungleich Ernsteres – ganz abgesehen davon, daß immer noch die Hoffnung bestand, den Erbschaftsprozeß, den Werssilow vor einem Jahr gegen die Fürsten Sokolskij angestrengt hatte, zu gewinnen und in kürzester Zeit in den Besitz eines Gutes im Wert von siebzigtausend und vielleicht noch einigen tausend Rubeln mehr zu gelangen. Ich habe oben erwähnt, daß dieser Werssilow in seinem Leben bereits drei Erbschaften durchgebracht hatte – nun sollte ihm die nächste Erbschaft wieder einmal Rettung bringen! Der Prozeß sollte in Kürze vor Gericht entschieden werden. Daraufhin wurde ich hierherbestellt. Allerdings ließ die Hoffnung sich nicht in blanker Münze auszahlen, niemand wollte sie beleihen, und so lange mußte man durchhalten.
Aber Werssilow suchte auch niemanden auf, wiewohl er manchmal tagelang unterwegs war. Es war schon über ein Jahr her, daß er aus der Gesellschaft ausgestoßen worden war. Diese Geschichte blieb für mich, ungeachtet aller meiner Bemühungen, in ihrem Kern unaufgeklärt, ungeachtet dessen, daß ich seit einem ganzen Monat in Petersburg gewohnt hatte. Ob Werssilow schuldig oder unschuldig war – das war für mich wichtig, das hatte mich dazu bewogen, nach Petersburg zu kommen! Alle hatten sich von ihm abgewandt, alle, unter anderem auch sämtliche Personen von Rang und Namen, mit denen beste Beziehungen zu unterhalten er sein ganzes Leben meisterlich verstanden hatte; dem Gerücht zufolge nach einer außerordentlich gemeinen und (in den »Augen der Welt« das Schlimmste) skandalösen Handlung, die er angeblich vor einem Jahr in Deutschland begangen habe, und sogar nach einer Ohrfeige, die er zur selben Zeit unter irgendwie auffälligen Umständen von einem der Fürsten Sokolskij erhalten und nicht mit einer Forderung beantwortet habe. Sogar seine Kinder (die legitimen), Sohn und Tochter, hatten sich von ihm abgewandt und wohnten nicht mit ihm zusammen. Freilich, sein Sohn und seine Tochter verkehrten in den höchsten Kreisen, durch die Familie Fanariotow und durch den alten Fürsten Sokolskij (Werssilows früheren Freund). Allerdings lernte ich, als ich ihn diesen vollen Monat lang beobachtete, einen hochmütigen Menschen kennen, den nicht die Gesellschaft aus ihrem Kreis ausgeschlossen, sondern der selbst die Gesellschaft aus seinem Lebenskreis verbannt hatte – so souverän war seine Haltung. Aber ob er auch das Recht darauf hatte – das war die Frage, die mich bewegte! Ich wollte die Wahrheit möglichst bald erfahren, denn ich war gekommen, um diesen Menschen zu richten. Von meiner Macht durfte er vorläufig nichts ahnen, aber ich mußte mich entscheiden und ihn entweder anerkennen oder fallenlassen, ganz und gar. Letzteres aber wäre über meine Kräfte gegangen, und ich quälte mich. Ich will es endlich gestehen: Dieser Mensch war mir teuer!
Einstweilen wohnte ich mit ihnen unter einem Dach, arbeitete und bemühte mich, nicht grob zu werden. Ich brauchte mich sogar nicht einmal zu bemühen. Nach einem Monat solchen Zusammenlebens konnte ich mich mit jedem weiteren Tag aufs neue davon überzeugen, daß ich mich wegen einer endgültigen Erklärung gar nicht an ihn zu wenden brauchte. Der stolze Mann ragte vor mir wie ein Rätsel auf, das mich zutiefst verletzte. Er war sogar nett zu mir und scherzte, aber ein Streit wäre mir lieber gewesen als solche Scherze. Alle meine Gespräche mit ihm hatten stets etwas Zweideutiges, das heißt schlicht und einfach Spöttisches von seiner Seite. Von meiner Ankunft aus Moskau an hat er mich nicht ernst genommen. Ich aber konnte es nicht begreifen, warum er das getan hat. Natürlich, er hat damit erreicht, daß er für mich undurchdringlich blieb; ich aber hatte mich nie so weit erniedrigt zu bitten, mich ernst zu nehmen. Außerdem verfügte er über erstaunliche und unwiderstehliche Kniffe, gegen die ich machtlos war. Kurz, er behandelte mich völlig wie einen grünen Jungen, was ich kaum ertragen konnte, wiewohl ich im voraus wußte, daß es so kommen würde. Die Folge war, daß auch ich nicht mehr ernsthaft redete und mich aufs Warten verlegte; ich redete fast überhaupt nicht mehr. Ich wartete auf eine Person, mit deren Eintreffen in Petersburg ich der Wahrheit auf den Grund kommen konnte; das war meine letzte Hoffnung. Jedenfalls traf ich Anstalten, unsere Beziehung endgültig abzubrechen. Meine Mutter tat mir leid, aber … »entweder er oder ich« – das war es, was ich ihr und meiner Schwester vorschlagen wollte. Auch der Termin dafür stand bereits fest; einstweilen versah ich täglich meinen Dienst.
Zweites Kapitel
I
An diesem Neunzehnten sollte ich auch mein erstes Gehalt für den ersten Monat meiner Petersburger Anstellung in einem »privaten Hause« erhalten. Wegen dieses Postens hatten sie mich nicht einmal gefragt, sondern mich einfach hingeschickt, ich glaube, gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft. Das war sehr rücksichtslos, und ich wäre beinahe verpflichtet gewesen, dagegen zu protestieren. Dieser Posten war, wie es sich zeigte, im Hause des alten Fürsten Sokolskij. Aber ein Protest gleich am Anfang wäre einem Bruch mit ihnen gleichgekommen, was mich keineswegs erschreckt, jedoch meinen wesentlichsten Zielen geschadet hätte, und deshalb trat ich diese Stelle zunächst schweigend an, durch das Schweigen meine Würde behauptend. Ich möchte gleich am Anfang erklären, daß dieser Fürst Sokolskij, enorm reich und Geheimrat, mit den Fürsten Sokolskij in Moskau (die bereits seit mehreren Generationen völlig verarmt waren), mit denen Werssilow prozessierte, nicht im entferntesten verwandt war. Sie waren lediglich Namensvettern. Dennoch brachte der alte Fürst ihnen sehr lebhaftes Interesse entgegen und sympathisierte ganz besonders mit einem jener Fürsten, sozusagen dem Haupt ihrer Familie – einem jungen Offizier. Werssilow hatte bis zuletzt einen starken Einfluß auf die Angelegenheiten dieses alten Herrn und galt als sein Freund, ein seltsamer Freund, weil dieser alte Fürst vor ihm, wie ich bemerken konnte, furchtbaren Respekt hatte, und zwar nicht erst, seit ich meine Stellung angetreten hatte, sondern, wie mir schien, schon immer, während der ganzen Zeit ihrer Freundschaft. Übrigens hatten sie sich schon lange nicht mehr gesehen. Die ehrlose Handlung, deren Werssilow beschuldigt wurde, bezog sich gerade auf die Moskauer Fürstenfamilie; aber da tauchte Tatjana Pawlowna auf, und eben durch ihre Vermittlung wurde ich bei dem alten Herrn angestellt, der einen »jungen Mann« für sein Kabinett wünschte. Dabei zeigte sich, daß ihm furchtbar viel daran lag, Werssilow eine Gefälligkeit zu erweisen, sozusagen den ersten Schritt in seine Richtung zu tun, und Werssilow gestattete es. Seine Anordnung hatte der alte Fürst während der Abwesenheit seiner Tochter, einer Generalswitwe, getroffen, die ihm diesen Schritt gewiß nicht erlaubt hätte. Davon später, ich möchte nur erwähnen, daß gerade dieses merkwürdige Verhalten gegenüber Werssilow mich stutzig machte und zugunsten des alten Herrn zu sprechen schien. Man hätte denken können, daß, wenn ein Senior der beleidigten Familie seine Achtung gegenüber Werssilow nicht verloren hätte, die kursierenden Gerüchte über Werssilows Gemeinheit absurd oder jedenfalls zweifelhaft wären. Es lag zum Teil an diesem Umstand, daß ich gegen meine Anstellung nicht protestierte: Ich habe gehofft, gerade in der neuen Position allem auf den Grund zu gehen.
Diese Tatjana Pawlowna spielte zu jener Zeit, als ich sie in Petersburg antraf, eine höchst bedeutsame Rolle. Ich hatte sie fast völlig vergessen und war verblüfft und hatte niemals damit gerechnet, daß sie einen solchen Einfluß haben könnte. Ich hatte sie früher, während meines Moskauer Lebens, drei- oder viermal gesehen, sie tauchte, Gott weiß woher, in irgendeinem Auftrag auf und war jedesmal da, wenn es galt, mich irgendwo zu etablieren – als ich in der elenden Pension von Touchard untergebracht werden sollte oder später, nach zweieinhalb Jahren, beim Eintritt ins Gymnasium und beim Einzug in die Wohnung des unvergeßlichen Nikolaj Semjonowitsch. Wenn sie auftauchte, verbrachte sie mit mir diesen ganzen Tag, prüfte meine Wäsche und meine Kleidung, kutschierte mit mir über den Kusnetzkij und durch die ganze Stadt, kaufte alles Notwendige ein, bedachte meine ganze Aussteuer, vom Koffer bis zum Federmesser; dabei mäkelte sie den ganzen Tag an mir herum, beschimpfte mich, redete mir ins Gewissen, examinierte mich, hielt mir irgendwelche phantastischen Knaben, ihre Bekannten und Verwandten, als unerreichbare Beispiele vor, die alle viel mehr taugen sollten als ich, und hat mich, Ehrenwort!, sogar geboxt, sogar mehrmals, und zwar schmerzhaft. Nachdem meine Ausstattung komplett und ich an Ort und Stelle eingerichtet war, verschwand sie spurlos für einige Jahre. Sie war es, die sogleich nach meiner Ankunft erschien und alle Anstalten traf, um mich abermals zu etablieren. Sie war ein dürres, zierliches Persönchen mit einer spitzen Vogelnase und flinken Vogeläuglein. Werssilow diente sie wie eine Sklavin und betete ihn an wie den Papst, aber aus vollster Überzeugung. Sehr bald jedoch mußte ich zu meinem Erstaunen feststellen, daß ausnahmslos alle ihr überall die höchste Achtung entgegenbrachten und sie, das war die Hauptsache, ausnahmslos und überall kannten. Der alte Fürst Sokolskij behandelte sie mit einzigartigem Respekt, seine Familie ebenfalls; diese hochmütigen Kinder Werssilows ebenfalls; die Fanariotows ebenfalls – indessen lebte sie von Handarbeiten, wusch irgendwelche Spitzen und holte sich ihre Aufträge in einem Laden. Wir beide haben uns vom ersten Wort an gestritten, weil es ihr sofort einfiel, an mir wie einst, vor sechs Jahren, herumzumäkeln; seitdem zankten wir uns jeden Tag; aber das war kein Hindernis für gelegentliche Unterhaltungen, und ich gestehe, daß sie mir gegen Ende des Monats sogar gefiel; ich denke, wegen ihres unabhängigen Charakters. Aber das habe ich sie übrigens nicht merken lassen.
Es war mir sofort klar, daß ich meine Anstellung bei diesem alten, kranken Herrn nur zu dem Zweck erhalten hatte, ihn zu »amüsieren«, und daß darin mein ganzer Dienst bestand. Natürlich fühlte ich mich dadurch erniedrigt, und ich hatte unverzüglich entsprechende Maßnahmen getroffen; aber bald erweckte dieser alte Sonderling in mir einen völlig unerwarteten Eindruck, etwas Ähnliches wie Mitleid, und am Ende des Monats hing ich irgendwie seltsamerweise an ihm und ließ meine ursprüngliche Absicht, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, einfach fallen. Er war übrigens nicht älter als sechzig. Aber da gab es eine Geschichte für sich. Vor etwa anderthalb Jahren hatte er plötzlich eine Art Attacke erlitten, gerade auf einer Reise schnappte er unterwegs über, so daß es zu einem Skandal kam, über den in Petersburg eine Weile geredet wurde. Wie in solchen Fällen üblich, wurde er schnurstracks ins Ausland gebracht, aber etwa fünf Monate später war er wieder da und erfreute sich bester Gesundheit, quittierte aber den Dienst. Werssilow behauptete mit großem Ernst (und auffällig beteiligt), daß von einer Geisteskrankheit nicht die Rede sein könne, sondern nur von einer nervlichen Indisposition. Diese Anteilnahme Werssilows habe ich sofort registriert. Übrigens möchte ich hinzufügen, daß ich beinahe seiner Meinung war. Der alte Herr erschien hin und wieder allenfalls viel zu leichtsinnig, irgendwie nicht altersgemäß, was früher, wie man sagte, niemals vorgekommen war. Man sagte auch, daß er früher als Berater irgendwo sehr geschätzt worden sei und sich einmal anläßlich eines bedeutenden Auftrags nahezu auffallend ausgezeichnet habe. Nach dem Eindruck, den ich in diesem ganzen Monat von ihm gewonnen habe, hätte ich ihm die spezielle Fähigkeit eines Beraters nicht zugetraut. Man wollte an ihm beobachtet haben (ich selbst habe es allerdings nicht beobachtet), daß er nach dieser Attacke die spezielle Neigung an den Tag gelegt habe, baldmöglichst zu heiraten, und daß er auf diese Idee schon mehrmals in diesen letzten anderthalb Jahren zu sprechen gekommen sei. Die große Welt, hieß es, sei darüber unterrichtet, und es gebe Personen, die sich für sein Vorhaben besonders interessierten. Aber da diese Absicht den Interessen gewisser Personen aus der Umgebung des Fürsten keineswegs entsprach, wurde der alte Herr von allen Seiten bewacht. Seine eigene Familie war klein; er war verwitwet, bereits seit zwanzig Jahren, und hatte nur eine einzige Tochter, jene verwitwete Generalin, die nun täglich aus Moskau erwartet wurde, eine junge Person, vor deren Charakter er zweifelsohne zitterte. Aber ihn umgaben zahllose entfernte Verwandte, vorwiegend seitens seiner verstorbenen Frau, die allesamt beinahe am Bettelstab gingen; außerdem eine Menge von Ziehsöhnen und Ziehtöchtern, die alle auf ein paar Krümel aus seinem Testament hofften und deshalb der Generalin bei der Bewachung des alten Herrn beistanden. Er hatte überdies eine Schwäche, und ich weiß nicht eigentlich, ob sie komisch war oder nicht: Bereits in jungen Jahren brachte er für sein Leben gern mittellose Jungfrauen unter die Haube. Damit beschäftigte er sich schon seit einem Vierteljahrhundert – es handelte sich dabei um entfernte Verwandte oder um Stieftöchter irgendwelcher Vettern seiner Frau oder um Patenkinder, einmal war es sogar die Tochter seines Portiers. Sie kamen als kleine Mädchen in sein Haus, bekamen Gouvernanten und lernten Französisch, besuchten anschließend eine der besten Lehranstalten und heirateten schließlich mit angemessener Aussteuer. All dies umringte ihn ständig. Die Ziehtöchter kamen natürlich in ihren Ehen mit weiteren Mädchen nieder, alle dazugeborenen Mädchen strebten nach dem Status einer Ziehtochter. Er mußte sie überall aus der Taufe heben, das ganze Völkchen gratulierte ihm zum Namenstag, und all dies tat ihm außerordentlich wohl.
Als ich meinen Dienst antrat, merkte ich sofort, daß sich in dem Kopf des alten Herrn eine bedrückende Überzeugung eingenistet hatte – dies nicht zu bemerken wäre schlicht unmöglich gewesen –, nämlich, daß die ganze Welt ihn auf einmal sonderbar ansah, daß alle sich ihm gegenüber anders verhielten als früher, das heißt vor seiner Krankheit; diese Empfindung verließ ihn nicht einmal während der fröhlichsten gesellschaftlichen Ereignisse. Der alte Herr war argwöhnisch geworden und glaubte an aller Augen etwas abzulesen. Der Gedanke, daß er immer noch für geisteskrank gehalten wurde, quälte ihn sichtlich; selbst auf mich warf er gelegentlich einen mißtrauischen Blick. Und wenn er erfahren hätte, daß irgend jemand dieses Gerücht über seinen Geisteszustand verbreitete oder gar bestätigte, so glaube ich, wäre dieser allergutmütigste Mensch sein erbittertster Feind geworden. Gerade diesen Umstand bitte ich zu beachten. Es sei hinzugefügt, daß gerade diese Beobachtung gleich am ersten Tag der Grund war, weshalb ich ihn niemals patzig behandelte und mich sogar freute, wenn es mir manchmal gelang, ihn zu erheitern oder abzulenken; ich glaube nicht, daß dieses Geständnis meiner Würde abträglich sein wird.
Der größte Teil seines Vermögens bestand aus Kapitalanlagen. Er war, schon nach seiner Krankheit, einer großen Aktiengesellschaft als Teilhaber beigetreten, übrigens einer sehr soliden; obwohl die Leitung der Geschäfte in anderen Händen lag, interessierte er sich ebenfalls sehr lebhaft dafür, besuchte die Versammlungen der Aktionäre, wurde in den Ausschuß gewählt, nahm an Beratungen teil, hielt lange Reden, widerlegte, bestritt, und das alles mit sichtlichem Vergnügen. Besonders gern trat er mit Reden auf: So konnte er jedenfalls seinen Geist öffentlich unter Beweis stellen. Und überhaupt liebte er es jetzt über alles, selbst in den intimsten privaten Situationen, ganz besonders tiefsinnige Bemerkungen oder gar ein Bonmot in die Unterhaltung einzuflechten; ich finde das nur zu erklärlich. In seinem Haus, im Parterre, wurde eine Art Kontor eingerichtet und ein Beamter angestellt, um Post, Rechnungen und Buchführung zu erledigen und gleichzeitig das Haus zu verwalten. Dieser Beamte, der außerdem hauptamtlich einen Posten in einer Behörde bekleidete, hätte für die anfallende Arbeit vollkommen genügt; aber auf Wunsch des Fürsten persönlich wurde ich ihm beigegeben, angeblich, um ihm zu helfen; aber ich wurde umgehend in das Kabinett umgesiedelt und hatte oft nicht einmal zum Schein irgendeine Arbeit vor mir liegen, weder Schriftstücke noch Bücher.
Ich schreibe das als ein Mensch, der längst ernüchtert und in mancher Beziehung fast ein Außenstehender geworden ist, aber wie kann ich meine damalige, tief im Herzen nistende Trauer (die mir im Augenblick wieder gegenwärtig ist) und vor allem meine damalige Erregung in Worte fassen, eine Erregung, die sich bis zu einem so wirren fiebrigen Zustand steigerte, daß ich sogar nachts keinen Schlaf mehr fand – vor Ungeduld, vor lauter Rätseln, die ich mir selbst gestellt hatte.
II
Geld einfordern – eine gräßliche Situation, selbst wenn es um das Gehalt geht, sobald irgendwo in den Falten des Gedächtnisses das Gefühl entsteht, es eigentlich nicht wirklich verdient zu haben. Indessen hatte meine Mutter am Vorabend flüsternd, heimlich vor Werssilow (um Andrej Petrowitsch nicht zu betrüben), meiner Schwester anvertraut, daß sie am nächsten Morgen eine Ikone versetzen wollte, die ihr aus irgend einem Grunde besonders viel bedeutete. Ich sollte fünfzig Rubel monatlich bekommen, war aber völlig ahnungslos, auf welche Weise ich sie erhalten würde; bei dem Vorstellungsgespräch war ich darüber nicht unterrichtet worden. Vor etwa drei Tagen, als ich im Parterre den Beamten antraf, hatte ich mich bei ihm erkundigt, wer hier für das Gehalt zuständig sei. Er hatte mich mit einem erstaunten Lächeln gemustert (er mochte mich nicht):
»Steht Ihnen denn ein Gehalt zu?«
Ich dachte schon, er würde nach meiner Antwort hinzufügen:
»Und wofür denn das?«
Aber er antwortete nur trocken, daß ihm »nichts davon bekannt« sei, und vertiefte sich wieder in sein liniertes Hauptbuch, in das er aus verschiedenen Zetteln Zahlen übertrug.
Es konnte ihm jedoch nicht verborgen bleiben, daß auch ich einiges leistete. Vor zwei Wochen hatte ich geschlagene vier Tage lang über einer Arbeit gesessen, die er mir selbst ausgehändigt hatte: Es galt, einen Entwurf ins reine zu schreiben, aber es lief auf eine Neufassung hinaus. Es war eine ganze Meute von »Gedanken« des Fürsten, die er dem Komitee der Aktiengesellschaft vorlegen wollte. Alles mußte zu einem Ganzen komponiert und auch der Stil überarbeitet werden. Anschließend haben der Fürst und ich einen ganzen Tag lang über diesem Schriftstück gesessen, wobei er mir sehr lebhaft widersprach, aber im Ganzen zufrieden war; ich weiß nur nicht, ob er die Schrift wirklich vorgelegt hat oder nicht. Die paar Briefe, ebenfalls Geschäftsbriefe, die ich auf seine Bitte hin geschrieben habe, will ich gar nicht erwähnen.
Es gab aber noch einen ärgerlichen Grund, der mir die Frage nach meinem Gehalt schwermachte: Ich hatte nämlich schon beschlossen, meine Stellung zu kündigen, in dem Vorgefühl, mich auch hier zurückziehen zu müssen, den zwingenden Umständen folgend. Als ich an diesem Morgen in meinem Kämmerchen aufwachte, fühlte ich plötzlich beim Ankleiden mein Herz unbändig klopfen, und auch beim Eintritt in das Haus des Fürsten überkam mich wiederum, obwohl ich mir nichts daraus machen wollte, dieselbe Erregung: An diesem Vormittag sollte hier jene Person, jene Frau eintreffen, von deren Erscheinen ich sämtliche Erklärungen für all das erwartete, was mich so quälte! Es war niemand anders als die Tochter des Fürsten, die Generalin Achmakowa, die junge Witwe, die ich bereits erwähnte und die aufs grausamste mit Werssilow verfeindet war. Endlich ist es soweit, endlich habe ich diesen Namen niedergeschrieben! Ich hatte sie selbstverständlich noch nie gesehen und war auch außerstande, mir ein Gespräch mit ihr vorzustellen, falls eines stattfinden würde; aber ich stellte mir vor (vielleicht mit einer gewissen Berechtigung), daß mit ihrem Kommen auch das Dunkel, das in meinen Augen Werssilow umhüllte, sich endgültig lichten würde. Ich konnte unmöglich gelassen bleiben: Es war furchtbar ärgerlich, daß ich mich schon beim ersten Schritt so kleinmütig und ungeschickt anstellte; es war furchtbar spannend und vor allem widerwärtig – dreierlei Empfindungen auf einmal. An diesen ganzen Tag erinnere ich mich mit allen Einzelheiten!