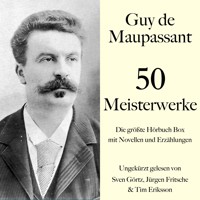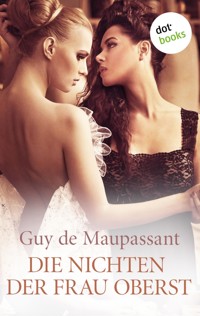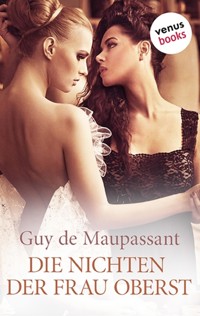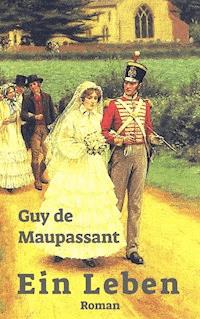
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die 17jährige Jeanne kehrt nach ihrem Schulabschluss in einem Pensionat 1819 nach Hause zurück. Sie heiratet ihren ersten Verehrer Julien de Lamare. Die Ehe ist für Jeanne, die aus dem einfachen Landadel stammt, eine ernüchternde Erfahrung. Ihr Mann betrügt sie. Erst nach der Geburt ihres Sohnes Paul findet Jeanne wieder Halt und Sinn. Als ihr Vater und ihr Mann sterben, verliert sie ihr Vermögen und lebt fortan in bescheidenen Verhältnissen. Guy de Maupassant entwirft in »Ein Leben« das Portrait einer ungewöhnlichen Frau, die ihr Schicksal ohne Sentimentalität und Selbstmitleid trägt. Der Autor hält sich stets im Hintergrund und verzichtet auf jede Kommentierung oder Psychologisierung. Guy de Maupassant lässt die Ereignisse in »Ein Leben« für sich sprechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Leben
Titelseite1234567891011121314ImpressumGuy de Maupassant
Ein Leben
Roman
1
Johanna hatte die Koffer gepackt und trat ans Fenster, aber der Regen hörte noch immer nicht auf, die ganze Nacht hindurch hatte er gegen die Scheiben und auf die Dächer geprasselt. Der Himmel, an dem die regenschwangeren Wolken tief hingen, schien zu bersten und sich auf die Erde zu ergießen, die er zu Schmutz zerrührte und zerschmolz wie Zucker. Ab und zu kam ein Windstoß daher und trug eine drückende Hitze mit sich. Das Brausen der überströmenden Gossen erfüllte die verödeten Straßen, in denen die Häuser gleich Schwämmen die eindringende Feuchtigkeit einsogen, sodaß die Mauern schwitzten vom Keller bis zum Boden hinauf.
Johanna war am Tage vorher aus dem Kloster gekommen, nun war sie endlich auf immer frei, sie konnte alles Glück des Lebens sich erobern, von dem sie solange schon geträumt.
Aber wenn es nicht besseres Wetter würde, fürchtete sie, würde der Vater noch nicht abreisen, und nun sah sie schon zum zehnten Male nach dem Himmel.
Dann fiel ihr ein, daß sie vergessen ihren Kalender in die Reisetasche zu stecken. Sie nahm von der Wand das Papptäfelchen, auf dem die einzelnen Monate eingeteilt waren und das inmitten einer Zeichnung in Golddruck, die Jahreszahl des laufenden Jahres 1819 trug. Dann strich sie mit dem Bleistift die ersten vier Kolonnen aus, indem sie die Namen der Heiligen bis zum zweiten Mai, dem Tage, da sie das Kloster verlassen, auslöschte.
Hinter der Thür rief eine Stimme:
– Hannchen!
Johanna antwortete:
– Komm doch Papa! – Und ihr Vater trat ein.
Baron Simon Jacob Le Perthuis des Vauds war ein Edelmann aus dem vorigen Jahrhundert, toll und gut. Als begeisterter Schüler Rousseaus liebte er zärtlich die Natur Felder, Wälder, und Tiere.
Als geborener Aristokrat haßte er instinktiv das Jahr 1793, aber von Natur Philosoph und liberal erzogen, haßte er ebenso jede Tyrannei mit einem nicht verletzenden, aber wortreichen Haß.
Seine große Kraft und seine Schwäche zugleich war die Güte, eine Güte, die nicht Hände genug hatte zu lieben, zu schenken, zu umarmen, eine Güte des Schöpfers, grenzenlos, widerstandlos, wie eine Lähmung des Willens, eine Durchlöcherung der Thatkraft, beinahe eine lasterhafte Güte.
Theoretisch hatte er einen ganzen Erziehungsplan für seine Tochter entworfen, er wollte sie glücklich, gut, aufrichtig und weich machen.
Bis zum zwölften Jahr war sie zu Hause geblieben, dann wurde sie trotz der Thränen der Mutter in das Sacré-Coeur gesteckt. Dort hatte er sie streng eingeschlossen, eingemauert, daß niemand von ihr wußte und auch sie die Dinge der Welt nicht kannte. Im Alter von siebzehn Jahren sollte sie ihm unschuldig wieder gegeben werden, und er wollte ihr dann selbst eine vernünftige, poetische Welt-Anschauung beibringen.
Auf dem Land, inmitten der fruchtbaren Erde, wollte er ihr die Seele öffnen und ihre Unwissenheit beim Anblick der naiven Liebe, der einfachen Zärtlichkeiten der Tiere, der reinen Gesetze der Natur belehren.
Nun kam sie glücklich, voll schlummernder Träume aus dem Kloster, sie wollte das Glück erjagen, alle Freuden genießen, und alle reizenden Zufälle, die im Nichtsthun der Tage, in langen Nächten, in einsamem Nachdenken und Hoffen ihr Geist sich ausgemalt.
Sie sah aus wie ein Bild von Veronese mit ihrem leuchtendem Blondhaar, das den Eindruck machte, als hätte es abgefärbt auf der Haut, einer nur leicht rosig angehauchten aristokratischen Haut, bedeckt mit seinem Flaum, wie matter Sammet, dessen man nur gewahr wurde, wenn die Sonne sie liebkoste. Ihre Augen waren blau, von jenem dunklen Blau, wie Delfter Malerei.
Auf dem linken Nasenflügel hatte sie einen kleinen Schönheitsfleck, einen andern rechts auf dem Kinn, wo ein paar Härchen wuchsen, aber von der Farbe der Haut, so daß sie sich kaum abhoben. Sie war groß, voll, von biegsamer Figur, ihre klare Stimme hatte manchmal etwas Scharfes, aber ihr helles Lachen verbreitete Freude um sie. Oft hob sie die beiden Hände mit ihr eigentümlicher Bewegung an die Schläfe, als wollte sie ihr Haar glatt streichen.
Sie lief ihrem Vater entgegen, küßte und umarmte ihn und fragte:
– Nun, geht es fort?
Er lächelte, schüttelte sein schönes, weißes Haar, das er ziemlich lang trug, und deutete zum Fenster:
– Wie willst Du bei dem Wetter reisen?
Aber sie bat schmeichelnd und zart:
– Ach Papa, wir wollen doch fort, ich bitte Dich, heute nachmittag wird es ja schön!
– Aber das wird die Mama nicht wollen!
– O ja, ich verspreche es Dir, ich will es ihr schon sagen!
– Ja, wenn Du die Mama herumkriegst, mir soll es recht sein.
Und sie lief zum Zimmer der Baronin, denn sie hatte auf diesen Tag der Abreise mit wachsender Ungeduld gewartet.
Seit sie in das Sacré-Coeur gekommen, hatte sie Rouen nicht verlassen, denn ihr Vater erlaubte keine Zerstreuungen vor dem Alter, das er bezeichnet. Nur zweimal war sie vierzehn Tage in Paris gewesen, aber das war ja eine Stadt, und sie sehnte sich nach dem Lande.
Sie sollte jetzt auf ihrer Besitzung Les Peuples den Sommer zubringen, einem altem Familiensitz, einem Schloß, das an der Küste bei Yport gelegen war, und sie versprach sich unendliche Freude von diesem ungebundenen Dasein am Ufer des Meeres. Und dann war es abgemachte Sache, daß sie einmal den alten Besitz als Mitgift bekommen und dort wohnen sollte, wenn sie erst verheiratet wäre.
Und dieser Regen, der ohne Unterlaß von früh bis abends fiel, war der erste große Schmerz ihres Lebens.
Aber nach zwei Minuten kam sie aus dem Zimmer der Mutter gelaufen und rief durch das ganze Haus:
– Papa, Papa! Mama ist einverstanden! Laß anspannen!
Die Sintflut hörte nicht auf, sie schien sogar noch stärker zu werden, als der Wagen vorfuhr.
Johanna war bereit, in den Wagen zu steigen, als die Baronin die Treppe herunter kam, auf der einen Seite von ihrem Gatten gestützt, auf der andern von einem großen, schlanken, kräftigen Stubenmädchen gehalten, einer Normannin aus der Gegend von Caux, die aussah wie wenigstens zwanzig Jahre alt, obgleich sie höchstens achtzehn zählte. In der Familie ward sie beinahe wie ein zweites Kind angesehen, da sie Johannas Milchschwester gewesen. Sie hieß Rosalie.
Übrigens bestand ihre hauptsächliche Thätigkeit darin, ihre Herrin zu begleiten, die seit ein paar Jahren durch eine Herzerweiterung, über die sie sich unausgesetzt beklagte, ungeheuer dick geworden war.
Die Baronin erreichte, schwer pustend, die Rampe des alten Hauses, blickte in den Hof, wo das Wasser nur so herunter lief und sagte:
– Es ist eigentlich unvernünftig!
Ihr Mann antwortete, immer lächelnd:
– Frau Adelaide, Du hast es so gewünscht!
Da sie den großartigen Namen Adelaide trug, stellte er ihm immer das ›Frau‹ voran, mit einem etwas ironisch gemeinten Respekt.
Nun ging sie weiter und stieg mit großer Mühe in den Wagen, dessen Federn sich bogen. Der Baron setzte sich an ihre Seite, Johanna und Rosalie nahmen auf dem kleinen Rücksitz Platz.
Die Köchin Ludwine brachte eine Menge Mäntel, über die Kniee zu decken, und zwei Körbe, die man unter den Sitzen versteckte; darauf kletterte sie auf den Bock neben den alten Simon, nahm sich eine Decke und wickelte sich von Kopf bis zu Fuß hinein.
Der Portier und seine Frau kamen ›adieu‹ zu sagen und schlossen die Wagenthür, man empfahl ihm noch einmal die Sorge für die Koffer, die auf einem Wägelchen folgen sollten. Dann ging es fort.
Der alte Kutscher Simon verschwand ganz, den Kopf eingezogen und indem er bei dem Unwetter einen krummen Buckel machte, unter dem dreifachen Kutscherkragen. Der Sturmregen schlug prasselnd an die Fenster und überschwemmte die Wege.
Der Wagen rollte in raschem Trabe den Quai hinab, an der Reihe der großen Schiffe vorüber, mit ihren Masten, Raaen und Takelagen, die traurig in den regnerischen Himmel starrten, wie entblätterte Bäume. Dann ging es den langen Boulevard du Mont-Riboudet hinunter.
Bald kamen sie auf die Wiesen, und hier und da zeichnete sich unbestimmt in dem wässerigen Nebel eine überschwemmte Weide ab, deren Zweige herabhingen wie tot. Die Eisen der Pferde klapperten, und die vier Räder sahen aus wie schmutzige rotierende Sonnen.
Man schwieg, sogar das Gehirn schien ertränkt wie die Erde.
Mutting lehnte sich zurück, lehnte den Kopf an und schloß die Lider. Der Baron betrachtete mit starren Augen die monotonen nassen Felder. Rosalie, die ein Paket auf den Knieen hielt, träumte in jener tierischen Döserei der gewöhnlichen Leute, aber Johanna fühlte sich unter diesem lauen Regen erwachen, wie eine lange eingeschlossene Pflanze, die man ans Licht bringt; und ihre unbändige Freude schützte wie das Blätterwerk ihr Herz vor Traurigkeit. Obgleich sie nicht sprach, hatte sie Lust zu singen und die Hände hinaus zu halten, um den Regen darin aufzufangen und zu trinken. Es machte ihr Spaß, so schnell im Wagen dahin zu fahren und draußen die traurige Landschaft zu erblicken, während sie sich doch selbst, mitten in dieser Überschwemmung sicher und trocken unter Dach und Fach fühlte. Und unter dem unausgesetzten Regen dampften die leuchtenden Kruppen der beiden Pferde.
Die Baronin schlief allmählich ein, ihr Gesicht, das von sechs regelmäßig gedrehten Löckchen umrahmt war, die immerfort hin und her baumelten, sank allmählich zusammen, von den drei großen Fettwülsten des Halses gehalten, dessen letzte Woge sich allmählich in der offenen See ihres Busens verlor. Ihr Kopf hob und senkte sich bei jedem Atemzug, ihre Wangen bliesen sich auf, während durch die halb geöffneten Lippen lautes Schnarchen klang. Ihr Mann beugte sich zu ihr und legte ganz leise in ihre über der mächtigen Wölbung ihres Leibes gefalteten Hände eine kleine Ledertasche.
Bei der Berührung wachte sie auf und betrachtete den Gegenstand mit verschwommenen Blicken und jenem törichten Ausdruck, den man nach dem Erwachen aus tiefem Schlaf zu haben pflegt. Das Täschchen fiel und ging auf, Gold und Banknoten verstreuten sich im Wagen. Sie ward ganz munter, und nun machte die Heiterkeit ihrer Tochter sich in lautem Lachen Luft.
Der Baron las das Gold zusammen und legte es in ihren Schoß:
– Liebe Freundin, das ist alles, was von meinem Meierhof Eletot übrig geblieben ist. Ich habe ihn verkauft um Les Peuples, wo wir von jetzt ab öfters wohnen werden, in Stand setzen zu lassen.
Sie zählte sechstausendvierhundert Franken und steckte sie ruhig in die Tasche.
Das war der neunte Meierhof von einunddreißig, die ihm die Eltern vererbt hatten, den sie so verkauften, aber sie besaßen noch etwa zwanzigtausend Franken Rente aus Grundbesitz, der, bei guter Verwaltung, leicht dreißigtausend hätte einbringen müssen.
Da sie einfache Lebensgewohnheiten hatten, hätte dieses Einkommen vollkommen ausgereicht, wenn in diesem Hause nicht ein unergründlicher Brunnen immer offen gestanden hätte: die Güte. Die ließ das Geld in ihren Händen schmelzen, wie die Sonne das Wasser der Sümpfe aufsaugt. Es lief durch die Finger, es entfloh, es verschwand. Wie? – wußte kein Mensch. Alle Augenblicke sagte eines von ihnen:
– Ich weiß nicht wie es kommt, ich habe heute hundert Franken ausgegeben und eigentlich nichts Besonderes dafür gehabt!
Übrigens war diese Freigebigkeit das große Glück in ihrem Leben, und in diesem Punkt verstand sich das Paar wirklich rührend.
Johanna fragte:
– Ist mein Schloß jetzt schön?
Die Baronin antwortete fröhlich:
– Das wirst Du sehen, Kleine!
Allmählich nahm die Kraft des Regens ab und endlich war er nur noch eine Art nassen Nebels, ein seiner in der Luft schwebender Regenstaub. Die Regenwolke schien zu steigen und Heller zu werden, und plötzlich brach durch ein unsichtbares Loch im Gewölk ein Sonnenstrahl auf die Wiesen herab.
Die Wolken teilten sich und das Blau des Himmels erschien, dann ward der Spalt breiter, wie wenn ein Schleier zerreißt, und allmählich wölbte sich ein schöner, reiner, tiefblauer Himmel über der Erde.
Ein süßer, frischer Hauch strich dahin wie ein glückliches Aufatmen der Welt, und wenn sie an Gärten oder Wäldern vorüber kamen, hörten sie ab und zu das fröhliche Zwitschern eines Vogels, der sein Gefieder trocknete.
Der Abend kam, außer Johanna schliefen jetzt alle im Wagen. Zweimal blieben sie an Wirtshäusern halten, um die Pferde ausruhen und ihnen Hafer und Wasser geben zu lassen.
Die Sonne war untergegangen. Aus der Ferne klang Glockengeläut. In einem kleinen Dorf wurden die Laternen angesteckt, und auch der Himmel erhellte sich und strahlte in einem Meer glitzernder Sterne. Hier und da erschienen erleuchtete Häuser, die einen feurigen Schein durch das Dunkel sandten, und plötzlich stieg hinter einer Anhöhe zwischen den Zweigen der Tannen der Mond auf, rot, riesig und wie verschlafen.
Die Luft war so mild, daß die Fenster offen blieben. Johanna ganz matt vom Träumen und befriedigt von den glücklichen Zukunftsbildern, ruhte jetzt auch. Ab und zu schlug sie, wenn sie zu lange in ein und derselben Stellung geblieben war, die Augen auf, dann blickte sie hinaus und sah in der hellen Nacht Bäume, einen Meierhof oder ein Paar Kühe, die hier und da auf dem Felde lagen und nur die Köpfe hoben, den Wagen vorüber gleiten zu sehen. Dann nahm sie eine neue Stellung ein und versuchte ihren flüchtigen Traum weiter zu träumen, aber das fortwährende Rasseln des Wagens klang ihr in den Ohren, schläferte ihre Gedanken ein, und sie schloß wieder die Augen, denn sie fühlte den Geist müde, wie den Körper.
Dann hielten sie. Männer und Frauen standen, Laternen in der Hand, am Wagenschlage. Sie waren angekommen. Johanna war sofort wach und sprang heraus. Während einer der Landleute leuchtete, trugen der Vater und Rosalie beinahe die völlig erschöpfte Baronin, die unausgesetzt wimmerte und fortwährend mit sterbender Stimme rief:
– Ach mein Gott! Meine Kinder! Meine Kinder!
Sie wollte nichts essen, nicht trinken, legte sich zu Bett und schlief sofort ein.
Johanna und der Baron aßen zusammen zu Abend. Sie lächelten, wenn sie sich anblickten, reichten sich über den Tisch die Hände und fingen beide, von kindischer Freude gepackt, an, das alte, renovierte Herrenhaus anzusehen. Es war eines jener großen, weiten, normannischen Wohnhäuser, halb Pachthof, halb Schloß, aus weißen, mit der Zeit grau gewordenen Steinen gebaut und geräumig, um einen ganzen Volksstamm aufzunehmen.
Ein riesiger Flur teilte das Haus in zwei Teile und durchschnitt es von einem Ende zum anderen. Rechts und links führten große Thüren zu ihm. Eine doppelte Treppe schien über dem Eingang breitbeinig zu stehen, sodaß die Mitte frei blieb und die beiden Aufgänge sich im ersten Stock zu einer Brücke vereinigten.
Im Erdgeschoß trat man rechts in einen Riesenraum bespannt mit Stickereien, auf denen Bäume zu sehen waren und Vögel. Das ganze Mobiliar war gepolstert mit Canevas- Stickerei, lauter Illustrationen zu den Fabeln von Lafontaine.
Johanna war glückselig, als sie einen Stuhl wiederfand, den sie als ganz kleines Kind so gern gehabt, auf dem die Fabel vom Fuchs und vom Storch zu sehen war.
Neben dem Salon that sich die Bibliothek auf, wo lauter alte Bücher standen, und noch zwei andere nicht benutzte Räume. Links lag das Eßzimmer, frisch getäfelt; die Wäschekammer, der Anrichteraum, die Küche und eine kleine Stube mit einer Badewanne.
Ein Gang lief durch die ganze Mitte des ersten Stockes, zehn Thüren von zehn Zimmern mündeten auf ihn. Ganz hinten befand sich rechts Johannas Zimmer. Sie traten ein. Der Baron hatte es völlig neu herrichten lassen, indem er dazu einfach Möbel genommen hatte, die unbenutzt auf dem Boden gestanden.
Tapeten flämischen Ursprungs und sehr alt, bevölkerten das Zimmer mit seltsamen Figuren.
Aber als das junge Mädchen sein Bett sah, stieß es einen Freudenschrei aus. An den vier Ecken trugen vier große eichengeschnitzte, ganz schwarze und glänzend gefirnißte Vögel die Bettstelle, wie Beschützer; an den Seiten waren breite Blumen- und Fruchtguirlanden geschnitzt, und vier fein-kannelierte Säulen, die in korintischen Kapitalen endeten, hielten ein Gewinde von Rosen und damit umkränzte Amoretten.
Trotz der ernsten Farbe des durch die Zeit gebräunten Holzes sah das Bett sehr graziös aus und zugleich monumental. Bettdecke und Himmel des Bettes glitzerten, wie das Firmament von Sternen. Sie waren aus alter, himmelblauer Seide, mit großen, goldgestickten Blumen gefertigt.
Als Johanna es genug bestaunt hatte, hob sie ihr Licht und betrachtete die Tapeten, um zu sehen, was sie darstellten.
Ein junger Herr und eine junge Dame, seltsam in grün und rot und gelb unterhielten sich unter einem blauem Baume, auf dem weiße Früchte reiften. Ein dickes Kaninchen von derselben Farbe fraß etwas graues Gras.
Gerade über den Personen erblickte man auf einem konventionellen Hintergrunde fünf kleine, runde Häuser mit spitzen Dächern und ganz oben, beinahe im Himmel eine feuerrote Windmühle. Große Zweige, die Blumen darstellen sollten, wuchsen überall.
Die beiden andern Bilder an der Wand ähnelten sehr den ersten, nur daß man aus den Häusern vier kleine Männchen kommen sah, flämisch gekleidet, die die Arme zum Himmel emporstreckten als Zeichen höchsten Erstaunens und größter Wut. Das letzte Bild aber stellte ein Drama dar. Neben dem Kaninchen, das noch immer fraß, lag der junge Mann, wie es schien, tot ausgestreckt. Die junge Dame durchbohrte, den Blick auf ihn gerichtet, ihren Busen mit einem Schwert. Die Früchte an den Bäumen waren schwarz geworden. Johanna wollte es schon aufgeben, die Bedeutung zu kapieren, als sie in einer Ecke ein winziges Tierchen entdeckte, das das Kaninchen, wenn es gelebt hätte, hätte auffressen können, wie einen Grashalm; und doch war es ein Löwe.
Da erkannte sie die unglückliche Geschichte von Pyramus und Thisbe, und obgleich sie über die Einfalt der Zeichnung lächeln mußte, fühlte sie sich doch glücklich, hier von dieser berühmten Liebesgeschichte nun immer umgeben zu sein, die ihr immerfort von süßen Hoffnungen reden und jede Nacht die alte, sagenhafte Zärtlichkeit über ihren Schlaf breiten würde.
Die übrigen Mübel zeigten die verschiedensten Stile. Es waren jene Möbel, von denen jede Generation etwas in der Familie zurückläßt, und die so aus alten Häusern eine Art Museum machen, in dem alles mögliche vorkommt. Eine wundervolle Kommode im Stil Louis XIV., mit glänzenden Kupferbeschlägen, stand zwischen zwei Fauteuils im Stil Louis XV., noch mit kunstvoll gesticktem Seidenstoffe überzogen. Ein Schreibtisch aus Rosenholz befand sich dem Kamin gegenüber, auf dem unter einer runden Glasglocke eine Empire- Uhr stand.
Sie stellte einen Bienenkorb aus Bronze dar, von vier Marmorsäulen getragen, über einem Beet von vergoldeten Blumen; aus dem Bienenkorb ragte ein schmales Pendel durch einen länglichen Spalt und schwang über den Blumen immerfort eine kleine Biene mit Emailleflügeln hin und her.
Das Zifferblatt aus gemalter Fayence war an der Seite des Bienenkorbes eingelassen.
Die Uhr schlug gerade elf. Der Baron umarmte seine Tochter und zog sich zurück.
Johanna konnte sich nur schwer zum Schlafen entschließen, einen letzten Blick warf sie noch auf ihr Zimmer, dann löschte sie das Licht. Aber neben dem Bett, dessen Kopfseite an der Wand stand, befand sich zur linken ein Fenster, durch das der Mond fiel, einen hellen Fleck auf den Fußboden zeichnend.
Der Widerschein traf die Wand, ein bleicher Schein, der ein schwaches Licht auf die unbewegliche Liebesscene zwischen Pyramus und Thisbe warf.
Durch das andere Fenster, ihr zu Füßen, bemerkte Johanna einen großen Baum, ganz in mildes Licht getaucht. Sie wandte sich zur Seite, schloß die Augen, aber nach einiger Zeit öffnete sie sie wieder.
Sie meinte noch immer im Wagen, dessen Rütteln und Rollen sie noch hörte, hin und her gestoßen zu werden.
Zuerst blieb sie unbeweglich liegen in der Hoffnung, so endlich einschlafen zu können, aber bald teilte sich die Unruhe ihres Geistes auch ihrem Körper mit.
Es prickelte ihr in den Beinen, und sie wurde immer erregter. Da stand sie auf und schritt barfuß, mit nackten Armen, in ihrem langen Nachthemds das ihr das Aussehen eines Gespenstes gab, auf dem Lichtschein am Boden hin und her, öffnete das Fenster und blickte hinaus.
Die Nacht war so klar, daß man sehen konnte wie am hellen Tag, und das junge Mädchen erkannte die Gegend wieder, die sie als Kind so gern gehabt.
Vor ihr lag ein großer Rasenplatz, jetzt gelb wie Butter im nächtlichen Licht. Zwei Riesenbäume reckten sich vor dem Schlosse in die Höhe, eine Platane auf der Nord-, eine Linde auf der Südseite.
Am Ende der breiten Rasenfläche schloß ein kleines Gehölz diesen Raum ab, vor dem Sturm durch fünf Reihen alter Ulmen geschützt, die krumm gebogen, abrasiert, zerzaust und schief geweht waren wie ein Dach, durch die immer vom Meere her wehenden Stürme.
Dieses Stück Park war rechts und links durch zwei lange Alleen riesiger Pappeln begrenzt, die das Herrenhaus von Den daran stoßenden beiden Meierhöfen trennten, der eine von der Familie Couillard, der andere von der Familie Martin bewohnt.
Die Pappeln hatten dem Schloß den Namen gegeben. Jenseits dieses umfriedeten Raumes dehnte sich eine weite, unbebaute Fläche aus, auf der Stechginster wuchs und der Wind pfiff und brauste Tag und Nacht. Dann plötzlich fiel die Küste in einem hundert Meter breiten Weißen Klippenstreifen ab, der seinen Fuß in den Fluten badete.
Johanna erblickte in der Ferne die weite, gekräuselte Wasserfläche, die im Sternenschein zu schlafen schien.
Jetzt in der Stille, nachdem längst die Sonne untergegangen, zogen alle Düfte der Erde daher. Ein Jasminstrauch, der um die Fenster gezogen war, strömte von unten unausgesetzt seinen durchdringenden Atem aus, der sich mit dem schwächern Duft der Knospen und Blüten mischte. Ein langer Windstoß trug den kräftigen Geruch der Seeluft und die klebrige Ausdünstung des Seetangs herbei.
Zuerst überließ sich das junge Mädchen der Wonne, nur zu atmen; die Ruhe des Landes that ihr wohl wie ein erfrischendes Bad.
Alle Tiere, die erwachen, wenn es Abend wird und ihr dunkles Dasein in der Stille der Nacht verbergen, erfüllten die halbe Dunkelheit mit schweigender Bewegung. Große Vögel flogen ohne Schrei schattenhaft durch die Luft, das Summen unsichtbarer Insekten traf das Ohr, im betauten Gras oder auf dem Sande der verlassenen Wege kroch es stumm dahin.
Nur ein Paar melancholische Kröten sandten ihren kurzen Schrei zum Mond empor.
Johanna war es, als weitete sich ihr Herz, und fülle sich mit murmelnden Geräuschen wie diese klare Nacht, und plötzlich mit tausend Wünschen, die wie all dieses nächtliche Getier in ihr erwachten und umherirrten und tasteten. Sie fühlte sich dieser lebenden Poesie verwandt, und in der milden Helle der Nacht liefen übermenschliche Schauer über ihren Leib, zitterte sie unter unbestimmten Hoffnungen, traf sie etwas wie ein Hauch des Glücks.
Und sie träumte von der Liebe.
Die Liebe! Seit zwei Jahren erfüllte sie sie mit wachsender Angst vor ihrem Nahen. Jetzt durfte sie lieben, sie brauchte ihm nur zu begegnen, aber wie würde er sein?
Sie wußte es nicht, und sie fragte nicht darnach. Er war es und mehr wollte sie nicht.
Sie wußte nur, daß sie ihn lieben würde aus tiefster Seele, und er sie lieben würde mit aller Kraft. An solchem Abend wie heute würden sie unter der leuchtenden Asche dahin schreiten, die von den Sternen niederstäubte, Hand in Hand, einer gegen den andern gepreßt, daß sie den Schlag ihres Herzens, daß sie die Warme ihrer Körper fühlten, indem sich ihre Liebe vermischte mit der süßen Klarheit der Sommernacht, so beide eins, daß sie allein durch die Macht ihrer Neigung die geheimsten Gedanken des andern errieten.
Und das würde immer so weiter gehen in unendlicher nie sich lösender Liebe.
Und plötzlich war es ihr, als fühlte sie ihn an ihrer Seite, und ein jäher Hauch der Sinnlichkeit lief ihr von Kopf zu Fuß. Mit unwillkürlicher Bewegung preßte sie die Arme gegen die Brust, als wollte sie ihren Traum umarmen, und ihre Lippen, die sie dem Unbekannten entgegenstreckte, streifte etwas, daß sie beinahe die Sinne verlor, als ob der Hauch des Frühlings sie mit dem Kuß der Liebe berührt.
Plötzlich hörte sie, ganz weit, hinter dem Schlosse, auf der Straße, Schritte, und sie dachte in jähem Aufschwung ihrer verzückten Seele, in fanatischem Glauben an das Unmögliche, an Wunder der Vorsehung, an göttliche Ahnung, an romantische Schicksalsfügungen: »Wenn er es wäre!«
Ängstlich lauschte sie auf den gleichmäßigen Schritt des Fußgängers, und sie wußte, daß er am Gitter stehen bleiben und Einlaß begehren würde.
Als er vorüber war, fühlte sie sich traurig wie nach einer Enttäuschung, aber sie sah die Überspanntheit ihrer Erwartung ein und lächelte über den Unsinn. Dann ward sie etwas ruhiger und dachte in vernünftiger Weise über ihre Zukunft nach, wie sich ihr Schicksal wohl gestalten würde.
Sie würde mit ihm hier leben, in diesem stillen Schloß, am Meer.
Zwei Kinder würden sie haben, einen Sohn für ihn, ein Mädchen für sie selbst, und sie sah sie schon vor sich im Grase herumlaufen, zwischen der Platane und der Linde, während Vater und Mutter ihnen mit entzückten Augen folgten, indem sie über ihre Köpfe hinweg Blicke der Leidenschafb wechselten.
Und lange, lange blieb sie so am Fenster träumend stehen, während der Mond, indem er seine Reise durch die Himmelsweiten vollendete, ins Meer versank.
Die Luft wurde frischer, gen Osten erbleichte der Himmel. Im Meierhof rechts krähte ein Hahn, andere antworteten im Hofe links. Ihre heiseren Stimmen schienen von weit her zu kommen aus dem Verschlag des Hühnerhofes, und an der unendlichen Himmelswölbung, die unmerklich heller ward, erbleichten die Sterne.
Ein leiser Vogelruf klang von irgend woher, leise antwortete es aus dem Blättermeer, dann wurden die Stimmen kräftiger, fröhlicher und schallten von Ast zu Ast, von Baum zu Baum.
Johanna sah sich plötzlich in der Tageshelle, und indem sie den Kopf hob, den sie in den Händen verborgen hatte, schloß sie die Augen, geblendet vom Morgenrot.
Ein großer, purpurner Wolkenberg, zum Teil hinter der großen Pappelallee verborgen, warf einen blutigen Schein auf die erwachende Erde.
Und langsam erschien, die hellen Wolken durchbrechend, die Bäume, die Ebenen, den Ozean, den ganzen Horizont in Feuer tauchend, die mächtige leuchtende Kugel.
Johanna fühlte sich ganz närrisch vor Glück, unsägliche Freude, unendliche Ergriffenheit vor der Schönheit der Welt erfüllte ihr schwaches Herz. Das war ihre Sonne, ihr Morgenrot, der Beginn ihres Lebens, der Aufgang ihrer Hoffnungen. Sie streckte die Arme in die stille Weite hinaus, als wollte sie die Sonne zu sich ziehen. Sie wollte sprechen, irgend etwas Göttliches in diese erwachende Welt hinausrufen, aber in ohnmächtiger Begeisterung blieb sie stumm.
Da ließ sie die Stirne in die Hände sinken, Thränen stiegen auf in ihren Augen, und ein glückseliges Weinen kam über sie.
Als sie den Kopf wieder hob, waren die Wunder des anbrechenden Tages schon verschwunden. Sie fühlte sich etwas ruhiger, ein wenig müde, wie erkältet. Ohne das Fenster zu schließen warf sie sich auf das Bett, träumte noch ein paar Minuten und schlief dann so fest ein, daß sie um acht Uhr das Rufen ihres Vaters nicht hörte und erst erwachte, als er ins Zimmer kam.
Er wollte ihr die Verschönerungen des Schlosses, ihres Schlosses zeigen.
Die Façade, die nach dem Lande zuging, war von der Straße durch einen breiten, mit Apfelbäumen bepflanzten Hof getrennt. Diese Straße, der sogenannte Gemeindeweg, der zwischen den Gehöften der Bauern hinlief, traf eine Meile weiter auf die große Landstraße von Havre nach Fécamp.
Eine gerade Allee führte vom hölzernen Thor bis an die Rampe.
Die Wirtschaftshäuser, kleine Gebäude aus unbehauenen Steinen, mit Stroh gedeckt, lagen zu beiden Seiten des Hofes, längs der Gräben, die die Grenze der Meierhöfe bildeten.
Die Dächer waren ausgebessert, das Fachwerk repariert, die Mauern ausgebessert, die Zimmer neu tapeziert, im Innern alles frisch gestrichen, und auf dem alten gedunkelten Schloß hoben sich wie Flecken in silbernem Weiß die frisch gestrichenen Fensterläden und der Gypsbewurf auf der großen, angegrauten Facade ab.
Auf der andern Seite, wo die Fenster von Johanna lagen, hatte man den Blick über Buschwerk und die Reihe oer vom Wind zerzausten Ulmen, nach dem Meer.
Johanna und der Baron besichtigten alles Arm in Arm, ohne einen Winkel zu vergessen. Dann gingen sie durch die lange Pappelallee, die das, was man einen Park nannte, umschloß; unter den Bäumen wuchs das Gras wie ein grüner Teppich. Sie schritten auf und ab im kleinen Hain am andern Ende, auf seinen geschlängelten Wegen, die durch Blattpflanze von einander getrennt waren. Plötzlich sprang ein Hase auf, sodaß das junge Mädchen erschrak, setzte über den Graben und ward flüchtig nach der Küste zu in die Binsen.
Nach dem Frühstück schlug der Baron, da Frau Adelaide noch zu müde war, sich ausruhen wollte und doch unsichtbar blieb, vor, bis Yport zu gehen.
Sie machten sich auf und durchschritten zuerst Etouvent, wo die Besitzung lag. Drei Bauern grüßten, als ob sie sie seit langer Zeit schon kennten.
Sie traten in das sich zum Meer hinabziehende Gehölz, indem sie im Bogen einem Thale folgten. Bald erschien das Dorf Yport. Vor den Häusern saßen auf den Schwellen Frauen, die ihre Kleider ausbesserten und ihnen nachblickten. Die schief geneigte Straße, mit der Gosse in der Mitte und den Misthaufen vor den Thüren strömte einen starken Fisch- Geruch aus. An den Thüren der Hütten trockneten braune Netze, in denen hier und da, wie Silbergeld leuchtende Schuppen hängen geblieben waren.
Aus den Häusern strömte jener Armeleuteduft, der entsteht, wenn zahlreiche Familien in einem einzigen Raum zusammengepfercht hausen.
Ein paar wilde Tauben spazierten am Rande der Gosse auf und ab und suchten sich Nahrung.
Johanna beobachtete das alles, und es erschien ihr seltsam und neu, wie ein Schauspiel im Theater.
Aber als sie um eine Mauer bogen, erblickte sie plötzlich das Meer, das dunkelblau und eben sich vor ihr ausdehnte, soweit das Auge reichte. Am Strande blieben sie stehen, um den Anblick zu genießen. Weiße Segel, wie die Flügel eines Vogels, zogen in weiter Ferne dahin. Rechts und links erhob sich der hohe Klippenrand, auf der einen Seite wurde der Blick durch eine Art Vorgebirge aufgehalten, während sich auf der andern Seite das Ufer bis in die Unendlichkeit fortsetzte, sodaß es nur noch eine unbestimmte Linie war.
In einem der nächsten Einschnitte der Küste erschien ein Hafen mit einzelnen Häusern, und mit leisem Plätschern rollten ganz kleine Wellchen, die wie eine Franze aus Schaum das Meer einsäumten, an den Strand.
Die Fischerboote waren auf den mit runden Steinen bedeckten Strand gezogen und lagen auf der Seite, indem sie ihre runden, mit Theer gestrichenen Wangen zur Sonne wandten. Ein paar Fischer setzten sie in Stand für den abendlichen Fischfang.
Ein Matrose kam heran, Fische zu verkaufen, und Johanna erstand eine Butte, die sie selbst gleich mitnehmen wollte. Da bot sich der Mann zu Segelfahrten auf dem Meere an, indem er seinen Namen mehrmals wiederholte, daß sie sich ihn merken sollten. »Lastique, Joseph Lastique!«
Der Baron versprach, ihn nicht zu vergessen, und sie kehrten zum Schloß zurück.
Da der große Fisch Johanna zu schwer wurde, steckte sie ihm den Spazierstock des Vaters durch die Kiemen, und jedes packte an einem Ende an.
Fröhlich schritten sie dahin, die Küste hinan, schwatzend wie zwei Kinder, während die Butte, die allmählich ihre Arme immer mehr ermüdete, mit ihrem fetten Fischschwanz auf dem Grase schleppte.
2
Für Johanna begann jetzt ein reizendes, freies Leben. Sie las, träumte und durchstreifte ganz allein die Umgebung. Langsam ging sie auf den Landwegen spazieren, in Gedanken verloren, oder sie lief das gewundene kleine Thälchen hinab, das beide Höhenrücken trennte und wie eine goldene Kappe einen Überzug von Stechginster trug. Sein starker, süßer Geruch noch erhöht durch die Hitze, stieg ihr wie parfümierter Wein zu Kopf, und das ferne Plätschern der gegen das Ufer schlagenden Wogen schläferte ihren Geist ein, und oft ließ eine süße Schlaffheit sie sich hinstrecken ins üppige Gras einer Senkung. Ab und zu, wenn sie bei einer Biegung des Weges durch einen Thalausschnitt, wie durch eine dreieckige Öffnung, das blaue, in der Sonne glitzernde Meer, mit einem Segelboot im Hintergrunde, erblickte, ergriff sie eine überschwängliche Jubelstimmung, als wäre ihr plötzlich das Glück nahe, nahe zum Greifen.
In der schönen frischen Landluft, in der Stille des weiten Horizontes kam die Liebe zur Einsamkeit über sie, und sie blieb so lange auf der Spitze der kleinen Hügelchen sitzen, daß wilde Kaninchen in großen Sätzen ihr zu Füßen umher sprangen.
Manchmal lief sie auf dem Klippenrande hin, während sie der Küstenwind peitschte, überselig, so ohne müde zu werden, wie der Fisch im Wasser, oder die Schwalbe in der Luft dahin zu schießen.
Überall, an allem blieb ihre Erinnerung haften, wie man die Saat ausstreut, Erinnerungen, die feste Wurzeln schlagen bis zum Tode. Es war ihr, als bliebe an jeder Bodenwelle dieser Thäler ein Stückchen ihres Herzens haften.
Sie fing an mit Leidenschaft zu baden; unabsehbar weit schwamm sie hinaus, denn sie war kräftig und verwegen und ahnte keine Gefahr in diesem klaren, blauen Wasser, das sie trug, indem es sie schaukelte. Sobald sie weit vom Strande war, warf sie sich auf den Rücken, kreuzte die Arme auf der Brust und blickte in das tiefe Blau des Himmels hinauf, durch das schnell einmal eine Schwalbe schoß oder der weiße Schatten einer Möve. Man hörte nichts mehr als ganz entfernt das Murmeln der Wellen am Strande und unbestimmte Laute vom Lande her, die über die Wogen glitten, aber fast nicht wahrzunehmen, nur ganz dumpf. Johanna richtete sich auf im plötzlichen Überschwang der Freude und kreischte und schrie laut, indem sie mit beiden Händen auf das Wasser schlug.
Manchmal, wenn sie sich zu weit hinaus gewagt, mußte ein Boot sie zurückholen.
Ganz blaß vor Hunger, aber leicht, flink und fröhlich kehrte sie ins Schloß zurück, ein Lächeln auf den Lippen, die Augen strahlend vor Glück.
Der Baron aber plante große, landwirtschaftliche Unternehmungen, er wollte Versuche anstellen, allerlei Fortschritte einführen, neue Maschinen ausprobieren, fremde Rassen eingewöhnen und einen Teil seiner Zeit verbrachte er in der Unterhaltung mit den Bauern, die den Kopf dazu schüttelten und von seinen Versuchen nichts wissen wollten.
Manchmal fuhr er auch aufs Meer hinaus mit Matrosen aus Yport. Nachdem er die Grotten, Quellen und Felsenpartien der Nachbarschaft besucht, wollte er auf den Fischfang gehen, wie ein einfacher Fischer.
Wenn eine gute Brise wehte und die windgefüllten Segel die runde, bausbäckige Schale des Schiffes über den Rücken der Wogen trieben, das zu beiden Seiten bis auf den Grund des Meeres hinab eine lange Bahn nach sich zieht, der ganze Schwärme von Makrelen folgen, hielt er den dünnen Strick, den er zucken fühlte, sobald ein Fisch angebissen hatte, in seiner zitternden Hand.
Bei Mondschein fuhr er fort um die Netze einzuholen, die am Tage vorher ausgelegt worden waren. Er liebte es, wenn der Mast knarrte, er atmete gern die frischen pfeifenden Böen ein in der Nacht. Und wenn sie lange gekreuzt waren, indem sie auf eine Felsennase zu hielten, auf einen Kirchturm oder den Leuchtturm von Fécamp, um die Bojen wieder zu finden, schwelgte er darin, unbeweglich dazusitzen unter den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne, die auf dem Deck des Schiffes die klebrigen Rücken der langen, fächerähnlichen Rochen und die feisten Bäuche der Steinbutten leuchten ließ.
Bei jeder Mahlzeit erzählte er mit großer Freude von seinen Spazierfahrten, und dafür berichtete ihm ihrerseits Mutting, wie oft sie die große Pappelallee auf- und abgegangen und zwar die rechte am Meierhof Cuillard, denn die andere lag zu sehr im Schatten.
Da man ihr anempfohlen hatte, »sich Bewegnng zu machen,« gab sie sich Mühe zu gehen. Sobald der Nachttau verschwunden war, kam sie herab, auf Rosalies Arm gestützt, in einen Mantel und in zwei Shawls gewickelt, den Kopf mit einer schwarzen Kapuze bedeckt, worüber sie noch eine rote Mütze gezogen hatte.
Dann begann sie ihre ewigen Reisen in gerader Linie, von der Ecke des Schlosses bis hinauf zu den Sträuchern des kleinen Parks. Sie schleppte den linken Fuß, der weniger beweglich war, hinterher, und hatte schon auf dem ganzen Weg, das eine Mal beim Kommen, das andere Mal beim Gehen, zwei staubige Furchen gezogen, in denen kein Gras wuchs.
An beide Enden ihres Weges hatte sie eine Bank stellen lassen und alle fünf Minuten blieb sie halten, indem sie dem armen, geduldigen Mädchen, das sie stützte, zurief:
– Wir wollen uns setzen, mein Kind, ich bin etwas müde.
Und bei jedem Halt ließ sie auf einer der Bänke erst das rote Kopftuch dann einen Shawl nachher die Kapuze und schließlich den Mantel liegen, und alle diese Gegenstände bildeten am Ende der Allee zwei große Kleiderbündel, die Rosalie auf dem freien Arme wieder zurückschleppen mußte, wenn sie zum Frühstück hineingingen.
Nachmittags begann die Baronin wieder ihre Wanderung, aber diesmal etwas langsamer und indem sie länger halten blieb. Ab und zu schlief sie sogar ein Stündchen auf einer Chaiselongue, die man ihr hinaus gerollt. Das nannte sie: »Meine Übung!«, Wie sie sagte: »Meine Hypertrophie.« Ein Arzt hatte vor zehn Jahren, als sie ihn konsultiert, weil sie Asthma hatte, von Hypertrophie gesprochen, und seit dieser Zeit war dieses Wort, dessen Sinn sie nicht verstand, in ihrem Gedächtnis hängen geblieben. Beharrlich ließ sie den Baron, Johanna oder Rosalie ihr Herz betasten, das aber niemand mehr fühlte, so tief war es unter Fettpolstern begraben.
Aber sie wehrte sich ganz energisch dagegen, sich von einem andern Arzte untersuchen zu lassen, in der Befürchtung, es möchten neue Krankheiten entdeckt werden. Sie sprach bei jeder Gelegenheit von »ihrer« Hypertrophie und so oft, daß es den Eindruck machte, als sei dieses Leiden nur ihr allein eigen, gehörte ihr, wie etwas, auf das die andern Menschen kein Recht hatten.
Der Baron sagte: »Die Hypertrophie meiner Frau« und Johanna: »Mamas Hypertrophie«, als ob sie gesagt hätten: »Mamas Hut, Kleid oder Regenschirm.«
In ihrer Jugend war sie sehr hübsch gewesen, schlank, wie ein Rohr. Nachdem sie mit allen Waffengattungen der Armee des Kaiserreichs getanzt, hatte sie Corinna gelesen, die sie zu Thränen gerührt. Seitdem stand sie wie unter dem Einfluß dieses Romans.
Je größer ihr Umfang wurde, desto poetischer war ihre Seele geworden, und als die Fettleibigkeit sie an den Stuhl bannte, beschäftigte sich ihre Phantasie mit allerhand zarten Abenteuern, für deren Heldin sie sich hielt. Sie hatte einzelne Lieblingsgedanken, die sich in ihren Träumen immer wiederholten wie die Musik auf einer Drehorgel, wenn man die Kurbel in die Hand nimmt, immer dieselben Melodien leiert. Alle schmachtenden Romanzen, in denen von Gefangenen und Schwalben die Rede war, näßten ihr ohne Widerrede die Augen. Sie verehrte sogar gewisse freie Lieder von Béranger, weil sie in elegischem Tone gehalten sind.
Manchmal blieb sie stundenlang in Gedanken versunken, und das Schloß gefiel ihr unendlich, weil es den Träumen ihrer Seele einen guten Rahmen bot, weil es durch die Wälder der Umgebung, durch die verlassene Haide, durch die Nähe des Meeres an die Bücher von Walter Scott erinnerte, die sie seit einigen Monaten las.
An Regentagen schloß sie sich in ihrem Zimmer ein, um das zu mustern, was sie ihre »Erinnerungen« nannte: nämlich alle ihre alten Briefe, die Briefe ihres Vaters und ihrer Mutter, die Briefe des Barons aus der Brautzeit und noch andere. In einem Mahagony-Schreibtisch waren sie eingeschlossen, der rechts und links ein kupferne Sphinx trug. Sie sagte mit ganz besonderer Betonung:
– Rosalie, mein Kind, bring mir die Schublade mit den »Erinnerungen«. Das Mädchen schloß das Möbel auf, nahm das Fach und setzte es auf einen Stuhl neben ihre Herrin, die nun anfing, langsam einen Brief nach dem andern zu lesen und von Zeit zu Zeit eine Thräne darauf fallen ließ.
Manchmal nahm Johanna Rosalies Stelle ein und führte Mutting spazieren, die ihr Erinnerungen aus ihrer Kindheit erzählte. Das junge Mädchen fand sich in allen diesen Geschichten wieder und wunderte sich über die Ähnlichkeit ihrer beiderseitigen Gedanken, über die Verwandtschaft ihrer Wünsche, denn jedes Herz bildet sich ein, zu allererst von einer Menge Dingen berührt worden zu sein, die doch schon die Herzen der ersten Menschen bewegten und noch die der letzten bewegen werden.
So langsam wie sie ging, erzählte sie auch, und manchmal mußte ein paar Sekunden inne gehalten werden. Dann entflohen Johannas Gedanken von der Erzählung, die sie gerade begonnen, und irrten in die frohe Zukunft hinaus und wiegten sich in allerhand Träumen.
Eines Nachmittags, als sie auf der Bank saßen, bemerkten sie plötzlich am andern Ende der Allee einen dicken Priester, der auf sie zukam.
Er grüßte von weitem, lächelte, grüßte wieder, als er auf drei Schritte herangekommen war, und rief:
– Nun Frau Baronin, wie geht es denn?
Es war der Pfarrer des Ortes, Mutting, die im Zeitalter der Philosophen geboren und von einem freisinnigen Vater erzogen war in den Tagen der Revolution, ging kaum in die Kirche, obgleich sie vermöge des instinktiven religiösen Gefühls der Frau die Priester verehrte.
Sie hatte den Abbé Picot, ihren Pfarrer, gänzlich vergessen und errötete, als sie ihn sah. Sie entschuldigte sich, daß sie seine Ankunft nicht bemerkt, aber der gute Mann schien gar nicht verletzt zu sein. Er sah Johanna an und sagte artig, daß sie gut aussähe; setzte sich, legte seinen dreieckigen Hut auf die Bank und betupfte sich die Stirn. Er war sehr dick und der Schweiß tropfte nur so herab.
Alle Augenblicke zog er ein gewürfeltes, buntes, schon ganz genäßtes Taschentuch hervor, mit dem er sich den Schweiß abtrocknete. Aber kaum war sein nasses Taschentuch in den Tiefen seines Priesterrockes verschwunden, als neue Tropfen auf der Stirn erschienen und auf das Priestergewand fielen, wo sie nun in kleinen, runden Flecken den Staub von der Straße festhielten.
Er war heiter, der richtige Landgeistliche, sehr tolerant, schwatzhaft, ein ganz braver Mann. Er erzählte Geschichten, sprach von den Leuten der Gegend und schien gar nicht gemerkt zu haben, daß seine beiden Gemeindemitglieder die Kirche noch nicht besucht hatten, denn bei der Baronin ward ihre geringe Gläubigkeit von ihrer Bequemlichkeit unterstützt, und Johanna war glücklich, aus dem Kloster erlöst zu sein, wo sie mit Gebeten gefüttert worden war.
Der Baron erschien. Seine pantheistische Weltanschauung machte ihn gegen die Kirche gleichgiltig. Er war aber liebenswürdig gegen den Geistlichen, den er oberflächlich kannte, und behielt ihn zum Essen.
Der Pfarrer wußte sich einzuschmeicheln, dank jener unbewußten Schlauheit, die das Seelenhirtenamt auch mäßig begabten Leuten verleiht, wenn sie durch den Lauf der Dinge dazu gekommen sind, über ihresgleichen eine Macht auszuüben.
Die Baronin verhätschelte ihn, vielleicht zog sie eine jener Wahlverwandtschaften, die ähnliche Naturen einander nähert, zu ihm. Das vollblütige Gesicht und der kurze Atem des Mannes gefielen ihrer asthmatischen Dicke.
Nach dem Diner war er aufgekratzt wie ein beschwipster Pfarrer und von jener familiären Formlosigkeit, wie sie sich am Ende eines heiteren Mahles einzustellen pflegt. Plötzlich rief er, als hätte er einen guten Gedanken:
– Aber ich habe ja ein neues Gemeindemitglied, das ich Ihnen vorstellen muß, den Herrn Vicomte Lamare.
Die Baronin, die den ganzen Adel der Provinz bis auf das Tz kannte, fragte:
– Ist es ein Lamare de L'Eure?
Der Priester nickte:
– Jawohl gnädige Frau, er ist der Sohn des Vicomte Johann von Lamare, der voriges Jahr starb.
Da fing Frau Adelaide, die den Adel über alles liebte, an, eine Menge Fragen zu stellen, und erfuhr, daß sich der junge Mann, nachdem er die Schulden seines Vaters bezahlt und sein Stammschloß verkauft, eine Wohnung in einem der drei Meierhöfe, die er in der Gemeinde Etouvent besaß, eingerichtet hatte. Im ganzen mochte sein Besitz wohl fünf- bis sechstausend Franken Rente abwerfen; aber der Vicomte war sparsam und vernünftig und wollte so zwei oder drei Jahre lang bescheiden leben, um etwas zusammen zu kratzen, damit er dann in Gesellschaft eine gute Figur machen und sich vorteilhaft verheiraten könnte, ohne Schulden oder Hypotheken auf seine Pachthöfe aufzunehmen.
Der Pfarrer fügte hinzu:
– Er ist ein sehr netter Herr, so ruhig und vernünftig, aber er amüsiert sich nicht gerade übermäßig hier.
Der Baron sagte:
– Herr Pfarrer, bringen Sie ihn uns nur, vielleicht giebt ihm das ab und zu eine Zerstreuung.
Und man sprach von andern Dingen.
Als sie in den Salon hinüber gingen, nachdem sie den Kaffee getrunken, bat der Pfarrer um die Erlaubnis, da er die Gewohnheit habe, nach Tisch sich Bewegung zu machen, in den Garten zu gehen.
Der Baron begleitete ihn. Langsam schritten sie die lange, weiße Fassade des Schlusses ab, um denselben Weg wieder zurück zu machen.
Ihre Schatten, der eine mager, der andere rund, mit einem flachen Hut auf dem Kopfe, kamen und gingen mit, bald vor, bald hinter ihnen, je nachdem sie der Sonne den Rücken kehrten, oder ihr entgegen schritten.
Der Pfarrer hatte eine Cigarette in der Hand, die er aus der Tasche gezogen. Mit der Offenheit eines Landbewohners setzte er den Nutzen derselben auseinander: – Ich brauche das, um den Stuhlgang zu befördern, denn ich habe etwas schwere Verdauung.
Dann plötzlich blickte er zum Himmel auf, an dem das klare Gestirn dahinzog und sagte:
– Daran kann man sich nie satt sehen!
Und er ging hinein, um sich von den Damen zu verabschieden.
3
Am folgenden Sonntag gingen die Baronin und Johanna zur Messe aus zartfühlender Rücksicht gegen ihren Pfarrer.
Nach dem Gottesdienst erwarteten sie ihn, um ihn für Donnerstag zum Frühstück zu laden. Er trat mit einem großen, jungen, eleganten Herrn, der ihm freundschaftlich den Arm gab, aus der Sakristei.
Sobald er die beiden Damen sah, machte er eine Bewegung frohen Erstaunens und rief:
– Nein, wie sich das trifft! Frau Baronin und Fräulein Johanna erlauben Sie mir, Ihnen Ihren Nachbarn vorzustellen, Vicomte Lamare.