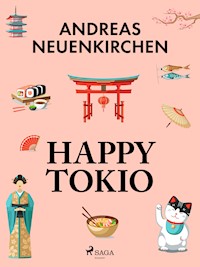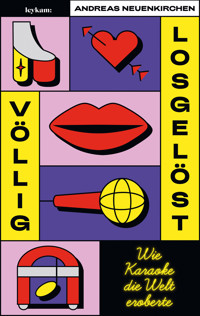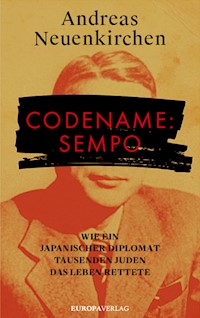Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine hinreißende Kriminalkomödie zum Miträtseln! Amadeus Wolf, einst literarisches Wunderkind, nun alleinerziehender Vater mit Schreibblockade, und Schnulzenautorin Holly McRose sind im gleichen Alter, wohnen im selben Haus, leben beide vom Schreiben – und könnten unterschiedlicher nicht sein. Dennoch beschließen sie, sich zusammenzuraufen und ihr kreatives Talent zu nutzen, um den mysteriösen Mord an ihrem alten Nachbarn aufzuklären. Mit Baby im Gepäck jagen sie den Täter und können sich vor Verdächtigen kaum retten: Da ist die Influencerin, die aus Karrieregründen ihre Intelligenz verschweigt. Eine reiche Familie, die es auf das Erbe ihres ärmsten Mitglieds abgesehen hat. Der intriganteste Nordic-Walking-Club der Stadt. Und über allem hängt die Frage: Lauert der Mörder womöglich schon auf der nächsten Etage?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Neuenkirchen
Ein Toter lag im Treppenhaus
Kriminalroman
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur für Autoren und Verlage, Aenne Glienke, Massow.
Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-98708-017-3
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Andreas Neuenkirchen, geboren in Bremen, arbeitet seit den frühen 90ern als Journalist, zunächst frei im Feuilleton Bremer Tageszeitungen und Stadtmagazine, später als Redakteur in Münchner Redaktionen online und offline. Er ist der Autor mehrerer Sachbücher und Romane mit Japan-Bezug, darunter der Bestseller »Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan« (Piper) und die hochgelobte Krimi-Tetralogie um Inspector Yuka Sato (Conbook). Außerdem arbeitete er als Autor, Berater und Redakteur an über dreißig internationalen Film- und Fernsehproduktionen mit. Er lebt mit seiner japanischen Frau und der gemeinsamen Tochter in Tokio.
Für Junko, die mir die Idee aufdrängte. Und für Hana, die lieber etwas mit Piraten gehabt hätte.
Prolog
Westfriedhof Wild Style
Er liebte den Geruch frischer Sprühfarbe am frühen Morgen. Besonders wenn sie an Hauswänden trocknete. Dann wusste er, was er die Nacht über geleistet hatte.
Nicht dass man sein Werk ausschließlich riechen konnte. Der junge Mann im Kapuzenpulli trat einen Schritt zurück, um seinen eigenen Namen in bunten, geschwungenen Lettern an der Wand des zuvor viel zu grauen Mietshauses am Anfang der Feldmochinger Straße zu bewundern:
WFH Boi
WFH wie Westfriedhof, Boi wie Knabe. Darunter eine dynamische Darstellung eines Zuges der Linie 1, der blitzschnell durch die Eingeweide der Stadt schoss. Jene Eingeweide wurden symbolisiert durch Gullydeckel, ein paar Spinnweben und flatternde Fledermäuse mit großen, glänzenden Manga-Augen.
Als ob diese Züge das jemals täten, blitzschnell schießen. Das war halt künstlerische Freiheit. »Der nächste Zug in Richtung Mangfallplatz hat zwölf Minuten Verspätung« war kein allzu aufregendes Thema für ein Graffiti. Auf der Darstellung des Zuges hatte WFH Boi eine weitere Darstellung seines Namenslogos platziert. Sehr meta.
Gerade als er sein Smartphone in Anschlag brachte, um seine Arbeit mit der Welt zu teilen, öffnete sich die Tür des Hauses. Ein alter Mann trat heraus. Um diese Zeit? Nun begriff WFH Boi, dass eher er ein bisschen spät dran war als der andere zu früh. Er hatte in der Nacht angefangen zu sprühen und dann nicht mehr auf die Uhr geschaut. Völlig die Zeit vergessen. Und die Welt obendrein. Das passierte schon mal, wenn man so in seine Kunst vertieft war und der Bass elektrisierend aus den Earbuds pumpte.
WFH Boi hatte diesen alten Mann hier schon öfter gesehen, aber nicht so. Er trug die Kleidung einer jungen Frau. Zwar nicht Minirock und bauchfreies Top, doch die Art von glänzender, eng anliegender, neonfarbener Pellkleidung, in die sich junge Frauen oft zum Zwecke sportlicher Ertüchtigung zwängten.
Der Aufzug hatte seinen Grund. Der alte Herr Niedermeyer war tatsächlich drauf und dran, sich sportlich zu ertüchtigen. Und das durchaus in der Gesellschaft junger Frauen. Man war immer nur so alt, wie man sich fühlte, fand er.
Als er sah, was der junge WFH Boi da an seiner Hauswand hinterlassen hatte, fühlte er sich sehr alt. Ohne den Künstler, den er sehr wohl wahrgenommen hatte, eines Blickes zu würdigen, monologisierte er extra laut und deutlich: »Ich sehe: Narrenhände beschmierten diese Wände.« Dann ging er von dannen. Leuchtend, quietschend, mit seinen Walking-Stöcken einen strengen Rhythmus auf dem Asphalt vorgebend.
WFH Boi funkelte ihm böse hinterher. Der Alte hatte den Moment ruiniert.
Kurze Zeit später sollte er nicht mehr leben.
1
King of Feldmoching-Hasenbergl
Dieser Tage hatten nicht viele Mitglieder von Cem Aslams Familie den Mut, offen und ehrlich über Cem zu sprechen. Doch die, die nichts mehr zu verlieren hatten, hätten auf Anfrage vielleicht zu Protokoll gegeben, dass Cem in seiner Kindheit nur einen richtigen Freund hatte: den Fernseher. Käme Cem das zu Ohren, würde er auf seine ganz spezielle, sehr leidenschaftliche, oft dramatische Art und Weise Einspruch erheben. Er würde klarstellen, dass er zur fraglichen Zeit, als kleiner Bub in Hasenbergl, gleich zwei sehr gute Freunde hatte: »Yo! MTV Raps« und »Polizeirevier Hill Street«. So war ihm früh bewusst gewesen, dass für ihn einer von zwei Wegen vorgezeichnet war: Bulle oder Gangster.
Mit seinem Naturell, seinem Umfeld und seinen Talenten hatte sich einer dieser Wege schnell als weitaus unbeschwerlicher herausgestellt als der andere.
Der frühe Morgen war nicht Cems liebste Tageszeit. Schon gar nicht, wenn es so früh bereits um Leben und Tod ging. Vor allem natürlich um Tod. Wie an diesem speziellen frühen Morgen. Doch seine Stimmung besserte sich, als er viel zu schnell durch den ländlichen Teil Feldmochings in Richtung Süden bretterte, sich um ihn herum zusehends mehr städtisches Grau ins grüne Einerlei mischte und aus den Boxen seine übliche Aufwachmusik dröhnte. Ice-T schrie: »I got my twelve-gauge sawed off … I got my headlights turned off … I’m ’bout to bust some shots off … I’m ’bout to dust some cops off … I’m a cop killer, better you than me … cop killer, fuck police brutality!«
Deutschen Gangsta-Rap hörte Cem nie. Weil er wusste, dass kein deutscher Gangster es mit ihm aufnehmen konnte, und ein Gangsta-Rapper schon gar nicht. Ice-T hingegen … Okay, der machte heute Werbung für Kfz-Versicherungen und honigsüße Frühstückscerealien. Aber einer wie er durfte das. Keeping it real musste halt jeder für sich selbst definieren.
So beeindruckend das Soundsystem im Innern war, so wenig machte der braune Audi A4 von außen her, und so sollte es auch sein. In seiner Branche war die Unauffälligkeit oft zielführender als der große Auftritt, der ihm so lag. Nicht dass es irgendjemand wagen würde, Cem Aslams Wagen anzurühren, egal ob Audi oder BMW. Die Leute wussten, wer er war. Was er war. Sie hatten Respekt. Oder Angst. Für seine Belange war das eine so gut wie das andere.
Die Felder und Äcker von Feldmoching wichen endgültig den Neubauten und nicht mehr ganz so neuen Bauten von München-Moosach. Als er sein Ziel fast erreicht hatte, stellte er die Musik leiser. Er parkte den Wagen im Halteverbot direkt vor dem fraglichen Haus in der Feldmochinger Straße.
Es war kein schönes Haus. Es war kein neues Haus mehr, aber es war noch nicht alt genug, um als charmant durchzugehen. Wenn überhaupt, hatte es einen gewissen, sehr subtilen Nachkriegscharme für Mieter mit ganz besonderem Geschmack. Oder ganz besonders wenig Geschmack. Oder einer sehr anspruchslosen Definition von nostalgischem Flair. Weder das frische Graffiti an der Wand noch das rot-weiße Absperrband vor der Haustür konnten den Gesamteindruck positiv beeinflussen. Die beiden Polizeiwagen, die die Tür flankierten, schon gar nicht.
Cem stellte die Musik ganz aus und stieg aus dem Wagen. Ein hagerer uniformierter Polizist wartete bereits auf ihn. »Morgen, Toni«, sagte Cem.
»Guten Morgen, Kommissar Aslam«, antwortete Toni.
Cem blieb vor dem Graffiti stehen und atmete theatralisch ein. »Ah, ich liebe den Geruch von frischer Sprühfarbe am Morgen!«
Toni zuckte mit den Schultern. »Ich rieche nichts.«
»Geh mal ganz dicht mit der Nase dran«, forderte ihn Kriminalkommissar Cem Aslam auf. »Das ist noch nicht lange da.«
Toni beugte sich vor, schnüffelte an der Wand, richtete sich wieder auf. »Nichts.«
»Dann fehlt dir vielleicht die Erfahrung.« Cem knuffte Toni in die Seite, was den nur noch mehr verunsicherte. »Nie in tiefer Nacht deinen B-Boy-Namen an graue Wände gesprüht, Toni?«
Toni erschrak. »Sie etwa?«
»Waren wir nicht alle mal jung?«
»Äh …«
Cem schlug ihm auf die Schulter. »Passt schon, Digger. Locker bleiben. Also, was haben wir hier?«
Er war bereits bestens informiert, ließ sich aber dennoch von Toni den mutmaßlichen Tatort referieren, während er sich in der Praxis ansah, was er in der Theorie schon wusste. Der alte Albrecht Niedermeyer hatte allein im zweiten und damit obersten Stock des Hauses gewohnt, nun lag er allein im Zugang zum Keller, mit mehreren gebrochenen Knochen, darunter einige lebenswichtige in Hals und Rücken. Toni lüpfte das weiße Tuch, das andere Beamte über die Leiche gelegt hatten.
Cem runzelte die Stirn. »Was hat er denn da an?«
»Sportklamotten, würde ich sagen«, sagte Toni. »Laufen oder so.«
Cem fischte aus den Taschen seiner übergroßen Kapuzenjacke mit Camouflage-Muster ein paar Latexhandschuhe, die er sich quietschend überzog. Er hob etwas vom Boden auf, das wie ein zerbrochener Stock anmutete. »Skilaufen vielleicht. Dafür dürfte es allerdings noch zu früh sein.«
Tonis Gesicht erhellte sich in Erkenntnis. »Nein, diese Dinger sind für Nordic Walking. Meine Mutter macht das auch.«
Cem las weitere Gehstockteile vom Boden auf. »Anscheinend nicht sehr stabil.«
»Meine Mutter sagt immer, man darf nicht die billigen kaufen.«
»Ich sehe mir mal die Wohnung an.«
Im Gegensatz zum Erdgeschoss und ersten Stockwerk, die sich jeweils zwei Mietparteien teilten, gab es im zweiten Stock nur ein einziges Apartment. Vor der Tür leuchteten und pinselten bereits die Kollegen von der Spurensicherung ganz in Weiß nach Erklärungsansätzen. Die Tür selbst war geschlossen. Cem grüßte und fragte: »Schon drin gewesen?«
Eine Beamtin sah auf und zeigte auf den Schlüssel, der in der Nähe der Fußmatte mit Bergmotiv auf dem Boden lag. »Er war unmittelbar vor seinem Sturz gar nicht in der Wohnung gewesen. Er muss gerade nach Hause gekommen sein, wollte aufschließen, verlor das Gleichgewicht und fiel über das Treppengeländer den ganzen Weg hinunter in den Keller. Dabei ist er mehrmals mit den Treppenrändern zusammengestoßen.«
Cem sah durch den Spalt der gewundenen Treppe in den dunklen Abgrund. An den Außenkanten einiger Stufen klebte Blut.
»Keine Ahnung, was der alte Mann so früh schon draußen gemacht hat«, sagte die Frau von der Spurensicherung.
»Nordic Walking«, sagte Cem. »Macht Tonis Mutter auch.« Mit seinen kunststoffüberzogenen Fingern hob er behutsam den Schlüssel auf. »Ich schaue mich trotzdem mal drinnen um.«
»Ich glaube nicht, dass Sie da etwas finden werden. Seien Sie bitte dennoch vorsichtig und ziehen Sie sich Überschuhe an.« Sie reichte ihm ein paar weiße Einwegfüßlinge mit rutschfester blauer Sohle, mit denen er mühselig seine übergroßen Sportschuhe umkleidete.
Durch eine Überanzahl sperriger Möbel wirkte Niedermeyers Wohnung dunkler und kleiner, als sie eigentlich war. Eine typische Altherren-Schrankwand-Einrichtung. Allerdings mit recht moderner Elektronik, musste Cem feststellen. Großer Flachbildfernseher und sogar einer von diesen modernen Lautsprechern, die man mit Namen anreden musste. Sah man denen gar nicht an, aber die hatten ordentlich Bass. Überall Walking-Ausrüstung, wie er mit seinem neu gewonnenen Sachverstand sofort erkannte. Dem Niedermeyer schien es mit der Sache ernst gewesen zu sein. Sehr ernst. Ansonsten war auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches auszumachen. Den zweiten Blick würde er der Spurensicherung überlassen. Doch er hatte schon jetzt den Verdacht, dass der Fall schnell abgeschlossen sein würde beziehungsweise dass er sich nicht mal als ein solcher herausstellen würde. Alter Mann nimmt sich sportlich etwas zu viel vor, nach dem Treppensteigen wird ihm schwindelig, und holterdiepolter geht’s abwärts. Die Autopsie würde das bestimmt bestätigen, so überhaupt eine für nötig erachtet wurde.
Cem verließ die Wohnung wieder. Er wollte ein paar Nachbarn zur Befragung aus dem Bett klingeln, falls die durch den Polizeieinsatz nicht eh schon wach waren. Die Kollegin im Treppenhaus fragte er: »Irgendwelche Spuren von Gewalt? Ein Kampf oder so?«
Sie schüttelte den weiß verpackten Kopf. »Bislang nicht. Und wenn ich ehrlich bin, rechne ich auch nicht damit, etwas in dieser Richtung zu finden.«
Cem Aslam nickte. Er sah sich im hellen Treppenhaus um. »Schönes ruhiges Haus«, sagte er. Er würde es bestimmt nicht wiedersehen.
Zwei Tage später hatte er genügend Expertenunterschriften gesammelt, um den Fall als Nicht-Fall zu den Akten zu legen.
2
Amadeus Wolf, Frau Loibl und ein extrem braves Kind
Erst hatte ihn Silke verlassen, und dann war auch noch ein Mord geschehen. An manchen Tagen wäre Amadeus Wolf am liebsten unter der Decke geblieben. Aber das konnte er sich nicht erlauben. Sein Boss würde ein Riesengeschrei veranstalten.
Ohnehin war »verlassen« relativ und die Sache mit dem Mord nur eine Flause, die ihm die Frau aus der Wohnung gegenüber in den Kopf gesetzt hatte. Darüber hinaus war beides nicht erst heute geschehen, doch sein Gehirn begann beides erst jetzt zu verarbeiten. Ganz langsam. So wie es dieser Tage alles nur ganz langsam verarbeitete.
Weder mit der längst entfernten Leiche im Keller und den wirren Theorien seiner Nachbarin noch mit dem irrationalen Verhalten seiner Ehefrau konnte er sich jetzt genauer befassen, obwohl er wusste, dass er sich zumindest mit Letzterem früher oder später würde befassen müssen, und zwar dringend, also eher früher. Jetzt allerdings musste er an die Arbeit. Die Zeit war günstig. Er schwang die Füße auf den Boden, tat ein paar Schritte vom Doppelbett zum Babybett, in dem die kleine Maxine ausnahmsweise engelsgleich schlief. Hätte sie das nur mal in der Nacht getan. »Guten Morgen, Boss«, flüsterte Wolf, nicht ohne Zärtlichkeit. Wer konnte schon bei diesem Anblick nachtragend sein? Dann ging er in das Wickelzimmer, das laut Steuererklärung sein Arbeitszimmer war.
Wie die Wände des Flurs und des Schlafzimmers waren auch die in diesem Raum vollgestellt mit Bücherregalen. Ein Zugeständnis an Silke. Bevor sie in sein Leben getreten war und seine Wohnung umgestaltet hatte, bevor sich mehr als eine Person durch diese Wohnung manövrieren musste, hatte Wolf seine Bücherregale in Neunzig-Grad-Winkeln an den Wänden orientiert, sodass er sie beidseitig benutzen konnte. So, wie die Natur es vorgesehen hatte. Aber Silke hatte gesagt, sie wolle nicht in einer Bibliothek leben. Er hatte herzhaft gelacht, aber sie im Gegenzug klargestellt, dass sie das ernst meinte. Ein Mensch, der nicht in einer Bibliothek leben wollte. Sicherlich ein erstes Warnsignal, dass bei ihr irgendetwas nicht stimmte. So mussten die Regale flach an die Wände und die Hälfte der Bücher in den Keller. Die meisten der Exemplare, die in den Regalen verblieben waren, waren an ihren Rücken leicht als Veröffentlichungen von Verlagen zu erkennen, die von der literarischen Intelligenzia in abgöttischer Weise verehrt und vom Rest der Bevölkerung unangenehm mit schulischer Pflichtlektüre assoziiert wurden. Doch er hatte auch ein paar DeLillos und Walsers eingestreut, als Konzession an die leichte Muse, die sündigen Freuden. Um sich als volksnah zu inszenieren, falls mal Besuch käme, der nicht sein Besuch war.
Frohen Mutes und hoch motiviert vom zumindest einigermaßen bibliophilen Ambiente stellte Amadeus Wolf seinen Laptop auf die Wickelunterlage, setzte sich auf den Sitzball und schrieb nichts.
Vielleicht lag es am Sitzball. Silke hatte ihn auf Anraten ihrer Schwangerschaftskursleiterin gekauft und dann weder in der Schwangerschaft (zu gefährlich) noch danach (zu albern) jemals darauf gesessen. Sie hatte ihn schließlich am Schreibtisch ihres Mannes platziert, weil dort am wenigsten los war.
Er verbannte den Ball ins Wohnzimmer und tauschte ihn gegen eine richtige Sitzgelegenheit. Doch es half nichts.
Es lag am fehlenden Kaffee. Ganz bestimmt. Er brauchte Kaffee. Hörte man ja immer wieder. Schriftsteller brauchen Kaffee. Ohne Kaffee konnte er einfach nicht arbeiten. Er stand auf. Er ging in die Küche. Er öffnete die Kaffeedose. Hätte er sich sparen können, das Dosengewicht hatte die Notlage bereits verraten. Er schloss die Kaffeedose. Er öffnete den Vorratsschrank. Er hatte keinen Kaffee. Jede Menge Milchpulver, aber keinen Kaffee. Er musste einkaufen gehen. Und zwar schnell, bevor Maxi aufwachte. Er schnappte sich die Manduca.
Als sie die Babytrage gekauft hatten, hatte Wolf nie erwartet, dass ihm das Anlegen inklusive Kind jemals so geschmeidig gelingen würde wie das Anziehen seiner eigenen Socken. Anfangs schien es hoffnungslos, ein endloses Geruckel und Gezerre, schmerzhaft für beide Beteiligte plus Publikum. Oft genug hatte er vorzeitig aufgegeben und Silke gefragt: »Kann ich Maxi nicht einfach so tragen?« Woraufhin Silke geseufzt und dann das Kind und die Trage mit wenigen Handgriffen und ohne hinzugucken selbst angelegt hatte. Wieder einmal. »Aber das nächste Mal bist wirklich du dran«, hatte sie jedes Mal gesagt.
Vielleicht war sie deshalb gegangen.
Nein, Silke war nicht gegangen, weil Wolf motorische Probleme beim Anlegen der Manduca-Babytrage hatte. Sie war nämlich gar nicht gegangen. Nicht für immer. Nicht gegangen-gegangen. Sie kam an den Wochenenden. Zumindest an manchen Wochenenden. Zumindest hatte sie es sich an manchen Wochenenden ganz fest vorgenommen. Das sagte sie, und das musste er glauben.
Wenn sie ihn jetzt sehen könnte. Routiniert hatte Wolf seine Tochter vor seiner Brust vertäut, sogar ohne sie aufzuwecken. Schneller, als Silke es je hinbekommen hatte.
Er schaffte es sicher durchs Treppenhaus. Er schaffte sicher den kurzen Weg zum Rewe an der Ecke Dachauer Straße. Er schaffte es sicher am Bäckertresen vorbei in den Supermarkt hinein. Gerade als eine Kundin mit einem Blick auf den Babykopf zum Gurren ansetzte, begann Maxine zu schreien. Die Kundin gurrte aus Pflichtgefühl trotzdem etwas, begleitet von einem jovialen »Ja, die Kleinen müssen auch mal schreien, ja, ja«, und dann war sie blitzschnell in einem anderen Gang.
Die anderen im Laden teilten offenbar nicht die Meinung, dass die Kleinen auch mal schreien müssten, und mieden Vater und Kind mit missbilligenden Blicken.
Hat durchaus Vorteile, das Geschrei, dachte Wolf. Er sah sich in aller Seelenruhe im Laden um. Prompt wurde ihm sein Fehler bewusst: So viel er sich auf seine Manduca-Virtuosität einbildete, der Kinderwagen wäre hier angesichts seines Zusatznutzens als improvisierter Einkaufswagen praktischer gewesen. Die anderen Mütter wussten das natürlich. Aber so eine Profi-Mutter würde er schon auch noch werden. Er lud Würstchen, Käse, Brot, Joghurt, Kartoffelchips, Zahnpasta, Saure Sahne, Küchenpapier, die aktuelle »Zeit« und Currykochsoße in seinen Wagen. Fast hätte er den Kaffee vergessen, besorgte ihn dann aber noch und machte sich nach dem nicht sehr zeitaufwendigen Zahlvorgang auf den Rückweg.
Als sie wieder im Treppenhaus waren, hatte Maxi sich ausgeschrien und schaute nun neugierig und unschuldig aus ihrer Vertäuung. Da ging Frau Loibl zum Angriff über. Wie immer kam sie scheinbar aus dem Nichts. »Die Kleine ist immer so brav!«, jubilierte die alte Dame in der Schürze. Dabei warf sie einen so genauen Blick auf das Baby, als suche sie nach unveränderlichen Merkmalen, die Wolfs Vaterschaft bewiesen. Vielleicht war tatsächlich genau das ihr Ansinnen. Sie war genau diese Art von Nachbarin.
»Die ist nicht immer brav, die kann sich nur hin und wieder dreißig Sekunden am Stück zurückhalten«, erklärte Wolf. »Das sind zufälligerweise oft, wenngleich nicht immer, die dreißig Sekunden, in denen uns jemand über den Weg läuft, der mir prompt zuflötet, was für ein braves Kind ich hätte. Später, wenn ich mit ihr allein bin, verwandelt sie sich wieder in Linda Blair in ›Der Exorzist‹. Aber dafür gibt es dann keine Zeugen.«
»Ja, ganz brav, nicht?« Es war schwer zu sagen, ob Frau Loibl schwerhörig oder schwer von Begriff war oder nur so tat, als träfe eines von beidem zu. Offenbar war lediglich das Wort »brav« zu ihr durchgedrungen. Jetzt sah sie den Vater mit einem gewissen Misstrauen an. »Sollten Sie um diese Zeit nicht auf der Arbeit sein? Herr … äh …«
»Wolf. Amadeus Wolf.«
»Richtig, Herr Wolf. So ein Name ist so schwer zu merken. Was machen Sie gleich beruflich?«
»Ich bin Schriftsteller.«
»Schriftsteller? Das ist ja interessant. Kann man denn davon leben?«
»Nein. Deshalb arbeitet meine Frau ebenfalls.«
»Ach, wie modern! Das finde ich gut.« Ihr Ton, ihr Gesicht und ihre Haltung sagten das Gegenteil. »Wo arbeitet Ihre Frau denn?«
»Momentan in Luxemburg.« Er glaubte nicht, dass Frau Loibl alle Details wissen musste. Dass seine Silke als EU Mobile Evangelist für das Unternehmen Buystuff.com arbeitete und momentan für ein strategisches Gipfeltreffen der globalen Mobile-Marketing-Experten in der Firmenzentrale weilte anstatt in der Münchner Dependance, in der ihr eigentliches Büro war. War auch schwierig zu erklären, warum sie nicht so genau erklären konnte, dass niemand so genau wusste, wie viele Monate dieses Gipfeltreffen in etwa dauern würde.
»Luxemburg! Himmlisch!« Frau Loibl startete einen Vortrag über dichte Wälder und reizende Mittelalterarchitektur, der zu einem Monolog ohne Publikum wurde, als Wolf, Einkäufe und Kind umständlich balancierend, seine Wohnungstür auf- und hinter sich wieder verschloss. Er legte Maxine sanft unter ihr vielfach preisgekröntes Mobile und kochte sich den Kaffee, der alles verändern würde. Er begab sich an seinen Schreibtisch. Er setzte gerade die Tasse an die Lippen, als Maxine dem ganzen Haus ihr Erwachen verkündete. Auf das dämliche Mobile war sie noch nie reingefallen.
3
Holly McRose, der Highlander und ein mutmaßliches Mordopfer
Magnus McLuv schob den Dudelsack zurecht, sodass er auf seinen nackten, muskulösen Schenkeln zu liegen kam. So konnten Magnus’ starke Arme Miriam bequem an seine breite Brust ziehen. Die untergehende Sonne spielte sinnlich in den seidigen, wogenden Haaren des Highlanders, als er in einem dunklen, warmen Bariton sagte: »Oh, Miriam, auch wenn wir aus unterschiedlichen Welten und unterschiedlichen Zeitaltern kommen, so hat uns das Schicksal doch zusammengeführt, und dem Schicksal kann man nicht entfliehen. Es kann für mich nur eine geben. Und das bist du!«
Miriam schmolz in seinen Armen dahin wie ein Esslöffel Butter in einer vorgeheizten Pfanne, als sie seufzte: »Boah, Alter, wenn dieses Kind die ganze Zeit schreit, kann ich mich echt nicht konzentrieren!«
Jetzt schrie es schon wieder. Durch Wolfs geschlossene Wohnungstür hindurch in das Treppenhaus, wo das Geschrei an Hall gewann, dann durch Hollys geschlossene Wohnungstür hindurch in ihr Arbeitszimmer mit seinen bunten, zerlesenen, ungeordneten Taschenbücherstapeln und beidseitig genutzten Taschenbücherregalen, Motto-Katzenpostern und schottischen Landschaftskalendern direkt in ihr Mark und Bein.
So konnte sie nicht arbeiten. Ihr nächster Roman musste bis Freitag fertig werden, damit sie sich am Samstagvormittag in aller Ruhe den übernächsten ausdenken konnte. Und dann war da noch dieser Mordfall, den sie lösen musste, wenn es sonst schon keiner tun mochte. Wegen der Gerechtigkeit. Aber auch zur Inspiration. So ein Mord hatte ja meistens nicht nur Nachteile.
Amadeus Wolf aus der Wohnung gegenüber konnte bestimmt ebenfalls ein wenig Inspiration gebrauchen. Selbst wenn das Babygeschrei sie bei der Arbeit störte, konnte sie ihrem Nachbarn nicht böse sein. Der arme Mann. War den ganzen Tag allein mit dem Kind, die Frau Gott weiß wo. Wahrscheinlich kam er noch weniger zum Schreiben als Holly. Sie würde ein weiteres Mal versuchen, ihn für ihr investigatives Projekt zu gewinnen. Sicher, er hatte schon einmal abgelehnt, in wenigen wie unmissverständlichen Worten, aber manche Menschen wollten eben zu ihrem Glück gezwungen werden. Er war einfach ein bisschen schüchtern. Einer von diesen Schriftstellern, die allein im stillen Kämmerlein vor sich hin brüteten. In seinem Fall natürlich nicht ganz allein und in einem momentan alles andere als stillen Kämmerlein. Holly hingegen gehörte zu der Sorte, die keine Convention ausließ und über ihre multiplen Social-Media-Kanäle in ständigem Kontakt zu ihren Leserinnen stand, um stets die neuesten Mehrheitsmeinungen zu Figurenentwicklungen, Handlungswendungen und Covermotiven einzuholen. Das war sie ihren Fans schon schuldig.
Und ihrem Nachbarn war sie es schuldig, ihn aus seiner alleinerziehenden Misere zu befreien, zumindest vorübergehend. Und natürlich rein platonisch. Sie erhob sich von ihrem Sitzball, wuschelte sich die roten Haare zurecht, rückte die runde Brille gerade und überlegte, ob sie aus ihrem Trainingsanzug in etwas Formelleres wechseln sollte. Sie entschied sich dagegen. Die Leute erstarrten oft in überhaupt nicht angebrachter Ehrfurcht, wenn sie vor so einer berühmten Wortschmiedin standen. Wenn sie an Wolfs Tür klingelte, wollte sie nachbarschaftlich und nahbar wirken, um ihn nicht einzuschüchtern.
Das Kind hörte trotz aller babysprachlichen Beschwichtigungsversuche des Vaters und seiner körperlichen Nähe nicht auf zu schreien, und nun klingelte es auch noch an der Tür. Durch den Spion sah Wolf das türspiontypische Zerrbild seiner Nachbarin von gegenüber. Holly McRose. Schnulzenautorin. Äußerst produktiv. Selbstverständlich nicht ihr richtiger Name. Wahrscheinlich in seinem Alter, sah aber jünger aus. Ihr Problem. Sah außerdem so aus, als käme sie gerade vom Sport. Erst recht ihr Problem. Nur unwesentlich angenehmere Gesellschaft als die alte Frau Loibl. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und fragte, was es gäbe.
»Darf ich reinkommen?«, fragte Holly.
»Warum?«
»Ich war noch nie bei Ihnen drin.«
»Das ist doch kein –«
»Danke.« Schon war sie hereingeschlüpft. Irgendwie hatte sie unmerklich den Türspalt vergrößert und ihren kleinen, schmächtigen Körper hindurchgemogelt.
»… Problem. Frau McRose …«
»Ach, nennen Sie mich Holly.«
»Gut. Holly. Nennen Sie mich Amadeus, wenn es sein muss.«
Sie lachte. »Ganz bestimmt nicht. Ich bleibe bei Wolf.« Das war ihm recht. Er mochte seinen Vornamen nicht sonderlich. Der erinnerte ihn nur daran, welcher Versager er in den Augen seiner Eltern war. Seine literarische Karriere verstanden und billigten sie nicht. Sie hatten sich so sehr ein musikalisches Genie gewünscht. Leider war das schon in frühen Jahren an der Blockflöte gescheitert.
Angesichts der personellen Veränderung in ihrem unmittelbaren Umfeld hatte Maxine ihren Schreikrampf aufgegeben und war in großäugiger Neugier erstarrt. Wolf entschuldigte sich, ließ Holly im Flur stehen und ging ins Schlafzimmer, um seinem Kind die Flasche zu geben.
Holly sah sich um. So viele Bücher. Fast wie bei ihr zu Hause. Nur dass sie keines dieser Bücher kannte. War eigentlich klar, dass ihr Nachbar viele Bücher hatte. Er war schließlich auch ein Schriftsteller. Er hatte zwar nicht so viel geschrieben wie sie, aber das konnte ja noch kommen. Jeder fing mal klein an. Sie hatten so vieles gemeinsam. Sie konnte ihn unmöglich wegen des bisschen Babygeschreis rügen. Sie war doch nicht die alte Frau Loibl. Und überhaupt, es war schon wieder vorbei. So ein braves Kind.
Als Maxine auf absehbare Zeit zu voll zum Schreien war, kehrte Wolf zu seiner ungebetenen Besucherin zurück. Sie sah sich demonstrativ erneut um und sagte: »Wow, hier sieht es fast aus wie in einer Bibliothek!«
»Leider nur fast.«
»Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Benutzen Sie Ihre Bücherregale beidseitig.«
»Warum gehen wir nicht ins Wohnzimmer?«
Das Wohnzimmer war der Ort der Wohnung, der am wenigsten nach Bibliothek aussah. Es war vom weißen Ecksofa bis zu den beleuchtbaren Glasvitrinen komplett von Silke gestaltet worden. Sie hatte Wolf zugestanden, ein paar ausgewählte Bücher auch hier unterzubringen, solange sie »schön« seien. Nach derlei frivolen Kriterien konnte er natürlich nicht aussortieren. Beziehungsweise er konnte die Ordnung in den anderen Räumen nicht zerstören, indem er ausschließlich ansehnliche Ausgaben in eine Vitrine im Wohnzimmer transplantierte. Also hatte er für diesen Zweck lediglich ein paar seiner Bildbände über Nordkorea abgestellt.
»Oh, Sie haben auch einen Sitzball!«, rief Holly. »Sind die Dinger nicht toll, gerade beim Schreiben?«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Ja. Vielleicht. Muss wohl. Hört man ja immer wieder. Sollte ich mal ausprobieren.«
Nachdem sie sich gesetzt hatten (keiner auf dem Sitzball), Wolf ohne großen Enthusiasmus Kaffee angeboten und Holly mit großem Enthusiasmus angenommen hatte, Wolf wieder aufgestanden war und sich schließlich mit zwei großen Bechern wieder gesetzt hatte, fragte er: »Also: Was verschafft mir heute die Ehre Ihres Besuches?«
»Wussten Sie, dass die Polizei die Ermittlungen im Mordfall Niedermeyer offiziell eingestellt hat?«
Das schon wieder. »Meines Wissens ist es nie ein Mordfall gewesen, sondern ein tragischer Unfall.« Tragischer Unfall, dachte Wolf. Ich klinge wie jemand aus einem Unterhaltungsroman mit zu vielen unnötigen Adjektiven. Vielleicht einem McRose.
»Das glauben Sie doch selbst nicht. Einer wie Niedermeyer fällt nicht einfach so die Treppe runter. Der stirbt mit hundertzwanzig im Schlaf oder wird vorher …« Sie machte eine Geste mit dem Daumen vor ihrer Kehle und ein albernes Geräusch. »Der hatte viele Feinde.«
»Wie kommen Sie nur auf diese Ideen?«
»Wie kommen gerade Sie nicht auf solche Ideen?«
»Ich dachte, Sie schreiben Liebesromane.«
»Ich arbeite gerade an einem Mystery-Spin-off meiner Serie ›Ich liebe einen Highlander‹. Ich nenne sie ›Ein Highlander ermittelt‹.«
»Ist das derselbe Highlander? Der, der geliebt wird, und der, der ermittelt?«
»Na klar, es kann nur einen geben.« Sie lachte schallend, als hätte sie einen Witz gemacht.
Wolf schaute dumm aus der Wäsche.
»Das ist ein Highlander-Witz«, half Holly ihm auf die Sprünge.
»Tut mir leid, ich habe Ihre Bücher noch nicht gelesen.« Und ich gedenke, das auch in diesem Leben nicht mehr zu tun, selbst wenn Sie mir weiterhin jeden neuen Schmöker mit Widmung aufs Auge drücken, sobald er erschienen ist und Sie mich im Treppenhaus wittern.
»Das ist aus dem Film.«
»Dazu gibt es schon Filme?« Das erinnerte ihn schlagartig an etwas. Etwas so Erfreuliches, dass er unkontrolliert lächeln musste. Es war etwas, das seine finanzielle Eigenständigkeit zumindest für eine Weile sichern und ihm eine Galgenfristverlängerung für die Fertigstellung seines nächsten, bislang imaginären literarischen Meisterwerks verschaffen konnte.
»Ich meine den Film ›Highlander‹!«, erläuterte Holly. »Mit Christopher Lambert.«
»Ach, den. Habe ich nie gesehen. Neumodisches Zeug. Bei Filmen, muss ich gestehen, bin ich in den Siebzigern stehen geblieben.«
»Siebziger finde ich auch total stark. ›Star Wars‹ und so.«
Wolf stieg ein Hauch von Zornesröte ins Gesicht. »Das meine ich gerade nicht. ›Krieg der Sterne‹ hat alles zerstört. Eine vielleicht unbewusste, gleichwohl verheerende infantile Gegenreaktion auf das erwachsene New-Hollywood-Kino von Altman, Scorsese, Friedkin, Coppola, Bogdanovich. Quasi Old Hollywood in neuen, kunterbunten Schläuchen. Mit Lucas und Spielberg haben die Nerds das Filmgeschäft übernommen und es von Nerd-Generation zu Nerd-Generation weitervererbt. Deshalb gibt es seit Jahrzehnten nur noch geistloses Spielzeugverkaufskino für ewige Riesenbabys.«
Hollys Augen strahlten. »Ich weiß! Nerds sind so cool!«
»Kann man so oder so sehen. Wenn ich jedenfalls von den Siebzigern spreche, dann meine ich eher die frühen Siebziger.«
»In den frühen Siebzigern waren Sie doch noch gar nicht geboren«, gab Holly zu bedenken.
»Man kann sich kulturell zurückentwickeln. Oft ist das eine Weiterentwicklung.« Er musste das schnell aufschreiben, bevor er es vergaß. Vielleicht steckte da ein Roman drin. Oder zumindest der Beginn einer Aphorismensammlung.
Sie zwinkerte. »Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, was?«
»Das wäre schön.« Wolfs größter Traum war es, zwanzig Jahre älter zu sein, sodass er die Kultur, die er verehrte, noch in ihrer Entstehung hätte miterleben können. Andererseits wäre seine heutige Zuneigung dann kaum mehr als Nostalgie, und Nostalgie war Opium für den Pöbel. Das Leben machte es einem manchmal nicht leicht.
»›Highlander‹ ist jedenfalls ein Klassiker«, sagte Holly. »Wie ›Matrix‹ oder ›E.T.‹«
Wolf zeigte mit dem Finger auf sie. »Das fällt mir in letzter Zeit immer häufiger auf, dass die Leute ›Klassiker‹ sagen, wenn sie in Wirklichkeit meinen: ein seelenloser 08/15-Blockbuster, den ich als minderbemittelter Minderjähriger so toll fand, dass ich selbst heute, als mündiger Erwachsener, ums Verrecken nicht zugeben mag, dass er eigentlich ausgemachter Quatsch ist. ›Im Zeichen des Bösen‹ ist ein Klassiker. ›Das indische Grabmal‹ ist ein Klassiker. Natürlich das Original von 1921, nicht der neumodische Quatsch von 1959. ›Matrix‹ ist bloß lärmendes Popcornverzehrrahmenprogramm.« Er atmete tief durch. »Apropos Film. Ich muss dringend wohin.«
»Gut, ich wollte Sie auch gar nicht lange aufhalten. Ich wollte nur fragen, wie wir im Fall Niedermeyer weiter vorgehen.«
»Wie Sie schon sagten: Die Polizei ermittelt nicht mal.«
»Wie ich schon neulich sagte: Dann sollten wir beide es tun!«
»Wir? Wir beide?«
»Warum nicht? Frau Loibl ist zu alt, und der Herr Wagner ist … Sie wissen schon. Schwer zu sagen. Wir sind beide Schriftsteller. Beste Voraussetzungen.«
Es gefiel ihm nicht, dass Holly ihn und sich selbst auf ein und derselben Ebene verortete, nur weil sie beide als Haupterwerb Sätze produzierten. Sie momentan wahrscheinlich mehr als er. »Ich schreibe keine … Krimis.« Er bemühte sich, so wenig offenkundig verächtlich wie möglich zu klingen. Falls er sich mal irgendwann Milch oder Eier oder Baldrian leihen musste. »Ich gäbe kaum einen großen Ermittler ab.«
Sie sah ihn von oben bis unten an, als ob sie sich gerade zum ersten Mal begegneten, was leider nicht der Fall war. »Ich hatte Sie mir in der Tat größer vorgestellt. Hab ich schon gedacht, als ich Sie zum ersten Mal in echt im Treppenhaus gesehen hatte.«
Dabei fanden die meisten Menschen ihn ziemlich groß. Holly überragte er auf jeden Fall, wie ein unheilvoller Riese das Mädchen in einem Märchen. Oder wie der etwas tumbe, von der Dorfbevölkerung missverstandene Riese, mit dem das Mädchen sich anfreundet. Er hoffte, dass sein Bart in Kombination mit seiner Glatze ihn zusätzlich imposant erscheinen ließ. Wenn möglich zehn bis zwanzig Jahre älter, erfahrener, selbstsicherer. Ein Titan. Ein literarischer, vielleicht.
»Auf welcher Grundlage haben Sie denn Überlegungen über meine Körpergröße angestellt? Meiner Arbeit?« Eigentlich mochte er den Gedanken. Ein großes Werk muss von einem großen Mann geschrieben worden sein. So dachte sie wahrscheinlich.
»I wo, ich habe Ihr Buch ja gar nicht gelesen. Sie haben mir schließlich nie eins gegeben. Ich habe Überlegungen auf Grundlage Ihres Autorenfotos angestellt.«
»Wie kann man denn kleiner sein als auf seinem Autorenfoto? Haben Sie das Foto auf einer großformatigen Außenwerbung gesehen?«
»Das hätten Sie wohl gerne. Ich meine nur: Sie wirken darauf größer.«
»Aber auf dem Foto sind doch überhaupt keine Anhaltspunkte zum Schätzen meiner Größe. Keine Giraffe neben mir, und ich halte auch kein Streichholzheftchen in der Hand.«
Holly lachte. Stünde Wolf dieser Angewohnheit nicht grundsätzlich kritisch gegenüber, hätte er zugeben müssen, dass es kein unsympathisches Lachen war. Womöglich sogar ein diffus intelligentes. »Stellen Sie sich das mal vor, ein Autorenfoto mit beidem: Giraffe und Streichholzheftchen.« Sie stellte das Lachen abrupt ein. »Oje, das wäre gar nicht gut. Sie hätten sofort die Tierversteher am Hals. Peta-Shitstorm allererster Güte. Warum wollen Sie denn der armen Giraffe etwas antun?«
»Ich will keiner Giraffe irgendetwas antun!« Nun bekam er das Bild nicht aus seinem Kopf, wie er mit einem brennenden Streichholz eine Giraffe durch die Steppen jagte. Irgendwie hatte sich noch ein Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit ins Bild gemischt. Wahrscheinlich würde er in der Nacht davon träumen. Falls Maxine ihn schlafen ließ. Immerhin steckte vielleicht ein Roman drin. Vielleicht sogar ein kontroverser, Holly McRose mochte recht haben. »Ich meine nur, man kann von einem Autorenfoto, das wirklich nur den Autoren zeigt, nicht auf dessen Körpergröße schließen!«
»War halt nur so ein Eindruck von mir, dass Sie darauf größer wirken.« Sie musterte sein Gesicht. »Das Foto scheint ja auch schon etwas älter zu sein.«
»Ich bin seitdem stark geschrumpft. Genau wie meine Verkaufszahlen.«
»Dann schreiben Sie halt mal was Neues. Am besten einen Bestseller.«
»Ich …«
»Wissen Sie, was Sie mal schreiben sollten?«
»Nein …?«
»So eine Netflix-Serie. Die nehmen jetzt jeden. Ich arbeite gerade an zweien. Eine natürlich über die Liebe in den Highlands, basierend auf meinen Erfolgsromanen. Die andere ist ein Originalstoff. Eher leichte Muse. Dystopische Rural Romantasy für junge Zuschauerinnen.«
»Okay, mach ich.« Seine Antwort war sarkastisch gemeint, doch der Vorschlag war nicht so weit von dem entfernt, was ihm gerade durch den Kopf ging. Die Sache, die ihm tatsächlich genügend Zeit kaufen konnte, bis ihm der nächste Bestseller einfiel. Die Sache, auf die Holly ihn gebracht hatte. Das musste er ihr lassen. »War es das dann?«
»Ich sehe, Sie wollen mich loswerden. Sie können sich das mit der Mordermittlung ja noch mal durch den Kopf gehen lassen.« Sie stand auf.
»Das werde ich tun. Und ich unterbreche unser schönes, bereicherndes Gespräch nur ungern, aber ich muss nun meine Tochter weiterfüttern und dann gleich wieder weg.« Er erhob sich ebenfalls, um seine Besucherin in Richtung Tür zu manövrieren.
»Ach, wie schön«, sagte sie im Gehen. »Was isst denn die Kleine am liebsten?«
»Milch.«
»Und wo müssen Sie dann so dringend hin? Schon wieder?«
»Schon wieder?«
»Sie sind doch gerade erst vom Einkaufen zurückgekommen.«
Vielleicht machte sie sich wirklich nicht so schlecht als Ermittlerin, dachte Wolf. »Netflix«, sagte er.
»Ganz, ganz liebe Grüße!«
Als Holly wieder auf der anderen Seite der nun geschlossenen Tür stand, konnte sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sie wusste, dass sie ihn hatte. Eine Frau spürte so etwas. Dabei hatte sie ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen. Sie wusste, dass sie diesen Mann benutzte. Sie benutzte diesen guten, harmlosen Mann als Hilfe. Nicht nur bei der Aufklärung eines Mordfalls. Das würde sie zur Not auch allein hinkriegen. Er würde ihr ebenso bei einer viel heikleren Aufgabe helfen. Einer, die ihr nach wie vor mehr Schwierigkeiten bereitete, als sie sich selbst eingestehen wollte. Er würde ihr dabei helfen, herauszukommen. Aus dem Haus und aus allem.
4
Das Buch zum Film
Wolf und Maxine waren nicht auf dem Weg zu Netflix, sondern zu Wolfs Agenten. Das Kind schrie verlässlich die gesamte U-Bahnfahrt vom Moosacher St.-Martins-Platz bis zur Münchner Freiheit, was nicht unbemerkt blieb. Sobald sie die Agentur Schmidbauer in einer üppig begrünten, verkehrsberuhigten Seitenstraße erreicht hatten, war sie ein mucksmäuschenstiller Sonnenschein.
»So ein braves Kind, beneidenswert!«, sagte Udo Schmidbauer, als er Wolf an seiner Bürotür abholte und mit übertriebener Geste hereinbat.
Wolf bezweifelte, dass er ihn wirklich beneidete. Schmidbauers Kinder waren beide lange erwachsen, hatten eigene Agenturen in Hamburg und Berlin eröffnet. Die schliefen vermutlich die Nacht durch, mussten nicht mehr gewickelt werden und bekamen auch bei Tag keine Schreikrämpfe mehr. Obwohl natürlich hinsichtlich des Schreikrampfs selbst im Erwachsenenalter viele nicht drüberstanden, vor allem in Führungspositionen.
Doch wenn die jungen Schmidbauers nach dem Alten kamen, mussten sie recht umgängliche Gesellen sein. Möglicherweise würden sie irgendwann die Klienten ihres Vaters übernehmen, wenn er sich zur Ruhe setzte, womit er seit Jahren drohte, ohne jemals Anstalten zu machen, diesen Drohungen Taten folgen zu lassen. Fürs Erste blieb er, wo er war und was er war. Der Pferdeschwanz, den er seit fast fünfzig Jahren für unkonventionell hielt, eher weiß als grau, jede Bewegung des dürren Körpers in Tweedsakko und leger gemeinter Jeanshose ein einziges Schlottern, aber der Verstand messerscharf wie eh und je, der Enthusiasmus für seinen Auftrag ungebrochen. Wolf konnte sich nicht vorstellen, sich von einem anderen vertreten zu lassen. Ob er nun etwas zu vertreten hatte oder nicht.
Wolf nahm im angebotenen Sessel vor Schmidbauers Schreibtisch Platz, der so bequem war, wie er antik aussah. Der Agent selbst setzte sich hinter den Tisch, vor die hohen Fenster, die einen idyllischen Ausblick in den sonnendurchfluteten Garten erlaubten, unter dessen Bäumen nach legendären Feierveranstaltungen schon manche literarische Größe zwangsgenächtigt hatte.
Die geschäftsmäßige Sitzordnung beruhigte Wolf. Das bedeutete, dass Schmidbauer nach wie vor davon ausging, dass es zwischen ihnen Geschäftliches zu besprechen gab. Für einen ungezwungenen Plausch, vielleicht sogar für ein sanftes Gehenlassen, hätte der Agent seinen Autor in die Sitzecke vor den Bücherregalen nahe dem Kamin gebeten. Der Sommer war bereits gekommen, da musste im schwarzen Schlund kein Feuer lodern.
Mit einem Blick in das prominenteste Regal im Büro stellte Wolf erleichtert fest, dass er dort weiterhin gut sichtbar präsentiert war. Mit seinem ersten Kurzgeschichtenband »Touristen in der Horrorsozialwelt«, der zwei Förderpreise gewonnen hatte und schließlich in einem Braunschweiger Kleinverlag erschienen war, und natürlich mit seinem großen Wurf, »Nirgendwoland«, dem Romanepos einer Generation, die sich gemeinhin nicht als Generation sehen mochte und auf Romanepen eher allergisch reagierte. Als der in mehr als einer Hinsicht sperrige Wälzer erschienen war, war Wolf kurz vor Mitte zwanzig gewesen. Da war er gerade noch als Wunderkind durchgegangen. Diesen Bonus hatte er nun verspielt.
Die Männer erlaubten sich ein bisschen unverbindlichen Small Talk über Leid und Freud der Vaterschaft, über Bücher, die sie unlängst gelesen hatten, zu lesen beabsichtigten oder dem anderen unbedingt zu lesen anrieten. Schließlich brachte Schmidbauer das Gespräch feinfühlig auf Wolfs eigenes Schreiben. Dabei war Wolf gar nicht so direkt wegen seines eigenen Schreibens gekommen. Zumindest nicht wegen gegenwärtigen oder zukünftigen Schreibens. Er legte seine Schwierigkeiten dar und erwähnte, dass seine umtriebige Nachbarin, die im allerweitesten Sinne ebenfalls literarisch tätig war, diese Schwierigkeiten offenbar nicht hatte. Er seufzte. »Vielleicht sollte ich auch auf dystopische Rural Romantasy umsatteln.«
Schmidbauers Gesicht leuchtete auf. »Das könntest du?«
Wolfs Miene verfinsterte sich. »Das möchtest du?«
»Ich habe da keine Berührungsängste. So funktioniert das Geschäft, bei Verlagen wie bei Agenturen. Einige wenige erfolgreiche Titel finanzieren die guten und wichtigen. Der erotische Historienbestseller ›Die Radldirne‹ hat es mir ermöglicht, zwei oder drei experimentelle Lyriker unter Vertrag zu nehmen, von denen man nur hoffen kann, dass sie irgendwann irgendwelche Preise gewinnen, von denen dann in der Zeitung berichtet wird und einige der zwei bis drei letzten Zeitungsleser diese Bücher kaufen. Falls du es mal mit Young Adult versuchen wolltest, würde ich lediglich zu einem Pseudonym raten, um dein Branding nicht zu verwässern. Irgendwas Englisches, vielleicht was Weibliches. Oder Fluides. Kommt auch auf den Stoff an.«
»Das war es eigentlich nicht, weshalb ich …«
Schmidbauer drehte sich um und schaute verträumt aus dem Fenster. »Und wenn erst mal der Film zur ›Radldirne‹ rauskommt, hole ich mir vielleicht noch ein paar Lyriker mehr.«
Wolf räusperte sich. »Film. Gutes Stichwort. Darüber wollte ich mit dir sprechen.«
Schmidbauer winkte mit großen, wedelnden Bewegungen ab. »Ich weiß, du bist nicht interessiert. Das Vetorecht für dich hätte ich niemals durchboxen dürfen. Aber es konnte ja keiner ahnen, dass ›Nirgendwoland‹ so ein Erfolg wird.«
Wolf lächelte anerkennend. »Keiner außer dir.«
Schmidbauer grinste spitzbübisch.
Wolf entgleisten die Züge. »Du meinst, ich bin einer von deinen … experimentellen Lyrikern?«
»Das darfst du als Kompliment auffassen. Weißt du, warum ich dich damals aufgenommen habe?«
»Weil dir mein Manuskript gefallen hat … habe ich die längste Zeit gedacht.«
»Das hat es. Sehr sogar. Es war schwierig, post-avantgardistisch und deprimierend. Ich war sofort verliebt! Ich schätzte es außerdem als schwer vermittelbar ein. Schwer bis unmöglich. Aber zu unser beider Glück hatte gerade Uwe ›Kalle‹ Kalkowski bei mir unterzeichnet.«
»Sagt mir nichts.«
»Der Auswanderer-King. ›Von Wuppertal nach Winnipeg‹. Eine ganz große Nummer auf RTL2. Kein todsicherer Literaturnobelpreiskandidat, doch der Name allein bewegt Einheiten. Besonders zu Weihnachten, wenn die Leute verzweifelt sind. Er hat jetzt ein Reisebuch, ein Kochbuch und eins über Autotuning veröffentlicht. Seine Autoren arbeiten gerade an etwas ganz Persönlichem über seine Katzen.«
»Wahrscheinlich sollte ich ihm dankbar sein. Ihm und seinen Autoren.«
»Erstaunlicherweise hast du noch mehr Bücher verkauft als er.«
»Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.«
»Du weißt genau, was du geleistet hast. Alle im Literarischen Quartett liebten ›Nirgendwoland‹.«
»Alle außer Biller.«
»Ach, der fühlte sich nur bedroht. Du weißt doch, wie er sein kann.«
Wolf hatte keine Ahnung, wie Biller sein konnte. Er bemühte sich dennoch, Schmidbauers verschwörerisches Grinsen wissend zu reproduzieren. »Ich weiß, du wartest auf ›Nirgendwoland 2‹. Alle warten auf ›Nirgendwoland 2‹. Aber …«
Tatsächlich war Schmidbauer die Enttäuschung darüber, dass Wolf offenbar nicht mit erfreulichen Fortschrittsberichten gekommen war, kaum anzumerken. Als Profi wusste er, dass man Autoren in dieser Lage besser aufbaute, als sie unter Druck zu setzen. Andererseits war inzwischen, nach allzu vielen solcher Treffen, jede »Ach, du schaffst das!«-Phrase längst jenseits aller Glaubwürdigkeit. Also sagte er: »Hey, wenn bei dir selbst gerade die Einfälle nicht so sprudeln, kannst du gerne für einen meiner Reality- oder YouTube-Klienten ghosten. Wir haben noch keinen für die Lebensbeichte von La Veroniqua, der Styling-Queen aus dem Hostessen-Camp. Ihre Catchphrase ist: ›Alte, ich mach dich Laufsteg!‹ Wahrscheinlich wird eine geistreiche Variation davon der Titel ihrer Autobiografie. Aber das überlasse ich euch beiden.«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich den Auftrag annehme.«
Schmidbauer sah ihn mitleidig an. »Vielleicht solltest du das. Wenn du nicht gerade ein brillantes, fertiges Überraschungsmanuskript in deiner Wickeltasche hast …«
»Habe ich nicht.«
»Dann solltest du dich nach neuen Einnahmequellen umsehen.«
»Keine Sorge, Silke verdient genug bei Buystuff.« Nur wie lange Silkes Geld noch Familiengeld war, stand in den Sternen.
»Aber wie lange kannst du daran noch teilhaben? Jetzt, wo sie dich verlassen hat.« Man konnte ihm nichts vormachen.
»Sie hat mich nicht verlassen! Außerdem bin ich gekommen, um dir die frohe Kunde zu bringen: Ich werde die Verträge für die Filmrechte doch unterschreiben.«
»Nein!«
»Doch!«
»Oh!«
»Oh?«
»Ich wusste nicht, dass es dir so schlecht geht.«
»Es geht mir nicht schlecht. Ich dachte mir nur: Sei’s drum. Der Film wird das Buch ja nicht ersetzen. Ich muss mir den nicht mal angucken. Ich muss nichts damit zu tun haben. Ich muss keine Interviews geben, gar nichts. Nur das Geld einstreichen. Quasi Gratis-Geld.«
Schmidbauer beugte seinen zierlichen Körper über seine gewaltige Tischplatte, kratzte sich verlegen im straff gebundenen Haar. »Tja, das ist so eine Sache … Laut Vertrag müsstest du für Promo-Interviews zur Verfügung stehen und Sachen sagen wie ›Das ganze Team war wie eine große Familie‹ und ›Ich hätte mir keinen besseren Regisseur und Hauptdarsteller wünschen können‹.«
Aus Wolf entwich alle Luft. »Das kann ich nicht.«
»Du darfst auf jeden Fall nicht wieder sagen: ›Dieser große grinsende Dummvogel hält sich für den Retter des deutschen Kinos, dabei ist er dessen aasstinkender Totengräber.‹ Also nicht so wie letztes Mal, als du die Verhandlungen hast platzen lassen.«
»Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass ich mich komplett raushalte? Sag nichts Böses und muss nicht lügen?«
Schmidbauer seufzte. »Wir müssten den Vertrag neu aufsetzen. Prinzipiell kein Problem. Dauert allerdings eine Weile, bis alle Parteien wieder drübergesehen haben. Eine Entschuldigung für den ›aasstinkenden Totengräber‹ wäre bestimmt prozessförderlich. Es könnte trotzdem ein bisschen weniger rausspringen. Ganz ehrlich, der Titel ist nicht mehr ganz so heiß wie letztes Jahr.«
»Aber so ein Film wird sich bestimmt noch mal positiv auf die Buchverkäufe auswirken.«
Schmidbauer nickte. »Besonders wenn eine Neuausgabe mit Filmplakatmotiv und einem ›Das Buch zum Film‹-Sticker auf den Markt kommt.«
»Nur über meine …«
Schmidbauer biss sich auf die Unterlippe. »Du musst dir unbedingt bewusst machen, dass du nicht mehr am längeren Hebel dieser Verhandlungen sitzt …«
»›Das Parfum‹ wurde erst Jahrzehnte nach der Buchveröffentlichung verfilmt. Ich glaube nicht, dass da jemand dem Süskind gesagt hat, er säße nicht mehr am längeren Hebel der Verhandlungen.«