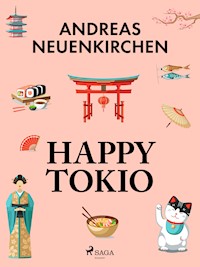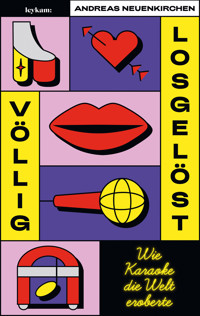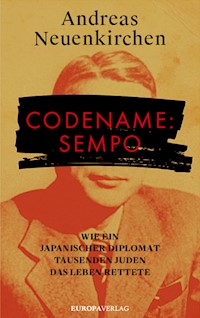
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1940 ist Chiune "Sempo" Sugihara offiziell der japanische Vize-Konsul in Litauen. Tatsächlich aber spioniert er als Agent seines Außenministeriums deutsche und russische Truppenbewegungen aus. Seit seinen Lehrjahren in japanischen Kolonien ein entschiedener Gegner von Tyrannei und Unterdrückung, nimmt er sich der jüdischen Flüchtlinge an, die sein Konsulat belagern. Gemeinsam mit einem kreativen holländischen Konsul und einem profitorientierten russischen Kommunisten heckt er einen wahnwitzigen Plan aus, ihnen mit Visa zweifelhafter Gültigkeit die freie Passage nach Japan zu ermöglichen. Für die Juden beginnt eine aufreibende Odyssee durchs eiskalte Sibirien und über die raue japanische See in die Freiheit. Für Sugihara folgen Kriegsgefangenschaft, die unehrenhafte Entlassung aus dem Staatsdienst, Gelegenheitsjobs in Japan und Russland. Erst Jahrzehnte später erfährt er, dass sein Plan aufgegangen ist, und erst kurz vor seinem Tod wird er als Held des Holocaust anerkannt. Dieses Buch erzählt zum ersten Mal ausführlich in deutscher Sprache die Geschichte seines außergewöhnlichen Lebens, von der Kindheit als brillanter, aber eigensinniger Schüler über die Jahre als Student und angehender Spion in der Mandschurei und Korea bis zu seinem größten menschlichen Triumph im kriegsgebeutelten Europa. Es schildert den tiefen Fall danach sowie die späte, emotionale Wiedervereinigung mit denen, deren Leben er retten konnte. Eine wahre, packende Geschichte vor dem Panorama einer Welt und Weltordnung im radikalen Wandel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Neuenkirchen
CODENAME:SEMPO
Wie ein japanischer DiplomatTausenden Juden das Leben rettete
1. eBook-Ausgabe 2022© 2022 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, MünchenUmschlaggestaltung und Motiv:Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Motivs von © picture alliance / Kyodo / MAXPPPRedaktion: Franz LeipoldLayout & Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 9-783-95890-491-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
PROLOG
Wer war Herr Sugihara?
KAPITEL 1
Zwischen den Kriegen, zwischen den Jahrhunderten
KAPITEL 2
Neue Zeiten, andere Sitten
KAPITEL 3
Ein guter Schüler mit eigenem Kopf
KAPITEL 4
In der Schule der Spione
KAPITEL 5
Baseball-Diplomatie und die Essstäbchen-Allianz
KAPITEL 6
Unter Nordlichtern
KAPITEL 7
Die Schweiz des Ostblocks, das Casablanca Europas
KAPITEL 8
Eine Verschwörung der Gerechten
KAPITEL 9
Nazis & Partisanen
KAPITEL 10
In Gefangenschaften
KAPITEL 11
Der Hafen der Hoffnung
KAPITEL 12
Held, Verräter, Handlungsreisender
KAPITEL 13
Ein Gerechter unter den Völkern
KAPITEL 14
Der Schindler Japans oder der allerletzte Samurai?
ANMERKUNGEN & DANKSAGUNGEN
HANDELNDE PERSONEN
DIE FAMILIE
Chiune Sugihara:
ein Diplomat, Spion, Soldat, Übersetzer und Kaufmann
Yukiko Sugihara:
seine Ehefrau
Hiroki, Chiaki, Haruki und Nobuki:
die Söhne der Sugiharas
Setsuko Kikuchi:
Yukiko Sugiharas Schwester und Kindermädchen der Familie in Europa
Yatsu Sugihara:
Chiunes Mutter
Yoshimizu Sugihara:
Chiunes Vater, ein Steuereintreiber und späterer Gastwirt
Toyoaki Sugihara:
Chiunes älterer Bruder
Ryuko Sugihara:
Chiunes jüngere Schwester
IN HARBIN
Klaudia Semionova Apollonova:
Chiune Sugiharas erste Ehefrau
Semion Apollonov:
ihr Vater, ein Wachposten der Transmandschurischen Eisenbahn
Konstantin Ivanovich Nakamura:
ein Friseur und Schwerverbrecher
Chu’ichi Ōhashi:
Sugiharas Vorgesetzter in verschiedenen Positionen
Giichi Shimura:
ein Freund und Kollege Sugiharas
Tadakazu Kasai:
Freund Sugiharas, später Botschafter Mandschukuos in Deutschland
Shinpei Gotō:
Gründer der Harbin Gakuin, später u. a. Bürgermeister von Tokio und Präsident des japanischen Pfadfinderverbandes
Kenji Doihara:
ein japanischer Spion und General mit dem Beinamen »Lawrence von Mandschurien«
Kiichirō Higuchi:
ein Generalleutnant der Kaiserlich Japanischen Armee
Yōsuke Matsuoka:
Präsident der Südmandschurischen Eisenbahn, später japanischer Außenminister
Shigenori Tōgō:
ein Kollege Sugiharas im Umfeld der Transmandschurischen Eisenbahn, später u. a. japanischer Botschafter in Deutschland
IN KAUNAS
Borislav:
Assistent Chiune Sugiharas
Wolfgang Gudze:
ein deutscher Angestellter im japanischen Konsulat
Jadvyga Ulvydaite:
eine Nachbarin der Sugiharas
Solly Ganor:
ein junger Filmfreund
Anushka:
seine Tante
Serach Wahrhaftig, Joshua Nishri, Samuel Graudenz, Zvi Klementynovsky und Joseph Ogur:
Sprecher der jüdischen Flüchtlinge vor dem japanischen Konsulat
Moshe Zupnik:
ein Rabbinerschüler
Shōjirō Ōtaka:
japanischer Konsul in Litauen, nominell Sugiharas Vorgesetzter
Jan Zwartendijk:
Elektronikhändler und holländischer Konsul
Wladimir Georgijewitsch Dekanosow:
stellvertretender Volkskommissar für Auswärtige Beziehungen im russischen Konsulat
IN BERLIN
Hiroshi Ōshima und Saburo Kurusu:
japanische Botschafter
Joachim von Ribbentrop:
deutscher Reichsminister des Auswärtigen
Adolf Hitler:
Diktator des Deutschen Reiches
PROLOG
WER WAR HERR SUGIHARA?
Großer Medienrummel kommt über einen kleinen Ort.
Ein Geheimnis wird gelüftet.
Eine Frage bleibt.
Kamakura war einmal die einwohnerreichste Stadt Japans und fungierte sogar als dessen Hauptstadt. Eine ganze Epoche der Landesgeschichte ist nach ihr benannt. Die ist nun allerdings schon seit über 700 Jahren vorbei. Die Geschicke des Landes werden inzwischen etwa 50 Kilometer östlich in Tokio gelenkt, und Kamakura hat sich zu einem recht beschaulichen Küstenort moderater Größe gesundgeschrumpft, der mit religiösen Sehenswürdigkeiten, bunten Volksfesten, Surf- und Badevergnügen einen stetigen Fluss stadtmüder Wochenendausflügler anlockt. Die große Buddhastatue ist wahrscheinlich eine der meistfotografierten der Welt, an den Stränden geht es in den drückend heißen Sommern schon mal hoch her.
Trubel und ein gewisses Maß an Medieninteresse sind die Einwohnerinnen und Einwohner Kamakuras also durchaus gewohnt. Doch was da im August 1986 über die ruhige Nachbarschaft hereinbrach, in der im Monat zuvor der unauffällige Herr Sugihara im Alter von 86 Jahren gestorben war, war für seine Nachbarn doch ungewohnt. Zur Beisetzung kamen Hunderte von Berichterstattern und Gästen aus aller Welt. Bei den meisten handelte es sich um Juden. Selbst Yacoov Cohen, der israelische Botschafter in Japan, ließ es sich nicht nehmen, dem Ereignis beizuwohnen. Etliche russische Geschäftsleute wollten Herrn Sugihara ebenfalls die letzte Ehre erweisen.
Nun fragten sich diejenigen, die den Verstorbenen in den letzten Jahren seines Lebens zu kennen geglaubt hatten: Wer war dieser Herr Sugihara eigentlich wirklich gewesen? Er hatte als Händler in Japan und im Ausland gearbeitet, so viel wusste man, sich dann zur Ruhe gesetzt, wie man es in einem gewissen Alter nun mal tut, und mit seiner Frau Yukiko ein zurückgezogenes Leben an einem Ort geführt, der aus unterschiedlichen Gründen vor allem recht junge und etwas ältere Menschen anzieht. Seit längerer Zeit war er schwer krank gewesen und hatte nur noch selten das Haus verlassen. Das, was jetzt über ihn berichtet wurde, passte so gar nicht zu dem Bild des gebrechlichen, pensionierten Handelsreisenden. Ein international tätiger Spion soll er gewesen sein, der fließend mehrere Sprachen sprach. Schließlich ein Rebell gegen das System, das ihn hervorgebracht hatte, und ein tragischer Held des Holocausts, der als Konsul in Litauen gegen die Anordnung der japanischen Regierung Tausenden von Juden das Leben gerettet hatte und dabei kaum mit dem eigenen davongekommen war. Ein Verräter oder ein Heiliger, je nachdem, wen man fragte. Als Mensch ein Mysterium, als Figur ein Mythos.
Und so blieb trotz aller frisch gewonnener Erkenntnisse über die Verdienste des kranken alten Herrn die Frage: Wer genau war dieser Chiune Sugihara?
KAPITEL 1
ZWISCHEN DEN KRIEGEN,ZWISCHEN DEN JAHRHUNDERTEN
Herr Iwai zieht in den Krieg, Herr Sugihara kehrt zurück.
Frau Iwai heiratet unter ihrem Stand.
Chiune lernt früh zu schwimmen, im Fluss und in der Gesellschaft.
Um ein Haar wäre der Vater des Diplomaten, Spions, Soldaten und Kaufmanns Chiune Sugihara gestorben, bevor er einen Sohn hätte zeugen können. Sogar bevor er selbst ein Sugihara werden konnte.
Im August 1894 brach zwischen Japan und China Krieg um die Vorherrschaft in Korea aus. Im folgenden Jahr wurde Yoshimizu Sugihara an die Front gerufen. Nur hieß er da noch nicht Yoshimizu Sugihara. Sein Name lautete Mitsugoro Iwai. Iwai war ein häufiger Familienname in seiner Heimatpräfektur Gifu. Doch nicht alle Iwais waren eine große Familie, und nicht alle Iwais waren gleichermaßen angesehen. Yoshimizu gehörte zu den niederen Iwais. Seine Familienlinie lässt sich kaum zurückverfolgen, und während des Krieges schien es ziemlich wahrscheinlich, dass sie bei ihm enden würde.
Dass er beinahe als Kriegstoter auf den Schlachtfeldern in China oder der Mandschurei geendet wäre, war derweil nicht den Schwertern, Speeren, Pfeilen, Spießen und Hellebarden der kaum organisierten chinesischen Heere geschuldet, die gegen die Feuerkraft der Repetierbüchsen und Krupp-Kanonen der Kaiserlich Japanischen Armee wenig ausrichten konnten. Es war die Tuberkulose, die ihn niederstreckte. Doch ein freundlicher Offizier namens Kosui Sugihara nahm sich seiner an. Er pflegte Iwai wieder gesund. Aus Dankbarkeit ließ sich Iwai von Offizier Sugihara adoptieren, woraufhin er den Familiennamen seines neuen Vaters übernahm. Das war im Japan jener Zeit keine ungewöhnliche Praxis. Und noch heute gefällt es manchen, sich im Erwachsenenalter einen neuen Vornamen zu wählen, der besser zum Selbstbild passt. Dabei wird diese Namensänderung nicht immer offiziell vorgenommen, sondern lediglich informell im Alltag praktiziert. Laut einigen Quellen soll der ehemalige Iwai von seinem Wohltäter auch den Vornamen Kosui übernommen haben, meistens jedoch wird er als Yoshimizu oder Yoshimi gelistet.
Die Namensänderung ist verbürgt, die Beweggründe sind Legende. Einer anderen Theorie zufolge wollte der ehemalige Iwai lediglich eine größere Trefferquote bei der Zustellung seiner Post bewirken. Es gab einfach zu viele Iwais vor Ort.
Obwohl er über so viel Weitsicht nicht verfügt haben wird, führte die Namensänderung auch zu weniger Verwirrung, als er nach seiner vollständigen Genesung auf Freiersfüßen durch die Straßen Gifus wandelte. Bald fand er eine Dame, der er den Hof machen wollte, und sie war ebenfalls eine Iwai. Nicht nur irgendeine. Heute würde man sagen: Sie spielte außerhalb seiner Liga. Yatsu Iwai war nicht nur als die Stadtschönheit bekannt, sie war außerdem von edler Abstammung. Eine von den besseren Iwais. Sie entstammte einem Samuraigeschlecht mit langer Tradition und einigen Vermögenswerten. Dennoch beschied sie sein Werben positiv. Aus den beiden Iwais wurde eine Familie, und zu zweit blieben sie auch nicht lange. Nicht mal zu dritt. Nach dem kleinen Toyoaki wurde ihnen am 1. Januar 1900 in der Stadt Kōzuchi ihr zweiter Sohn Chiune Sugihara geboren. So steht es im Geburtenregister jenes Ortes (heute die Stadt Mino), und so wird es mittlerweile gemeinhin akzeptiert. Bis vor wenigen Jahren hatte auch die Kleinstadt Yaotsu, ebenfalls in der Präfektur Gifu, für sich beansprucht, Sugiharas Geburtsort zu sein, basierend auf zwei handgeschriebenen Dokumenten, die dem späteren Diplomaten zugeordnet wurden und für die man sogar die Aufnahme ins Weltdokumentenerbe der UNESCO beantragt hatte. Sein letzter lebender Sohn Nobuki bezweifelte allerdings die Authentizität der Schriftstücke, und tatsächlich wurden sie schließlich als Fälschungen entlarvt. Trotzdem hielt Yaotsu seinem vermeintlichen Sohn der Stadt die Treue, zumal er später mit seiner Familie tatsächlich dort lebte. Heute erinnern in jenem Ort ein Museum und ein Monument an den Mann, der knapp nicht dort geboren worden war.
Chiune Sugihara hatte nie großes Aufheben um sein nach westlicher Rechnung bemerkenswertes Geburtsdatum gemacht. Das Jahr 1900 war nach japanischem Kalender das Jahr 33 der Meiji-Zeit, benannt nach dem posthumen Namen ihres Kaisers Mutsuhito. Auch wenn der Krieg mit China vorüber war, sollte 1900 kein friedliches Jahr für Japan und China werden. Die japanische Armee unterstützte die britische dabei, den Boxeraufstand niederzuschlagen, bei dem selbst erklärte chinesische Freiheitskämpfer gegen ausländische Institutionen und chinesische Christen vorgingen. Es dauerte außerdem nicht mehr lange, bis die Kaiserliche Armee in ihren nächsten großen eigenen Krieg zog. Im Februar 1904 wurden bei einem Angriff auf russische Schiffe vor der chinesischen Küstenstadt Dalian die ersten Schüsse des Russisch-Japanischen Krieges abgefeuert. Der Konflikt, ausgelöst von Rivalitäten über Gebietsansprüche in der Mandschurei und in Korea, endete mit dem ersten Sieg einer asiatischen über eine europäische Großmacht in der Moderne.
Yoshimizu Sugihara, ehemals Mitsuguru Iwai, mischte diesmal nicht mit. Zumindest nicht an der Front. Er fand, dass er in seiner neuen Position seinem Land bereits ausreichend diente: Er arbeitete in seiner Region als Steuereintreiber des Kaisers.
Obwohl der Titel einen respektablen Stand suggerierte, war die Bezahlung eher solide als großzügig, und das Ansehen des kaiserlichen Steuereintreibers bei der gemeinen Bevölkerung war kaum besser als das irgendeines anderen Steuereintreibers. Sugihara sen. war den traditionsbewussteren Bürgerinnen und Bürgern zudem schon äußerlich suspekt. Obwohl er ein Amt ausfüllte, das in einer gewissen patriotischen Tradition stand, trug er westliche Kleidung wie Jacken und Hosen. Er legte bei Tanzveranstaltungen zu westlicher Musik eine heiße Sohle aufs Parkett und war Stammgast in den zu dieser Zeit neu eröffnenden Lichtspielhäusern der Gegend. Dieser Mann, der adrett zwischen Tanzpalast und Kino flanierte, mochte seinem Sohn Chiune in dessen späteren Jahren alles andere als unähnlich gewesen sein, auch wenn ihr Verhältnis da längst zerrüttet war. Yoshimizus kulturelle Neugier, die keine geografischen und ideologischen Grenzen kannte, war anscheinend vererbt.
Ob in Jacke und Hose oder Herren-Kimono, er machte seine Arbeit sehr gewissenhaft. Es kam nicht von ungefähr, dass Pfandhäuser in den aktiven Jahren des Steuereintreibers Sugihara die am schnellsten wachsenden Unternehmen in seinem Wirkungsgebiet waren. Der siegreiche Krieg gegen Russland kam seinem Wirken zugute. In Kriegszeiten beziehungsweise nach gewonnenen Kriegen ließen sich die Bürgerinnen und Bürger leichter in patriotische Wallungen bringen, und sie waren viel eher bereit, den Geldbeutel für den Staat zu öffnen. Für die Familie Sugihara fiel zusehends mehr ab. Zunächst lebte sie in einem Tempel, daraufhin zog sie um in eine Personalwohnung im Finanzamt von Nagoya. Schließlich konnte man sich ein kleines Eigenheim leisten.
Jenes Holzhaus befand sich nah am Fluss Kiso, der durch die Stadt Yaotsu floss. Ein vortrefflicher Platz zum Angeln, wovon der junge Chiune und sein zweieinhalb Jahre älterer Bruder Toyoaki reichlich Gebrauch machten, wenn sie nicht gerade in den Läden des Ortes ihr bescheidenes Taschengeld für Süßkartoffeln, Süßspeisen oder Reisgebäck ausgaben. Im Sommer konnte es in den Ebenen der Region unerträglich heiß werden, deshalb verbrachten die Jungen nicht nur einen großen Teil ihrer Freizeit im Fluss selbst, sondern vor allem im Haus ihrer Großmutter mütterlicherseits, das ein paar Kilometer entfernt in einem schattigen Bambushain auf einem Hügel lag.
Obwohl die Sugiharas nicht in Saus und Braus lebten, so hatten sie durch die Reserven der Mutter und das geregelte Einkommen des Vaters doch ein komfortableres Leben als die meisten Familien im Ort, die auf den Feldern schufteten; eine harte Arbeit, um die auch die jüngeren Familienmitglieder nicht herumkamen. Da die Sugihara-Familie nicht landwirtschaftlich tätig war und man von den Kindern kaum erwarten konnte, dass sie dem Vater beim Eintreiben der Steuern und bei der Buchführung halfen, hatten sie mehr Zeit für Spiel und Müßiggang als ihre Altersgenossen aus der Nachbarschaft. Bereits mit fünf Jahren war Chiune Sugihara ortsbekannt als ein exzellenter Schwimmer mit breiten Schultern. Er verfügte schon über den stechenden Blick, der später so viele Menschen, denen er beruflich oder privat begegnete, tief beeindrucken sollte. Der Fluss war sein Revier. Er und sein Bruder bauten sich Angelruten aus den Bambushalmen, die sie am Haus ihrer Großmutter schnitten. Die Schnüre fertigten sie aus Pferdeschwanzhaaren, die sie eigenhändig ausrupften. Wurmköder für ihre Fänge fanden sie mit Leichtigkeit am schlammigen Flussufer. Ihre Konkurrenten waren die Kormorane, die über dem Wasser ihre Runden zogen und blitzschnell hinabschossen, wenn sie unter der Oberfläche einen appetitanregenden Schwarm ausmachten.
Bisweilen waren die Vögel dabei nicht ganz so frei, wie man es gemeinhin mit ihrer Art assoziiert. Die beruflichen Fischer der Region nutzten sie für ihren eigenen Fang. Schnüre um den Hals verhinderten dabei, dass die Fische verschluckt wurden. Diese Kormoranfischerei wird noch heute in einigen Teilen Asiens praktiziert, ist allerdings inzwischen mehr Brauchtumspflege als ein Mittel, den Lebensunterhalt zu verdienen. Lediglich für Hindus und Buddhisten, die sich vorwiegend vegetarisch ernähren, hat die Methode nach wie vor praktischen Nutzen. Sie können dank ihr den einen oder anderen Fischtag einlegen, weil sie die Tiere nicht selbst töten, sondern diese Arbeit den Meeresvögeln überlassen.
Ausgehungert vom vorangegangenen Schwimmen, machten die Kinder nicht selten gleich am Angelplatz ein Feuer, brieten ihren Fang und verspeisten ihn vor Ort. Die Forellen des Flusses Kiso genießen einen hervorragenden Ruf. Das Kaiserhaus soll schon über tausend Jahre zuvor voll des Lobes gewesen sein, und später warb der Ort damit, dass Charlie Chaplin von der lokalen Methode des Kormoran-Fischens sehr angetan war. Chaplin war ohnehin begeistert von Japan und somit häufiger und gern gesehener Gast des Landes. Einige Hotels und andere Einrichtungen von touristischem Interesse werben damit, den berühmten Schauspieler und Regisseur einst als Gast gehabt zu haben.
Yaotsu wurde schnell vom Dorf zu einer boomenden Kleinstadt. Trotz seiner bäuerlichen Tradition zog der Ort viele Siedler an, die des Landlebens überdrüssig waren, obgleich die Verlockungen der Großstädte Tokio (damals bereits zwei Millionen Einwohner) und Osaka (knapp 900 000) sie finanziell oder mental überforderten. Verständlich: Die Tokioter selbst waren recht unzufrieden in Tokio. Demonstrationen gegen den Verfall des Lebensstandards arteten regelmäßig in Gewalt aus. Nicht jeder war glücklich über die militärischen Erfolge des Landes. Diejenigen, die nun randalierend durch die Straßen der Hauptstadt zogen und Straßenbahnen anzündeten, fanden, dass man ruhig mehr Geld für die Bevölkerung im Land als für das Töten ihrer angeblichen Feinde im Ausland ausgeben sollte und dass geschickte Diplomatie möglicherweise auf mannigfaltige Art mehr erreichen könnte als militärische Aggression.
In Yaotsu war man von solchen Debatten, und vor allem von solchen Ausschreitungen, weit entfernt. Zwischen 1890 und 1920 verdoppelte sich die Einwohnerzahl des Ortes auf knapp über 3500. Das mag noch nicht nach urbanem Flair klingen (dafür reicht es mit knapp 12 000 Einwohnern, weniger als Ende des letzten Jahrhunderts, auch heute nicht). Dennoch brachte der Zuwachs an neuen Bürgerinnen und Bürgern entscheidende Veränderungen mit sich. Die Straßen wurden zahlreicher und breiter, und nicht mehr jedes vierrädrige Fahrzeug, das darauf unterwegs war, wurde von Vierbeinern gezogen. Um die alten und neuen Bewohner zu bewirten, machten stetig mehr Teehäuser auf. Manche von ihnen waren fragwürdigen Rufes; die Bedienungen schenkten dort nicht nur Tee aus. Mutter Sugihara soll nicht unglücklich darüber gewesen sein, dass ihre Jungs einen Großteil ihrer Zeit bei den Fischern am Flussufer und bei der Großmutter auf dem Bambushügel verbrachten. Von einem allzu ausufernden Nachtleben war Yaotsu dennoch in den frühen Jahren dieser Expansion weit entfernt. Elektrizität und Telefone sollten noch Jahre auf sich warten lassen. Auch die erste Bücherei wurde deutlich nach dem ersten Bordell eröffnet, aber derlei Prioritäten stellen sich wohl an anderen Orten in anderen Teilen der Welt nicht anders dar.
Trotz des Wachstums war das gesellschaftliche Leben lange vom Gutdünken einiger weniger Großfamilien bestimmt. Die Familie Sugihara nahm da eine wackelige Sonderstellung ein. Der Vater, ein mittelloser Kriegsveteran, gleichwohl mit einem Beruf, der direkt dem Kaiserhaus unterstand. Die Mutter eine Hochwohlgeborene, trotzdem halt bloß eine Frau, die nach alten Gepflogenheiten mit ihrer Hochzeit Teil der Familie ihres Mannes geworden war, und nicht etwa umgekehrt. Dennoch drückten die feineren Familien des Ortes in dieser Angelegenheit gern ein Auge zu, wenn es um gesellschaftliche Anlässe ging. Dabei wurde allerdings nie ein Zweifel daran gelassen, dass es ohne dieses zugedrückte Auge nicht ging. Diese Umstände werden dem jungen Chiune nicht entgangen sein, machten ihn womöglich frühzeitig empfänglich für die Feinheiten gesellschaftlicher Hackordnungen und mitfühlend denen gegenüber, die sich am unteren Ende befanden.
KAPITEL 2
NEUE ZEITEN, ANDERE SITTEN
Ein Samurai spielt nicht Baseball.
Patrioten bekämpfen den Westen – mit Rindfleisch, aber ohne Taschenuhren.
Die Polen kommen (zwei zumindest).
Wenn der junge Chiune Sugihara nicht gerade schwamm oder angelte, glänzte er auf dem Baseballfeld. Oder auf irgendeiner freien Fläche, die als Baseballfeld herhalten musste. Der Sport mag einem so amerikanisch wie Coca-Cola erscheinen, doch heute ist er Volkssport Nummer eins in Japan, noch vor Sumo. Sein Siegeszug begann Ende des 19. Jahrhunderts, als das Spiel von einem amerikanischen Professor, der möglicherweise unter freizeitgestalterischen Entzugserscheinungen litt, nach Japan importiert wurde. Heute werden die Weltranglisten internationaler Spieler meist von Japanern angeführt. Dabei war das Spiel, das in Japan yakyu (Feldball) genannt wird, nicht immer unumstritten. Dr. Inazō Nitobe (1862–1933), seinerzeit einer der prägendsten Intellektuellen des Landes, nannte es einen »Sport für Taschendiebe«. Schließlich ginge es darum, bei der Umrundung des Spielfelds die Laufmale (bases) zu »stehlen«, wie es im Jargon heißt. Das konnte nicht gut sein für die Moral des Landes; wie vieles, was aus dem Westen kam.
Nitobe war eine Schlüsselfigur in der Zeit, in der Sugihara aufwuchs. Und obwohl sie die Einstellung zum Baseball nicht einte, hatten die beiden doch eine gewisse kosmopolitische Ader gemein. Obgleich Nitobe den Einfluss des Westens auf Japan kaum mit Begeisterung sah, war ihm am internationalen Austausch sehr gelegen. Sein Hauptwerk, Bushidō: Die Seele Japans, das bereits 1901 auf Deutsch erschien, schrieb er in Kalifornien, und zwar auf Englisch. Seinen Lebensabend verbrachte er in Kanada. Obwohl Bushidō in erster Linie dem Rest der Welt das japanische Wesen näherbringen sollte, wurde es schließlich auch in Japan ein großer Erfolg. Was Leser in Ost und West dabei manchmal übersahen (und heute noch übersehen), ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Buch nicht um eine wissenschaftliche Chronik japanischer Denkweisen und Traditionen, sondern um eine Ausformulierung der Wunschvorstellungen des guten Doktors handelt. Den Bushidō (Weg des Kriegers) als in Stein gemeißelten (oder in Tinte kalligrafierten) Ehrenkodex der Samurai gab es nicht. Mit der Ehre hatte es der gemeine historische Samurai nicht mehr als der gemeine Kreuzritter. Dennoch ist das Buch lesenswert als eine oft rührende Dokumentation japanischer Idealvorstellungen. Bedenken muss man nur, dass sich hüben wie drüben zwischen Ideal und Alltag oft eine beträchtliche Kluft auftut. Dass Nitobes Visionen eines edlen, ritterlichen Japans umgehend von rechtsaußen missbraucht wurden, war in den kriegerischen Zeiten von Chiune Sugiharas Kindheit und Jugend abzusehen. Trotz einiger in der Tat unglücklicher Zitate anderer Denker im Text ist das jedoch nicht die Schuld des Buches und entspricht nicht dem Ansinnen des Autors, der stets zwischen den Welten vermitteln wollte.
Wenngleich die sieben Tugenden der Samurai, die Nitobe formuliert, eher seine eigenen Ideen als ein althergebrachtes Regelwerk wiedergeben, so lohnt es sich doch, einen Blick auf sie zu werfen, denn auch Sugihara musste mit diesen Vorstellungen vom korrekten Mannsbild aufwachsen. Als da wären:
Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit: Nitobe zitiert zur Veranschaulichung einen bekannten Krieger: »Rechtschaffenheit ist die Kraft, sich für eine Verhaltensweise je nach Anlass zu entscheiden; zu sterben, wenn der Tod angebracht ist, und zuzuschlagen, wenn es erforderlich ist.«
Wagemut und Duldsamkeit: Der Autor kommt mit Konfuzius: »Das Richtige wahrzunehmen und es nicht zu tun, ist ein Mangel an Mut.« In eigenen Worten formuliert er es positiv: »Mut ist, wenn man das tut, was richtig ist.«
Mitmenschlichkeit, das Gefühl für Leid: Gemeint sind »Liebe, Großmut, Zuneigung zu anderen, Sympathie und Mitleid«. Hier führt der Autor wieder Konfuzius an, wenn er das Ideal eines Herrschers im Sinne des BushidŌ beschreibt: »Der Herrscher kultiviert zuerst seine Tugend; wenn er tugendhaft ist, kommen die Menschen von selbst zu ihm. Mit den Menschen kommt das Land zu ihm und mit dem Land der Wohlstand, den er zu nutzen weiß. Tugend ist die Wurzel und Wohlstand eine Folge davon.« Der Umkehrschluss ist für die weitere Lebensgeschichte Sugiharas interessant: Verhält sich ein Herrscher untugendhaft, dann wäre es auch nicht tugendhaft, sich seinem Willen zu beugen. Nitobe und Konfuzius plädieren für eine »väterliche Regierung« im Gegensatz zu einer despotischen.
Höflichkeit: Die gemeinte Höflichkeit solle nicht »nur von der Angst, den guten Geschmack zu verletzen, angetrieben« werden. »In ihrer höchsten Ausprägung kommt Höflichkeit der Liebe nah«, so Nitobe.
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit: Schriftliche Verträge waren zur Zeit der Samurai unüblich. Es galt das Bushi-no-ichigon, das »Ritterwort«. Nitobe: »Lügen oder Ausflüchte galten gleichermaßen als Feigheit.« Und Feigheit widersprach selbstverständlich der Anforderung des Wagemuts.
Ehre: Die Ehre ist ein zweischneidiges Schwert, um im kriegerischen Bild zu bleiben. Das löbliche »[wache] Bewusstsein der persönlichen Würde und des Wertes« kann eine starke Fokussierung auf den eigenen Ruf zur Folge haben: »Ein guter Name […] ist das Wichtigste für einen Menschen, alles andere steht auf der Stufe der Tiere.« Nitobe sah die Schattenseiten: »Im Namen der Ehre wurden Taten begangen, die im Kodex von Bushidō keine Berechtigung finden. Der heißblütige Angeber nahm die geringste, ja sogar eingebildete Beleidigung übel, und viele unschuldige Leben wurden geopfert.«
Loyalität: Wie Aristoteles setzt der Bushidō den Staat vor den Bürger: Es »muss das Individuum für den Staat leben und sterben oder für dessen Inhaber der legitimen Autorität«. Allerdings setzte dies, wie gehabt, einen tugendhaften, väterlichen Herrscher voraus. Denn weiter heißt es: »Ein Mann, der sein eigenes Gewissen dem unberechenbaren Willen oder den Launen und Grillen eines Herrschers opferte, wurde nach den Regeln von Bushidō als niedrig angesehen.«
Chiune Sugihara war ein exzellenter Baseballspieler. Konnte er gleichzeitig ein exzellenter Samurai nach Nitobe sein, der dieses Spiel doch so verachtete? Es wird an anderer Stelle noch einmal auf die Samurai-Anforderungen zurückzukommen sein.
Zum Unterhaltungsangebot wachsender Städte wie Yaotsu gehörten zur Zeit des jungen Sugihara zunehmend propagandistische Straßenspektakel, bei denen Regierungsgesandte dem Volk mit Vorführungen und Reden Werte beibiegen sollten, die dem Land zugutekämen und den Zeiten angemessen wären. Oft sprachen sich die verschiedenen Ensembles nicht ab. So wurden die Bürgerinnen und Bürger mal vor westlichen Marotten wie dem Tragen von Uhren gewarnt, am nächsten Tag wurden sie über die Tugend der Pünktlichkeit belehrt. Die Abgesandten des Landwirtschaftsministeriums ermahnten die Landbevölkerung, auf den Äckern und Feldern zu bleiben und gewissenhaft zu tun, was dort zu tun war. Vertreter des Handelsministeriums versuchten, Bauern in die neuen Fabriken zu locken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Kritische Bauern merkten an, dass sie weder Zeit für das eine noch für das andere hätten, wenn sie ständig diesen Veranstaltungen beiwohnen müssten.
Deren Akteure waren oft Männer in Lehrpositionen, die selbst zu alt waren, um bei Bedarf noch mal in den Krieg zu ziehen, was sie sehr bedauerten. Sie waren Ultranationalisten, die den Japanisch-Chinesischen Krieg als eine einzige glorreiche Siegesgeschichte erzählten und ihrem Publikum shobu shobu nahebringen wollten, eine während des besagten Konflikts in Mode gekommene, besonders aggressive Art von Patriotismus, verquickt mit Glorifizierung von Kampfgeist und Militarismus, befeuert von harten Worten, zackigen Kriegsliedern und militärischen Übungen. Die Landesregierung in Tokio sah das ambivalent. Patriotisch überdrehte Heerscharen hatten sich in den letzten Kriegen als schwer kontrollierbar erwiesen. Dennoch hatten sie gerade erste Siege gegen westliche Mächte errungen (Russland gehört aus Japans Sicht geografisch selbstverständlich zu diesen). Das Verhältnis zu westlichen Einflüssen wurde durch diese Siege nur noch ambivalenter. Vor allem aus einem zunehmenden Gefühl der Überlegenheit heraus erwuchs die Theorie, dass man sich diesen Einflüssen in Einzelfällen durchaus hingeben dürfe, denn ihre Gefahr für die reine, starke japanische Seele hielt sich in engeren Grenzen, als zunächst befürchtet. Außerdem ist ja genau das eine altbewährte Taktik: Kenne deinen Feind. So kamen die scheinbar oft widersprüchlichen Botschaften der Propagandaveranstaltungen zustande. Obwohl meistens Ablehnung eingebläut wurde, ging der Weg zum Ziel oft über Aneignung des Abzulehnenden. Die Frauen sollten sich die Haare nach der westlichen Mode frisieren und die Männer mehr Rindfleisch essen, um körperlich mit ihren westlichen Pendants konkurrieren zu können. (Tatsächlich waren die jungen Damen, die sich an der Mode und Ästhetik Europas orientierten, in jenen Jahren als »Haarschnittmädchen« bekannt. Für einige waren sie Feindbild, für andere erotische Projektionsfläche, für nicht wenige wahrscheinlich beides zugleich. Ambivalente Zeiten erzeugen ambivalente Gefühle.)
Die ersten Schritte zum Patriotismus neuer Schule konnten bei diesen Anlässen bereits gegangen werden: Es gab stets reichlich zu essen, auch verwestlichendes Rindfleisch. Wahrscheinlich lag darin der Grund für den großen Zuspruch, den die Veranstaltungen trotz ihrer verwirrenden Botschaften und gemischten Signale erhielten. Essen war wichtig, doch solle nicht mehr so gegessen werden, wie man es gewohnt war: Das Volk wurde bei einigen Veranstaltungen ermahnt, sich das laute Schlürfen der Nudelsuppe abzugewöhnen, weil dies im Westen wortwörtlich nicht zum guten Ton gehörte.
Das Schlürfen konnte den Japanern mehrheitlich nicht abgewöhnt werden, doch die Debatte ist geblieben. Zuletzt wurde im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 (faktisch 2021) darüber diskutiert, ob man es nicht unterlassen könne, um die vielen erwarteten Gäste aus dem Ausland nicht zu vergraulen (was sich dann freilich angesichts der ganz besonderen Umstände jenes Wettbewerbs eh erledigt hatte). Im Zuge dieser Diskussion wurde der Begriff nuhara geprägt, analog zu sekuhara, der japanisierten und abgekürzten Version von sexual harassment, also sexueller Belästigung. Nuhara beschreibt demnach ein Phänomen namens Nudelbelästigung.
Bei all diesen unterschiedlichen Botschaften, die der Staat am Anfang des 20. Jahrhunderts seiner Bevölkerung nahebringen wollte, schien eines eindeutig: Die Zeiten änderten sich. Die Sitten änderten sich. Loyalitäten verschoben sich, wenn auch nicht ganz klar war, wohin. Und mittendrin ein Heranwachsender wie Chiune Sugihara, geboren zwischen zwei Kriegen, der die Welt seiner Eltern schwinden sah und seine eigene kommende zunächst nur schemenhaft ausmachen konnte.
Dabei wirkten die internationalen Kräfte, die sein Leben prägen sollten, bereits während seiner Kindheit und in seinem Heimatland. Damals trommelten nicht nur Japaner in Japan leidenschaftlich für ihre politischen Anliegen. 1904 war der polnische Politiker und Aktivist Józef Piłsudski in den Fernen Osten gereist. Der Führer des militanten Flügels der Polnischen Sozialistischen Partei und langjährige Redakteur des Parteiblatts Robotnik (Arbeiter) wollte in Japan um Unterstützung für den Aufstand seiner Mitstreiter gegen die russische Fremdherrschaft werben. Geboren wurde Piłsudski 1867 nicht weit von Kaunas, der Stadt, die zu Sugiharas Schicksal werden sollte. In den 1920er-Jahren brachte er es in Polen vom verfolgten Untergrundkämpfer zum autoritären Staatsoberhaupt. Die jüdische Bevölkerung des Landes hegte damals große Sympathien für ihn, da er antisemitische Gesetze abschaffte und die Loyalität zum Staat über die ethnische Abstammung stellte.
Piłsudski war nicht der einzige Pole, der in jenen Tagen versuchte, Japan für polnische Belange zu interessieren. Kaum hatte er die Reise angetreten, schickten seine politischen Gegenspieler den strammen Nationalisten und Antisemiten Roman Dmowski hinterher, der die Japaner davon überzeugen sollte, dass dieser andere Pole Unsinn redete und man ihm rein gar nichts zugestehen solle. Erfolg hatte er damit nicht so recht. Piłsudski gelang es in Japan tatsächlich, Waffen und finanzielle Mittel gegen den gemeinsamen Feind Russland herauszuschlagen. Erst nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941 standen Japan und Polen offiziell auf unterschiedlichen Seiten eines Krieges, obwohl man unter der Hand weiterhin diplomatische Beziehungen und militärische Kooperationen über Spionageringe aufrechterhielt. Bei der Etablierung Letzterer sollte Chiune Sugihara eine entscheidende Rolle zukommen, als er ein paar Jahrzehnte später nicht weit von Józef Piłsudskis Geburtsort eine neue Dienststelle antrat.
Die Themen, die den erwachsenen Sugihara umtreiben sollten, lagen also bereits während seiner Kindheit in der Luft, die er atmete. Gleichwohl ist es unwahrscheinlich, dass Piłsudski oder Dmowski es bis Yaotsu geschafft haben. Falls Chiune in jenen Jahren überhaupt irgendein Bild vom jüdischen Volk vermittelt worden war, dann allenfalls ein unvorteilhaftes aus Schullektüren wie dem Kaufmann von Venedig.
Russische Juden hingegen hatten in und nach der Zeit des Russisch-Japanischen Krieges ein durchaus positives Bild von Japanern, obwohl sie offiziell auf unterschiedlichen Seiten kämpften. Das russische Militär setzte Juden als Kanonenfutter ein. Als jüdischer Mann hatte man nahezu keine Chance, der Einberufung zu entgehen. Ungefähr 30 000 jüdische Soldaten wurden von der russischen Armee in Marsch gesetzt. Nicht wenige von ihnen zogen Selbstverstümmelung oder Flucht ins Ausland dem Dienst an der Front vor. Und sollte sich das nicht bewerkstelligen lassen, war offenbar sogar die japanische Kriegsgefangenschaft vorzuziehen. Ein russisch-jüdischer Rekrut, der zuerst durch eine japanische Mörsergranate einen Arm verloren hatte und dann dem Feind in die Hände gefallen war, schrieb 1905 an seine Eltern: »Die mit zwei Armen können mich beneiden. Die Japaner behandeln uns so gut, wie man es sich nur vorstellen kann.« Andere sprachen ähnliche Erfahrungen aus: Es ging ihnen als Soldaten in japanischer Kriegsgefangenschaft besser denn als Juden im zivilen Russland (Gefangene und Beherrschte anderer Kriege und anderer Völker machten dagegen wesentlich unangenehmere Erfahrungen mit japanischen Soldaten). Sie entdeckten außerdem gewisse Ähnlichkeiten zwischen jüdischer und japanischer Mentalität – etwa einen Widerwillen, sich äußeren Kräften, darunter nicht zuletzt westlichen Einflüssen, zu beugen und allen gesellschaftlichen Entwicklungen zum Trotz an althergebrachten Traditionen festzuhalten.
Das Bild vom ritterlichen japanischen Soldaten wurde in jenen Tagen von kaum einem besser projiziert als von General Maresuke Nogi (1849–1912). Der Sohn eines Samurai, der europäische Kriegsstrategien in Deutschland studiert hatte, war von der japanischen Regierung als Held des Russisch-Japanischen Krieges aufgebaut worden. Ein bekanntes Poster, das auch in Yaotsu an mancher Hauswand hing, zeigte ihn Seite an Seite mit seinem just besiegten russischen Gegenspieler General Anatolij Michailowitsch Stößel. Beide imposante Männer mit Bart, beide aufrecht und in voller, ordenbewehrter Montur. Nogi wurde nicht nur dafür geschätzt, dass er seinem Feind in dessen Niederlage die Würde ließ, sondern auch dafür, dass er bereits während der Entscheidungsschlacht der Gegenseite 50 Hühner und 100 frische Eier zum Verzehr zukommen ließ. Und das, obwohl in jener Schlacht seine eigenen Söhne gefallen waren.
Die Geschichte vom ehrenhaften General Nogi wurde damals jedem japanischen Schulkind eingetrichtert. Ob sie nun ganz und gar der Wahrheit entspricht, ist strittig. Eines jedoch steht fest: Sie diente in erster Linie der Gesichtswahrung des japanischen Militärs. Nogi hatte sich im Konflikt alles andere als mit Ruhm bekleckert. Seine theoretischen militärischen Studien hatten ihm in der Praxis nicht viel geholfen; zu viele Soldaten schickte er in zu viele unnötige Scharmützel – und somit in noch unnötigere Tode, als es in Kriegen ohnehin der Regelfall ist.
Ob Legende oder nicht, die Botschaft kam beim jungen Chiune Sugihara und seinen Altersgenossen an: Sogar im Angesicht des Feindes darf man sein Mitgefühl nicht verlieren. Wie es mit moralischen Geschichten so ist, hatten sicherlich einige Schulkinder die Lektion auf dem Weg ins Erwachsenenleben wieder verlernt. Sugihara nicht.
Ob der Staat überhaupt wollte, dass Chiune Sugihara in der Schule allzu gut aufpasste, ist dabei nicht unbedingt gesagt. Das Bildungswesen war eine weitere Institution, die unterschiedliche Signale sendete. Einerseits wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Schulpflicht um zwei Jahre verlängert, andererseits kritisierte das Innenministerium die Regionalregierungen dafür, zu viel Geld in den Ausbau von Schulen zu stecken. Budgetkürzungen hatten daraufhin zufolge, dass Lehrergehälter von einem komfortablen Mittelklasseniveau unter die Armutsgrenze fielen. Überhaupt war zu viel Bildung vielen suspekt – sogar dem Bildungsministerium. Dort war zu hören, dass das Streben zu vieler nach höherer Bildung »von Übel« sei: »Die Doktoren vermehren sich wie der Bambus nach dem Regen.« In einem populären Ulkschlager jener Tage heißt es sinngemäß: »Ich werde ein Doktor der Rechte, du einer der Literatur / Lass uns ins Freudenhaus gehen, unsere Eltern graben daheim nach Süßkartoffeln.«
Chiune sollte durchaus ein Doktor werden, nämlich einer der Medizin. Das war die Art von nützlichem Doktor, auf die man sich allseits einigen konnte. Dieses Berufsziel schwebte zumindest dem Vater für den Sohn vor; er selbst war ja ebenfalls kein Süßkartoffelbauer. Welche gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Umwälzungen auf seine Generation auch warten mochten, eines war klar: Krank wurden die Menschen immer. Außerdem hatte es unter den Vorfahren des Vaters einen Arzt gegeben, und dem war es wohl nicht allzu schlecht gegangen. Und wo wäre Yoshimizu selbst ohne medizinische Hilfe geblieben, als ihn im Krieg beinahe die Tuberkulose dahingerafft hatte?
Zunächst allerdings musste Chiune die gemeine Schulbildung hinter sich bringen. 1907 lebte die Familie in der heutigen Stadt Kuwana in der Präfektur Mie, die an die Präfektur Gifu grenzt. Im selben Jahr noch wurde in die Stadt Gifu umgezogen, wo Chiune die Nakatsu Grundschule besuchen würde. Er war ein guter Schüler, doch er lernte nicht nur allein in der Schule. In Gifu sah er im Kino einen Film, der ihn tief beeindrucken sollte. Es war eine von vielen Nacherzählungen der Legende der 47 Rōnin, einer in Grundzügen auf historischen Begebenheiten basierenden Geschichte, die in Japan so bekannt ist wie im Westen die von Robin Hood und seinen fröhlichen Gefährten (sie ist allerdings weniger fröhlich). International erlangte sie in jüngerer Vergangenheit eine gewisse Bekanntheit als Inspiration für den britisch-amerikanischen Actionfilm Ronin und den amerikanischen Fantasyfilm 47 Ronin, der unter anderem gerne für die Freiheiten kritisiert wird, die er sich gegenüber dem Originalstoff herausnähme. Dabei ist es auch in japanischen Nacherzählungen der Legende gang und gäbe, die Geschichte auszuschmücken und mit übernatürlichen Elementen anzureichern. Die künstlerischen Freiheiten beginnen schon damit, dass die realen 47 Rōnin wahrscheinlich über 50 waren.