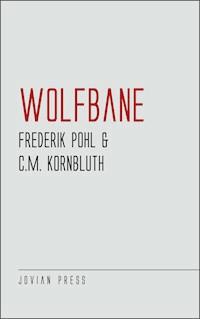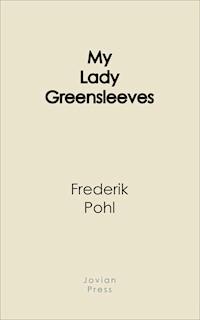7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Wir brauchen die Venus, wir brauchen Raum!"
Gigantische Werbeagenturen beherrschen die Welt des 21. Jahrhunderts, die politischen Institutionen sind zu Attrappen verkümmert, die Bürger nichts weiter als statistisch erfasste Konsumenten. Doch als sich das angebliche Geschäft des Jahrhunderts – die Besiedlung des Planeten Venus – als Flop herausstellt, kommt es zu unkontrollierbaren Folgen: Die Konsumenten rebellieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Wissenschaft dem Versiegen der natürlichen Ressourcen stets einen Schritt voraus: Als echtes Fleisch knapp wird, gibt es als Alternative Sojaburger; eine gigantische Maschine in Form eines Huhns liefert Protein ohne Ende; und als das Öl ausgeht, wird kurzerhand das PediCab als Autoersatz entwickelt … Um neue Rohstoffquellen zu erschließen, will die Firma Fowler Schocken Inc., ein global operierender Megakonzern, den ganz großen Coup landen: die Besiedelung der Venus. Da es auf dem Planeten angeblich unerschöpfliche Mengen an Energie gibt, wird mit dem Slogan geworben: »Wir brauchen die Venus, wir brauchen Raum!« Die ersten Siedler aus dem Heer problemlos manipulierbarer Konsumenten sind bald gefunden. Mitchell Courtenay, der Star unter den Werbetextern, lügt dafür das Blaue vom Himmel herunter – bis er von einer Aktivistengruppe, denen die Lebensbedingungen auf der Erde wichtiger sind als alles andere, gezwungen wird, radikal umzudenken.
»Ein Meilenstein der Science Fiction – Frederik Pohl und Cyril M. Kornbluth haben sich damit in die Annalen des Genres geschrieben.«
New York Times
DIE AUTOREN
Frederik Pohl zählt – neben Isaac Asimov, Robert A. Heinlein und Ray Bradbury – zu den legendären Gründervätern der amerikanischen Science Fiction. Geboren 1919 in New York, gehörte er zu den SF-Herausgebern der ersten Stunde und machte schnell auch mit eigenen Storys und Romanen von sich reden, darunter die gefeierte »Gateway«-Trilogie. Pohl lebt mit seiner Familie in Illinois.
Cyril M. Kornbluth, Jahrgang 1923, galt in den fünfziger Jahren als das herausragende Talent der amerikanischen SF. In seinen Kurzgeschichten und Romanen gelang es ihm immer wieder auf kongeniale Weise, Sozialkritik mit beißender Satire zu verbinden. Kornbluth starb 1958.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
von Richard Morgan
In den vergangenen Jahrzehnten hat es sich eingebürgert, die Science Fiction des sogenannten Golden Age – also die amerikanische SF der vierziger und fünfziger Jahre – geringschätzig zu betrachten. Weithin wird das Genre jener Periode mit muskelbepackten, vierschrötigen und natürlich dezidiert weißen Helden assoziiert, die weit draußen im All, auf bisher ungezähmten Welten den amerikanischen Traum propagieren, während ihnen ebenfalls weiße vollbusige Schönheiten dabei unterwürfig zur Seite stehen.
Diese Assoziation ist etwas unfair.
Was nicht heißt, dass darin nicht auch eine gehörige Portion Wahrheit steckt. Immerhin kennen wir alle die schrillen Cover der SF-Magazine jener Zeit, haben bei der Lektüre der entsprechenden Geschichten ungläubig den Kopf geschüttelt, haben uns wohlfeil auf die Brust geklopft angesichts der Tatsache, dass wir uns von dieser reaktionär-chauvinistischen Betrachtungsweise von Frauen, Sexualität, generell allem, was der weißen, infantilen Mittelschicht damals als fremdartig erschien, weit entfernt haben. Ja, das Zeug gab es wirklich, und zwar jede Menge davon. Aber darum geht es hier nicht. Wie Theodore Sturgeon einmal so treffend sagte: »Neunzig Prozent der Science Fiction sind Blödsinn – aber neunzig Prozent von allem anderen sind auch Blödsinn!« Das Golden Age macht keine Ausnahme von dieser Regel.
Unfair also nicht deshalb, weil wir die Science Fiction jener Periode geringschätzen, sondern weil wir sie so verallgemeinernd, so allumfassend verurteilen, dass wir die Sicht darauf komplett versperren. Was ein Fehler ist – denn diese enorm produktive Zeit in der Geschichte der Science Fiction einfach in Bausch und Bogen zu verdammen, lässt uns zum Beispiel übersehen, dass, obwohl das Golden Age tonnenweise grotesken Kitsch und chauvinistischen Mist hervorgebracht hat, zur selben Zeit Meisterwerke wie Ray Bradburys »Fahrenheit 451« oder Alfred Besters »Der brennende Mann« entstanden sind. Dass zur selben Zeit ein Genie wie Robert Sheckley die Novellen »Immortality Inc.« und »Mindswap« geschrieben hat, deren existentialistische Extrapolationen – der Körper, der Geist, das Universum – ein halbes Jahrhundert später meine eigenen Arbeiten immer noch stark beeinflussen konnten. Und dass zur selben Zeit »Eine Handvoll Venus« veröffentlicht wurde.
Ursprünglich erschien dieser Roman zur Fortsetzung in einem Science-Fiction-Magazin, und in mancherlei Hinsicht merkt man das dem Plot auch an: Er ist episodisch in Form und Tonfall, hechelt von Cliffhanger zu Cliffhanger, anstatt einen übergreifenden Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, und er bewegt sich sehr, sehr schnell. Auf kaum dreihundert Seiten hetzen wir von New York über Washington, San Diego, die Antarktis und Costa Rica bis zum Mond. Geboten werden: Morde, versuchte Morde, Überfälle, Verfolgungsjagden, Kidnappings, Rettungsaktionen, Betrügereien, einer der übelsten Psychopathen, den die Literatur überhaupt je hervorgebracht hat, eine bemannte Mission zur Venus, ein großartiger Tumult in den heiligen Hallen des US-Kongresses sowie ein monströses genmodifiziertes Huhn (wirklich!). Dazu: heimtückischen Humor, ruchlose Satire und einige überaus präzise Voraussagen der turbokapitalistischen Gesellschaft, in der wir gerade leben. »Eine Handvoll Venus« ist über fünfzig Jahre alt – aber seine Vision erscheint uns heute immer noch erschreckend vertraut.
»Ich bin Mitchell Courtenay. Ich kann Sie kaufen oder verkaufen, ohne mein Taschengeldbudget strapazieren zu müssen.«
So spricht – man bedenke: zur Blütezeit des Golden Age – unser Held. Er ist kein tollkühner Weltraumfahrer, er zieht nicht am schnellsten mit seiner Laserpistole – seine Waffen sind viel subtiler und letztlich weitaus verheerender. Mitch Courtenay gehört zur »Starklasse«, er ist ein Marketing-Fachmann der obersten Kategorie. Er braucht keine Waffe zu tragen, denn er hat eine niedrige Sozialversicherungsnummer, einen hohen Kreditrahmen und Zugang zu den »Movers and Shakers« der globalen Wirtschaft. Wie sein Boss ihm zu Beginn des Romans sagt:
»Mitch, Sie sind noch jung und erst kurze Zeit in der Starklasse. Aber Sie haben Macht. Ein paar Worte von Ihnen, und innerhalb von Wochen oder Monaten hat sich das Leben von einer Million Konsumenten völlig verändert. Das ist Macht, Mitch, absolute Macht. Sie kennen doch das alte Sprichwort: Macht adelt. Absolute Macht adelt absolut.«
Es gibt eben eine Art von Weisheit, gegen die kein Kraut gewachsen ist …
»Eine Handvoll Venus« ist insofern ein in vielerlei Hinsicht subversiver Text – nicht nur was das SF-Genre im engeren Sinne betrifft, sondern vor allem auch das politische Umfeld, in dem er entstanden ist. In seinem Zentrum steht zwar die klassische »Final frontier«-Geschichte (hier ist die Venus diese Grenze). Doch die Aufgabe unseres Helden ist es nicht, dorthin zu reisen und die Neue Welt zu zähmen – seine Aufgabe ist es, einem Haufen Idioten den Traum von dieser Neuen Welt zu verkaufen (wobei er die höllischen Bedingungen, die auf der Venus herrschen und ein Leben dort praktisch unmöglich machen, wohlweislich verschweigt). Der Roman ist, wenn man so will, ein so zynischer wie effektiver Doppelschlag: eine Gerade ins Gesicht der damals aufkommenden Marketingindustrie und ein Konter in Richtung der Lügen, die sich Amerika vom »frontier life«, von der »Eroberung des Westens« bis heute erzählt. Wie Bradbury in »Fahrenheit 451« verwenden auch Frederik Pohl und Cyril M. Kornbluth eins zu eins jene sprachlichen und charakterlichen Verkrampfungen, die eine Gesellschaft offenbar benötigt, um sich über ihren eigenen Zustand – über das, was es bedeutet, »normal« zu sein – zu täuschen. Und so wie »Fahrenheit 451« liefert auch »Eine Handvoll Venus« einige erstaunlich luzide Annahmen darüber, wie die Zukunft – jetzt die Gegenwart – aussehen könnte.
Natürlich lagen die beiden Autoren zuweilen völlig neben der Spur: Es gibt keine Städte auf dem Mond und keine Touristenburgen in der Antarktis (noch nicht jedenfalls), und wir reisen auch nicht in Raketen rund um den Globus, die so groß wie ein Kreuzfahrtschiff sind. Aber wenn Sie hier lesen, wie man vom Wohnzimmersessel aus bequem Golf oder Tennis spielt oder wie Hühnerfleisch auf wahrhaft industrielle Weise produziert wird – sollten Ihnen die Parallelen schmerzlich bewusst werden. Wenn Sie von den Obdachlosen lesen, die in den Eingängen jener Firmenhochhäuser schlafen, die Mitch Courtenay regelmäßig besucht, vom perfiden Marketing von »Brand Names«, von der Verwandlung ganzer Staaten in Rohstofflager (zum Beispiel »Indiastries«) – dann ahnen Sie, dass die Autoren sich die politischen Entwicklungen ihrer Zeit ganz genau angesehen haben, lange bevor die literarische Auseinandersetzung mit politischen Entwicklungen als »cool« deklariert wurde. Und wenn Sie von Sicherheitsfirmen lesen, die man wie eine Privatpolizei mieten kann, von Landstrichen in Südamerika, in denen Agrar-Konzerne eine Art Diktatur ausüben, und von den »Consies«, einer Organisation, die versucht, eine Gesellschaft vor dem Untergang zu bewahren und dafür von dieser Gesellschaft verachtet wird – dann kommen Sie wohl nicht daran vorbei, Pohl und Kornbluth zu ihrem klaren Blick auf die Zukunft zu gratulieren.
Aber vor allem, wenn Sie das hier lesen:
Seine eigene Traumwelt wurde von jedem einzelnen Wort, das ich gesagt hatte, torpediert. Mein Bericht war Blasphemie gegen den Gott des Verkaufs. Fowler Schocken konnte und konnte es nicht glauben, dass ich – mein wirkliches Ich – es glaubte. Wie konnte Mitchell Courtenay, Texter, vor ihm sitzen und so entsetzliche Dinge erzählen wie: Die Interessen von Produzenten und Konsumenten sind nicht identisch; die meisten Menschen auf der Welt sind unglücklich; Arbeiter finden nicht automatisch die für sie am besten geeignete Beschäftigung; Unternehmer halten die Regel »hart, aber fair« nicht ein; die Consies sind normal, intelligent und gut organisiert.
… und sich vor Augen halten, dass dies 1952 in den USA geschrieben wurde, auf dem Höhepunkt der McCarthy-Umtriebe – nun, dann werden Sie wohl nicht nur vor der visionären Kraft der beiden Autoren den Hut ziehen, sondern auch vor ihrem Mut, eine solche Vision unter die Leute zu bringen. Es ist keine Überraschung, dass »Eine Handvoll Venus« zuerst in Galaxy veröffentlicht wurde, einem Science-Fiction-Magazin, von dessen Herausgeber Horace Gold Ray Bradbury sagte, er wäre »weitaus mutiger als viele andere seiner Zeit« gewesen. Gold veröffentlichte etwa zur selben Zeit Bradburys emblematische Anti-Zensur-Story »The Fireman«, aus der später »Fahrenheit 451« werden sollte, ja er war der einzige Herausgeber, der es überhaupt in Erwägung zog, diese Story zu veröffentlichen. Gut möglich, dass er auch der Einzige war, der »Eine Handvoll Venus« veröffentlichen wollte. Es waren jedenfalls keine einfachen Zeiten für politische Visionen.
Wir sollten also nicht vergessen – und »Eine Handvoll Venus« erinnert uns nachhaltig an diese Tatsache –, dass das Golden Age neben all dem Kitsch, all den chauvinistischen Exzessen eine politische Kante hatte, die mindestens so scharf war wie alles, was später in der New Wave und noch später im Cyberpunk kommen sollte. Zur Zeit der New Wave, in den Sechzigern, war politische Provokation der Schlager der Woche – jeder, der irgendetwas gelten wollte, tat es –, und als in den Achtzigern der Cyberpunk kam, war sie aus der literarischen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Im Amerika der frühen fünfziger Jahre jedoch sind Pohl und Kornbluth – gemeinsam mit Gold und Bradbury und vielen anderen – ein wirkliches Risiko eingegangen. Dafür verdienen sie unseren Respekt. Die Satire und Sozialkritik von »Eine Handvoll Venus« steht wie ein zeitloses Monument für die subversive Kraft der Science Fiction – wann immer und wo immer das Buch auch geschrieben wurde.
Richard Morgan ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren der Gegenwart, der sich ebenƒalls intensiv mit politischen Themen auseinandersetzt. Zuletzt sind von ihm die Romane »Das Unsterblichkeitsprogramm«, »Profit« sowie »Skorpion« erschienen.
1
An jenem Morgen ging ich, während ich mich anzog, in Gedanken noch mal die lange Liste von Statistiken, Ausreden und Übertreibungen durch, die man in meinem Bericht erwartete. In meiner Abteilung – PRODUCTION – hatte es in letzter Zeit eine ganze Reihe von Krankheitsfällen und Kündigungen gegeben, und die Arbeit lässt sich halt nicht erledigen, wenn keine Leute da sind. In der Chefetage allerdings würde das kaum als Entschuldigung akzeptiert werden.
Ich rieb mein Gesicht mit Enthaarungscreme ein und spülte es anschließend unter dem kümmerlichen Rinnsal aus dem Frischwasserhahn ab. Das ist Verschwendung, klar, aber ich zahle schließlich Steuern, außerdem verträgt mein Gesicht kein Salzwasser. Bevor die letzten Stoppeln fortgespült waren, versiegte das Süßwasser. Ich fluchte vor mich hin und beendete meine Reinigungsprozedur mit Salzwasser. Das war in letzter Zeit häufiger vorgekommen; einige Leute machten Consie-Saboteure dafür verantwortlich. Überall in New York fanden Überfälle auf die Wasserversorgungsgesellschaft statt. Bisher war nichts Gutes dabei herausgekommen.
Einen Augenblick lang fesselten mich die Nachrichten im TV über dem Rasierspiegel … die Ansprache des Präsidenten vom vergangenen Abend; ein kurzer Blick auf die Venusrakete, die gedrungen und silbern im Sand von Arizona kauerte; Aufstände in Panama … ich schaltete den Apparat ab, als das viertelstündliche Signal ertönte.
Sah so aus, als würde ich mich mal wieder verspäten. Und das würde ganz bestimmt nicht die Laune des Chefs verbessern. Ich sparte fünf Minuten ein, indem ich das Hemd vom Vortag noch mal anzog, anstatt mir ein sauberes aus dem Schrank zu nehmen, und ließ meinen Frühstückssaft auf dem Tisch warm und klebrig werden. Aber ich verlor die fünf Minuten wieder, weil ich versuchte, Kathy anzurufen. Sie ging nicht ans Telefon, und ich würde zu spät ins Büro kommen. Glücklicherweise – und das war noch nie da gewesen! – verspätete sich auch Fowler Schocken.
Bei uns im Büro ist es üblich, dass Fowler einmal die Woche fünfzehn Minuten vor dem regulären Arbeitsbeginn eine Chefsitzung abhält. So wird jeder von uns auf Trab gehalten, und für Fowler ist es weiter nicht unbequem. Er verbringt den Morgen ohnehin im Büro, und der beginnt für ihn mit Sonnenaufgang.
Heute hatte ich allerdings noch Zeit genug, um die Berichte durchzusehen, die meine Assistentin auf den Schreibtisch gelegt hatte. Als Fowler Schocken mit einer höflichen Entschuldigung für seine Unpünktlichkeit hereinkam, saß ich so entspannt und sicher an meinem Platz am Ende des Tisches, wie es ein Gesellschafter von Fowler Schocken nur sein kann.
»Guten Morgen«, psalmodierte Fowler, und wir elf gaben das übliche idiotische Gemurmel von uns. Er setzte sich nicht. Er blieb stehen und starrte uns eineinhalb Minuten väterlich an. Dann schaute er sich mit dem erstaunten Gesichtsausdruck eines Touristen in Xanadu langsam und aufmerksam im Raum um.
»Ich habe über unser Konferenzzimmer nachgedacht«, sagte er, und wir alle blickten uns um. Der Raum ist nicht groß, aber auch nicht klein; etwa zehn mal zwölf Meter. Doch er ist kühl, gut beleuchtet und höchst eindrucksvoll möbliert. Die Klimaanlage ist geschickt hinter Friesen versteckt; der Teppich ist dick und weich; jedes Möbelstück besteht ganz und gar aus echtem, fachmännisch ausgewähltem makellosem Holz.
Fowler Schocken fuhr fort: »Wir haben wirklich ein hübsches Konferenzzimmer. Und das ist auch richtig, denn schließlich ist Fowler die größte Werbeagentur der Stadt. Wir setzen jährlich eine Million mehr um als alle anderen hier in der Gegend. Und«, er blickte uns alle an, »ich glaube, Sie werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass wir alle davon profitieren. Ich glaube jedoch nicht, dass sich in diesem Zimmer auch nur ein Einziger befindet, der nicht mindestens ein Zwei-Zimmer-Appartement bewohnt.« Er zwinkerte mir zu. »Sogar die Junggesellen. Und was mich selbst betrifft, so kann ich nicht klagen. Mein Sommersitz grenzt direkt an einen der größten Parks von Long Island. Seit Jahren esse ich kein Protein, sondern echtes, frisches Fleisch, und wenn ich mal eine kleine Spritztour mache, steht mir ein Cadillac zur Verfügung. Ich kann also wirklich nicht klagen, und ich glaube, Sie alle können von sich dasselbe sagen, richtig?« Die Hand unseres Marktforschungsleiters schoss in die Höhe, und Fowler nickte ihm zu: »Ja, Matthew?«
Matt Runstead weiß, woher seine Brötchen kommen. Er warf einen angriffslustigen Blick in die Runde. »Ich wollte nur meine Zustimmung ausdrücken, Mr. Schocken – meine hundertprozentige Zustimmung!« , tat er seine Meinung kund.
Fowler Schocken neigte den Kopf. »Danke, Matthew.« Und er meinte es so. Es dauerte einen Augenblick, bis er weitersprechen konnte. »Es ist uns allen klar«, sagte er, »warum wir es so weit gebracht haben. Wir erinnern uns an Starrzelius Verily Account und daran, wie wir Indiastries aus dem Boden stampften. Der erste Sphärentrust. Die Verschmelzung eines ganzen Subkontinents zu einem einzigen Fabrikationskomplex. Schocken Inc. hat Pionierarbeit geleistet. Niemand kann sagen, wir seien lahm. Aber das ist vorbei. Leute! Ich möchte eines wissen: Sagt es mir ehrlich – lassen wir nach?« Er ließ sich Zeit und schaute jedem von uns prüfend ins Gesicht, ignorierte den Wald von ausgestreckten Händen. Du lieber Himmel, auch ich hatte die Hand erhoben. Dann nickte er dem Mann rechts neben ihm zu. »Du zuerst, Ben«, forderte er den Kollegen auf.
Ben Winston erhob sich und begann mit tiefer Stimme: »Von der Abteilung INDUSTRIAL ANTHROPOLOGY aus betrachtet ist das nicht der Fall! Hören Sie sich den heutigen Fortschrittsbericht an – Sie werden ihn am Mittag ohnehin bekommen. Ich möchte ihn jetzt kurz zusammenfassen: Nach den Tabellen von Mitternacht zu urteilen, benutzen mittlerweile alle Grundschulen östlich des Mississippi unsere Verpackung für die Lunchpakete. Sojaburger und künstliche Steaks« – es gab nicht einen am Tisch, den es bei dem Gedanken an Sojaburger und künstliche Steaks nicht schauderte – »sind in Behältern verpackt, die denselben Grünton haben wie die Universal-Produkte. Bonbons, Eiskrem und KiddieButt-Zigaretten jedoch sind in leuchtendes Starrzelius-Rot eingewickelt. Sobald diese Kinder herangewachsen sind …«, er hob die Augen triumphierend von seinen Notizen. »Unseren Prognosen gemäß werden die Universal-Produkte in fünfzehn Jahren bankrott sein und damit völlig vom Markt verschwunden!«
Er setzte sich wieder. Stürmischer Applaus. Auch Schocken klatschte in die Hände und strahlte uns an. Ich beugte mich vor, nachdem ich Ausdruck Nummer eins auf mein Gesicht gezaubert hatte – Eifer, Intelligenz, Know-how –, aber die Mühe hätte ich mir auch sparen können. Fowler deutete auf den hageren Mann neben Winston: Harvey Bruner.
»Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass es im Verkauf ganz eigene Probleme gibt«, sagte Harvey und blähte seine eingefallenen Wangen auf. »Ich schwöre, diese verdammte Regierung ist durch und durch von Consies infiltriert! Sie wissen ja, was die fertiggebracht haben! Niederfrequenzen in unserer Radiowerbung wurde verboten – aber wir haben mit einer ganzen Liste semantischer Schlüsselwörter zurückgeschlagen, die Bezug nehmen auf jedes Trauma und jede Neurose des modernen amerikanischen Way of Life. Man hat auf die Sicherheitsvorschriften hingewiesen und uns verboten, Werbespots auf den Screen-Fenstern der AirBusse zu platzieren – aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Ich habe vom Labor erfahren«, er nickte unserem Research Director zu, der auf der anderen Seite des Tisches saß, »dass wir in Kürze ein System testen werden, das direkt auf die Netzhaut des Auges projiziert.
Und das ist nicht alles, es gibt noch mehr Fortschritte. Als Beispiel möchte ich nur Coƒƒiest nen…« Erschrocken hielt er inne. »Entschuldigen Sie, Mr. Schocken«, flüsterte er, »ist dieses Zimmer von der Security überprüft worden?«
Fowler Schocken nickte. »Absolut sauber. Nur die üblichen Abhörmikros vom Auswärtigen Amt und vom Repräsentantenhaus. Für die spielen wir natürlich frisierte Playbackaufnahmen ab.«
Harvey entspannte sich allmählich wieder. »Also zu Coffiest«, sagte er dann. »Wir verteilen Proben in fünfzehn Schlüsselstädten. Unser normales Angebot – dreizehn Wochen kostenlos Coffiest, tausend Dollar in bar und ein Wochenendurlaub an der Ligurischen Riviera für jeden, der mitmacht. Aber – und aus diesem Grund ist die Kampagne, jedenfalls meiner Meinung nach, wirklich fantastisch – jede Coffiestprobe enthält drei Milligramm einfaches Alkaloid. Nicht schädlich. Aber auf jeden Fall besteht Gewöhnungsgefahr. Nach zehn Wochen haben wir den Kunden lebenslänglich. Eine Entziehungskur würde mindestens fünftausend Dollar kosten, also ist es einfacher, weiterhin Coffiest zu trinken – drei Tassen zu jeder Mahlzeit und eine Kanne auf dem Nachtschrank, wie’s auf dem Beipackzettel steht.«
Fowler Schocken strahlte, und ich setzte wieder Ausdruck Nummer eins auf. Neben Harvey saß Tildy Mathis, Personalchefin, von Schocken persönlich ausgesucht. Aber bei Direktionssitzungen erteilte er Frauen nicht das Wort und neben Tildy saß ich.
Ich sortierte in Gedanken gerade meine Eröffnungsworte, als mich Fowler Schocken mit einem Lächeln befreite. Er sagte: »Ich werde nicht jede Abteilung um einen Lagebericht bitten. Wir haben keine Zeit. Aber ich habe Ihre Antwort, meine Herren. Eine Antwort, die mir gefällt. Bisher haben Sie jeder Herausforderung getrotzt. Und jetzt – biete ich Ihnen eine neue Herausforderung.«
Er drückte auf einen Knopf an seiner Konsole und schwenkte seinen Drehstuhl herum. Das Licht ging aus; der projizierte Picasso hinter Schockens Sessel verschwand, und die gefleckte Oberfläche des Monitors wurde sichtbar. Ein neues Bild nahm Konturen an.
Ich hatte an jenem Tag bereits etwas Ähnliches gesehen, und zwar in den Nachrichten, auf dem Bildschirm über meinem Rasierspiegel.
Es ging um diese Venusrakete, ein dreihundert Meter langes Monstrum, das aufgedunsene Kind der schlanken V-2S und der untersetzten Mondraketen der Vergangenheit. Auf einem Gerüst aus Stahl und Aluminium wimmelte es von winzigen Gestalten, die mit winzigen, blauweißen Schweißflammen hantierten.
Offensichtlich war es ein altes Bild, denn es zeigte die Rakete in einem früheren Konstruktionsstadium, das Wochen oder Monate zurücklag, nicht himmelwärts gerichtet und startklar, wie ich sie gesehen hatte.
Eine Stimme vom Monitor sagte triumphierend und ungenau: »Dieses Schiff wird eine Brücke zu den Sternen schlagen!« Ich erkannte die Orgelstimme eines Kommentators aus der Abteilung AURAL EFFECTS, der Text stammte ohne Zweifel aus Tildys Büro. Diese geniale Schlampigkeit, die Venus mit einem Stern zu verwechseln, konnte schlichtweg nur aus Tildys Abteilung kommen.
»Dieses Schiff wird von einem modernen Kolumbus durch den Weltraum gesteuert«, faselte die Stimme. »Sechseinhalb Millionen Tonnen eingefangener Blitz und Stahl – eine Arche für achtzehnhundert Männer und Frauen, und alles was sie brauchen, um sich eine neue Welt zur Heimat zu machen. Wer wird mitfliegen? Welche glücklichen Pioniere werden dem reichen, frischen Boden einer anderen Welt ein Imperium entreißen? Ich werde sie Ihnen vorstellen – ein Mann und seine Frau, zwei unerschrockene …«
Die Stimme hörte nicht auf zu reden. Ein neues Bild wurde eingeblendet, eine geräumige, gutbürgerliche Wohnkabine am frühen Morgen.
Der Mann schob gerade das Bett beiseite und ließ die Trennwände zur Kinderecke herunter; die Frau besorgte das Frühstück und stellte den Tisch auf. Am Frühstückstisch – für jede Person selbstverständlich ein Becher dampfendes Coffiest – redeten sie beschwörend aufeinander ein, sprachen davon, wie klug und tapfer es doch sei, sich um einen Platz in der Venusrakete zu bewerben. Und die abschließende Frage des Jüngsten (»Mammi, wenn ich groß bin, kann ich meine kleinen Jungen und Mädchen dann auch an einen so schönen Ort wie die Venus bringen?«) leitete über zu einem Cut und einer Reihe höchst fantasievoller Aufnahmen von der Venus, wie sie einmal aussähe, wenn das Kind erwachsen sein würde: grüne Täler, kristallene Seen, ein herrliches Gebirgspanorama …
Der Kommentator verschwieg die jahrzehntelange Wasserkultur und das Leben in hermetisch geschlossenen Kabinen, das die Pioniere in Kauf nehmen müssten, während sie in der Atmosphäre, in der man nicht atmen konnte, und an der wasserlosen Chemie der Venus arbeiteten, zwar nicht ausdrücklich, ging aber auch nicht näher darauf ein.
Instinktiv hatte ich den Timer auf meiner Uhr eingestellt, als der Film begann. Als er zu Ende war, schaute ich nach: neun Minuten! Dreimal so lang wie jeder normale Werbefilm. Und eine volle Minute länger, als uns normalerweise genehmigt wurde!
Erst als das Licht wieder eingeschaltet war, die Zigaretten glimmten und Fowler Schocken wieder zu sprechen anfing, wurde mir allmählich klar, wie das hatte passieren können. Er begann in der umständlichen, langatmigen Weise, die unabdingbar zu unserer Branche gehört: Er lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Geschichte der Werbung – von der einfachen Aufgabe, fertige Waren zu verkaufen, bis zum gegenwärtigen Problem, neue Industrien zu schaffen und die Lebensbedingungen in der Welt neu zu gestalten, um den Bedürfnissen des Handels zu entsprechen. Mehr als einmal erwähnte er, was wir, Fowler Schocken Inc., geschaffen hatten. Und dann sagte er:
»Es gibt ein altes amerikanisches Sprichwort: ›Die Welt ist unsere Auster.‹ Wir haben es wahr gemacht, doch leider haben wir die Auster irgendwann gegessen.« Langsam drückte er seine Zigarette aus. »Wir haben sie gegessen«, wiederholte er. »Wir haben die Welt wirklich und wahrhaftig erobert. Wie einst Alexander, so weinen auch wir wegen neuer Welten, die es zu erobern gibt. Und dort«, er deutete auf den Bildschirm hinter sich, »dort haben Sie gerade die erste dieser Welten gesehen.«
Ich habe Matt Runstead, wie Sie wohl schon gemerkt haben, nie gemocht. Er steckt seine Nase in alles hinein, und ich habe ihn im Verdacht, selbst innerhalb der Firma die Leitungen anzuzapfen. Er muss schon vorher vom Venusprojekt erfahren haben, denn nicht einmal jemand mit besonders extremer Reaktionsfähigkeit hätte es auf Anhieb fertiggebracht, eine derartige kleine Ansprache zu halten, wie er es tat. Während wir übrigens noch damit beschäftigt waren, das, was Fowler Schocken gerade verkündet hatte, zu verdauen, sprang Runstead auf.
»Meine Herren«, sagte er leidenschaftlich, »dies ist wahrlich das Werk eines Genies. Nicht einfach Indien, nicht einfach eine Ware. Ein ganzer Planet wird verkauft. Ich gratuliere Ihnen, Fowler Schocken – der Clive, der Bolivar, der John Jacob Astor einer neuen Welt!«
Matt war, wie ich bereits sagte, der Erste, aber wir alle erhoben uns und sagten nacheinander dasselbe. Ich auch. Es war einfach; ich tat es seit Jahren. Kathy hat es nie verstehen können, obgleich ich wer weiß wie oft versucht habe, es ihr zu erklären, ich versuchte ihr klarzumachen, dass es eine Art religiöses Ritual war – wie die Sektflasche, die man am Bug des Schiffes zerschellen lässt, oder die Jungfrau, die man opfert, um eine gute Maisernte einzufahren. Aber selbst mit dieser Einstellung trieb ich es nie zu weit. Ich glaube nicht, dass einer von uns, Matt Runstead vielleicht ausgenommen, nur des Geldes wegen die Welt mit Opiumderivaten gefüttert hätte. Aber wenn wir Fowler Schocken sprechen hörten, wenn wir uns selbst mit den antiphonischen Antworten hypnotisierten, waren wir jeder Tat fähig, die unserem Götzen Verkauf diente.
Ich will damit nicht sagen, dass wir Kriminelle waren. Der Alkaloidgehalt im Coffiest war, wie Harvey bereits ausgeführt hatte, nicht schädlich.
Als wir alle durch waren, drückte Fowler Schocken auf einen anderen Knopf und zeigte uns eine Karte. Er erklärte sie sorgfältig, Stück für Stück; dann zeigte er uns Tabellen, Grafiken und Diagramme der gesamten neuen Abteilung Fowler Schocken Inc., die eingerichtet werden sollte, um die Entwicklung und Ausbeutung des Planeten Venus zu leiten. Er sprach über die langwierigen Vorarbeiten, die Lobby und das Freundschaftswerben beim Kongress; auf diese Weise hatten wir das Exklusivrecht zur Nutzung des Planeten erlangt – und allmählich wurde mir klar, warum er ohne weiteres einen Werbefilm von neun Minuten Länge senden konnte. Er erklärte, die Regierung – seltsam, dass wir noch immer von diesem mit Abhängigkeiten jonglierenden Beziehungsfilz reden, als sei es eine Einheit mit eigenem Willen – wünsche, dass die Venus ein amerikanischer Planet werde, und dass man das explizit amerikanische Talent zur Werbung gewählt hatte, um dies möglich zu machen. Während er sprach, sprang der Funke auf uns über. Ich beneidete den Mann, der die Abteilung VENUS SECTION leiten würde; jeder von uns wäre stolz gewesen, die Aufgabe zu übernehmen.
Er sprach von den Schwierigkeiten mit dem Senator von Du Pont Chemicals, der fünfundvierzig Stimmen besaß, und von seinem mühelosen Sieg über den Senator von Nash-Kelvinator mit nur sechs Stimmen. Er sprach stolz über die vorsätzlich provozierte Consie-Demonstration gegen Fowler Schocken, die den Innenminister, der ein fanatischer Gegner dieser Gruppe war, auf den Plan gerufen hatte. Die Abteilung »Anschauungsmaterial« hatte gute Arbeit geleistet, dennoch schauten wir beinahe eine Stunde die Tabellen an und lauschten Fowlers Vorstellungen und Plänen.
Irgendwann schaltete er endlich den Projektor ab und sagte: »Das wär’s. Das ist unser neuer Werbefeldzug. Und er beginnt auf der Stelle – sofort. Ich habe nur noch eines zu sagen, danach gehen wir alle an die Arbeit.«
Fowler Schocken ist ein guter Schauspieler. Er suchte umständlich nach einem Stück Papier, um einen Satz abzulesen, den selbst der unfähigste unserer Texter aus dem Handgelenk geschüttelt hätte. »Präsident von VENUS SECTION«, las er vor, »ist Mitchell Courtenay.«
Und das war die allergrößte Überraschung, denn Mitchell Courtenay bin ich.
2
Ich blieb noch ein paar Minuten bei Fowler, während die Kollegen wieder in ihre Büros zurückkehrten; die Fahrt im Lift nach unten in mein Büro im 86. Stock dauerte nur wenige Sekunden. Hester räumte bereits meinen Schreibtisch aus, als ich reinkam.
»Herzlichen Glückwunsch, Mr. Courtenay«, sagte sie. »Sie ziehen jetzt in den 89. Ist das nicht herrlich? Und ich habe auch ein eigenes Büro!«
Ich bedankte mich und nahm den Telefonhörer in die Hand. Als Erstes musste ich meine Mannschaft um mich scharen und die Produktionsleitung in andere Hände legen; Tom Gillespie war am längsten in der Firma und schon von daher mein Favorit. Zuvor aber rief ich schnell bei Kathy an. Immer noch keine Antwort, also ließ ich meine Mitarbeiter kommen.
Es tat ihnen wirklich leid, dass ich ging, aber ebenso sehr freuten sie sich darüber, dass jeder auf einen besseren Posten rückte.
Und dann war Mittagszeit; ich verschob die Probleme des Venusprojekts auf den Nachmittag.
Ich telefonierte, aß schnell einen Happen in der Kantine, fuhr mit dem Fahrstuhl zur Haltestelle hinunter und dann sechzehn Blöcke weiter nach Süden. Als ich ausstieg, war ich zum ersten Mal an diesem Tag an der frischen Luft und holte meine Smogfilter heraus, allerdings ohne sie zu benutzen. Es nieselte etwas, und die Luft war sauberer als sonst. Ein heißer, stickiger Sommertag; die Menschenmenge, die auf dem Bürgersteig entlangkroch, zog es ebenso schnell wie mich in die Gebäude. Ich musste mir einen Weg durchs Gewühl bahnen und verschwand dann in einem Haus.
Der Fahrstuhl brachte mich ins 14. Stockwerk. Es war ein altes Haus mit mangelhafter Klimaanlage, und ich fröstelte in meinem feuchten Anzug. Ich dachte flüchtig daran, aus dieser Tatsache etwas herauszuholen, statt die Geschichte zum Besten zu geben, die ich mir zurechtgelegt hatte, verwarf den Gedanken aber schnell wieder.
Ein Mädchen in gestärkter weißer Uniform blickte auf, als ich ins Büro trat. Ich sagte: »Mein Name ist Silver. Walter P. Silver. Ich bin angemeldet.«
»Ja, Mr. Silver«, erinnerte sie sich. »Ihr Herz – Sie sagten, es sei dringend.«
»Stimmt. Natürlich ist es vermutlich psychosomatisch, aber ich dachte …«
»Natürlich.« Sie bat mich Platz zu nehmen. »Dr. Nevin wird Sie gleich hereinbitten.«
Es dauerte zehn Minuten. Eine junge Frau kam aus dem Arztzimmer, und ein Mann, der vor mir im Warteraum gesessen hatte, ging hinein; bald kam auch er wieder heraus, und die Schwester sagte: »Wenn Sie jetzt bitte zu Dr. Nevin hineingehen wollen?« Ich ging hinein. Kathy, sehr adrett und hübsch in ihrem Doktorkittel, legte gerade eine Karteikarte auf den Schreibtisch. Als sie aufblickte, sagte sie »Oh, Mitch«, und es klang recht ärgerlich.
»Ich habe nur einmal gelogen«, verteidigte ich mich. »Als ich einen falschen Namen genannt habe. Und es ist in der Tat dringend. Und um mein Herz geht es wirklich.«
Es schien, als wolle sie lächeln, doch das Lächeln gelangte nicht an die Oberfläche. »Aber nicht medizinisch gesehen.«
»Ich habe dem Mädchen gesagt, die Sache sei vermutlich psychosomatisch. Sie sagte, ich solle trotzdem hineingehen.«
»Ich werde mit ihr reden. Mitch, du weißt, dass ich während der Arbeitszeit nicht mit dir sprechen kann. Bitte.«
Ich setzte mich an ihren Schreibtisch. »Du willst mich überhaupt nicht mehr sehen, Kathy. Was ist los?«
»Nichts ist los. Bitte geh, Mitch. Ich bin Ärztin, ich muss arbeiten.«
»Nichts ist so wichtig wie das hier, Kathy, ich habe gestern Abend und heute Morgen vergeblich versucht, dich anzurufen.«
Sie zündete sich eine Zigarette an, ohne mich anzuschauen. »Ich war nicht zu Hause«, sagte sie einfach.
»Nein.« Ich beugte mich nach vorn, nahm ihr die Zigarette aus der Hand und inhalierte. Sie zögerte, zuckte die Schultern und nahm sich eine neue. Ich sagte: »Vermutlich habe ich kein Recht, meine Frau zu fragen, wo sie ihre Zeit verbringt?«
Kathy fuhr auf: »Verdammt, Mitch, du weiß…« Das Telefon klingelte. Sie schloss einen Augenblick lang die Augen. Dann nahm sie den Hörer ab, lehnte sich zurück, blickte entspannt durch den Raum, ganz Arzt, der einen Patienten beruhigt. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Aber danach war sie vollkommen beherrscht.
»Bitte geh«, sagte sie dann und drückte die Zigarette aus.
»Nicht bevor du mir gesagt hast, wann wir uns treffen.«
»Ich … ich habe keine Zeit, Mitch. Ich bin nicht deine Frau. Du hast kein Recht, mich zu belästigen. Ich könnte es dir verbieten oder dich festnehmen lassen.«
»Meine Urkunde liegt bei den Akten«, erinnerte ich sie.
»Aber meine nicht. Und sie wird es niemals. Sobald das Jahr um ist, sind wir geschiedene Leute, Mitch.«
»Ich wollte dir etwas erzählen.« Neugier war Kathys schwache Seite.
Es entstand eine lange Pause, und anstatt noch einmal zu sagen: »Bitte geh«, sagte sie: »Nun, und was ist es?«
Ich sagte: »Es ist etwas Großes. Es muss gefeiert werden. Und ich werde es als Vorwand benutzen, dich heute Abend zu sehen. Bitte, Kathy – ich liebe dich sehr und ich verspreche, dir keine Szene zu machen.«
»… Nein.«
Titel der amerikanischen Originalausgabe THE SPACE MERCHANTS Deutsche Übersetzung von Helga Wingert-Uhde, neu durchgesehen und vollständig überarbeitet von Werner Bauer
Überarbeitete Neuausgabe 1/09
Copyright © 1952 by Frederik Pohl & Cyril M. Kornbluth Copyright © 2008 des Vorworts by Richard Morgan Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH www.heyne.de
Umschlagbild: Arndt Drechsler Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie, München - Zürich Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN: 978-3-641-09436-2
www.randomhouse.de
Leseprobe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: