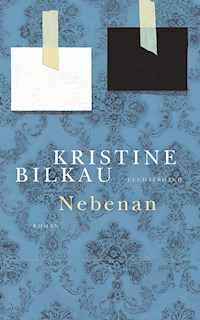9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung aufgewachsen, wollen sie die Welt kennenlernen, anders leben und lieben. Edgar ergreift die Chance, für eine Firma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat. Fünfzig Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter, fragt sich Tonis Tochter: Welche Hoffnungen und Träume hatte ihre Mutter als junge Frau? Lebte sie, wie sie es sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? Und wer war dieser Mann, den sie nie vergessen konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kristine
Eine Liebe,
Bilkau
in Gedanken
Luchterhand Literaturverlag
Das Buch
Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen den Traum von einer Zukunft fern von ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung aufgewachsen, wollen sie sich entwickeln, die Welt kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat. Nach einem Jahr der Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und hoffen, sondern endlich weiterleben. Tonis und Edgars Leben entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie ein roter Faden durch beide Biographien. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit und dem Wunsch, sich zu binden, um Edgar zu vergessen.
Fünfzig Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter fragt sich Tonis Tochter: War ihre Mutter gescheitert oder lebte sie, wie sie es sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? Wer war dieser Mann, den sie nie vergessen konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal.
Kristine Bilkau hält uns einen Spiegel vor: Wie viel Intensität, Risiko und Schmerz lassen wir zu, wenn es um unsere Gefühle und Beziehungen geht?
Die Autorin
KRISTINE BILKAU, 1974 geboren, arbeitet als Magazinjournalistin und lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Ihr erster Roman »Die Glücklichen« fand ein begeistertes Medienecho und wurde mit dem Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur ausgezeichnet.
Wenn Ihnen danach ist, einen ganzen Tag lang ins Wasser zu spucken, um Kringel zu machen, wird die Frau, die Sie liebt, den ganzen Tag an Ihrer Seite bleiben, ohne etwas zu sagen, und Ihnen dabei zusehen, wie Sie Wasserkringel machen; (…) Sie haben hinzugefügt, ich würde das nicht fertigbringen. Das muß ich wohl oder übel zugeben. Ich würde erst einmal versuchen zu schlafen oder selbst irgend etwas zu tun; wenn das nicht ginge, könnte ich es mir nicht verkneifen, Ihnen zu sagen, daß Sie ein Dummkopf sind und daß Sie mich lieber küssen sollen. Dann würde ich mich neben Sie setzen und auch Wasserkringel machen, um dasselbe zu tun wie Sie, und ich würde das Spiel der größten und der kleinsten Kringel erfinden.
Hätten Sie es denn ausgehalten, an meiner Seite zu bleiben und mir dabei zuzusehen, wie ich Wasserkringel mache?
Marcelle Sauvageot: Fast ganz die Deine
Wer hat mich gefunden? Wie sah ich aus?«
Meine Mutter sitzt vor mir auf der Küchenbank, sie bestreicht sich ein Stück Baguette mit zerschmolzenem Camembert, sie sitzt, wie immer, wenn sie uns besuchte, auf dieser alten Holzbank, die Florian und ich, als Studenten, vor über zwanzig Jahren auf einer Reise durch Polen gekauft hatten, sie nippt an ihrem Darjeeling und will alles über ihren eigenen Tod wissen.
»War mein Anblick eine Zumutung für dich?«, fragt sie. »Ich hätte dich gern beschützt«, sagt sie und klingt wie früher, wenn sie etwas von mir hatte fernhalten wollen; Nachrichten mit grausamen Bildern im Fernsehen, die ich nicht hätte sehen sollen, eine Todesgeschichte aus der Nachbarschaft, von der ich nichts hätte hören sollen.
Eine Zumutung war ihr Anblick nicht. Sie wirkte schmaler als sonst, vor allem das. Sie lag im Bett, auf dem Rücken, zugedeckt bis zu den Schultern, das Gesicht leicht dem Fenster zugewandt, die Augen geschlossen, die Lippen geschlossen, mit einer Spur von Anspannung. Ich sah auch den Hauch eines Lächelns, ein wenig ironisch, wie ich es von ihr kannte.
Die Situation hat dich nicht entblößt. Du bist gut davongekommen. Das würde ich ihr sagen.
»Und? Was machen wir denn jetzt?«
Sie klingt nicht betrübt, sondern auf trotzige Art belustigt. Als könnte sie ihren Tod mit einem »Och, nöö«, wie ich es oft von ihr gehört hatte, auf später verschieben, rückgängig machen oder wieder vergessen, wie ein schnell behobenes Problem. Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt, einige Tage vor Weihnachten, meine Mutter hatte ihr restliches Geld für Geschenke und Lebensmittel für die Festtage abgehoben, dann stahl ihr jemand das Portemonnaie, sie war für diesen Monat pleite, ich sah ihr an, wie enttäuscht und erstaunt sie war, dass ihr das jemand hatte antun können, dann lächelte sie, Och, nöö. Sie rief Freunde an, lieh sich etwas Geld, und es ging weiter.
»Ich hatte meine Haare am Mittag gewaschen. Immerhin das. Waren sie in Ordnung? Oder sah ich bemitleidenswert aus?«
Auch als es ihr miserabel ging, sie kaum eine Treppe mehr schaffte, überhaupt ihre Wohnung nur noch selten verließ, um sich selbst nicht damit zu konfrontieren, wie schwach ihr Herz war, kümmerte sie sich um ihre Frisur. Ihr akkurat geschnittenes, ohrläppchenkurzes Haar, ein Leben lang kaum verändert, dunkelbraun, dann dunkelbraun gefärbt, alle acht Wochen kam ein Friseur zu ihr nach Hause.
Ich hatte gedacht, sie wäre unverwundbar.
Doch dann saß ich an ihrem Bett, betrachtete ihr leicht gebräuntes, dahinter eindeutig blasses Gesicht, und zupfte an den Seiten ihr Haar zurecht, so, wie sie es gemocht hätte.
»Weißt du, was frappierend ist?« Sie benutzte gern das Wort frappierend. »Ich habe gedacht, ich würde nicht sterben. Ja, sicher, ich habe es gespürt, aber ich habe es trotzdem nicht für möglich halten wollen. Und dann passiert es. Ist das nicht erstaunlich?« Sie sagt das, als hätte sie eine interessante Dokumentation gesehen oder einen aufschlussreichen Artikel gelesen und würde dazu gern meine Meinung hören.
Mich hat ihr Tod überrascht. Sie war keine schwache, alternde Frau, trotz ihrer Herzschwäche. Eine verschleppte Grippe vor einigen Jahren, beschädigtes Herzgewebe, porös, wie der Chirurg sagte. Zwei künstliche Klappen, Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Blutverdünner. Dann Diabetes und Nierenschwäche. Ich stellte ihr ein Heimfahrrad ins Schlafzimmer. Sie benutzte es, um ihre Jacketts und Kleider darauf abzulegen. Über dem Lenker hingen, hauchdünn und schwarz, ihre Strumpfhosen.
Das schwache Herz ließ sich gut verdrängen. Wenn sie am Tisch saß, Tee nachschenkte, wenn sie erzählte, was sie gerade las oder welchen Film sie gesehen hatte, konnten wir es vergessen. Doch sie konnte keine zehn Treppenstufen mehr steigen, ohne mich schwer atmend und vorwurfsvoll anzublicken.
Unser letztes Telefonat, Ende Januar, Sonntag, um die Mittagszeit. Ich wollte sie am Nachmittag besuchen, wir hatten uns seit Wochen nicht gesehen, hatten Verabredungen verschoben, es hatte an mir gelegen. Kurz bevor ich losfahren wollte, rief sie an, sie müsse absagen, ihr sei schrecklich übel. Ob ich einen Notarzt rufen solle, fragte ich. Nein, sagte sie streng, bloß nicht, sie wolle nur etwas schlafen. Ihr war schon oft übel gewesen, manchmal, wenn sie aufgewühlt oder erschöpft gewesen war. Am Abend erreichte ich sie nicht, ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Sie starb in den frühen Morgenstunden, wahrscheinlich im Schlaf, sagte die Ärztin und erwähnte, Übelkeit sei ein Symptom für einen stummen Infarkt.
»Du hattest recht, wir hätten einen Notarzt rufen sollen. Es ist meine Schuld, nicht deine, fang gar nicht erst an, dir Vorwürfe zu machen.«
Am Ende habe ich ihre Hand berührt. Ich wollte wissen, ob ihre Hand sich anders anfühlte als sonst. Sie war wie immer: weich, kein bisschen alt.
Und ihre Füße habe ich mir angesehen, zum Abschied.
»Och, nöö, meine hässlichen Füße.«
Sie hatte ihre Füße nie gemocht, sie wirkten immer ein wenig geschwollen, zierliche Schuhe, Sandalen mit dünnen Riemen oder schmale Pumps passten meiner Mutter nicht, im Sommer und im Winter lief sie in bequemen Ballerinaschuhen herum. »Meine Pfannkuchenfüße«, hatte sie oft gesagt. Sie lag im Bikini auf der Liege im Garten und sonnte sich, die Augen geschlossen, das Gesicht entspannt, und ich kletterte zwischen ihren Beinen herum, ihre Füße gehörten mir, ihr ganzer Körper gehörte mir, alles an ihr war schön. Ich habe ihr nichts von dieser Kindheitserinnerung erzählt, ich habe einfach nicht daran gedacht, es zu tun. Dabei hätte sie sicher gern davon gewusst.
Wie war dein letzter Abend, deine letzte Nacht?
Warst du lange wach, wie so oft? Hattest du Angst, hast du dich einsam gefühlt? Oder hast du wirklich, wie wir alle glauben möchten, tief geschlafen, während der frühen Morgenstunden?
Ich wünschte, sie könnte mir davon erzählen. Doch Stille, meine Mutter, dort, auf der Küchenbank, und ich, wir haben diese letzten Stunden nicht in unserem Repertoire.
An einem Abend, auf dem Heimweg von einem Termin im Museum, stieg ich einige Stationen eher aus dem Bus. Ich fuhr oft durch diese Straße, die Buslinie führte wie eine Hauptader durch die Stadt, vorbei an der Staatsbibliothek, der Universität. Ich stellte mich etwas abseits der Leute und schaute zum Haus gegenüber, oben, in einem Zimmer neben einem kleinen Erker, brannte Licht. Als meine Mutter und ich, da studierte ich noch und wohnte nicht weit von hier, ins Kino gehen wollten, hatte sie auf die Häuserreihe gegenüber gezeigt und gesagt:
»Da hatte ich mal ein Zimmer, siebzig Mark im Monat. Bei einer energischen Frau, die manchmal Zigarillos rauchte und hier in einem Tabakladen arbeitete. Ich war so alt wie du jetzt.«
Ich hatte nicht gefragt: Wo meinst du? Wo genau? Ich hatte nur genickt, aha, in einem dieser Häuser, wie schön, wir müssen uns beeilen, der Film fängt gleich an.
Inzwischen hatte ich die Bündel ihrer alten Briefe durchgesehen und dabei die Adresse entdeckt. Antonia Weber c/o Konrad, es war die Hausnummer 97. V. Stock, links.
Wo? Wo genau war dein Zimmer?
Ich sah hoch zu dem Fenster neben dem kleinen Erker und stellte mir vor, es wäre ihres gewesen. Ich behielt das Fenster im Blick, sah so lange hin, bis das Zimmer wirklich ihr gehörte, Antonia Weber, bis die Zeit wieder die ihre war, Mitte der Sechzigerjahre. Solange ich das Fenster nicht aus den Augen ließ, wohnte die junge Frau da oben, die Zweiundzwanzigjährige mit den kurzen, dunklen Haaren, den schlanken Armen, den dichten, geschwungenen Augenbrauen, der dauerhaften leichten Bräune eines Mädchens, das an der See aufgewachsen war, der schmalen Taille einer Frau, die sich von Dosenmandarinen mit Joghurt und Pumpernickel mit etwas Käse ernährte, weil sie ihr Geld lieber für Schallplatten und Zeitungen ausgab, für kurze Kleider und Verzugsgebühren in der Bibliothek der Universität, an der sie nicht studierte, aber wo sie sich manchmal herumtrieb, als würde sie dazugehören. Sie war dort oben in dem Zimmer, ich konnte ihre Zuversicht spüren, ihre Vorfreude auf diesen Abend, auf den nächsten Tag, auf die kommenden Wochen und Monate, auf alles, was nun endlich geschehen würde, nun, da sie einen Job, ein eigenes Zimmer, ein Leben in dieser Stadt hatte. Ich konnte ihre Erwartungen spüren.
Sie schlüpft aus den Schuhen und legt Musik auf. Nat King Coles weiche Stimme und das gleichmäßige Knistern der Kratzer, denn sie behandelt ihre Schallplatten mit Ungeduld.
Sie trägt ein Kleid in Zitronengelb, kurz, mit weißem Kragen, ihre Schritte rascheln leise auf dem Teppich, während sie durch das Zimmer geht, zum Regal, zum Sofa, immer wieder in die Nähe des Fensters, um zu sehen, ob der Mann noch dort unten wartet. Sie hat ihm in der Straßenbahn, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, den Kopf verdreht; den Kopf verdreht, so würde sie es einer Freundin erzählen. So hat sie es mir erzählt. Anfangs beobachtete er sie zaghaft, als wollte er nicht erwischt werden beim Hinsehen. Sie erwischte ihn doch, lächelte ihn direkt an, um dann kurz darauf scheinbar gelassen aus dem Fenster zu blicken, was sie aber nicht lange durchhielt. Sie mochte sein Gesicht, eine hohe Stirn wie die von Camus, und auch so feine Lippen wie er, dunkle Haare. Mit seinen schmalen Schultern sah er aus wie jemand, der als Junge nicht der Schnellste, Stärkste oder Lauteste gewesen war, und der das auch gar nicht vorgehabt hatte.
An der Haltestelle vor ihrem Haus stieg sie aus, mit ihr noch ein paar andere Leute, und dahinter er; das sah sie aus dem Augenwinkel, während sie an der Ampel warten musste. Langsam ging sie auf die andere Straßenseite und blickte wie zufällig über die Schulter zurück; er folgte ihr immer noch, in höflichem Abstand. Vor der Tür klappte sie ihre Handtasche auf und suchte nach dem Schlüssel. Nachdem sie ihn gefunden hatte, tat sie weiter so, als würde sie suchen, dabei wartete sie neugierig darauf, was nun passieren würde.
»Verzeihen Sie«, sagte der Mann, sie drehte sich zu ihm um, »wahrscheinlich haben Sie ohnehin keine Zeit, sicher haben Sie Besseres vor, aber ich möchte trotzdem gern fragen, ob ich Sie zu einem Kaffee einladen darf.« Er blickte abwechselnd zu ihr und zum Café gegenüber, sie mochte sein nervöses Lächeln und hätte fast sofort Ja gesagt. Doch eine Frau auf der Straße anzusprechen, das war zu einfach, darauf konnte sie sich nicht einlassen, ohne den falschen Eindruck zu wecken. Sie überlegte, wie sie es anstellen konnte, den Kaffee abzulehnen und dann doch nicht abzulehnen.
»Ich habe eine Cousine zu Besuch«, sagte sie und fügte hinzu, »aus Paris.« Es hatte einen gewissen Reiz, Paris zu erwähnen, es klang nach Abenteuer und der Möglichkeit für Glanzvolles, es klang nach einem Leben voller interessanter Ereignisse. Auf der Straße von einem fremden Mann angesprochen zu werden, war nur ein staubkornkleiner Teil eines solchen Lebens, so klang Paris.
»Ich weiß noch nicht, was meine Cousine heute vorhat. Vielleicht habe ich etwas Zeit für einen Kaffee, vielleicht in einer halben Stunde, vielleicht später.« Sie schloss die Tür auf, schob sie einen Spaltbreit auf und sah ihn fragend an.
»Sicher, das verstehe ich. Da drüben«, er zeigte zum Lokal gegenüber, »werde ich eine Weile warten und würde mich freuen, wenn Ihre Cousine Sie für eine Viertelstunde freigibt. Die haben auch Eiskaffee«, sagte er noch, lächelte, »also, ich meine, wirklich guten Eiskaffee.« Er wirkte nicht wie einer, der regelmäßig Frauen auf der Straße ansprach.
Jetzt muss sie noch etwas Zeit verstreichen lassen, um herauszufinden, ob er jemand ist, der wartet, ob sie jemand ist, auf den gewartet wird.
Erst fünfzehn Minuten sind geschafft. Wieder geht sie ans Fenster, nicht zu nah, nur gerade so, dass sie die andere Straßenseite sehen kann. Da hinten steht er. Sie beobachtet, wie er sich tapfer langweilt, wie er die Auslage des Tabakladens betrachtet, dann die des Käseverkäufers, wie er langsam in die eine Richtung, dann in die andere geht. Er könnte sich ins Café setzen und dort auf sie warten, aber das scheint er nicht zu wollen. Fünfzehn zähe Minuten, doch die genügen noch nicht, sie darf es ihm nicht zu leicht machen, niemals leicht, leicht ist ein hartes Wort, ein ungerechtes dazu, es lässt sich schnell dahinsagen und verschwindet nie wieder. »Pass bloß auf dich auf«, sagt ihre Mutter bei jedem Abschied, »ich mach mir solche Sorgen«, sagt ihre Mutter am Ende jedes Telefonats und klingt dann, als würde sie schrecklich darunter leiden, sich Sorgen machen zu müssen. Das Mädchen, das noch keinen Ring trägt, das allein in der Großstadt lebt, ist schuld daran. Doch die Sorge ist nicht echt, sie ist nichts als ein Vorwurf, sie bedeutet Enge und Bevormundung.
Aus dem Wäschehäuflein unten im Schrank zieht sie drei Paar Nylonstrümpfe heraus. Um noch etwas Zeit zu überbrücken, kann sie auch gleich etwas Sinnvolles tun. Sie geht ins Bad, weicht die Nylons in lauwarmem Wasser ein und gibt einen Klecks Schauma dazu, nicht zu viel, die Tube muss bis Ende des Monats halten, dann kann sie wieder einkaufen. Vor dem Spiegel zupft sie sich das Haar zurecht, zwirbelt links die Locke neben der Wange um den Finger und gibt einen Zisch Spray darauf, dann die rechte, mit dem Kamm hebt sie das Haar hinten etwas an, toupiert ein bisschen nach.
Sie hat Glück, die Leine über der Wanne ist frei, keine vergilbten Unterkleider von Frau Konrad, keine ausgeleierten Schlüpfer von Herrn Lewerenz. Sein Husten ist schlimmer geworden, jeden Morgen hört sie, wie Herr Lewerenz sich abmüht, in seinem Zimmer am anderen Ende des Flurs. Sie drückt das Wasser vorsichtig aus den Strümpfen und legt die federleichten Stoffe über die Leine. Manchmal hängt Fräulein Friedrichs ihre mit Ziehfäden durchsetzten Strümpfe dazu, doch nimmt Stunden später, wie aus Versehen, die anderen, die guten wieder ab. Immer wieder das gleiche Spiel: Mit den alten Strümpfen in der Hand klopft sie dann bei Fräulein Friedrichs, hält ihr die zerzausten Dinger vor die Brust, »Das müssten Ihre sein, nicht meine Größe, die sind mir nämlich zu kurz, wissen Sie?«
Schnell zurück ins Zimmer, zum Fenster, er ist noch da. Ein Blick auf die Uhr. Sie dreht die Schallplatte um. Das kleine Sofa, das nur für zwei schmale Leute gemacht ist, könnte näher am Fenster stehen, das hatte sie schon lange vor. »Damensofa in einem modernen Campari-Rot«, stellte es der Verkäufer ihr vor. Sie hat sich das Sofa einiges kosten lassen, zusammen mit dem Plattenspieler und sechs Cocktailgläsern hat sie es sich gekauft, für ihren neu gegründeten Haushalt, hier, in diesem Zimmer.
Was sagt sie, wenn der Mann sie fragt, wie sie zu einer Cousine in Paris gekommen ist? Eine Cousine in Paris, die haben sicher nicht viele. Sie bräuchte einen Onkel und eine Tante in Frankreich. Ein Onkel, der in Frankreich stationiert war, der sich, anders als von ihm erwartet wurde, in eine Französin verliebte, der, anders als von ihm erwartet wurde, in Frankreich blieb, die Französin heiratete und sieben Kinder mit ihr bekam. Wie schön wäre es, einen solchen Onkel zu haben. Sie hat nur einen, über den niemand spricht.
Sie rückt das Sofa ein Stück von der Wand ab und schiebt es durch das Zimmer, zur anderen Seite, bis es schräg in der Ecke, halb vor dem Fenster steht, die Sitzfläche dem Raum zugewandt. Den kleinen Tisch stellt sie davor und nimmt Platz. Als wäre sie zu Besuch, als wäre sie zum ersten Mal hier, als wäre sie der Mann aus der Straßenbahn, lässt sie das Zimmer auf sich wirken. Ihm würde auffallen, dass sie leuchtende Farben mag, das rote Sofa, die orangefarbene Tagesdecke auf dem Bett, die zwei meerblauen Kissen auf dem Boden. Er würde sehen, dass sie Zeitungen hortet, dass sie Pernod und Gin trinkt, und halbtrockenen Sherry. Vielleicht würden ihm die alten Tapeten auffallen, er würde die Risse an der Decke sehen und würde bemerken, dass sie nicht gern Staub wischt. Sie lässt den Blick weiter schweifen, er würde die Postkarten mit den Bildern von den Straßen in Paris sehen, die über dem Plattenspieler hängen, er würde vielleicht denken, die Karten hätte ihre Cousine geschickt.
Sie zieht die Beine hoch, kniet sich aufs Sofa und schaut wieder aus dem Fenster. Tabakladen, Käsegeschäft, Café, Ampel, eine Straßenbahn hält. Er ist nicht mehr da. Sie wartet, die Bahn fährt weiter. Der Mann mit den knabenhaften Schultern und dem zaghaften Lächeln, er ist wirklich gegangen. Er hat sich überlegt, dass er sie doch nicht kennenlernen muss, dass dreißig Minuten Warten zu lang sind. Die Nadel des Plattenspielers hängt auf dem letzten stummen Stück fest, in der Küche klappert jemand mit Töpfen. Vielleicht ist er vor Kurzem in die Straßenbahn gestiegen, vielleicht in jene, die sie eben hat davonfahren sehen. Im Flur klingelt das Telefon, jemand geht eilig hin, sie hört die Stimme von Fräulein Friedrichs.
Wieder schaut sie auf die Straße, hätte sie eine Cousine aus Paris zu Besuch, was würde sie mit ihr jetzt unternehmen? Sie würden in ein Restaurant gehen, vielleicht würden sie danach durch die Wallanlagen spazieren, vorbei an den Teichen mit den Seerosen, weiter zu den Wasserfontänen, wo sie eine Weile bleiben und sich eine Limonade kaufen würden.
Er hat nicht gewartet, aber das ist nicht weiter schlimm. Morgen hat sie ihn vergessen.
Sie und ihre Cousine könnten auch zur Universität gehen und nachsehen, ob ein interessanter Vortrag stattfindet, oder eine Filmvorführung.
Er hat nicht gewartet, aber das ist nicht weiter wichtig.
Oder sie könnten ins Kino gehen und danach, hier oben, eine Weile am offenen Fenster sitzen, Musik hören, Pernod trinken und die warme Abendluft atmen.
Eine Zeitung unterm Arm tritt er aus dem Tabakladen.
Er ist wieder da. Er ist gegangen und zurückgekehrt. So kommt es ihr vor. Nein, er war die ganze Zeit da und hat auf sie gewartet. Unvermittelt bleibt er stehen, schaut herunter auf seine Schuhe. Zwischen den Leuten, die es eilig haben, steht er einfach da und betrachtet die Schuhspitzen, als wäre er allein mit sich, und weil sie sich so freut, dass er dort auf sie wartet, dass er für sie zurückgekommen ist, obwohl er gar nicht gegangen war, beschließt sie, dass er ein feiner Mensch ist und dass sie sofort bei ihm sein muss. Sie zieht den kleinen Spiegel aus der Handtasche, streicht mit der Fingerspitze über die Augenbrauen. Sie schlüpft in die Schuhe, verlässt die Wohnung, läuft hastig die Treppen herunter, einen Moment wartet sie, bis sich der Atem beruhigt hat, dann öffnet sie die Tür. Der Straße den Rücken zugewandt liest er Zeitung. Er wird nicht sehen, wie sie zu ihm geht, er wird überrascht sein, wenn sie auf einmal hinter ihm steht und ihm auf die Schulter tippt. »Guten Abend«, wird sie sagen, und vielleicht ein Spiel daraus machen, »Verzeihen Sie, aber dürfte ich Sie einladen? Es soll hier Eiskaffee geben, wirklich guten, habe ich gehört.«
Ab-reise, Ab-schied, Ab-; auf dem Küchentisch lag einNotiz von Florian für mich, ich konnte das erste Wort nicht erkennen. Ich freute mich über seine kleinen Zettel, er war der Einzige von uns, der Nachrichten auf der Kommode oder dem Tisch hinterließ, doch an seine undeutliche Schrift hatte ich mich nie gewöhnt. Ab-leben, sicher, das stand da nicht, meine Wahrnehmung spielte mir einen Streich. Es ging um das Probeabo bei einem Filmanbieter.
Abmelden nicht vergessen. Kuss
Florian hatte mich gestern schon daran erinnert, das Abo musste gekündigt werden. Abmelden, ich war erleichtert und wusste gar nicht, warum.
Ich stellte den Kessel auf das heiße Kochfeld, Wassertropfen knisterten, ich öffnete den Kühlschrank, holte Butter und Marmelade heraus, deckte den Tisch für mich und für Hanna, sie schlief noch. Hier ein Geräusch, da ein Geräusch, sonst Stille, nur meine Handgriffe, nur ich. Draußen war es noch dunkel.
Ich musste Hanna nicht wecken, das machte ihr Telefon, und heute fiel die erste Schulstunde aus. Hin und wieder versuchte ich, Hannas Telefon zuvorzukommen, ging dann leise an ihr Bett, um kleine Kreise in ihr Gesicht zu zeichnen, rund um die Augen, über die Wangen. So hatte ich es schon gemacht, als sie noch ein Säugling gewesen war, wenige Tage, wenige Wochen alt. Damals sollte ich sie alle drei oder vier Stunden wecken, um sie zu stillen, denn anfangs wog Hanna zu wenig, weil sie nicht genug trank und lieber schlief.
Ich schaute auf die Uhr, es war noch etwas Zeit. Eine selbstständige Achtzehnjährige zu früh zu wecken war keine gute Idee. Schon gar nicht, wenn ich es nur machte, um ihr Gesicht zu betrachten und ihre Wange zu streicheln.
»Mama, was is?«, würde sie schlaftrunken und etwas muffig fragen.
»Nichts, nichts Besonderes«, würde ich antworten, und sie würde sich seufzend noch einmal auf die Seite drehen.
»Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass meine Mutter gestorben ist.« Ich stellte mir vor, wie Edgar Janssen mir die Tür öffnete und ich ihm das mitteilte. Die Nachricht würde wichtig für ihn sein, ja, das schon, wie wichtig, das wusste ich nicht, auch nicht, ob sie ihn noch lange beschäftigen würde. Doch ich wollte, dass er es erfuhr; und ich wollte ihm begegnen, ein einziges Mal.
Edgar Janssen verbrachte, soweit ich wusste, jedes Jahr den Spätsommer in seinem Elternhaus. Seine Eltern lebten nicht mehr, er musste selbst inzwischen Mitte siebzig sein. Er war vor über fünfzig Jahren ins Ausland gegangen und nicht zurückgekehrt, doch das Haus hatte er behalten.
Das Haus, in dem meine Mutter ein- und ausgegangen war, eine Frau Mitte zwanzig, die gedacht hatte, sie würde ihr Leben mit Edgar Janssen verbringen. Das Haus, das sie nicht losgelassen hatte, an dem sie jedes Jahr im Spätsommer vorbeigefahren war, um das Licht hinter den Fenstern zu sehen. »Edgar ist in der Stadt, ich weiß es«, hatte sie dann gesagt; ich war vierzehn, achtzehn, einundzwanzig Jahre alt, und ich bemerkte dieses schwer zu deutende Strahlen in den Augen meiner Mutter, sie hatte verletzlich und auf undurchschaubare Weise glücklich gewirkt.
Leise Schritte hinter Hannas Tür, ich hatte den Moment, sie zu wecken, verpasst. Ich konnte die Monate zählen, März, April, Mai, Juni, dann würde sie ihr Abitur geschafft haben, würde durch Europa reisen, für eine Zeit nach Neuseeland gehen, danach anfangen zu studieren, vielleicht, sagte sie, vielleicht. Florian und ich hatten sie mit Vorschlägen überschüttet und dabei ihre sanfte Resistenz hervorgerufen. Hanna wusste, was sie wollte, erzählte es uns aber nicht mehr sofort. Ich dachte wieder an den Spätsommer, auf den ich wartete, um bei Edgar Janssen zu klingeln. Doch die Tage, an denen ich mich leise an Hannas Bett stellen und mit dem Finger über ihre Wange kreisen konnte, würden dann aufgebraucht sein.
Ich packte meine Tasche, zog den gefütterten Mantel an, es war wieder Schnee angesagt. Im Bad hörte ich die Dusche rauschen, ich klopfte, verabschiedete mich, in der Küche sei noch warmer Kaffee.
»Okay«, sagte Hanna nur, sonst nichts, was sollte sie auch sagen, wies ich mich zurecht, ich war zu einer dieser Mütter geworden, die zu oft auf ein Zeichen der Zuneigung hofften.
Der Weg zu Edgar Janssens Haus war nicht weit, fünfzehn Minuten mit dem Fahrrad vielleicht. Ich fuhr am Kanal entlang und blies kleine Atemwolken in die kalte Luft. Ich schob mein Fahrrad durch seine Straße, sie verlief parallel zum Kanalufer. In einer Reihe aus Stadtvillen war sein Haus das kleinste, dadurch fiel es ins Auge und hatte etwas Liebenswertes. Der hellblaue Anstrich der geduckten Villa wirkte welk, doch der Vorgarten war von einem neuen Zaun aus blankem Metall geschützt. Hinter den Fenstern war es dunkel.
An welchem Tag würde ich klingeln? Wann begann für Edgar Janssen der Spätsommer, wann würde er in die Stadt kommen, wann wieder abreisen?
Ich fuhr zurück zum Kanal, vom Ufer aus konnte ich in die Gärten der Häuser sehen. Ein hoher, gusseiserner Zaun mit einer Gitterpforte, die mit einer Fahrradkette und einem Vorhängeschloss abgesichert war, trennte das Grundstück vom Spazierweg am Ufer. Der Garten schien verwahrlost, karge Sträucher und Büsche, die länger nicht mehr geschnitten worden waren, hochgewachsener Rasen, eine Wiese aus gelblichem Gras. Ich blieb am Ufer stehen wie eine Spaziergängerin, hin und wieder schaute ich hoch zu den Fenstern im Obergeschoss, dort waren die Vorhänge zugezogen.
Vielleicht würde ich vergeblich klingeln.
Weil Edgar Janssen längst gestorben war.
Oder weil er krank war und nicht mehr reisen konnte.
Oder weil er in diesem Jahr zufällig nicht den Spätsommer, sondern den Winter in der Stadt verbringen würde; was wusste ich schon von ihm?
Vielleicht würde er mir die Tür öffnen, doch versuchen, mich schnell wieder loszuwerden. Weil er meinen Besuch aufdringlich fand. Weil er die Erinnerung an meine Mutter aufdringlich fand. Ich stellte mir einen elegant gekleideten Mann vor, der freundlich, aber unverbindlich sagte, er hätte leider gerade keine Zeit. Ich stellte mir seine Frau vor, die in der Tür stand und sagte, »Es tut mir leid, aber wir können Ihnen nicht weiterhelfen.« Nein, sie würde Englisch sprechen, »I am sorry, but there is nothing we can do for you.«
Ich kannte die alten Fotos von Edgar Janssen und die wenigen Briefe und Karten, die meine Mutter von ihm aufbewahrt hatte. Doch vor allem kannte ich die Geschichte der beiden, die Geschichte von Antonia und Edgar, von der meine Mutter mir oft erzählt hatte.
Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass; nein, eigentlich war das ein Vorwand, denn ich wollte viel mehr. Ich wollte Edgar Janssen dazu bringen, sich an meine Mutter zu erinnern, an seine und ihre gemeinsame Zeit. An die Liebe zwischen Toni und Edgar, die von so kurzer Dauer gewesen war und für meine Mutter doch ein Leben lang gehalten hatte.
Ich sehnte mich nach Toni und Edgar, nach ihrem Glück, nach ihrer gemeinsamen Zukunft, die es einmal gegeben hatte. Nach den beiden Menschen, die Toni und Edgar gewesen waren. Ich wünschte mir, diese Zeit der beiden von irgendwoher zurückholen und meiner Mutter zurückgeben zu können. Wie ein verloren geglaubtes Schmuckstück, das immer vermisst und nie vergessen worden war. Hier, das habe ich für dich gefunden, es gehört zu dir.
17/9.64 Sie schenkt Pernod ein, dazu etwas Eiswasser aus dem Behälter ihres neuen Cocktailsets. »Jetzt müssen wir leise sein«, flüstert sie. Sie hat gehört, wie Frau Konrad ins Bad gegangen ist, danach in die Küche, für ihren Becher warme Milch mit einem Schuss Likör, gleich wird sie durch den Flur kommen und an den Türen horchen, wie immer an Donnerstagen, Freitagen und an Wochenenden. Den Montag, Dienstag und Mittwoch scheint Frau Konrad harmlos zu finden, vielleicht sollte man männlichen Besuch besser an diesen Tagen einladen.
Edgar Janssen stellt sein Glas auf den Tisch, etwas ungeschickt, es stößt an ihres, Kling, macht es in die Stille hinein. Er wirkt unentschlossen. Gehen oder bleiben, sie kann sein Unbehagen ja verstehen, wer wird schon gern von einer Zimmerwirtin aus der Wohnung bugsiert. Sie legt den Finger auf die Lippen.
»Fräulein Weber«, die Stimme der Konrad. »Ist Ihr Besuch noch da?«
»Nein, kein Besuch. Es ist doch schon nach elf«, ruft sie zurück. Sie warten, verharren wie zwei Kinder, die sich versteckt haben, kurz davor, in ihrem Unterschlupf entdeckt zu werden.
Pünktlich, kurz vor zehn, hatte sie erst ihre Zimmertür, dann die Wohnungstür geöffnet und laut wieder geschlossen, um den Eindruck zu wecken, ihr Besuch wäre gegangen. Sie lächelt den Mann neben sich an, damit er weiß: keine Sorge. Im Flur knarren die Dielen, als würde Frau Konrad ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern, als wäre sie unentschlossen, lockerlassen oder nachsehen.
»Dann ist ja gut«, sagt sie schließlich, »angenehme Nachtruhe«, schon einige Schritte entfernt. Sie wird jetzt ins Bett gehen, dort ihre Milch trinken, vielleicht ein Zigarillo rauchen. Das wäre geschafft.
Sie öffnet das Fenster weit, lässt die warme Luft herein, Mitte September, und es ist noch sommerlich, selbst die Nächte. Sie haben den Nachmittag und den Abend zusammen verbracht, waren im Park spazieren, haben sich eine Portion Pommes frites geteilt, sind zu ihr gegangen, haben Tee getrunken, Musik gehört, alles ohne einen Moment der Enttäuschung. Sie kennt das nur zu gut, sie stellt sich jemanden vor, und dann wird doch alles anders; der Mann spricht sie mit Mädchen oder Kleines an, oder er kratzt sich ständig im Ohr, oder zittert auf einmal mit den Händen, bis er zugibt, irgendwo einen Klaren trinken zu wollen, oder er sagt, der FJ Strauß, der sei ja doch ein ganz Guter, einer der wenigen, die Biss hätten. Jede Begegnung ein Irrtum. Aber nicht heute.
»Es war mir eine Freude.«
»Was war Ihnen eine Freude?«
»Dass ich Ihr Gast sein durfte.« Er nimmt ihre Hand und deutet gespielt altmodisch einen Kuss an. »Ich sollte wohl gehen, solange ich es noch freiwillig tun kann«, sagt er, schaut demonstrativ mit dem Anflug eines Lächelns zur Tür.
»Sie klopft nur. Aber öffnet nie. Und jetzt schläft sie wahrscheinlich.«
Noch immer hat er ihre Hand nicht losgelassen. Sie spürt seine Haut, warm und etwas rau. Auf einmal hört sie seinen Atem, leise, durch die Nase, so deutlich, dass sie sich auf einmal vorstellen muss, wie sie an seinem Krawattenknoten zupft, ihn löst, das Hemd aufknöpft und die nackte Brust dieses Mannes sehen kann. Sofort wird sie verlegen.
»Wie geht es Ihrer Cousine in Frankreich?«, fragt er flüsternd.
Ach ja, das. Sie fühlt sich ertappt. »Es geht ihr fantastisch«, antwortet sie entschlossen. Die ausgedachte Cousine, die in Paris lebt, in einem kleinen Apartment unterm Dach, mit Blick auf die Dächer der Stadt, weiter auf die Seine, auf Notre-Dame, den Eiffelturm, auf den Champs-Élysée, auf den Arc de Triomphe, auf die Gräber des Père Lachaise, eine wundersame Wohnung mit Blick auf alles, alles, was sie unbedingt einmal sehen muss.
»Dann richten Sie ihr Grüße aus.«
Noch immer hält er ihre Hand. Sie müssen beide lächeln, als wären sie sich einig, dass es keine Cousine in Paris gibt, aber dass es richtig, dass es schön ist, eine erfunden zu haben. Wie selten passiert es, dass man jemanden trifft, der einen versteht und keine falschen Fragen stellt. Ihr Knie wird unruhig, das nervöse Zittern kommt ausgerechnet dann, wenn jede Regung etwas bedeuten könnte. Schnell zieht sie die Hand aus seiner und greift zum Tisch, zur Schale mit den Pistazien.
»Auch?«, fragt sie.
»Danke, gern«, sagt er und pflückt vorsichtig eine aus ihrer Hand. Die winzige Berührung treibt ihr einen Schauer über die Arme.