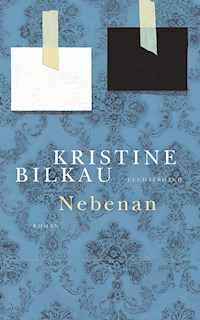21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2025!
Ein Haus am Wattenmeer. Eine Mutter und ihre Tochter. Und der Versuch einer Annäherung zwischen den Generationen. Für Leser*innen von Judith Hermanns »Daheim«, Anne Rabe »Die Möglichkeit von Glück«, Daniela Krien »Die Liebe im Ernstfall«und Elizabeth Strout »Am Meer«.
Eine Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Hier, an der Nordsee, lebt Annett, Ende vierzig, seit vielen Jahren, hier hat sie nach dem frühen Tod ihres Mannes ihre Tochter Linn allein großgezogen. Linn, Mitte zwanzig, ist nach dem Abitur voller Energie in die Welt gezogen, hat sich in schwedischen und rumänischen Wäldern als Umweltvolontärin engagiert, arbeitet für ein Aufforstungsprojekt. Für Annett ist ihre Tochter die Verkörperung von Hoffnung, Sinn und Zukunft. Doch auf einer Tagung, während eines Vortrags kippt Linn um, Kreislaufzusammenbruch, Erschöpfung. Annett holt sie für eine Woche zu sich nach Hause, ans Meer, nahe Husum. Aus einer werden zwei, dann drei Wochen, dann Monate. Zerrieben zwischen Leistungsdruck und Sinnsuche, scheint Linn mit Mitte Zwanzig an einem Nullpunkt. Annett fühlt sich hilflos angesichts der Antriebslosigkeit ihrer Tochter. Mit der Zeit brechen Konflikte auf, zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen zwei Generationen. Die eine muss die Lebenswirklichkeit der anderen neu verstehen lernen.
Mit großem Gespür für das Zwischenmenschliche lotet Kristine Bilkau die drängenden Fragen unserer Zeit aus - die Frage nach der Verantwortung der Älteren für den Zustand der Welt sowie der Wunsch der Jüngeren, das eigene Leben mit Sinn zu füllen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Eine Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Hier, an der Nordsee, lebt Annett, Ende vierzig, seit vielen Jahren, hier hat sie nach dem frühen Tod ihres Mannes ihre Tochter Linn allein großgezogen. Linn, Mitte zwanzig, ist nach dem Abitur voller Energie in die Welt gezogen, hat sich in schwedischen und rumänischen Wäldern als Umweltvolontärin engagiert, arbeitet für ein Aufforstungsprojekt. Für Annett ist ihre Tochter die Verkörperung von Hoffnung, Sinn und Zukunft. Doch auf einer Tagung, während eines Vortrags, kippt Linn um, Kreislaufzusammenbruch, Erschöpfung. Annett holt sie für eine Woche zu sich nach Hause, ans Meer, nahe Husum. Aus einer werden zwei, dann drei Wochen, dann Monate. Zerrieben zwischen Leistungsdruck und Sinnsuche, scheint Linn mit Mitte zwanzig an einem Nullpunkt. Annett fühlt sich hilflos angesichts der Antriebslosigkeit ihrer Tochter. Mit der Zeit brechen Konflikte auf, zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen zwei Generationen. Die eine muss die Lebenswirklichkeit der anderen neu verstehen lernen.
Mit großem Gespür für das Zwischenmenschliche lotet Kristine Bilkau die drängenden Fragen unserer Zeit aus – die Frage nach der Verantwortung der Älteren für den Zustand der Welt sowie der Wunsch der Jüngeren, das eigene Leben mit Sinn zu füllen.
Zur Autorin
Kristine Bilkau, 1974 geboren, zählt zu den wichtigen Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie studierte Geschichte und Amerikanistik in Hamburg und New Orleans. Bereits ihr Romandebüt Die Glücklichenfand ein begeistertes Medienecho, wurde mit dem Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Mit ihrem Roman Nebenan stand sie 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Kristine Bilkau lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
Kristine Bilkau
Halbinsel
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Copyright © 2025 Kristine Bilkau
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers.
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Umschlagmotiv: © Karoline Kroiß
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30020-3V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Die Liebe hatte dich wie eine dicke goldene Uhr aufgezogen. Die Hebamme haute auf deine Sohlen, und dein nackter Schrei fand seinen Platz bei den anderen Elementen.
Sylvia Plath: »Morgenlied« (übersetzt von Ruth Klüger)
Als Linn anderthalb Jahre alt war und laufen gelernt hatte, wollte sie jede Treppe allein hochklettern. Sie zappelte und schrie, sobald ich sie auf den Arm hob, auch an die Hand durfte ich sie nicht nehmen. So viele Male stand ich mit angehaltenem Atem hinter ihr, während sie wie in Zeitlupe Stufe um Stufe hochstieg und dabei gefährlich ins Wanken geriet. Jeden Moment war ich bereit, meine Tochter aufzufangen. Ich sah das Stolpern und Stürzen in grellen Details. Bei dem Gedanken an das Geräusch, den dumpfen Aufprall, kniff ich unweigerlich die Augen zusammen. Mit dem Kind war mit einem Mal eine neue, intensive Vorstellungskraft da.
Es war Ende Mai, ein Samstagvormittag, als Linn einen Schwächeanfall erlitt. Sie hielt einen Vortrag vor größerem Publikum, auf einer Tagung in einem Hotel, da verlor sie das Bewusstsein. Vor den Augen der Leute war sie umgekippt. Ich bekam einen Anruf aus einer Klinik in Nordbrandenburg.
»Sind Sie die Mutter von –?«
Ich saß an meinem Schreibtisch im Dachgeschoss, vertieft in die Arbeit. Die Luke stand offen, es war ein drückender Tag, Möwen kreischten, ich wollte später mit dem Fahrrad zum Deich.
Es war umsichtig von der Ärztin, sofort etwas Beruhigendes zu sagen. »Keine Sorge, Ihrer Tochter geht es gut.«
Kreislaufkollaps, vermutlich durch Dehydration. Der Sturz habe Prellungen an Kopf und Schulter hinterlassen, sagte die Ärztin. Zur Sicherheit wolle man Linn ein oder zwei Tage im Krankenhaus behalten, um Blutwerte abzuwarten, eine Gehirnerschütterung auszuschließen, ein EKG zu schreiben. Die Ärztin gab mir die Telefondurchwahl der Station und Linns Zimmernummer, sie entschuldigte sich für ihre Eile und legte auf.
Linns Handy war ausgeschaltet, es kam sofort ihre Mailboxansage, ich hinterließ eine Nachricht, dass ich auf dem Weg zu ihr sei. Kurz darauf rief ich ein zweites Mal an, nur um ihre Stimme zu hören.
In der Bibliothek gab ich Bescheid, dass ich Urlaub bis Mitte der Woche nehmen müsse, dann buchte ich eine Zugverbindung über Hamburg nach Berlin und weiter nach Nordbrandenburg. Vier Anläufe brauchte ich, bis ich meine Kreditkartennummer ohne Fehler eingetippt hatte. Ich spürte meine Bauchschlagader, ein dumpfes Pochen, das sich seit einiger Zeit bei Aufregung meldete.
Ich musste mich beeilen, um den nächstmöglichen Zug nicht zu verpassen, mit dem Auto brauchte ich eine halbe Stunde bis zur Stadt, zum Bahnhof, es war eine lange Fahrt, allein zwei Stunden bis Hamburg. Hastig packte ich meine Reisetasche, erst danach fiel mir auf, dass sich jemand um den Hund kümmern musste. Ich rief bei zwei Leuten an, die ich um Hilfe bitten konnte, doch niemand ging ans Telefon.
Nebenan waren vor wenigen Tagen neue Nachbarn eingezogen, ich hatte einige Male einen Transporter gesehen, sie hatten Matratzen, Möbel und Kartons ins Haus getragen. Zwei Frauen und ein Mann, Mitte, höchstens Ende zwanzig. Eine junge Wohngemeinschaft, ungewöhnlich für diesen Ort, hatte ich gedacht.
Tausenddreihundert Einwohner, außer Gastronomie, Hotels und Einzelhandel gibt es in der Region nicht allzu viel zu tun, die nächste Uni liegt mehr als eine Stunde mit dem Auto oder der Bahn entfernt. Während der Sommermonate verirren sich immer wieder Touristen hierher, sie halten am Markplatz, suchen nach einem Café oder einem Hofladen, doch sie finden nur die Bäckerei und den kleinen Supermarkt vor, Mittagsruhe von zwölf bis vierzehn Uhr, und fahren weiter an die Küste.
Die neuen Nachbarn und ich hatten uns bisher nur flüchtig gegrüßt. Nun stand ich mit dem Hund vor ihrer Tür, halb versteckt hinter dem Rücken hielt ich die Tüte mit Trockenfutter. Eine der beiden Frauen öffnete, sie trug hellblaue Frotteeshorts und ein geblümtes Bikinitop, ihr langes Haar war nass und glatt gekämmt, sie sah nach unbeschwerten Strandtagen aus.
Ich entschuldigte mich für den Überfall. Es war mir unangenehm, doch ich hatte keine Wahl, die Zeit lief mir davon.
Mir fällt es schwer, andere um etwas zu bitten. Manchmal verfange ich mich so sehr in diesem Gefühl, dass es mich überrascht, wenn jemand einfach freundlich ist.
»Na klar«, sagte die Frau, »kein Problem.« Sie fragte nach meiner Telefonnummer und tippte sie in ihr Handy. Ich gab ihr die Futtertüte, Bo sei pflegeleicht, sagte ich. Sie nickte, sie sei mit Hunden aufgewachsen. »Alles Gute für deine Tochter«, rief sie mir hinterher.
Wie eine Ohnmacht abläuft, habe ich bisher nie mitangesehen und auch selbst nicht erlebt. Während der Zugfahrt versuchte ich, es mir bei Linn vorzustellen – wie sie die Leute im Publikum mit ihrer tiefen, manchmal rauen Stimme über die Widerstandskraft junger Winterlinden und Traubeneichen in Dürrephasen aufklärt, wie sie mitten im Satz abbricht, als würde sie den Faden verlieren, wie ihr Körper seine Spannung aufgibt, einknickt und auf dem Boden aufkommt, das Geräusch.
Einmal habe ich gehört, wie jemand umkippte. Ich hatte auf einer Bank im Amtsgericht gesessen und auf einen Termin gewartet, es ging um das Schuldenerbe meines Vaters, das ich ausschlagen musste, da hörte ich diesen Aufprall. Ein wuchtiges, dumpfes Geräusch, das Gewicht eines Menschen, es war mir durch und durch gegangen. Ich wusste sofort, dass etwas passiert war. Ein älterer Mann lag am Boden, eine Frau kniete neben ihm, das Handy am Ohr, sie rief einen Krankenwagen.
Ich stellte mir die Leute vor, wie sie aufsprangen und sich um Linn kümmerten, wie jemand den Notruf wählte.
Auf der Suche nach Anzeichen, ob es Linn schon länger nicht gut ging, überflog ich ihre Nachrichten aus den vergangenen Wochen. Vielleicht hatte ich einen Nebensatz überlesen oder ein Foto nicht beachtet, auf dem sie blass oder müde aussah, doch ich konnte nichts entdecken. Es waren kurze Meldungen wie Schnipsel aus ihrem Alltag, geschmückt mit Emojis, mit Sonnen, Herzen, Blumen.
Die Bahnfahrt dauerte länger als geplant, der Zug hielt auf offener Strecke, ich verpasste meinen Anschluss, erst am späten Abend erreichte ich die Klinik.
Leise öffnete ich die Tür, zwei Betten im Zimmer, das vordere leer und unberührt, Linn lag hinten am Fenster und schlief. Die Vorhänge waren zugezogen, eine Stehlampe in der Ecke spendete gedimmtes Licht. Ich stellte meine Tasche ab und setzte mich auf den Stuhl neben Linns Bett. Lautlos atmete ich einmal aus, als hätte ich einen Sprint hinter mir.
An Linns Zeigefinger steckte eine Plastikklammer, über ein Kabel mit einem kleinen Gerät verbunden, das ihren Puls und die Sauerstoffsättigung aufzeichnete. Ihre Nägel waren lackiert, glatt, glänzend schimmerten sie im spärlichen Licht, die Farbe war Koralle oder Pfirsich. Linn hatte sich früher nie für Nagellack interessiert.
Als ich um das Bett herumging, sah ich das Hämatom an ihrer Stirn, seitlich, die Schwellung war fast so groß wie ein Handteller. Den Kopf hatte sie etwas zur Seite geneigt, den Handrücken an die Wange gelegt, den kleinen Finger abgespreizt, ihr langer, geflochtener Zopf begann sich aufzulösen. An diesem Ausdruck im Schlaf, es war das Versunkensein und das Vertrauen, hatte ich mich schon früher nicht sattsehen können.
Fast eine Stunde blieb ich. Es war nach Mitternacht, als ich aufbrechen wollte, um mir in der Nähe des Bahnhofs ein Hotelzimmer zu nehmen, da bot mir die Pflegerin das freie Bett neben Linn an, ich müsste nur morgen früh wieder raus, damit es frisch bezogen werden könne, falls es gebraucht würde.
Um Linn mit meinem Geraschel nicht zu wecken, zog ich mich in einem Duschraum am Gang für die Nacht um. Ich betrachtete mich im Spiegel, im fahlen Licht sah ich müde aus, aber meine Haare, immerhin, gefielen mir, ich war vor einigen Tagen beim Friseur gewesen, hatte sie mir schulterlang schneiden und die feinen grauen Fäden tönen lassen, Kastanienbraun, die Friseurin hatte die Farbe gut getroffen. Ich wusch mir das Gesicht, aus dem Hahn kam nur kaltes Wasser, putzte Zähne und ging zurück zu Linn.
Wann hatte ich das letzte Mal mit meiner Tochter in einem Zimmer geschlafen? Es war lange her, auf einer Urlaubsreise.
Sie hatte vor sechs Jahren die Schule abgeschlossen, war wenige Tage nach der Abiturfeier in einen Zug nach Stockholm gestiegen, weiter nach Norden gefahren, um in Schwedisch Lappland beim Aufforsten zu helfen, alles allein geplant und von ihrem Ersparten bezahlt. Danach hatte sie einige Monate in Rumänien verbracht, als Arbeitskraft für den Waldbau in den Ausläufern der Karpaten. Anschließend hatte sie begonnen zu studieren, erst in Freiburg, danach in Edinburgh, wo sie für ein Jahr ein Stipendium bekam und ihren Bachelor abschloss, schließlich in Lund, im Süden Schwedens, für ihren Master.
Als meine Tochter nach Lappland aufgebrochen war, damals, nach der Schule, hatte ich es noch nicht begriffen, das war er, der Meilenstein, sie war von zu Hause ausgezogen.
So leise wie möglich schob ich mich unter die Decke, der gestärkte Bezug fühlte sich kühl an auf der Haut. In der Stille war Linns gleichmäßiger Atem zu hören, und auch wenn ich beunruhigt war, nahm ich diesen Moment als etwas Schönes wahr. In der Nähe zu sein und auf mein Kind achten zu können.
Am nächsten Morgen, kurz nach sechs – im Flur waren Schritte zu hören, die Frühschicht hatte begonnen –, schaute mich Linn beim Aufwachen erstaunt an. Ich musste fast lachen, dieser Gesichtsausdruck war wie ein kleines Geschenk.
»Hä, seit wann bist du hier?«
»Schon die ganze Nacht.«
»So tief habe ich geschlafen?«
Wir bekamen beide ein Frühstück, Minztee, Graubrot, Margarine und Erdbeermarmelade, dazu für jede einen Becher Naturjoghurt.
Eine Frage nach der nächsten ging mir durch den Kopf. Kannst du dich an den Vorfall erinnern? An die Momente vor der Ohnmacht? Hattest du vorher Beschwerden? Trinkst du genug, isst du genug? Belastet dich etwas? Doch ich hielt mich zurück, sie schien erschöpft.
Wir zogen uns an, gingen ein Stück spazieren, und weil Linn bald wieder müde war, suchten wir uns einen Platz hinten im Garten des Krankenhauses. Im Stillen dachte ich, hoffentlich sind ihre Blutwerte okay, hoffentlich erfahren wir nicht irgendetwas Schlimmes, dann schob ich den Gedanken weg.
Später am Vormittag machte ich mich auf den Weg, um Linns Sachen aus dem Hotel zu holen. Es lag in einem Waldgebiet etwa zehn Kilometer vom Krankenhaus entfernt, ein Bus fuhr in die Richtung, den Rest legte ich zu Fuß zurück.
Die Tagung hatte sich um den Schutz und die Regeneration von Wäldern gedreht. Linn arbeitete seit einem halben Jahr für eine Beratungsfirma, die sich um die Förderung und Finanzierung von Umweltprojekten kümmerte, um Waldbau, Aufforstung und Renaturierung.
Ich habe Linns Entwicklung immer mit leisem Erstaunen und Bewunderung verfolgt. Wenn mich Freunde oder Bekannte nach ihr fragten, wie es ihr ging oder was sie beruflich machte, musste ich darauf achten, nicht in diesen Ton zu verfallen, selbstzufrieden. Ein Ton, den ich bei anderen unangenehm fand. Einige Leute erzählten von ihren erwachsenen Kindern, als ginge es um die eigenen Karrieresprünge oder um Statussymbole. So wollte ich nicht klingen.
Der Bus hielt an einem Dorfplatz mit einem stillgelegten Brunnen. Ein Wanderweg führte ein Stück weit durch den Wald, ich kam an einem Weiher vorbei. In der Luft lag noch etwas Morgendunst, in den sich schwer die Sonnenwärme mischte. Da ich es nicht eilig hatte, setzte ich mich auf einen Stein ans Ufer. Über die Wasserfläche schossen Libellen, ruckartig blieben sie in der Luft stehen, ihre Körper schillerten im Licht.
Über eine Landstraße erreichte ich eine Allee mit Kastanien, die Blüten sahen aus wie Zuckerhüte. Am Ende stand das Hotel, fast ein kleines Schloss, lindgrüne Fassade, Türmchen links und rechts, Treppenaufgang. Etwas abseits parkten einige Limousinen und SUVs, ihr Lack glänzte in der Sonne. Von irgendwoher hörte ich Lachen und Wasserplatschen, jemand war in einen Pool gesprungen.
Die Tür stand offen, ich ging hinein zur Rezeption, doch sie war nicht besetzt. Ich wartete eine Weile, erst dann benutzte ich die Messingklingel auf dem Tresen. In der Mitte des Empfangsraums stand ein runder Holztisch, darauf eine riesige Kristallvase. Blumen mit kräftigen, hohen Stielen waren darin arrangiert. Ich zupfte eines der dünnfädigen Blätter ab, erst da erkannte ich am Geruch, es war Dill. Wie hochgewachsen er war, wie schön er blühen konnte, ich musste neunundvierzig Jahre alt werden, um herauszufinden, wie Dill wirklich aussah, dass die essbaren, krautigen Blätter der kleinste Teil daran war, und das, obwohl ich selbst einen Garten hatte, einen ohne Dill.
Noch immer war niemand aufgetaucht, also beschloss ich, etwas umherzugehen. Ein breiter, hoher Korridor führte in einen Wohnsalon, dunkles Parkett, die Sofas, Vorhänge und Wände in gebrochenen Blautönen und hellem Grau, ein hoher schwedischer Kachelofen in der Ecke. An den Wänden Kunstwerke, die meisten von ihnen modern. Im Hintergrund lief Klaviermusik. Ich musste an die Bilder von Vilhelm Hammershøi denken, an seine Zimmer mit offenen Türen, leeren Tischen und Stühlen, grau-blauen Wänden, an die Stille, die er malte. Als würden die Menschen dort auf etwas warten, sich auf etwas vorbereiten, ein Ereignis, eine Veränderung.
Hinter einer Flügeltür entdeckte ich einen Saal, dort waren an die zwanzig Stuhlreihen aufgebaut, ganz hinten stand ein Podium, darauf schmale Ledersessel, ein kleiner Glastisch und ein Stehpult. Hier hatte Linn wahrscheinlich ihren Vortrag gehalten.
Neben dem Pult war ein dunkelroter Fleck auf dem Boden zu sehen, auch über die Wand verteilten sich Spritzer, deren Verlauf an einer Stelle abbrach, wie an einer unsichtbaren Kante.
Ich hörte eine Tür klappen und drehte mich um, doch da war niemand, trotzdem fühlte ich mich ertappt, als dürfte ich nicht hier sein. Durch die tiefen Fenster sah ich in den Garten, über den gepflegten Rasen verteilten sich ungemähte Inseln, auf denen Wiesenblumen blühten. Ich öffnete die Terrassentür, kurz dachte ich daran, dass ein Alarm losgehen könnte, ich hatte das in einem Bürogebäude erlebt, durch eine Glastür wollte ich auf eine Dachterrasse, doch als ich sie aufschob, ertönte ein schnarrendes schrilles Geräusch und jemand vom Sicherheitsdienst eilte herbei.
Draußen räumte eine Kellnerin Geschirr ab, ich sprach sie an, ob sie jemanden an den Empfang schicken könne.
»Ich bräuchte den Zimmerschlüssel meiner Tochter, um ihre Sachen zu packen und mitzunehmen. Sie war hier zu Gast, sie hat an der Tagung teilgenommen.«
Eine zweite Kellnerin kam zur Terrasse, sie trug einen Holzkasten, darin erdige Radieschen und Karotten, offenbar gehörte ein Gemüsegarten zum Anwesen.
Ich hätte einen Tee bestellen und alles gelassener sehen können, doch ich war ungeduldig geworden.
Zurück am Empfang wartete ich wieder, Minute um Minute, tippte nochmals auf die Messingklingel. Neben der Vase mit den Dillblüten entdeckte ich eine Silberschale, darin in Seidenpapier gehülltes Konfekt. Ich wickelte eines aus und schob es in den Mund, Feigengelee in dunkler Schokolade. Wie zu erwarten war, schmeckte es besonders gut.
Ich klingelte ein weiteres Mal an der Rezeption, holte mir ein zweites Konfekt aus der Schale. Die Stille im Foyer wirkte auf einmal wie eine Inszenierung, ich fühlte mich unsichtbar und zugleich beobachtet. Als würde mir jemand heimlich dabei zuschauen, wie ich vergeblich wartete in dieser stillen Hammershøi-Welt.
Nach einer Weile wickelte ich ein drittes Konfekt aus, aß es und wartete, dann ein viertes und fünftes. Ich ließ den Blick hoch zur Decke wandern, tippte wieder auf die Messingklingel, der Klang verhallte, und ich hörte in die Stille hinein, ob endlich jemand kommen würde, dann tippte ich noch einmal, Ding, Ding, nichts passierte.
Niemand schien mich zu hören. Was war das für ein Hotel?
Zugleich kam es mir vor, als würde diese Stimmung an mir liegen. Irgendetwas führte dazu, dass niemand meine Anwesenheit bemerkte. Ich stellte mir vor, ich würde für die anderen Menschen nicht mehr existieren. Ich würde die Leute ansprechen, um Hilfe bitten, jemanden berühren, doch immer vergeblich, ohne durchschauen zu können, was vor sich ging. Aussichtslos. Vor Schreck tippte ich weitere fünf, sechs, sieben Mal auf die Klingel.
Schließlich erschien eine Mitarbeiterin, sie sah mich erstaunt und vorwurfsvoll an, als hätte ich den Hausfrieden gestört.
Linn wurde für eine Woche krankgeschrieben.
»Die könnte ich zu Hause bei dir verbringen«, schlug sie vor.
Ihre Blutwerte und das EKG sahen gut aus, doch sie sollte sich ein paar Tage erholen, hatte die Ärztin gesagt. Ich war erleichtert und freute mich darüber, dass Linn die Woche bei mir sein wollte.
In dunkelrosa Leggings und einem alten T-Shirt, so alt, dass ich es aus ihrer Schulzeit kannte, stand sie vor ihrer offenen Reisetasche, legte Wäsche und ihren Kulturbeutel hinein. Danach holte sie die Hülle aus milchigem Kunststoff aus dem Schrank, in der ein Hosenanzug und zwei Seidenkleider verwahrt waren. Im Hotel hatte ich einen Blick in die Hülle geworfen, geschmackvolle, teure Sachen, die Linn sich für ihren Arbeitsalltag gekauft hatte. Es war noch ungewohnt für mich, meine Tochter so zu sehen, erwachsen, eine Expertin mit öffentlichen Auftritten.
Sie hatte die Haare zu einem festen Knoten gebunden, ihr Gesicht sah schmal aus. Sie musste in den vergangenen Monaten an Gewicht verloren haben, ich sah es an den Kieferknochen, am Hals, an den Beinen. Sie hatte sich verändert in den wenigen Monaten in Berlin.
Am frühen Nachmittag kamen wir mit dem Zug in der Stadt an. Meinen Wagen hatte ich auf dem Parkplatz der Bibliothek abgestellt, in der ich arbeite, sie liegt nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt.
Als wir das Stadtzentrum hinter uns gelassen hatten, schlug Linn vor, am Shoppingcenter beim großen Supermarkt zu halten. »Lass uns unanständig viel einkaufen«, sagte sie.
Mit ausladenden Schritten schob sie den Einkaufswagen durch die Regalgänge, über ihrem Shirt und den Leggings trug sie eine lange, dünne Strickjacke, die sie noch größer und schmaler wirken ließ. Ich beobachtete sie, sie wirkte zerbrechlich und energisch zugleich. Dann sah sie mich fragend an, erst da fiel mir auf, dass ich sie geradezu angestarrt hatte.
Der Wagen füllte sich, Linn legte Sourcream-Chips, Haferkekse, Pfefferminzschokolade, Lakritz hinein, ungewöhnliche Sorten Limonade, Limone mit Thymian, Himbeere mit Rosmarin, Mengen an Gemüse, Fenchel, Paprika, Auberginen, Süßkartoffeln.
Wir warteten in der Schlange vor der Kasse, da bemerkte ich, dass Linns Haarband verrutscht war. Sie hatte es sich über die Stirn gezogen, um das Hämatom zu verdecken, doch nun schimmerte die blaurot gesprenkelte Haut darunter hervor.
»Warte kurz«, sagte ich und zupfte den Stoff zurecht, sodass die Stelle wieder bedeckt war. Sofort fühlte sich die Geste falsch an, als wäre mir der Bluterguss unangenehm, als wollte ich ihn verbergen.
Sie hatte sich das breite Haarband am Hauptbahnhof in Berlin kurz vor der Abfahrt in einer Boutique gekauft, direkt nach dem Bezahlen hatte sie es sich über den Kopf gezogen. »Keinen Nerv, dass die Leute mich so neugierig und mitleidig anstarren.«
Ich verstand, was sie meinte, der Anblick hatte etwas Bedrückendes. Der blaue Fleck in ihrem Gesicht warf Fragen auf, von denen manche mit Gewalt zu tun hatten. Auch mich machte der Blick auf ihre versehrte Stirn beklommen, obwohl ich ja wusste, dass ein Sturz die Ursache war.
Ein Hämatom im Gesicht eines Menschen ist der Beweis für seine Verletzbarkeit.
Auf dem Rollband lagen Lebensmittel für mehr als eine Woche. Diese Fülle hatte etwas Feierliches, als würden wir ein Fest vorbereiten oder wären an einem Ferienort angekommen, wenn man ein Haus gemietet hat und diesen ersten, großen Einkauf erledigt, mit dem der Urlaub beginnt.
Während die Waren gescannt wurden, überschlug ich, ob mein Kontostand das überhaupt hergab, es war der 23. Mai, mein Gehalt war noch nicht auf dem Konto, ich zahlte außerdem die Reparatur meines Autos ab und musste gerade etwas sparsam sein.
»Hundertzwanzig und siebenundfünfzig«, sagte der Mann an der Kasse.
»Das geht auf mich«, sagte Linn, sie hatte gerade zwei leere Kartons für den Einkauf geholt und stellte beide ab. Obwohl ich protestierte, zog sie ihre Karte aus dem Portemonnaie, ein buntes Lederetui, das vor Zettelchen fast überquoll, und hielt sie an das Lesegerät.
Auch früher war es finanziell oft eng geworden, irgendwann hatte ich es vor Linn nicht mehr verbergen können, mit der Zeit hatte sie durchschaut, woran es lag, wenn wir ab dem 18. oder 19. eines Monats abwechselnd Pellkartoffeln und Pfannkuchen aßen, und wenn manche Anschaffungen, ein Winterparka oder neue Sneaker, ein weiteres Mal aufgeschoben wurden.
Vor einem halben Jahr, als ich ihr in Berlin beim Einzug in die Wohnung geholfen hatte, führte sie mich in ein Restaurant aus, sie hatte für uns einen Tisch reserviert. Wildkräutersalat, Fenchelrisotto, Buttermilchklöße mit Waldbeeren, die Preise auf der Karte ließen mich staunen. Linn hatte darauf bestanden, mich einzuladen. Ihr erstes eigenes Gehalt auf dem Konto. Das Gefühl von finanzieller Unabhängigkeit, ihr Ankommen im Erwachsenenleben. Ich sah, wie zufrieden und stolz sie war, und auch wenn ich mich freute, war da Wehmut, sogar ein wenig Scham, mein Kind sollte nicht für mein Essen zahlen.
Wir waren auf der Landstraße unterwegs, kamen vorbei an Maisfeldern und blühendem Raps, das Schilf in den Gräben war hoch gewachsen. Linn fragte, ob wir einen Bogen fahren könnten, zum Deich und zum Sielhafen. Früher hatten wir Radtouren zum kleinen Hafen gemacht, Linn auf ihrem roten Kinderfahrrad mit dem Körbchen am Lenker, später mit ihrem Mountainbike. Manchmal aßen wir im nahen Gasthof Bratkartoffeln mit Spiegelei, zum Nachtisch Zitronencreme mit Sprühsahne. Im Herbst schickten wir Linns selbst gebastelten Drachen in den Wind. Die verhedderte Schnur, die starken Böen, die Anstrengung, ein Stück Papier an einem Holzkreuz in der Luft zu halten, es machte mich aggressiv. Ich gab mir alle Mühe, rannte mit Linn den Deich hinunter, ein Versuch, noch ein Versuch, bis der Drache einige Momente oben blieb und Linn nicht enttäuscht war. Dabei der Gedanke an Johan, dem das alles leichtgefallen wäre, der ein Gespür dafür gehabt hätte, wie man mit dem Wind umgeht. Johan, der in seinen ausgebeulten Jeans, dem Norwegerpulli und den alten Sneakern mit Linn über die Wiese gelaufen wäre.
Wir parkten am Sielhafen, stiegen aus, das Wasser stand niedrig, Linn machte ein Foto, tippte etwas auf ihrem Telefon, vielleicht schickte sie jemandem das Bild. Ich bot ihr an, im Gasthof zu essen, doch sie sagte, sie habe keinen Hunger, und dann wollte sie weiter.
Das letzte Stück der Landstraße war von hohen Bäumen gesäumt, wie eine Allee, an drei Stellen steckten Holzkreuze im Boden, zwei standen dort seit mehr als einem Jahrzehnt, das dritte noch kein Jahr. Autounfälle von jungen Leuten, die feiern gewesen waren. Wie ich mich früher davor gefürchtet hatte, dass Linn in einen Wagen mit betrunkenem Fahrer steigen würde.
Hinter den Sträuchern duckten sich vereinzelt Reetdachhäuser, die meisten von ihnen waren nur an den Wochenenden bewohnt. Wir passierten den Bahnübergang und erreichten die Ortschaft, fuhren durch das kleine Zentrum mit den niedrigen alten Häusern, kamen vorbei am Dorfkrug, an der Kirche und dem Gemeindehaus, bogen ab in unsere Wohnstraße, dahinter lagen die Felder.
Ich parkte in der Einfahrt, das Garagentor ließ sich seit einiger Zeit nicht öffnen, es klemmte, ich hatte mich noch nicht darum gekümmert. Linn stieg aus und streckte sich. Ich folgte ihrem Blick, von den staubigen Gummistiefeln neben der Tür, zu den gestapelten Säcken Blumenerde, die dort seit fast einem Jahr lagen, weil ich sie noch nicht in den Garten geschleppt hatte, hoch zu den Dachziegeln, auf denen Moos wuchs, und der schiefen Regenrinne, in der noch das Winterlaub moderte, am Dach standen Reparaturen an.
»Wir haben endlich wieder Nachbarn«, sagte ich und wies mit einem Blick nach nebenan, »eine Wohngemeinschaft. In deinem Alter.«
Einige junge Familien hatte es in die Gegend gezogen, sie hatten Bauland gekauft und pendelten beruflich nach Kiel oder Neumünster. Doch Leute im Studienalter, die zu dritt ein altes Haus am Dorfrand bezogen, fielen im Ort sofort auf.
Während ich die Tür aufschloss, dachte ich an die Unordnung im Haus, die Linn nun sehen würde. Auch die Arbeit im Garten hatte ich schleifen lassen, das Bäumeschneiden, die Beete, es ermüdete mich zwischendurch, alles allein zu machen. Seit einiger Zeit fragte ich mich, ob ich überhaupt hierbleiben wollte. Allein in einem Haus, an dem ich zwar hing, aber das mir immer etwas abverlangte. Vor einigen Wochen hatte ich einen Makler kontaktiert, er schaute sich um und empfahl mir, in ein modernes Heizsystem und isolierte Fenster zu investieren, ansonsten könne es schwierig werden, einen passablen Preis zu erlangen. Das Interesse an alten Häusern lasse nach, die Leute schauten mehr auf die Energiekosten als auf Holzböden und Obstbäume.
»Deine Magnolie hinten blüht dieses Jahr besonders schön«, sagte ich zu Linn. Johan hatte sie gepflanzt, nachdem wir damals eingezogen waren. Die sei für Linn, hatten wir beschlossen. Ein Baum, der mit ihr wachsen würde. Es war ein kühler Tag gewesen, wir hatten stundenlang im Garten gearbeitet und danach heißen Earl Grey getrunken. Johan trug diese fingerlosen Strickhandschuhe, die er sich als Schüler in einem Hauswirtschaftskurs gestrickt hatte, aus Wollresten, ein bräunliches Orange gemischt mit einem dunklen Grün, scheußlich, ich zog ihn damit auf. Wir tranken den Tee, unsere Atemwolken hingen in der kalten Luft, im Garten fing es an zu dämmern.
Während Linn die Einkäufe auspackte, lüftete ich in ihrem Zimmer und bezog das Bett. Im Bad wischte ich eilig mit etwas Essigreiniger das Waschbecken und die Wanne, stopfte den Haufen gebrauchter Handtücher in die Maschine und stellte sie an.
Seitdem Linn ausgezogen war, hatte ich in ihrem Zimmer nichts verändert. Es hatte keinen Anlass dafür gegeben. Das Haus ist auch so groß genug für mich, das Wohnzimmer und die Essecke, die Küche, oben das Schlafzimmer, das ausgebaute Dachgeschoss, draußen die Veranda. Ich fand den Gedanken schön, dass Linn in den Semesterferien und der Weihnachtszeit ihr vertrautes Zimmer bewohnen würde. Das weiße Ein-Meter-vierzig-Bett von IKEA, die schlichte Arbeitsplatte aus Holz am Fenster, an der sie für ihr Abitur gelernt hatte, der kleine Kasten mit Schubladen darunter, der Gründerzeit-Kleiderschrank meiner Großtante. Sie hatte vor uns hier gelebt, über vierzig Jahre lang, bis sie angefangen hatte, tagsüber barfuß, im Nachthemd durch den Ort zu gehen, auch im Winter bei Schnee und eisigem Wind. Ihr Bruder hatte für sie einen Platz in einem Heim besorgt, in dem eine Nachbarin von ihr bereits wohnte.
Linn stellte ihre Tasche neben dem Bett ab.
»Wenn es okay wäre, würde ich mich hinlegen.«
»Ist dir wieder schwindelig?«
»Nein, ich bin nur müde.«
Sie zog die dünne Strickjacke aus, ließ das Rollo herunter, sodass es nachtdunkel im Zimmer wurde, und schlüpfte unter die Decke.
Ich ging nach unten und klingelte nebenan, um Bo abzuholen. Diesmal öffnete der Mann die Tür, sein dunkles Shirt war mit Farbflecken übersät, auch an den Händen hatte er Farbe, er trug eine weite, ausgebeulte Jeans, ähnlich wie die von Johan früher. Bo erschien neben ihm in der Tür und sah mich hechelnd an, doch machte keine Anstalten mitzukommen, er schien sich bei den neuen Nachbarn wohlzufühlen.
In der Supermarkt-Bäckerei hatte ich einen Zitronenkuchen besorgt, den ich jetzt überreichte. »Danke, dass ihr euch um Bo gekümmert habt«, sagte ich.
»Wie freundlich«, der Mann klang tatsächlich überrascht und lächelte etwas verlegen, dann zeigte er auf den Hund, »er kann gern bleiben und sowieso bei uns im Garten sein, das stört uns nicht. Im Gegenteil.«
»Und ihr könnt jederzeit klingeln, falls ihr etwas braucht«, sagte ich und lächelte.
Dabei stimmte es eigentlich nicht, es kam mir mittlerweile häufig ungelegen, wenn Leute überraschend an der Tür standen. Aufräumen, gebrauchtes Geschirr einsammeln, die erdigen Tatzenspuren vom Boden wischen, Zeitungen aussortieren, Wäsche waschen, es gab Zeiten, da fehlte mir der Antrieb für die einfachsten Dinge. Wenn ich nicht arbeiten musste, erschien es mir mühsam, unter die Dusche zu steigen, ein frisches Shirt und eine saubere Jeans anzuziehen. Ich geisterte im Schlafanzug durch das Haus, hasste den Geruch unter meinen Achseln und fragte mich, wie es hier mit mir weitergehen sollte. Wenn es schlimm kam, legte ich mich nachmittags ins Bett, obwohl ich wusste, dass es mir damit nicht besser gehen würde. Ich versank in tiefen Schlaf und wachte mit Panik auf, als wäre ich auf einer abenteuerlichen Wanderung verloren gegangen, zurückgelassen von den anderen, Schicksal besiegelt.
Insgesamt war ich also recht oft nicht in der Verfassung für spontanen Besuch. Aber es hörte sich großzügig an. Kommt vorbei, wenn ihr etwas braucht.
Linns Anwesenheit verschaffte mir einen Schub von Energie, ich wischte die Dielen im Wohnzimmer, schüttelte die Kissen und die Wolldecke auf dem Sofa aus, sammelte benutzte Teetassen und leere Joghurtbecher ein, stellte die Spülmaschine an. Ich fegte die Veranda, klopfte die Polster der Sitzecke aus. Ich schälte Kartoffeln und wusch Salat, während Linn weiterhin schlief.