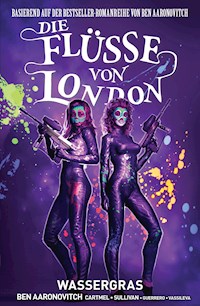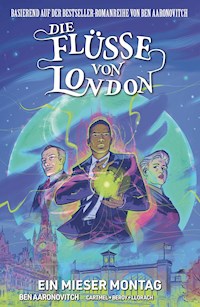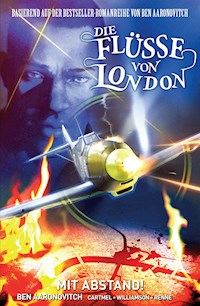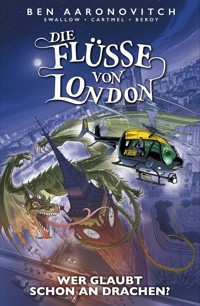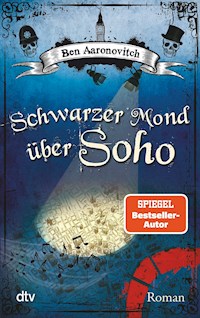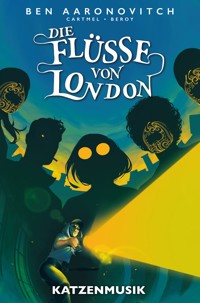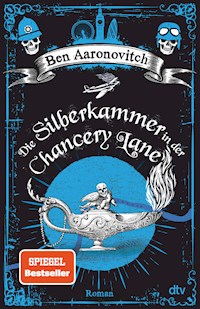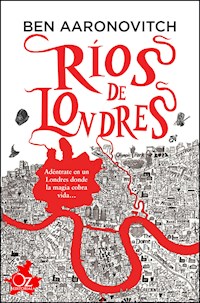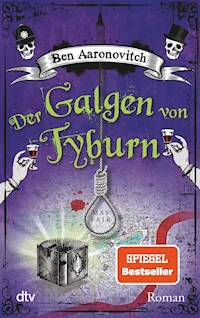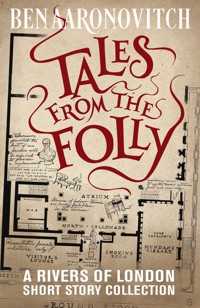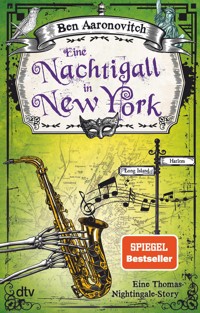
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Von den Flüssen von London nach New York New York, 1920er-Jahre: Augustus Berrycloth-Young, Absolvent der Zauberschule Casterbrook, ist unangenehm überrascht: Denn unangekündigt steht sein alter Schulkamerad Thomas Nightingale vor der Tür und reißt ihn aus seinem behaglichen Leben. Nightingale ist auf geheimer Mission nach New York geschickt worden, um ein verzaubertes Saxophon ausfindig zu machen, das seltsame Kräfte entfaltet, wenn es gespielt wird. Und ausgerechnet Augustus soll ihm helfen, dabei will er eigentlich nur das Dolce Vita genießen. Auf der Suche machen die beiden Männer die Jazzclubs der Metropole unsicher und machen unfreiwillig mit der nicht-magischen und korrupten Polizei Bekanntschaft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Sie können sich sicher vorstellen, dass mich eine gewisse innere Unruhe überkam, als ich hörte, der oberste Problemlöser des Folly, der Mann, der ausgeschickt wird, um Schwierigkeiten zu überwinden und Ärgernisse zu beseitigen – kurzum, besagter Mr. Thomas Nightingale stünde vor meiner Tür.
Augustus Barrycloth-Young fühlt sich im New York der 1920er-Jahre pudelwohl. Er genießt die schönen Seiten des Lebens und ist daher von dem Besuch seines alten Schulfreundes Thomas Nightingale gar nicht erfreut. Denn Augustus weiß genau: Dieser Besuch bedeutet Ärger. Und schon bald steckt er wie erwartet knietief im Schlamassel und macht unfreiwillig Bekanntschaft mit der nicht-magischen und korrupten Polizei …
Ben Aaronovitch
Eine Nachtigall in New York
Eine Thomas-Nightingale-Story
Deutsch von Christine Blum
Für Andrew Cartmel,
der sich den Namen
ursprünglich ausgedacht hat.
Ich bin verrückt nach dieser Stadt.
Toni Morrison, Jazz
1
Wie ich mich schon des Öfteren veranlasst sah zu bemerken: Was hat man davon, Meister der arkanen Künste zu sein, wenn man sich besagter Meisterschaft nicht in irgendeiner Weise bedienen darf? Na gut, ich gebe zu, beim Rennen von Goodwood seinen Mitzauberern die Zylinder von der, verzeihen Sie, Rübe zu schubsen mag etwas kindisch sein, ist in meinen Augen jedoch kaum ein Kapitalverbrechen. Leider waren die alten Stockfische im Folly anderer Meinung, daher schien es mir angeraten, mich eine Weile aus ihrem tadelsüchtigen Gesichtskreis zu entfernen, bis die segensreichen Wasser der Lethe ihren Groll fortspülten. Oder so.
Da ich kein großer Freund des Landlebens bin, nahm ich einen Schnelldampfer nach New York, wohin das Folly, so meine Annahme, niemals einen Fuß setzen würde. (Wie sich herausstellte, irrte ich mich, doch dazu später mehr.)
Ich fand eine überaus behagliche Wohnung, oder wie man hierzulande sagt: ein Apartment, mit Blick auf den Washington Square, und stellte einen Diener für die Erfordernisse des Alltags ein.
An dieser Stelle sind wohl ein, zwei Worte zu meinem Diener Beauregard angebracht, ehe all der Sturm und Drang und übrige Spuk hier hereinbrechen. Eben hatte ich mein neues Apartment am Washington Square betreten und stand bar meines Gepäcks im leeren Flur, da läutete es an der Tür. In der Hoffnung, es könnten meine Siebensachen sein, riss ich sie auf. Davor stand ein hochgewachsener farbiger, sympathisch wirkender Gentleman mit langem ernstem Gesicht. Er sprach mit diesem kultivierten Südstaaten-Tonfall, der einen gleichsam tröstlich einhüllt. Und etwas Trost hatte ich wahrhaftig nötig, so allein und verlassen in einer fremden Stadt, ohne jedes Möbelstück oder auch nur meine Koffer.
»Mein Name ist Maximillian Beauregard«, sagte er. »Ich glaube, der Herr bedarf eines Dieners.«
»Donnerwetter«, sagte ich, weil ich diesbezüglich noch nicht einmal Erkundigungen eingezogen hatte. »Woher in aller Welt wissen Sie das?«
»Sie erwähnten Ihren Mangel dem Liftboy gegenüber, Sir, und da er wusste, dass ich mich nach einer solchen Anstellung umsah, informierte er mich umgehend.«
»Oha, das ist aber zackig.«
»Vielen Dank, Sir.«
»Kommen Sie doch herein«, sagte ich, und der Mann schwebte in den Flur wie auf einem Luftkissen.
»Ihnen ist nicht zufällig etwas über den Verbleib meines Gepäcks bekannt?«, fragte ich.
»Tatsächlich bemerkte ich es soeben unten im Foyer, Sir, und war so frei, einige Träger anzuweisen, es nach oben zu bringen.«
»Fabelhaft«, sagte ich. »Und wie sieht’s mit Möbeln aus?«
»Das Warenhaus Macy’s wird sicherlich mit Vergnügen jemanden mit einem Katalog zu Ihnen schicken.«
»Essen?«
»Wir sind in New York, Sir«, sagte Beauregard mit einem Hauch hauteur. »Um Ihr leibliches Wohl können Sie unbesorgt sein.«
»Sie sind eingestellt«, sagte ich.
»Sehr wohl, Sir.«
Ein englischer Gentleman mit den nötigen Mitteln kann in New York ein höchst angenehmes Leben führen, vorausgesetzt, er ist so klug, die Einheimischen nicht zu verprellen. Selbst der örtliche Arm des Gesetzes, der bis auf den letzten Mann aus Iren zu bestehen scheint, ist (mit Ausnahme des verabscheuungswürdigen Sergeant Bracknel) durchaus respektvoll, solange man höflich bleibt und ihm nicht im Weg ist. Es gibt einige sehr passable Restaurants, Galerien und Konzerthäuser für den, sagen wir mal, niveauvoll gestimmten Geist. Doch worin New York London um Längen schlägt, das ist die moderne Musik, und die beste solche findet man jenseits der 110th Street in einem Stadtteil namens Harlem.
Dort kommt der interessierte Gentleman in Gesellschaft Gleichgesinnter in den Genuss des besten Jazz der Welt.
Wie Sie sich also vorstellen können, war ich reichlich verdutzt, als ich eines schönen Maimorgens im Bett meine erste belebende Tasse Kaffee zu mir nahm – ein anständiger Tee überstieg die ansonsten überaus breit gefächerten Talente des guten Beauregard – und mit einem Mal mein geschätzter Diener an die Tür klopfte und verkündete, ein Besucher sei gekommen. »Ein englischer Gentleman, Sir.«
Da es keinem meiner Bekannten, ob englisch oder amerikanisch, einfiele, Freund Augustus vor dem Mittagsläuten zu stören, wunderte ich mich doch ein wenig. Ein irritierender Schauder kräuselte die gewöhnlich so friedvolle Oberfläche meiner Morgenroutine, doch mannhaft hielt ich diesen Turbulenzen stand. Besuch aus England war durchaus kein ganz ungewöhnliches Vorkommnis, und die Dampfer neigten dazu, zu unchristlichen Zeiten anzulegen. Also hatte der arme Kerl als Fremder in diesen Gefilden womöglich Beistand nötig, und niemand soll Augustus Berrycloth-Young nachsagen, er hätte nicht die Gelegenheit wahrgenommen, die Hand auszustrecken und einem Mitmenschen zu Hilfe zu eilen. Nach einem anständigen Bad und einem ordentlichen Frühstück, wohlgemerkt.
Hätte ich gewusst, was mir bevorstand, ich hätte mich flugs unter meinem Bett verkrochen und Beauregard angewiesen, meinem Besucher zu melden, ich sei über Nacht einer Seuche erlegen.
Stattdessen nahm ich noch einen Schluck des segensreichen schwarzen Getränks. »Hat dieser Gentleman einen Namen?«
Beauregard nickte. »Ein Mr. Thomas Nightingale.«
Die geneigten Leser meines, ich darf es wohl Œuvre nennen, sind bereits vertraut mit Magie, der Demi-monde und dem Folly, doch für alle, die bis dato unerklärlicherweise noch nicht auf die Erzeugnisse meiner Feder gestoßen sind, werde ich kurz ausholen.
In den altehrwürdigen Zeiten der turmhohen Perücken befasste sich Sir Isaac Newton nicht nur mit der Erfindung der Schwerkraft und dem Hängen von Falschmünzern, sondern entdeckte nebenbei auch die Magie. Seine Erkenntnisse vertraute er einer Vereinigung braver aufrechter Gentlemen an, der »Gesellschaft der Weisen«, oder für Eingeweihte … dem Folly. »Folly« wie im Pope’schen Gedicht über die menschliche Torheit, denn unsere erlauchten Vorfahren waren stets für einen guten Scherz zu haben. Wie es damals Mode war, gründeten sie eine Schule, um ihr Wissen an künftige Generationen weiterzugeben, und eben jener ruhmreichen Anstalt wurde der junge Augustus im Sommer des Jahres 1914 anvertraut. Heutzutage ist es schick geworden, über die eigene Schulzeit zu klagen, sich über die Stockschläge, die Kälte und Einsamkeit auszulassen, doch ich muss sagen, ich selbst verbrachte dort eine famose Zeit, fand einige verteufelt gute Kameraden, und vor allem lernte ich zaubern.
Sie denken nun vielleicht: Zaubern, Gussie? Mein lieber Junge, so etwas gibt es doch nicht! Das liegt daran, dass ich als anständiger Casterbrook-Absolvent und Mitglied des Folly dazu verpflichtet bin, die Existenz der Magie – pssst! – hübsch sub rosa zu halten, oder wie man hierzulande sagen würde, unterm Deckel.
In den falschen Händen – oder in überhaupt keinen – kann Magie recht gefährlich sein, daher wurde das Folly damit betraut, in magischer Hinsicht für Recht und Ordnung und dafür zu sorgen, dass nicht etwa die Pferde der Nation scheu gemacht werden. Dank dieser feierlichen Pflicht waren die alten Stockfische im Folly zu einem grimmigen, humorlosen Haufen verkommen, welcher dazu neigte, jeden jungen Zauberer schief anzusehen, der in einem Augenblick des Überschwangs seine Künste darauf verwandte, einen Konstabler seines Helms oder lästige Zeitgenossen ihrer Garderobe zu entledigen oder sich beim Cheltenham Festival im Verlangen nach einem kühlen Trunk eine Flasche Champagner aus ihrem Eisbett in die Hand schweben zu lassen. Wie bereits erwähnt, entsprang meine eigene Übersiedlung in transatlantische Gefilde ursprünglich dem Wunsch, mich dem Unmut der Stockfische wegen eines ähnlich trivialen Vorfalls zu entziehen.
So können Sie sich vorstellen, dass mich eine gewisse innere Unruhe überkam, als ich hörte, der oberste Problemlöser des Folly, der Mann, der ausgeschickt wird, um Schwierigkeiten zu überwinden und Ärgernisse zu beseitigen – kurzum, besagter Mr. Thomas Nightingale stünde vor meiner Tür.
Doch wir Casterbrook-Absolventen sind Leitsterne der Tapferkeit, und statt die Flucht über die Feuerleiter zu ergreifen, bat ich Beauregard, die Nachtigall – wie Thomas Nightingale oft genannt wird – ins Wohnzimmer zu geleiten und ihm dort eine Kleinigkeit anzubieten, während ich ein rasches Bad nahm und mich ankleidete.
Beauregard, ein unverbesserlicher Optimist in Sachen Wetter, hatte mir einen meiner jüngst erworbenen Leinenanzüge herausgelegt, taubengrau und im sogenannten »Jazz-Cut«, der meiner Figur nach den Worten einiger guter Bekannter außerordentlich schmeichelte. Nunmehr tadellos gewandet, rückte ich meine Courage zurecht und trat so unbekümmert wie möglich ins Wohnzimmer.
»Thomas, altes Haus!«, rief ich beim Eintreten.
Wie ich vielfach festgestellt habe, unterscheiden sich die musikalischen Werke von Blake & Sissle, Gershwin & Gershwin oder Rogers & Hart und die von Gestalten wie Verdi, Tosca und noch so einem verflixten Italiener, dessen Name mir entglitten ist, vornehmlich darin, dass man bei Ersteren seinen Platz einnehmen kann, ohne befürchten zu müssen, man werde nach der Vorstellung auch nicht mehr Ahnung von dem Stück haben als zuvor. Wohingegen ich bei jenen Gelegenheiten, da man mich gewaltsam in die Oper schleifte, den gesamten Abend damit verbrachte, zu rätseln, warum Sänger A nun zornig auf Sänger B einsingt, während Sängerin C in der Ecke betrübt vor sich hintrillert. Um noch Salz in die Wunde zu streuen, habe ich oft das starke Gefühl, jedermann außer mir wüsste haargenau, worum es geht. Lucy, eine mir persönlich sehr gut bekannte Autorität auf dem Gebiet der Oper, sagt immer, wenn ich nur im Voraus das Libretto läse, bräuchte ich mir keine Gedanken mehr um die Handlung zu machen und könnte mich auf die Musik konzentrieren, um die es ja eigentlich geht.
In diesem Sinne sollte ich Ihnen vielleicht Thomas Nightingale kurz vorstellen, ehe wir ihm an jenem schicksalhaften Frühlingsmorgen sozusagen Aug in Auge gegenüberstehen, um Ihnen, den geschätzten Leserinnen und Lesern, ein besseres Verständnis der Handlung des nun folgenden Stücks zu geben, auf dass Sie umso unbeschwerter die Musik genießen können. Andernfalls bestünde das Risiko, dass die Geschichte irgendwann in einen dieser langatmigen Exkurse abschweift, die der Fluch der modernen Literatur sind.
Er war ein hochgewachsener Bursche mit markantem Unterkiefer, blauen Augen und braunem Haar, das, wiewohl an den Seiten kurz gehalten, obenauf zur Widerspenstigkeit neigte. Dies und das glattrasierte Kinn sorgten dafür, dass er, obgleich gute vier Jahre älter als ich, je nach Laune jünger wirken konnte. In der Tat konnte er so träge und sorglos erscheinen wie jeder x-beliebige Springinsfeld. Doch ich wusste aus sicherer Quelle, dass er bereits einige ziemlich heikle Fälle gemeistert hatte, sowohl in der Heimat als auch andernorts. Ja, was da in meiner Fensternische saß und in meiner Herald Tribune blätterte, verhieß nichts Gutes, auch wenn es einen recht gut geschnittenen Tweedanzug trug.
»Gussie!« Er sprang auf und ergriff meine Hand. »Schön, dich zu sehen. Ich habe mich gefragt, ob du mir, wenn es nicht zu viele Umstände macht, für ein paar Nächte Obdach gewähren könntest?«
»Klar doch!«, versicherte ich und dachte dabei an die vielen vortrefflichen Hotels, insbesondere am Broadway, die noch viel ekstatischer gewesen wären, ihn zu Gast zu haben. »Was führt dich nach New York – Geschäfte oder Vergnügen?«
»Geschäfte natürlich«, sagte er.
Mir sank der Mut. Zwar hatten nicht wenige Mitglieder der Gesellschaft der Weisen berufliche oder geschäftliche Interessen außerhalb des Folly, doch Thomas Nightingale gehörte nicht dazu. Wenn er geschäftlich in New York war, konnte das nur magische Dinge betreffen.
»Oh, prima«, sagte ich in Ermangelung einer geistreicheren Erwiderung. Ich schielte zur Uhr und erschauerte innerlich, als ich sah, dass sie erst Viertel nach zehn zeigte. Nicht nur eine barbarische Zeit, um überhaupt munter zu sein; es war zudem viel zu früh für einen Lunch. »Kann ich dir ein zweites Frühstück anbieten?«
»Danke«, sagte er, »dein guter Mann hier hat mich bereits mit Kaffee versorgt.« Er warf einen Blick auf Beauregard, der nicht weit von uns unaufdringlich auf eventuelle Aufträge wartete. »Allerdings würde ich gern unter vier Augen mit dir sprechen.«
Ich bin durchaus in der Lage, einen Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen, daher gab ich Beauregard, nachdem er mir eine zweite dringend benötigte Tasse des labenden schwarzen Bohnentranks serviert hatte, einige Aufträge außer Haus und ließ deutlich anklingen, dass er sich bis zum Nachmittag Zeit lassen sollte.
Nightingale wartete, bis er verschwunden war, und fragte dann: »Ordentlicher Bursche?«
»Kam mir bisher stets so vor. Nun, was für Geschäfte führen dich her? Ich versichere dir, ich war vorsichtiger als jeder Pastor bei einer Taufe.«
Nightingale lächelte und hob die Hand in einer geradezu bischöflichen Segensgeste. »Ich bin in einer ganz anderen Angelegenheit hier. Und ich hoffe, dass du mich dank deiner Vertrautheit mit der Materie dabei unterstützen kannst.«
»Ah ja?«, sagte ich, ein wenig auf der Hut.
»Ich möchte die Provenienz eines Saxophons ermitteln.«
»Eines Saxophons?«, fragte ich verdattert.
»Eines verzauberten Saxophons.«
»Wozu in aller Welt sollte jemand ein Saxophon verzaubern?«
»Erstens«, sagte Nightingale, »kann es der spielenden Person größere Meisterschaft verleihen. Und zweitens kann dieses hier bei korrekter Handhabung sprechen.«
Ich war baff. »Und was sagt es?«
»Das hängt vom Spieler ab. Der Bursche, dem es gehörte, hatte gelernt, ›hallo‹, ›ja‹ und ›nein‹ zu spielen. Doch soweit unsere gelehrten Experten feststellen konnten, hat es keinen eigenen Willen. Es sagt – oder vielmehr: singt –, was sein Besitzer spielt.« Bei diesem handelte es sich um einen gewissen Laurence Ellwood, einen Jamaikaner, der über New York nach London gekommen war. »Je von ihm gehört?«, fragte Nightingale.
»Nicht dass ich wüsste.« Doch Lucy hatte das mit Sicherheit. Lucy hatte ein Gedächtnis wie diese verflixten Karteikataloge in Bibliotheken. Sollten Sie je in New York einen Ton geblasen, gestrichen, gezupft oder gesungen haben, dann weiß Lucy alles über Sie. Das ist mitunter geradezu unheimlich und wäre verdammt nützlich gewesen, hätte ich vorgehabt, Lucy der Nachtigall vorzustellen oder vice versa. Doch aus bitterer Erfahrung habe ich gelernt, gewisse Seiten meines Lebens von den anderen getrennt zu halten.
»Sei’s drum«, sagte Nightingale. »Mr. Ellwood erwies sich als sehr empfänglich für unseren Vorschlag, das Instrument durch ein anderes von gleicher, wenn auch unverzauberter Qualität zu ersetzen – plus natürlich einen Finderlohn.«
»Natürlich«, sagte ich.
Mr. Ellwood hatte Nightingale Namen und Adresse des Pfandhauses genannt, wo er das Saxophon gekauft hatte. Ich war dort noch nie gewesen, doch einer der Vorteile der amerikanischen Manie, Städte gitterförmig auszurichten, ist, dass man Adressen problemlos findet.
Diese lag an der West 47th Street, nicht weit von der Ecke Tenth Avenue, mitten in dem als Hell’s Kitchen bekannten Viertel – ein mehr als angemessener Name für diese als kriminelles und gewalttätiges Pflaster berüchtigte Gegend. Lucy hatte mich gewarnt, nur ja nicht den Fuß hineinzusetzen. Natürlich bestand Nightingale darauf, auf der Stelle hinzufahren.
Nun, die ganze Sache schien mehr als kurios, doch wir Zauberer haben einen Ehrenkodex, und niemand soll von Augustus Berrycloth-Young sagen können, er habe sich vor seiner Pflicht als Hüter der geheimen Flamme gedrückt. Nicht dass ich die leiseste Ahnung hätte, was oder wo die geheime Flamme sein könnte; liegt wohl daran, dass sie geheim ist.
Jedenfalls stellte ich mich der Herausforderung, und wir riefen uns ein sehr hübsches grün-rotes Taxi herbei und brachen zur 47th Street auf.
Die Pfandleihe war eine Art vollgestopfte Schatzhöhle aus Tausendundeiner Nacht mit zwei gläsernen Schaukästen, die eine Fülle an Uhren, Ringen und Silberbesteck enthielten; an den Wänden hingen reihenweise Musikinstrumente, Barometer und Flinten. Ein ganzer Satz Trompeten baumelte nebeneinander von Haken wie gehäutete Kaninchen, und den Abschluss bildete, ich schwöre es, eine waschechte Balalaika. Oder vielleicht war es auch eine Laute.
Dazwischen waren Seekisten und Koffer zu wackligen Stapeln aufgetürmt, was, wie ich fand, großes Vertrauen der neu Zugewanderten darauf bewies, dass sie in New York ihre endgültige Heimat gefunden hatten. Über einem Ladentisch im hinteren Teil verkündete ein Schild KREDITABTEILUNG und DIAMANTSCHÄTZUNG.
Schon beim Eintreten fielen mich Hunderte von Vestigia an – habe ich schon erläutert, was das ist? Nein? Ausgebildete Praktizierende vergessen leicht, dass die meisten Menschen Vestigia nicht erkennen, wenn sie darauf stoßen. Nun, ganz einfach: Magie, selbst die Magie des profanen alltäglichen Treibens, hinterlässt eine Spur, die der alte Isaac Vestigium nannte. Auch Ihnen begegnet Derartiges sicherlich jeden Tag, doch Sie tun es als belanglosen Laut, Geruch oder als flüchtige Einbildung ab. Es ist so ungreifbar wie ein Tagtraum und meist, auch für magisch Bewanderte, ungefähr ebenso nützlich.
An Orten wie Pfandleihen, Fundbüros und Bibliotheken sammeln sich Unmengen dieser Eindrücke und Phantasmen an, daher schenkte ich ihnen vorerst keine Beachtung.
Aber Augustus, mag der geneigte Leser aufbegehren, wenn diese Vesti… – wie heißt das Zeug gleich wieder? – so unwichtig sind, wozu dann die langwierige Abhandlung darüber? Worauf ich nur erwidern kann: Geduld, mein Freund, schon bald werden Vestigia hier eine Rolle spielen.
Ein stämmiger Mann mit kantigem Gesicht, einem wildwuchernden Schnurrbart und einem absurd flotten Homburg begrüßte uns mit kurzem Nicken und einem bedrohlichen Blick. »Kann ich den Herren helfen?«, fragte er. Sein Tonfall ließ ahnen, dass er es vorziehen würde, dies wäre nicht der Fall.
»Ein Freund von mir hat in diesem Laden vergangenes Jahr ein Musikinstrument erworben«, sagte Nightingale.
»Geld zurück gibt’s hier nicht«, sagte der Homburg. Er sprach es wie »hie nich« aus.
»Das wird auch nicht nötig sein«, erwiderte Nightingale. »Wir sind lediglich auf der Suche nach einer Auskunft.«
»Sind Sie ’n Cop?«
»Nein.«
»’n Seamus?«
Mit fragend hochgezogener Augenbraue warf Nightingale mir einen Blick zu.
»Privatdetektiv«, übersetzte ich.
Nightingale wandte sich wieder dem Mann mit dem verwegenen Schnurrbart zu. »Nein. Wir möchten nur gern wissen, wer das Instrument, das unser Freund hier erworben hat, ursprünglich verpfändet hatte.« Er zeigte dem Mann den Kaufbeleg, doch dieser zeigte sich ungerührt, oder möglicherweise auch begriffsstutzig.
Gerade wollte Nightingale seine Erklärung wiederholen, da schüttelte der Mann den Kopf. »Tut mir leid, Mac. Kann Ihnen nicht helfen.«
»Ich bin gewillt, Sie für den Aufwand zu entschädigen«, sagte Nightingale.
Der Mann horchte sichtlich auf und gab uns zu verstehen, er wolle sehen, was wir zu bieten hätten. An dieser Stelle gestand Nightingale, dass es ihm gegenwärtig an amerikanischer Währung mangelte, und bat mich, vorläufig die finanzielle Belastung auf mich zu nehmen. Es wäre gelogen, zu behaupten, ich wäre nicht leicht verstimmt über diese nonchalante Schnorrerei gewesen. Doch in Gegenwart des Schnurrbarts konnte ich dies schwerlich äußern, daher kramte ich meine Börse heraus. Und auch wenn Nightingales Schätzung, wie viel die verlorene Zeit des Schnurrbarts wert war, ein wenig hoch gegriffen war, spürte ich, dass ich auch dies jetzt lieber nicht zur Diskussion stellen sollte.
Nun nahm das Ganze eine erstaunliche Wendung: Der Schnurrbart fragte, ob er den Kaufbeleg noch einmal sehen könne, und als Nightingale ihm diesen unklugerweise reichte, tat sich unter dem Gestrüpp auf der Oberlippe des Pfandleihers ein beunruhigend großes Maul auf. Er stopfte das Papier hinein, kaute ein-, zweimal konzentriert darauf herum und schluckte es hinunter.
Es heißt ja so schön, Unwissenheit sei ein Segen, und im Grunde ist genau dies das inoffizielle Motto des Folly, aber hätte unser prächtig bebarteter Freund auch nur einen blassen Schimmer gehabt, mit wem er es zu tun hatte, so hätte ihn, was nun folgte, nicht so überraschend getroffen.
Mit Sicherheit hätte er Nightingale nicht mit dieser herausfordernden »Na, was willst du jetzt machen?«-Miene angesehen. Insbesondere, wenn er ihn wie ich schon einmal hätte Hallentennis spielen sehen.
»Verstehe«, sagte Nightingale. »Ich fand das Bestechungsgeld recht angemessen; was meinst du, Gussie?«
»Geradezu großzügig«, sagte ich, und weil mich der Verlust noch immer schmerzte: »Sogar ausnehmend großzügig.«
»Ich zähle jetzt bis fünf«, erklärte Nightingale, »und Sie werden mir in dieser Zeit entweder die gewünschte Auskunft geben oder aber«, er warf mir über die Schulter ein Grinsen zu, »meinem Freund seine Investition zurückerstatten.«
Schnurrbarts Miene wurde noch finsterer – keines von beiden schien ihm zuzusagen. Nightingale war bei zwei angelangt, da riss er wieder dieses schreckliche Maul auf und blaffte: »Jake! Schwing deinen Arsch hier rüber!«
Dann bedachte der arme ahnungslose Narr Nightingale mit einem selbstzufriedenen Blick, wie man ihn einem Rivalen zuwirft, wenn dieser den Ball schon am ersten Loch mit einem Slice in einen Bunker befördert und man das Spiel so gut wie vorüber glaubt, abgesehen vom Auszahlen des Gewinns. Nightingale seinerseits hörte auf zu zählen und wartete auf Jake.
Jake, ein weiterer stämmiger Mann mit Homburg, nur dankenswerterweise glattrasiert, ließ sich volle zehn Sekunden Zeit, dann kam er durch eine Tür hinten im Laden hereingestürmt, eine Schrotflinte schwingend. Ehe er zielen konnte, machte Nightingale, ohne die Augen von Schnurrbart zu nehmen, eine kleine Bewegung mit der linken Hand. Wie von unsichtbarer Hand gepackt wurde Jake die Waffe entrissen und schlitterte über den Boden bis genau vor meine Füße. Gleichzeitig bekam der arme Teufel einen Stoß, dass er längelang zu Boden fiel, was ein Krachen und schmerzvolles Stöhnen hervorrief.
»Gussie, alter Junge«, sagte Nightingale, »könntest du bitte ein Auge auf ihn haben?«
Ich muss gestehen, die Chance auf eine kleine magische Balgerei war verlockend, obwohl es mir ein wenig unsportlich schien, mit Zaubersprüchen auf nichtsahnende Ladenbesitzer loszugehen. Ich bin jederzeit für das Lüpfen eines Polizeihelms oder einen Streich oben im Folly oder dem Bliss zu haben, doch dies erschien mir einen Hauch ernster. Und das bereitete mir Sorgen.
Schnurrbart griff unter den Ladentisch, zweifellos, um sich ebenfalls zu bewaffnen, erstarrte jedoch, als etwas metallisch Blitzendes an seinem Gesicht vorbeisauste. Eine der Myriaden von Schubladen hinter ihm hatte sich geöffnet, und etwa ein Dutzend Tafelmesser waren ihr entschwebt und umschwirrten nun seinen Kopf.
In der korrekten Annahme, es könnte unklug sein, eine plötzliche Bewegung zu machen, richtete der Mann sich langsam auf. Mit hervorquellenden Augen stierte er Nightingale an und versuchte dann vergeblich, den vorbeiflitzenden Messern mit dem Blick zu folgen.
»Und jetzt«, sagte Nightingale, »noch einmal von vorn.«
2
»Und wer ist nun dieser ›Killer‹?«, fragte Nightingale, als wir den Laden verließen.
»Ein Mr. Madden«, erklärte ich. »Obergangster dieses Viertels. Die beiden stehen vermutlich in seinen Diensten oder, noch wahrscheinlicher, unter seinem Schutz.«
»Ah, ha!«, sagte Nightingale mit einem entzückten, vollkommen unangebrachten Grinsen. »Eine dieser berühmten Schutzgelderpressungen, über die ich schon gelesen habe.«
»Genau so eine«, sagte ich düster.
»Als er uns also warnte, der ›Killer‹ würde sich gewiss für uns interessieren, war das als Drohung zu verstehen?«
Ich bestätigte das; allerdings schien Nightingale deswegen nicht im Mindesten besorgt. Eine Haltung, die in mir, entgegen meinem gewöhnlich sonnigen Gemüt, Ärger aufsteigen ließ. »Hör mal, Thomas, du für deinen Teil hast vermutlich vor, mit dem nächsten Dampfer zurück in die Heimat zu schippern, aber mir gefällt’s hier ganz gut, und ich wäre dir dankbar, wenn du mir nicht die Tour vermasseln würdest.«
»Gussie«, rief er leicht überrascht, »willst du etwa hier sesshaft werden?«
»Und wenn?«
»Freut mich für dich. Und sei unbesorgt wegen dieses ›Killers‹. Ich habe Erfahrung mit Ganoven wie den beiden eben. Sie plustern sich gern auf, aber vor diesem … Mr. Madden, nicht wahr?«
»Owney Madden.«
»Waliser?«
»Aus Leeds, soweit ich weiß.«
»Vor diesem Owney Madden haben sie ebenso viel Angst wie jeder andere. Und da bei dem Vorfall nichts abhandenkam außer ihrem Stolz, ist es unwahrscheinlich, dass sie ihm davon berichten werden. Solche Gangsterbosse haben nicht viel für Untergebene übrig, die ihre Zeit verschwenden.«
Das klang zwar verdammt plausibel; dennoch nahm ich mir vor, Hell’s Kitchen in Zukunft zu meiden. Und sei es nur, um Lucy keine schlaflosen Nächte zu bereiten.
Da wir in Hell’s Kitchen schwerlich ein freies Taxi finden würden, schlenderten wir zu Fuß gen Osten, in Richtung Theater District. Während unseres Aufenthalts in der Schatzhöhle musste es geregnet haben, denn die Straßen glänzten blitzsauber im Frühlingssonnenschein. An solchen Tagen zeigt sich New York von seiner besten Seite, frisch und voller Verheißung. Dann ist es kaum möglich, etwas anderes zu empfinden als die gute alte joie de vivre. Und Schnurrbart hatte uns mit einigem Widerwillen einen Namen genannt.
»Ein Name ist nicht eben viel«, sagte Nightingale.
»Au contraire«, erwiderte ich selbstzufrieden – ich glaube, nicht unberechtigterweise. »Wir wissen, dass er Saxophon spielte. Das sollte reichen.«
»Meinst du?«
»Ich kenne da jemanden«, sagte ich. »In Harlem.«