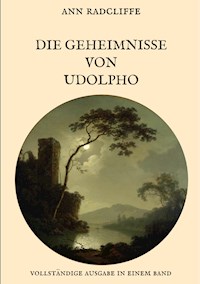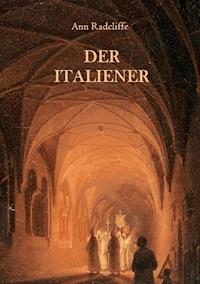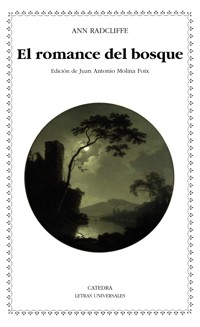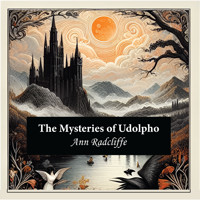Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Band 2 der ersten deutschsprachigen Ann-Radcliffe-Gesamtausgabe, herausgegeben von Maria Weber. Wohlbehütet wachsen Julia und Emilia, die Töchter des hartherzigen Marquis von Mazzini, auf dem väterlichen Schloss auf, während ihr Vater in Neapel weilt. Doch mit der ruhigen Idylle ist es vorbei, als ihr Vater nebst seiner attraktiven Gattin anreist und sich für einen längeren Aufenthalt einrichtet. Fortan werden auf dem Landsitz prunkvolle Feste gefeiert. Indessen scheint es auf Schloss Mazzini zu spuken. Die ersten seltsamen Erscheinungen werden noch als Sinnestäuschungen abgetan, aber bald beginnen die Bediensteten sich vor dem Geist, der im verfallenen Südflügel des Schlosses sein Unwesen treibt, zu fürchten. Doch dann stellt sich heraus, dass mehr hinter dem Seufzen und den Lichterscheinungen steckt, als bloßer Spuk. Bei einem der rauschenden Bälle lernt Julia den charmanten Grafen de Vereza kennen, der scheinbar auch ein Auge auf sie geworfen hat. Doch es gibt noch einen anderen Bewerber, den reichen und einflussreichen Herzog von Luovo, den ihr Vater favorisiert. Und der Marquis von Mazzini ist daran gewöhnt, seinen Willen durchzusetzen... A Sicilian Romance, Ann Radcliffes zweiter Roman, erschien erstmals im Jahre 1790. Diese Neuübertragung aus dem Englischen orientiert sich an der ersten deutschen Übersetzung von Meta Forkel-Liebeskind aus dem Jahre 1792, wurde aber um einige damals gekürzte Stellen erweitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
——
VON
ANN RADCLIFFE,
VERFASSERIN DER BURGEN VON ATHLIN UND DUNBAYNE.
——
IN ZWEI TEILEN.
——
Ich könnte eine Geschichte erzählen…
Hamlet 1, 5.
———
LONDON:
1 7 9 0.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Zweiter Teil
Siebentes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
ERSTER TEIL.
AN der nördlichen Küste von Sizilien sind noch die prächtigen Ruinen eines Schlosses zu sehen, das einst dem edlen Hause der Mazzini gehörte. Es steht inmitten einer kleinen Bucht auf einer Anhöhe, die auf einer Seite zur See hin abfällt, und auf der anderen in eine von dunklen Wäldern gekrönte Eminenz emporsteigt. Die Lage ist bewundernswürdig schön und malerisch, und die majestätische Größe dieser Überreste der Vorzeit, die feierliche Stille, welche über der ganzen Gegend schwebt, erfüllen den Wanderer mit Ehrfurcht und Neugier. Ich besuchte diesen Ort während meiner Reisen im Ausland. Als ich einen Steinhaufen erklomm, und den unermeßlichen Umfang des Gebäudes und die erhabene Pracht der Ruinen überschaute, versetzte mich meine Phantasie in die Zeiten zurück, da diese Mauern stolz in ihrer ursprünglichen Hoheit prangten, als die Säle Szenen der Gastfreundlichkeit und festlicher Pracht waren, und von den Stimmen derer ertönten, welche längst der Tod von der Erde abgestreift hat.
„Ebenso,“ rief ich aus, „wird die gegenwärtige Generation, wird er, der jetzt im Elende erliegt, und er, der im Taumel der Vergnügungen fortschwimmt, dahingehen, und in Vergessenheit sinken!“
Mein Herz schwoll in mir bei den Gedanken; ich wendete mich mit einem Seufzer ab, und entdeckte einen Mönch, dessen ehrwürdige Gestalt, sanft zur Erde geneigt, keinen uninteressanten Gegenstand in der Gruppe bildete. Sein Blick traf den meinigen; er sah die Bewegung meines Gemüts, schüttelte den Kopf, und zeigte auf die Ruinen.
„Diese Mauern,“ sagte er, „waren einst der Sitz der Üppigkeit und des Lasters. Sie zeugten von einem wunderbaren Beispiele der rächenden Wiedervergeltung des Himmels, und wurden von dem Augenblicke an verlassen, und dem Verfall preisgegeben.“
Seine Worte erregten meine Neugierde, und ich forschte nach ihrer Bedeutung.
„Eine schauerliche Geschichte ist von diesem Schlosse zu erzählen, aber für jetzt ist sie zu lang und zu verwickelt. Einer unserer Ordensbrüder, ein Abkömmling aus dem edlen Hause Mazzini, sammelte und zeichnete die auffallendsten Vorfälle in Bezug auf seine Familie auf, und hinterließ die so geformte Geschichte unserem Kloster als Vermächtnis. Wenn Sie wollen, gehen wir dorthin.“
Ich begleitete ihn zum Kloster, und der Mönch stellte mich dem Prior vor, einem Mann von intelligentem Geist und mit einem wohlwollenden Herzen, mit dem ich einige Stunden in interessante Gespräche vertieft verweilte. Ich glaube, meine Gefühle freuten ihn; Denn durch seine Nachsicht durfte ich Auszüge aus der Geschichte vor mir nehmen, die, mit einigen weiteren Einzelheiten, die wir im Gespräch mit den Nachkommen erhalten haben, auf den folgenden Seiten angeordnet sind.
Erstes Kapitel.
GEGEN Ende des sechzehnten Jahrhunderts war diese Burg im Besitz von Ferdinand, des fünften Marquis von Mazzini, und war für seine Familie für mehrere Jahre ihr Hauptwohnsitz. Er war ein Mann von wollüstigem, herrschsüchtigem Charakter. In erster Ehe vermählte er sich mit Louisa Bernini, der zweiten Tochter des Grafen della Salario, einer Dame, die sich mehr noch durch ihre gefälligen Manieren und ihren Sanftmut, als durch ihre Schönheit auszeichnete. Sie gebar ihm einen Sohn und zwei Töchter, die ihre liebenswürdige Mutter in früher Kindheit verloren. Der arrogante und ungestüme Charakter des Marquis wirkte mächtig auf die milde und anfällige Natur seiner Dame ein, und viele glaubten, daß die unfreundliche und nachlässige Behandlung des Marquis ihrem Leben ein Ende gesetzt hätte. Nicht lange darauf heiratete er, wie auch immer das sein konnte, Maria de Vellorno, eine junge Dame, welche außerordentlich schön war, aber einen Charakter besaß, der dem ihrer Vorgängerin entgegengesetzt war. Sie war schlau, verstellt, dem Vergnügen ergeben, und von unbiegsamem Geiste. Der Marquis, dessen Herz für väterliche Zärtlichkeit taub war, und dessen gegenwärtige Dame zu leichtsinnig war, um sich um die häuslichen Angelegenheiten des Marquis zu kümmern, vertraute die Erziehung seiner Töchter einer Vertrauten der verstorbenen Marquise an; und er hätte sie in keine besseren Hände geben können.
Er verließ Mazzini bald nach seiner zweiten Ehe für die Gärten und die Pracht von Neapel, wohin sein Sohn ihn begleitete. Seiner von Natur aus stolzen, gebieterischen Gemütsart ungeachtet, stand er ganz unter der Herrschaft seines Weibes. Seine Leidenschaften waren heftig, und sie beherrschte die Kunst, sie zu ihren eigenen Zwecken zu lenken; und sie verstand es so gut, ihren Einfluß zu verbergen, daß er am unumschränktesten zu regieren glaubte, wo er am meisten Sklave war. Er pflegte einmal im Jahr nach dem Schlosse Mazzini zu kommen, wohin die Marquise ihn selten begleitete, und wo er nur verweilte, um einige allgemeine Befehle über die Erziehung seiner Töchter zu erteilen, die mehr sein Stolz als Zärtlichkeit ihm eingab.
Emilia, die ältere, war ein Abbild ihrer Mutter, mit einem sanften, feinfühlenden Herzen vereinigte sie einen hellen Verstand. Ihre jüngere Schwester Julia war weitaus lebhafter. Eine äußerst reizbare Empfindlichkeit trübte oft ihre Laune; sie war auffahrend, aber großzügig; sie war leicht reizbar, und schnell beschwichtigt; ein Verweis lockte ihr Tränen ab, nie aber machte er sie mürrisch. Sie besaß eine feurige Einbildungskraft, und zeigte früh Spuren von Genie. Madame de Menon ließ es sich eifrigst angelegen sein, den Charakteranlagen ihrer jungen Zöglinge entgegen zu arbeiten, welche ihrem zukünftigen Glück gefährlich werden konnten, und niemand war wohl fähiger zu einem solchen Geschäfte. Eine Reihe früher Mißgeschicke hatte ihr Herz gebändigt, ohne die Kräfte ihres Geistes zu schwächen. In der Zurückgezogenheit hatte sie Ruhe gefunden, und das scharfe Gefühl des Kummers zu sanfter Schwermut gemildert. Sie liebte ihre jungen Pflegetöchter mit mütterlicher Zärtlichkeit, und fand in ihrer allmählichen Vervollkommnung und ihrer respektvollen Zärtlichkeit allen Ersatz für ihre Sorge. Madame war Meisterin in der Musik und im Zeichnen. Oft hatte sie ihre Sorgen bei diesen Vergnügungen vergessen, wenn ihr Geist zu beschäftigt war, als daß sie Trost aus Büchern schöpfen konnte; und sie bemühte sich, Emilia und Julia eine Kraft einzugeben, die so wertvoll war, daß sie das Gefühl der Trübsal betrog. Emilia fand vorzüglich Geschmack am Zeichnen, und brachte es bald sehr weit darin. Julia war ungewöhnlich empfänglich für den Zauber der Harmonie; ihre Gefühle zitterten im Einklange mit den Saiten des Instruments.
Sie erfaßte Madames Unterricht mit erstaunlicher Leichtigkeit, und brachte es in ihrem Lieblingsfache bald zu einem Grade von Exzellenz, den wenige Menschen jemals erreichen. Sie hatte ihre ganz eigene Art. Ihre Stärke bestand weniger in der Fertigkeit, rasch die komplizierte Ausführung zu beherrschen, als vielmehr in einer Feinheit des Geschmacks und einem bezaubernden Ausdrucke, der jedem Ton eine Seele einzuhauchen schien, und unwiderstehlich das Herz des Zuhörers fesselte. Die Laute war ihr Lieblingsinstrument, und ihre zarten Töne harmonierten mit der süßen schmelzenden Melodie ihrer Stimme.
Das Schloß Mazzini war ein großes, unregelmäßig gebautes Gebäude, und schien für ein so zahlreiches Gefolge erbaut zu sein, als die Sitte der damaligen Zeit in Krieg und Frieden um den Adel versammelte. Die gegenwärtige Familie füllte nur einen kleinen Teil desselben aus, und auch diesem gaben die weitläufigen, geräumigen Zimmer, die langen einsamen Gänge, die zu denselben führten, ein verlassenes, verödetes Aussehen. Melancholische Stille herrschte in den gewölbten Hallen, und oft unterbrach ganze Stunden lang kein Schritt das tiefe Schweigen in den Vorhöfen, die von hohen Türmen beschattet wurden. Julia, die schon früh Geschmack am Lesen gefunden hatte, mochte sich gern nachmittags in ein kleines Kabinett zurückziehen, wo sie ihre Lieblingsschriftsteller um sich liegen hatte. Dieses Zimmer bildete den westlichen Winkel des Schlosses; eines der Fenster stieß auf die See, über welche hinaus das Auge dämmernd die schwarze, felsige Küste von Kalabrien erblickte, welche den Horizont begrenzte; aus dem anderen Fenster, das in den Schloßhof ging, hatte man eine Aussicht auf die umliegenden Wälder. Ihre Musikinstrumente, und alles, was ihren Lieblingszeitvertreib ausmachte, waren hier um sie versammelt. Manche kleine Verzierungen, die sie selbst erfand, und einige Zeichnungen von ihrer Schwester verschönerten diesen eleganten und angenehmen Ort. Das Kabinett grenzte an ihr Schlafzimmer, und war nur durch einen kurzen Gang von Madames Zimmern getrennt. Der kleine Gang führte durch einen anderen, langen und gewundenen, Gang zur großen Treppe, die zur nördlichen Halle herablief, an welche die Hauptzimmer von der Nordseite des Gebäudes stießen.
Madame de Menons Zimmer öffneten sich in beide Gänge. In einem dieser Räume brachte sie gewöhnlich ihre Vormittage mit der Ausbildung ihrer jungen Zöglinge zu. Die Fenster blickten auf die See, und das Zimmer war hell und angenehm. Des Mittags speisten sie in einer der unteren Wohnungen, und hatten bei Tisch einen Mann zur Gesellschaft, den der Marquis seit vielen Jahren im Schlosse unterhielt, und der die jungen Damen in der lateinischen Sprache und in Geographie unterrichtete. An den schönen Sommerabenden hielt diese kleine Gesellschaft oftmals ihre Abendmahlzeiten in einem Pavillon, der auf einen Hügel in dem Gehölze, das zum Schlosse gehörte, gebaut war. Von diesem Flecke hatte das Auge eine beinahe grenzenlose Aussicht über See und Land. Man überschaute die Meerenge von Messina, die gegenüberliegenden Ufer von Kalabrien, und eine große Fläche der wilden, malerischen Gegenden von Sizilien. Der Berg Ætna, mit ewigem Schnee bedeckt, und aus den Wolken hervorbrechend, bildete ein großes, erhabenes Bild im Hintergrund der Szene. Auch die Stadt Palermo war sichtbar, und wenn Julia die schimmernden Türme derselben anstarrte, malte ihre Einbildungskraft ihr die Schönheiten dieser Stadt, während sie insgeheim nach einem Anblicke der Welt seufzte, von welcher die widrige Eifersucht der Marquise, und ihre Furcht vor der verdunkelnden Schönheit ihrer Stieftöchter sie bisher ausschloß. Sie wendete allen ihren Einfluß bei dem Marquis an, sie in der Einsamkeit des Schlosses zurückzuhalten, und obgleich Emilia jetzt zwanzig und ihre Schwester achtzehn Jahre alt waren, hatten sie doch noch niemals die Grenzen von ihres Vaters Gebiete überschritten.
Oft erzeugt Eitelkeit unnötige Besorgnisse; doch hier hatte die Marquise gerechten Grund zu fürchten, denn die Schönheit der Töchter ihres Mannes ist selten übertroffen worden. Emilias Gestalt war nach dem feinsten Ebenmaße gebaut; ihre Haut zart, ihr Haar blond und ihre dunkelblauen Augen voll süßen Ausdrucks. Sie hatte einen gewissen Adel in ihrem ganzen Wesen, verbunden mit einer weiblichen Sanftheit, einer holden Schüchternheit, die unwiderstehlich die Herzen fesselte. Julias Wuchs war schlank und geschmeidig, ihr Gang leicht und schwebend, ihre Miene lebhaft, und ihr Lächeln bezaubernd. Ihre Augen waren dunkel und voller Feuer, aber von weniger Sanftheit. Ihre Züge standen in schönem Verhältnisse – jede lachende Grazie spielte um ihren Mund, und ihr Gesicht verriet schnell alle Bewegungen ihrer Seele. Das dunkle, kastanienbraune Haar, das sich in üppiger Fülle um ihren Nacken lockte, vollendete den Reiz ihrer Gestalt.
So reizend, und so in Dunkelheit verschleiert waren die Töchter des edlen Hauses Mazzini. Aber sie waren glücklich, denn sie kannten noch nicht genug von der Welt, um ernstlich die Entbehrung ihres Genusses zu beklagen. Wenn auch Julia zuweilen nach dem Luftbilde seufzte, das die Phantasie ihr malte, und ein schmerzliches Sehnen nach dem bunten Schauplatze, von dem sie abgeschnitten war, in ihr aufstieg, so verscheuchte eine Rückkehr zu ihren gewohnten Vergnügungen das idealistische Bild aus ihrer Seele, und gab ihrem Herzen seine glückliche Selbstgenügsamkeit wieder. Bücher, Musik und Malen teilten ihre Mußestunden, und mancher schöner Abend schwand im Pavillon, wo Madames verfeinerte Unterhaltung, Tassos Gedichte, Julias Laute und Emilias Freundschaft eine Art von Glückseligkeit schufen, welche nur fein gebildete und hochempfängliche Seelen zu genießen und mitzuteilen fähig sind. Madame verstand und übte alle angenehmen Künste der Unterhaltung, und ihre jungen Freundinnen fühlten den Wert derselben, und versuchten ihren Geist zu haschen.
Konversation kann in zweierlei Klassen geteilt werden, in vertrauliche und sentimentale. Es ist das Gebiet der ersteren, Freude und Zwanglosigkeit zu verbreiten, das Herz des Menschen dem Menschen zu öffnen, und einen milden Sonnenschein über die Seele zu strahlen. – Um uns für die Reize der anderen, die ich hier sentimentale Konversation nennen will, und worin Madame de Menon Meisterin war, empfänglich, und zu ihrer Ausübung fähig zu machen, müssen Natur und Kunst zusammentreffen. Ein hoher Grad von Geisteskultur muß mit natürlich gutem Verstande, lebhaftem und feinem Gefühle verbunden sein, und um sie unwiderstehlich anziehend zu machen, wird eine Kenntnis der Welt und eine bezaubernde Leichtigkeit des Tons erfordert, die man nur im häufigeren Umgange mit den verfeinerten Kreisen des höheren Lebens erlangt. Die sentimentale Konversation bringt Gegenstände auf die Bahn, die Herz und Einbildungskraft fesseln; man verhandelt sie gleichsam scherzend mit Geist und Feuer, und verweilt nie so lange dabei, daß sie ermüden könnten. Hier blüht die Phantasie; das Gefühl ergießt sich, und Witz, von Feinsinnigkeit geleitet, und durch Geschmack verschönert, trifft zum Herzen.
Solcherart war Madame de Menons Konversation, und die anmutige Lage des Pavillons schien ihn ganz zur Szene geselligen Vergnügens bestimmt zu haben. Am Abend eines sehr schwülen Tages, als sie in ihrem Lieblingsaufenthalte gespeist hatten, reizte die Kühle und Schönheit der Nacht die glückliche Gesellschaft, länger als gewöhnlich darin zu bleiben. Als sie nach dem Hause zurückgingen, überraschte sie der Schimmer eines Lichts durch die zerbrochenen Fensterladen eines Zimmers in einem Flügel des Schlosses, der seit vielen Jahren verschlossen war. Sie blieben stehen, um es zu beobachten, als es plötzlich verschwand, und sich nicht wieder sehen ließ. Madame de Menon, über diese Erscheinung beunruhigt, eilte ins Schloß, um nach der Ursache zu forschen, als ihr im nördlichen Vorplatze Vincent begegnete. Sie erzählte ihm, was sie gesehen hatte, und befahl, daß man unverzüglich nach den Schlüsseln zu diesen Zimmern suchte. Sie fürchtete, daß jemand, in der Absicht zu rauben, in diesen Teil des Gebäudes gedrungen wäre. Sie kannte keine kleingeistige Furcht, wo ihre Pflicht im Spiele war, und rief sogleich die Diener herbei, um sie dahin zu begleiten. Vincent lächelte über ihre Besorgnisse, und schrieb das, was sie gesehen hatte, einer Täuschung zu, welche die Feierlichkeit der Stunde ihrer Phantasie gespielt hätte. Madame beharrte aber dessen allen ungeachtet auf ihrem Entschlusse, und nach mehrmaligen langen Suchen brachte man einen schweren, verrosteten Schlüssel herbei. Sie ging nun mit Vincent, und von den Dienern begleitet, die voll ungeduldiger Neugierde waren, nach dem südlichen Flügel des Gebäudes. Der Schlüssel gehörte zu einem eisernen Tor, das in einen Vorhof ging, der diesen Flügel von den anderen Teilen des Schlosses trennte. Sie gingen in den Hof, der mit Gras und Strauchwerk bewachsen war, und stiegen einige Stufen hinauf zu einer großen Türe, die sie sich vergebens zu öffnen bemühten. Alle Schlüssel aus dem ganzen Schlosse wurden umsonst versucht, und sie mußten schließlich fortgehen, ohne ihre Neugier befriedigt, und ihre Furcht gestillt zu haben. Alles blieb indessen still, und das Licht erschien nicht wieder. Madame verhehlte ihre Besorgnisse, und die Familie legte sich zur Ruhe.
Dieser Vorfall blieb bei Madame de Menon haften, und lange Zeit verstrich, ehe sie wieder einen Abend in dem Pavillon zuzubringen wagte. Einige Monate verflossen, ohne daß sie etwas sahen oder entdeckten, bis eine neue Erscheinung ihre Furcht wieder erweckte. Julia war eines Abends länger als gewöhnlich in ihrem Kabinett geblieben; ein Lieblingsbuch hatte ihre Aufmerksamkeit weit über die gewöhnliche Stunde der Ruhe hinaus gefesselt, und jeder Bewohner des Schlosses, sie allein ausgenommen, lag lange in Schlummer versunken. Die Schloßuhr, die eins schlug, weckte sie plötzlich aus ihrer Vergesslichkeit. Erschrocken, daß es so spät war, stand sie eilends auf, und wollte in ihr Schlafzimmer gehen, als die Schönheit der Nacht sie ans Fenster lockte. Sie öffnete es, und lehnte sich heraus, um die schöne Wirkung des Mondlichts auf den dunklen Wäldern zu betrachten. Nicht lange hatte sie so verweilt, als sie einen schwachen Lichtschein durch einen Fensterflügel im unbewohnten Teile des Schlosses wahrnahm. Ein plötzliches Zittern ergriff sie, und sie konnte sich kaum aufrecht halten. Das Licht verschwand nach wenigen Augenblicken, und bald darauf kam eine Gestalt mit einer Laterne aus einer verborgenen Tür des südlichen Turms hervor, schlich sich außen längs den Schloßmauern hin, und drehte sich um den südlichen Winkel, der sie vor Julias Blick verbarg. Erstaunt und voll Schrecken lief sie in Madame de Menons Zimmer, und erzählte ihr, was sie gesehen hatte. Man weckte sogleich die Diener, und das ganze Haus geriet in Aufruhr. Madame ging in die nördliche Halle, wo die Bediensteten bereits versammelt waren. Keiner hatte Mut genug, in den Vorhof zu gehen, und Madames Befehle wurden nicht beachtet, da der Eindruck abergläubischen Schreckens ihnen entgegenstand. Sie sah, daß Vincent fehlte, und wollte ihn eben rufen lassen, als er in die Halle trat. Voll Verwunderung, die ganze Familie versammelt zu finden, fragte er nach der Ursache. Er befahl sogleich einem Teile der Bediensteten, ihn rings um die Schloßmauern zu begleiten, und mit einigem Widerstreben und mehr Furcht noch gehorchten sie ihm. Sie kamen alle zurück, ohne etwas gesehen zu haben; allein obgleich ihre Furcht nicht bestätigt war, war sie doch auf keine Weise zerstreut. Die Erscheinung eines Lichtes in einem Flügel des Schlosses, der seit vielen Jahren verschlossen war, und dem Zeit und Umstände ein Aussehen besonderer Verödung gegeben hatten, mußte in hohem Maße Verwunderung und Schrecken erregen. Der gemeine Mann empfängt begierig jeden Eindruck des Wunderbaren, und die Bediensteten zögerten nicht zu glauben, daß eine übernatürliche Macht im südlichen Flügel des Schlosses wohnte. Zu aufgeregt um schlafen zu können, beschlossen sie, den Rest der Nacht zu durchwachen. Zu diesem Zwecke begaben sie sich in die östliche Galerie, wo sie eine Aussicht auf den südlichen Turm hatten, aus welchem das Licht hervorgegangen war. Die Nacht verstrich ohne weitere Störung, und die Morgendämmerung, die sie mit unaussprechlichem Vergnügen anbrechen sahen, zerstreute auf eine Weile ihre ängstlichen Besorgnisse. Die Rückkehr des Abends aber erneuerte sie wieder, und mehrere Nächte bewachten die Bedienten den südlichen Turm. Obgleich nichts sich sehen ließ, entstand dennoch das Gerücht und fand Glauben, daß es im südlichen Flügel des Schlosses spukte. Madame de Menon war zwar über den kleingeistigen Wahn des Aberglaubens erhaben, war aber dennoch beunruhigt und verwirrt, und beschloß, wenn das Licht sich je wieder sehen ließe, den Marquis davon zu benachrichtigen, und die Schlüssel zu den Zimmern zu fordern.
Der Marquis, in den Vergnügungen von Neapel versunken, dachte selten an das Schloß und seine Bewohner. Sein Sohn, der unter seiner unmittelbaren Aufsicht erzogen wurde, war der einzige Gegenstand seines Stolzes, so wie die Marquise der alleinige Gegenstand seiner Liebe war. Er hing mit romantischer Zärtlichkeit an ihr, die sie mit scheinbarem Gegengefühle und heimlicher Untreue vergalt. Sie erlaubte sich freien Genuß der ausschweifendsten Vergnügungen, beachtete aber eine so schlaue Vorsicht, daß sie aller Entdeckung, ja sogar dem Verdachte selbst auswich. Sie war in ihren Liebschaften ebenso unbeständig als feurig, bis der junge Graf Hippolitus de Vereza ihre Aufmerksamkeit fesselte. Ihre natürliche Unbeständigkeit schien bei ihm zu verschwinden, und alle Wünsche ihres Herzens konzentrierten sich auf ihn allein.
Der Graf de Vereza hatte in früher Kindheit seinen Vater verloren. Er war jetzt mündig, und hatte eben den Besitz seiner Güter angetreten. Seine Person war angenehm und männlich zugleich, sein Verstand aufgeklärt, seine Sitten fein und gefällig. Sein Antlitz drückte eine glückliche Mischung von Geist, Würde und Wohlwollen aus, welches die Hauptzüge seines Charakters waren. Ein edleres Gefühl lehrte ihn die wollüstigen Laster der Neapolitaner verachten, und nach höheren Zwecken streben. Er war der ausgewählte und frühe Freund des jungen Ferdinand, und kam fast täglich in des Marquis Haus. Die Marquise behandelte ihn vom ersten Augenblicke an mit auffallender Auszeichnung, und machte ihm schließlich Avancen, die weder die Ehre noch Neigung des jungen Grafen ihm zu bemerken erlaubte. Er betrug sich gegen sie mit eiskalter Höflichkeit, welche die Leidenschaft, die sie abkühlen sollte, nur noch mehr entflammte. Bis auf diesen Augenblick hatte man gierig um die Gunst der Marquise gebuhlt, und mit Entzücken sie empfangen, und die zurückstoßende Kälte, die sie jetzt erfuhr, rief allen ihren Stolz auf, und setzte jede Kunst der Koketterie in Bewegung.
Es geschah um diese Zeit, daß Vincent in eine Krankheit fiel, die so schnell zunahm, daß sie in kurzer Zeit mit äußerster Gefahr drohte. An seinem Leben verzweifelnd, verlangte er, daß man sogleich einen Boten an den Marquis schickte, um ihn von seinem Zustande zu benachrichtigen, und schien inständig zu wünschen, ihn zu sehen, ehe er stürbe. Der Fortschritt seiner Krankheit bot jeder Arzneikunst Trotz, und seine sichtliche Seelenangst schien sein Schicksal zu beschleunigen. Als er fühlte, daß seine letzte Stunde herannahte, verlangte er einen Beichtvater. Man holte einen Mönch aus einem benachbarten Kloster, der lange Zeit bei ihm eingeschlossen blieb, und schon hatte er die letzte Ölung empfangen, als Madame de Menon an sein Bett gerufen wurde. Die Hand des Todes lag bereits auf ihm; kalter Schweiß stand auf seiner Stirne, und mühsam schlug er seine schweren Augen nach ihr auf. Er winkte ihr, näher zu treten, bat sie, niemand ins Zimmer zu lassen, und schwieg einige Augenblicke. Seine Seele schien unter einer quälenden Erinnerung zu arbeiten; er versuchte zu verschiedenen Malen zu sprechen; aber es gebrach ihm an Entschlossenheit oder Kraft. Endlich heftete er einen Blick unaussprechlicher Angst auf sie.
„Ach Madame!“ sprach er, „der Himmel gewährt die Bitte eines so Elenden wie mir nicht! Ich muß sterben, lange bevor der Marquis ankommen kann. Da ich ihn nicht mehr sehen werde, wünschte ich Ihnen ein Geheimnis zu offenbaren, das schwer auf meinem Herzen liegt, und meine letzten Augenblicke ebenso furchtbar macht, als sie ohne Hoffnung sind.“
„Seien Sie getröstet,“ unterbrach ihn Madame, die von seinem feierlichen Tone bewegt war; „man hat uns glauben gelehrt, daß bei aufrichtiger Reue Vergebung nie verweigert wird.“
„O Madame! Sie kennen mein ungeheures Verbrechen noch nicht, wissen nicht das schreckliche Geheimnis, das auf meiner Brust liegt. Meine Schuld ist in dieser Welt ohne Hilfe, und ich fürchte, sie wird in der zukünftigen ohne Vergebung bleiben. Darum erhoffe ich wenig von der Beichte, selbst vor einem Priester. Doch ist es noch in meiner Macht, etwas Gutes zu tun; lassen Sie mich denn Ihnen das Geheimnis offenbaren, das so geheimnisvoll mit den Erscheinungen im südlichen Teile des Schlosses verbunden ist.“
„Welches denn?“ unterbrach ihn Madame voll Ungeduld.
Vincent gab keine Antwort mehr; erschöpft von der Anstrengung des Redens, war er in Ohnmacht gesunken. Madame klingelte um Hilfe, und durch wirksame Mittel kehrte seine Besinnung zurück; seine Sprache aber war dahin, und in diesem Zustand blieb er, bis er verschied, was etwa eine Stunde nach der Unterredung mit Madame geschah.
Madames Verwirrung und Erstaunen war durch diesen letzten Auftritt zu einem schmerzhaften Grade erhöht. Sie erinnerte sich an alle besonderen Umstände, die sich auf den südlichen Flügel des Schlosses bezogen – die vielen Jahre, die er unbewohnt gewesen war – das tiefe Schweigen, das man stets darüber beobachtete – die Erscheinung des Lichts und der Gestalt – die fruchtlose Suche nach den Schlüsseln, und das allgemein geglaubte Gerücht; und so stellte ihr Gedächtnis ihr eine Reihe von Umständen dar, die nur dazu dienten, ihre Befremdung zu vermehren, und ihre Neugierde zu erhöhen. Ein geheimnisvoller Schleier hüllte diesen Teil des Schloß fest ein, und es schien jetzt unmöglich, ihn je zu durchdringen, da die einzige Person, die ihn wegziehen konnte, nicht mehr war.
Am Tag nach Vincents Tode kam der Marquis an. Er kam nur von wenigen Dienern begleitet, und stieg mit einem ungeduldigen Wesen und einem Gesicht, das starke Bewegung ausdrückte, vor den Toren ab. Madame und die jungen Damen empfingen ihn in der Halle. Er grüßte eilends seine Töchter, ging in das angrenzende Zimmer, und bat Madame, ihm zu folgen. Sie gehorchte, und der Marquis fragte mit großer Unruhe nach Vincent. Als er seinen Tod vernahm, ging er mit hastigem Schritte im Zimmer auf und ab, schwieg eine Weile, setzte sich endlich, sah Madame mit durchforschenden Blicken an, und tat einige Fragen über die näheren Umstände von Vincents Tode. Sie erwähnte sein ernstliches Verlangen, den Marquis zu sehen, und wiederholte seine letzten Worte. Der Marquis wollte sie unterbrechen, schwieg aber sogleich wieder, und sie erzählte ihm nun weiter alle Umstände von dem südlichen Flügel des Schlosses und den nächtlichen Erscheinungen, die sie ihm zu entdecken für unumgänglich notwendig hielt. Er behandelte die Sache sehr obenhin, lachte über ihre Folgerungen, stellte ihr die Erscheinungen, die sie beschrieb, als Täuschungen eines schwachen furchtsamen Kopfes vor, und brach das Gespräch ab, um in Vincents Zimmer zu gehen, worin er lange Zeit verweilte.
Den folgenden Tag speisten Emilia und Julia mit dem Marquis. Er war finster und schweigend; ihr Bestreben, ihn zu unterhalten, schien eher Unmut als Güte zu erregen, und sobald die Mahlzeit vorbei war, ging er in sein Zimmer, und ließ seine Töchter voll Verwunderung und Betrübnis zurück.
Vincent sollte nach seinem eigenen Wunsche in der Kirche des St. Nicholas-Klosters begraben werden. Einer der Diener, dem der Marquis einige nötige Befehle wegen des Leichenbegängnisses erteilte, wagte es, ihn von den Lichterscheinungen im südlichen Turme zu benachrichtigen. Er erwähnte die abergläubischen Gerüchte, die im Hause herumgingen, und klagte, daß die Diener sich weigerten, nach Einbruch der Dunkelheit über den Hof zu gehen.
„Und wer hat euch diese Geschichte aufgetragen?“ fragte der Marquis in unwilligem Tone: „müssen mir die kindischen, schwachen Grillen der Weiber und Bediensteten vorgetragen werden? – Fort! laßt euch nicht wieder vor mir sehen, bis ihr von Dingen zu sprechen gelernt habt, die mir zu hören geziemen.“
Robert zog sich beschämt zurück, und niemand wagte für eine lange Zeit, die Sache gegenüber dem Marquis wieder zu erwähnen.
Die Volljährigkeit des jungen Ferdinand nahte nunmehr heran, und der Marquis beschloß, diesen Zeitpunkt mit festlicher Pracht auf dem Schlosse Mazzini zu feiern. Er rief die Marquise und seinen Sohn von Neapel herbei, und ließ prächtige Vorbereitungen veranstalten. Emilia und Julia fürchteten die Ankunft der Marquise, deren Einfluß sie lange gefühlt hatten, und von deren Gegenwart sie einen schmerzlichen Zwang vorausahnten. Unter der sanften Führung der Madame de Menon waren ihre Stunden in glücklicher Ruhe vergangen; sie kannten ebensowenig das Ungemach, als die Freuden der Welt. Dieses beugte sie nicht nieder, und jene entflammten sie nicht. Mit Streben nach Wissen und mit dem Erwerb eleganter Fertigkeiten beschäftigt, flohen ihre Augenblicke leicht dahin, und nur die Fortschritte ihrer Vervollkommnung bezeichneten den Flug der Zeit. Madame vereinigte die Zärtlichkeit einer Mutter mit der Teilnahme einer Freundin, und sie hingen mit warmer, unverbrüchlicher Liebe an ihr.
Der nahe Besuch ihres Bruders, den sie seit vielen Jahren nicht gesehen hatten, erfüllte sie mit Freude. Zwar erinnerten sie sich seiner nicht deutlich, aber sie freuten sich mit eifriger und entzückter Erwartung auf seine Tugenden und Talente, und hofften in seiner Gesellschaft einen Trost für das Unbehagen zu finden, das die Gegenwart der Marquise ihnen verursachen würde. Ebensowenig sah Julia die herannahenden Festlichkeiten mit gleichgültigen Augen an. Eine neue Szene eröffnete sich ihr, die ihre jugendliche Einbildungskraft mit den wärmsten, glühendsten Farben der Freude ausmalte. Die Vorfreude erweckt oft das Herz zu Empfindungen, die eine entferntere und unbestimmtere Betrachtung nie hervorbringen würde. Julia, die aus der Ferne ruhig auf die bunten, schimmernden Szenen des Lebens hingeblickt hatte, durchseufzte jetzt in ungeduldiger Erwartung die Augenblicke, die noch zwischen dem Genusse standen. Emilia, deren Gefühl weniger lebhaft, deren Einbildungskraft weniger stark war, sah das Fest mit ruhiger Betrachtung herannahen, und beklagte beinahe die stillen Freuden unterbrochen zu sehen, die ihrem Geiste und Herzen angemessener waren.
Nach wenigen Tagen langte die Marquise auf dem Schlosse an. Ein großer Zug folgte ihr, begleitet von Ferdinand und verschiedenen vom italienischen Adel, die das Vergnügen an ihr Gefolge heftete. Der Schall von Musik verkündigte ihren Einzug, und die Tore, die lange an ihren rostigen Angeln gehangen hatten, wurden aufgerissen, um sie zu empfangen. Die Vorhöfe und Hallen, die noch vor kurzem Dunkelheit und Verödung verkündigten, erschienen jetzt mit plötzlichem Glanze, und hallten die Töne der Fröhlichkeit und Freude wieder. Julia sah aus einem verborgenen Fenster die Szene an, und als der Schall des Triumphs durch die Lüfte bebte, bebte ihre Brust und klopfte ihr Herz vor Freude, und ihre Furcht vor der Marquise verlor sich in einer Art von wildem Entzücken, das ihr bisher unbekannt gewesen war. In der Tat schien die Ankunft der Marquise das Signal zu allgemeinem, unbegrenztem Vergnügen zu sein. Als der Marquis herauskam, um sie zu empfangen, schmolz die Finsternis, die bisher auf seinem Gesichte hing, in gefälliges Lächeln, welches die ganze Gesellschaft als Einladung zur Freude zu betrachten schien.
Emilias ruhiges Herz konnte gegen einen so einladenden Auftritt nicht standhalten; sie seufzte bei dem Anblicke, ohne selbst zu wissen warum. Julia zeigte ihrer Schwester die einnehmende Gestalt eines jungen Mannes, der der Marquise folgte, und äußerte den Wunsch, daß dies ihr Bruder sein möchte. Von der Betrachtung der Szene vor ihnen wurden sie zur Marquise abberufen. Julia zitterte vor Furcht, und wünschte auf einige Augenblicke das Schloß in seinen alten Zustand zurück. Sowie sie durch den Saal gingen, in welchem sie der Marquise vorgestellt werden sollten, glühten Julias Wangen hochrot; Emilia aber, obgleich ebenso furchtsam, behielt ihre ungezwungene Würde bei. Die Marquise empfing sie mit einem Lächeln, worin Herablassung und Höflichkeit gemischt waren, und ihre Eleganz und Schönheit zog sogleich die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft auf sich. Julias forschende Augen versuchten vergebens ihren Bruder zu entdecken, dessen ihr dunkel vorschwebendes Bild sie in keinem der Gegenwärtigen fand. Endlich führte ihr Vater ihn zu ihr; und mit einem Seufzer sah sie, daß er nicht der Jüngling war, den sie vom Fenster bemerkt hatte. Er nahte sich ihr mit einem sehr einnehmenden Wesen, und sie sagte ihm ein uneingeschränktes Willkommen. Seine Gestalt war hochgewachsen und majestätisch; er hatte einen sehr edlen, geistvollen Anstand, und sein Gesicht drückte Milde und Hoheit zugleich aus. Das Abendessen wurde im östlichen Saale aufgetragen, und die Tische waren verschwenderisch mit Leckereien besetzt. Eine Gruppe Musikanten spielte während der Mahlzeit, und ein Konzert im Salon beendete den Abend.
Zweites Kapitel.
DER von Julia so lange und ungeduldig ersehnte Tag des Festes brach endlich an. Der ganze Adel aus der Nachbarschaft war dazu eingeladen, und die Tore des Schlosses wurden zu einem allgemeinen Freudenfeste geöffnet. Ein prächtiges Gastmahl, das aus den leckersten und kostbarsten Gerichten bestand, wurde in den Sälen aufgetragen. Sanfte Musik schwebte längs den gewölbten Decken; die Wände waren mit Verzierungen behangen, und die Hand eines Zauberers schien dieses vormals düstere Gebäude plötzlich in einen Feenpalast verwandelt zu haben. Nur der Marquis saß oft mit abwesender Miene inmitten all dieses Genusses, und die Beklemmung seines Herzens war trotz all seiner Bemühungen um gute Laune an seinem Gesichtsausdruck erkennbar.
Gegen Abend war ein großer Ball. Die Marquise, die sich noch immer durch Schönheit und durch einnehmendes Betragen auszeichnete, erschien in glänzendem Putze. Ihr Haar war reich mit Juwelen geschmückt, aber so geordnet, daß es ihrer ganzen Gestalt eher ein wollüstiges denn ein anmutiges Aussehen gab. So bewußt sie sich auch ihrer Reize war, sah sie doch mit neidischem Auge Emilias und Julias Schönheit, und mußte heimlich eingestehen, daß die einfache Eleganz, mit der sie sich geschmückt hatten, bezaubernder war, als alle studierte Kunst eines glänzenden Zierrats. Sie waren beide gleich in leichte sizilianische Tracht gekleidet, und nur einige Perlenschnüre hielten die üppige Fülle ihres fließenden Haares zurück. Der Ball wurde von Ferdinand und der Dame Matilda Constanza eröffnet. Emilia tanzte mit dem jungen Marquis della Fazelli, und benahm sich mit der Ungezwungenheit und Würde, die ihr so natürlich war. Julia empfand eine gemischte Regung von Furcht und Vergnügen, als der Graf de Vereza, den sie als eben den Kavalier erkannte, welchen sie vom Fenster aus bemerkt hatte, sie zum Tanze führte. Die Grazie ihrer Bewegungen, das schöne Ebenmaß ihrer Gestalt erregte in der Gesellschaft ein leises Murmeln des Beifalls, und die sanfte Röte, die sich auf ihre Wangen schlich, verschuf ihren Reizen noch zusätzlichen Charme. Als aber die Musik sich veränderte, und sie nach dem sanften sizilianischen Taktmaße tanzte, verwandelte die schwebende Anmut ihrer Bewegung, der süße, zärtliche Ausdruck auf ihrem Gesichte, die Aufmerksamkeit in bewunderndes Schweigen, welches noch fortdauerte, als der Tanz längst aufgehört hatte. Die Marquise beobachtete die allgemeine Bewunderung mit scheinbarem Vergnügen und geheimen Mißbehagen. Sie hatte die peinlichste Angst ausgestanden, als der Graf de Vereza Julia zur Tänzerin wählte, und verfolgte ihn den ganzen Abend hindurch mit dem forschenden Auge der Eifersucht. Ihr Busen, der vorher nur von Liebe glühte, ward jetzt von andern heftigeren und zerstörenderen Leidenschaften zerwühlt. Unruhig irrten ihre Gedanken umher, die Szene vor ihr konnte ihren Verstand nicht beschäftigen, und es erforderte alle ihre Kunst, einen ruhigen Anschein zu wahren. Sie sah, oder glaubte einen leidenschaftlichen Blick bei dem Grafen zu sehen, sooft er Julia anredete, und dieser Wahn nagte mit wütender Eifersucht an ihrem Herzen.
Um zwölf wurden die Schloßtore geöffnet, und die Gesellschaft wanderte hinaus in das prächtig erleuchtete Gehölz. Lichterarkaden liefen die langen Alleen hinab, die mit Pyramiden von Lampen endeten, welche dem Auge eine glänzende Flammensäule darstellten. In unregelmäßiger Entfernung waren Gebäude errichtet, mit bunten Lampen behangen, die in mannigfaltigen, phantastischen Formen geordnet waren. Unter den Bäumen standen Tische mit Erfrischungen, und Musik, von unsichtbaren Händen berührt, wehte herum. Die Musikanten hatten sich an den entlegensten, belaubtesten Plätzen gelagert, um sich dem Auge zu verbergen und die Einbildungskraft zu täuschen. Der ganze Schauplatz schien bezaubert zu sein; das Ange sah nichts als Schönheit und romantischen Glanz, das Ohr fing nur Töne der Freude und Harmonie auf. Der jüngere Teil der Gesellschaft bildete Gruppen, die mal durch die Bäume hervorschlüpften, mal wieder verschwanden. Julia schien die Zauberkönigin des Orts zu sein. Ihr Herz hüpfte vor Freude, und goß einen Ausdruck reinen, wohlgefälligen Entzückens über ihre Züge. Ein edles, freimütiges und hohes Gefühl funkelte aus ihren Augen und beseelte ihr Wesen. Ihr Busen glühte von wohlwollender Zärtlichkeit, und sie schien allem, was um sie war, eine ebenso reine Glückseligkeit, als sie selbst genoß, mitteilen zu wollen. Wohin sie nur ging, folgte Bewunderung ihren Schritten. Ferdinand war ebenso fröhlich, als die Szene rings um ihn. Emilia war vergnügt, und der Marquis schien seine Melancholie im Schlosse zurückgelassen zu haben. Die Marquise allein war elend. Sie speiste mit einer ausgewählten Gesellschaft in einem Pavillon am Seeufer, den man mit besonderer Eleganz ausgeschmückt hatte. Er war mit weißer Seide behangen, die mit Blumenkränzen aufgebunden und mit reichen goldenen Fransen besetzt war. Die Sofas waren aus demselben Stoff, und abwechselnde Kränze von Rosen und Lampen umwanden die Säulen. Eine Reihe kleiner Lampen um das Gesimse formierte einen Lichtsaum rings um die Decke, der nebst den anderen unzähligen Lichtern in einer glänzenden Flamme aus den großen Spiegeln, die das Zimmer schmückten, wiederstrahlte. Der Graf Muriani war mit von der Partie. Er machte der Marquise Komplimente über die Schönheit ihrer Töchter, und nachdem er scherzhaft die Gefangenen, welche ihre Reize fesseln würden, beklagt hatte, kam er auf den Grafen de Vereza.
„Gewiß,“ sagte er, „verdient dieser junge Mann am besten unter allen die Dame Julia zu besitzen. Als sie tanzten, schien es mir, als sähe ich ein vollkommenes Ebenbild der Schönheit beider Geschlechter, und wenn ich nicht sehr irre, so haben sie einander gegenseitige Bewunderung eingeflößt.“ Die Marquise versuchte ihren Unmut zu verbergen und antwortete:
„Ich will dem Grafen keineswegs das Verdienst abstreiten, das Sie ihm zuschreiben; allein nach dem, was ich von ihm gesehen habe, zu urteilen, ist er zu flüchtig für eine ernsthafte Verbindung.“
In eben dem Augenblicke trat der Graf in den Pavillon. „Sieh an,“ sagte Muriani lachend; „eben waren Sie der Gegenstand unserer Unterhaltung, und Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen, um die Ehre, die Ihnen angetan wurde, zu vernehmen. Ich verwendete mich bei der Marquise für Sie um die Dame Julia, allein sie lehnt es durchaus ab; obgleich sie Ihr Verdienst anerkennt, behauptet sie, daß Sie von leichtsinniger und unbeständiger Natur wären. Was sagen Sie dazu? Würde nicht die Schönheit der Dame Julia ihr unstetes Herz fesseln?“
„Ich weiß nicht, wodurch ich es verdient habe, bei der Marquise in diesem Rufe zu stehen,“ sagte der Graf lächelnd; „allein das Herz müßte in ungewöhnlichem Grade krank oder empfindungslos sein, das in Fräulein Julias Gegenwart sich der Freiheit rühmen könnte.“ Die Marquise, empfindlich gekränkt bei dem ganzen Gespräche, fühlte alle Stärke von Verezas Antwort, die ihr mit besonderem Nachdrucke auf sie gerichtet zu sein schien.
Das Fest endete sich mit einem großen Feuerwerk, das am Seeufer aufgestellt war, und die Gesellschaft trennte sich erst, als der Morgen dämmerte. Julia bedauerte es, die Szene verlassen zu müssen. Sie war bezaubert von der neuen Welt, die sich ihr jetzt eröffnete, und nicht gelassen genug, die lebhafte Glut der Einbildungskraft von den Farben wirklichen Glücks zu unterscheiden. Sie glaubte, daß das Vergnügen, welches sie jetzt empfand, stets und in gleichem Maße durch die Gegenstände, die es zuerst erregten, erneuert werden müßte. Jugendliche Seelen sind nie geneigt, die Schwäche der Menschheit wahrzunehmen. Es ist eine schmerzhafte Wahrheit, daß Gegenstände auf uns wirken, deren Eindrücke ebenso veränderlich als unerklärlich sind, und daß wir dasjenige, was uns gestern tief bewegte, heute nur schwach, morgen vielleicht gar nicht mehr fühlen. Wenn endlich diese unwillkommene Wahrheit in das Herz eindringt, so verwerfen wir im ersten Augenblicke mit Ekel allen Anschein des Guten; wir verschmähen es, eine Glückseligkeit zu kosten, über die wir nicht gebieten können, und sinken nicht selten in eine vorübergehende Verzweiflung. Weisheit oder Zufall rufen uns schließlich von unserem Irrtum zurück, und bieten uns einen Gegenstand dar, welcher fähig ist, eine angenehme und doch dauernde Wirkung hervorzubringen, welche wir Glückseligkeit nennen können. Glückseligkeit ist darin wesentlich von dem, was wir gewöhnlich unter Vergnügen verstehen, verschieden, da Tugend ihre Basis ausmacht, und da man von ihr, als dem Resultate der Vernunft, eine gleichförmige Wirkung erwarten darf.
Die Leidenschaften, die bisher in Julias Herzen geschlummert hatten, brachen, zufällig berührt, in voller Kraft hervor, und ließen sie den Schmerz und das Entzücken erfahren, die mit ihrem Erwachen verbunden sind. Verezas Schönheit und Vorzüge erregten in ihr eine neue, mannigfaltige Bewegung, welche aufzumuntern die Vernunft sie zurück hielt, und die dennoch zu süß war, um ihr ganz widerstehen zu können. Einem Gefühle von Entzücken entgegenklopfend, noch durch keine getäuschte Hoffnung zurückgescheucht, heißt das junge Herz jedes Gefühl willkommen, das nicht geradezu schmerzhaft ist, mit einer romantischen Erwartung, es in Seligkeit aufgelöst zu sehen.
Mit ängstlicher Sorgfalt versuchte Julia Verezas Gesinnung gegen sie zu ergrübeln. Sie rief sich alle Ereignisse des Tages wieder hervor, doch sie gewährten ihr wenig Befriedigung; sie warfen nur ein schimmerndes trügliches Licht zurück, welches statt sie zu führen, sie nur noch mehr verwirrte. Mal erinnerte sie sich eines Beweises besonderer