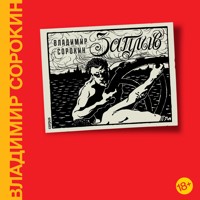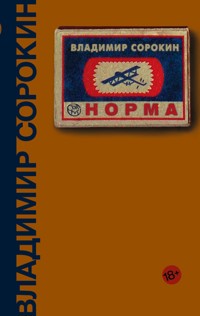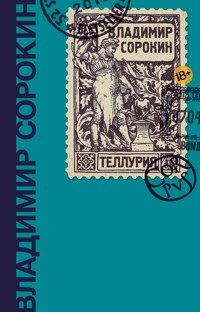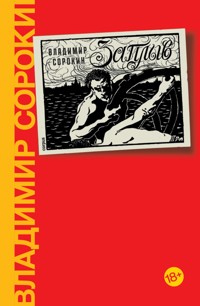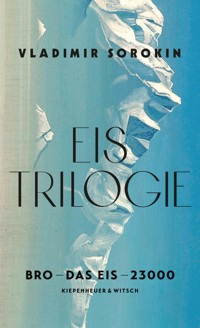
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
An einem Sommerabend in Tokio sah Vladimir Sorokin einmal einen Koch, der einen Eimer mit Eisstücken ausschüttete. Diese Szene lieferte ihm die Inspiration für seine Eis-Trilogie, mit der er sich endgültig in die allererste Riege russischer Schriftsteller schrieb und die seinen internationalen Ruhm begründete. Im Mittelpunkt der drei Romane "Bro", "Das Eis" und "23000" steht die "Bruderschaft des Lichts" mit ihrem Gründungsmythos, an den sich der Geologe Bro anlässlich einer Expedition zum Tungus-Meteoriten zurückerinnert. Die Brüder und Schwestern begreifen sich als Auserwählte, die sich wiederfinden und in Lichtstrahlen zurückverwandeln müssen. Nur so können sie selbst zu einer Art ewigem Sein zurückfinden. Dafür muss jedoch der kosmische Fehler einer sich reproduzierenden Menschheit, die real existierende Hölle aus Körperlichkeit und Gewalt, rückgängig gemacht, diese Menschheit also ausgerottet werden. Sorokin verwebt hier reale Ereignisse, die Historie Russlands - sowjetisch und post-sowjetisch - mit Phantastischem und mit Thriller-Elementen. Virtuos wechselt er Genres, Stile und Erzähltechniken und reichert seine Romane mit viel Zeitdiagnostik und literarischen Anspielungen an. Doch hinter all dem steht am Ende eine uralte Sehnsucht, die Sorokin selbst so beschreibt: "'Das Eis' handelt nicht vom Totalitarismus, sondern von der Suche nach dem verlorenen seelischen Paradies."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1191
Ähnliche
Vladimir Sorokin
Eis-Trilogie
Bro – Das Eis – 23000
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Vladimir Sorokin
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Bro
Die Kindheit
Die Revolution
Der Weg
Petrograd
Die Expedition
Ljod. Das Eis
Schwester Fer
Bruder
Die Kraft des Herzens
Schwestern
Moskau
Der Eishammer
Die Fleischmaschine
Der Zirkus
Die Suche
Die Zeit
Schwester Chram
Ljod. Das Eis
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
23000
Da klumpt das Fleisch
Der Kleine Kreis der Hoffnung
Die Herzen der Drei
Das Arsenal
Gorn
Der Große Kreis
Gorns Morgen
Olga Drobot
Chram und Gorn
Björn und Olga
Über der Welt
Qingjiu
Klub der toten Tölen
Alle auf einmal sehen
Zapfenstreich
Die Letzten
Die Verwandlungsroutine
Der Schlüssel
Ljodland, ade!
Aufwärts!
Ein Drittel Fleischmaschinentag
Zum Licht
Gott
Inhaltsverzeichnis
Bro
Roman
Inhaltsverzeichnis
Die Übersetzung wurde gefördert vom Literarischen Colloquium Berlin mit Mitteln des Auswärtigen Amtes und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Berlin.
Inhaltsverzeichnis
Die Kindheit
Geboren wurde ich 1908 auf dem Gut meines Vaters Dmitri Iwanowitsch Snegirjow. Dieser zählte seinerzeit zu den größten Zuckerfabrikanten Russlands und besaß zwei Landgüter: eines in Waskelowo nahe Sankt Petersburg, wo ich zur Welt kam, das andere im ukrainischen Bassanzy, Gouvernement Charkow, wo ich meine Kindheit verbrachte. Außerdem gehörte der Familie noch ein kleines, aber gemütliches Holzhaus in Moskau, Uliza Ostoshenka, und eine große Wohnung in der Millionnaja in Petersburg.
Das Gutshaus in Bassanzy hatte mein Vater eigenhändig errichtet – noch in den »Troglodytenzeiten« seines Zuckergeschäfts, als er eben erst zweitausend Desjatinen fruchtbaren ukrainischen Boden zum Rübenanbau erworben hatte. Er war der erste russische Zuckerfabrikant, der selbst anbaute, statt die Rüben den Bauern abzukaufen, wie es Sitte war. Die Fabrik stellten Großvater und er gleich daneben hin. Ein Gutshaus hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, da die Familie zu jener Zeit schon in der Hauptstadt Sankt Petersburg wohnte. Doch der Großvater, von Natur aus misstrauisch, bestand darauf. »In unsicheren Zeiten wie diesen gehört der Chef in die Nähe der Rüben und der Fabrik.«
Vater mochte Bassanzy nicht besonders.
»Ein Paradies der Fliegen«, pflegte er zu sagen.
»Die kommen ja nur deines Zuckers wegen!«, entgegnete die Mutter lachend.
Fliegen gab es dort wirklich jede Menge. Den ganzen Sommer über war es heiß. Dafür waren die Winter prächtig: mild und schneereich.
Das Gut in Waskelowo erwarb Vater erst später, als er schon ein sehr reicher Mann war. Ein ehrwürdiges Haus mit strenger Fassade, Säulenportal und zwei Seitenflügeln. Dort kam ich auf die Welt. Es war eine Frühgeburt, zwei Wochen vor dem Termin. Der Grund dafür sei das merkwürdige Wetter gewesen, das an jenem 30. Juni herrschte, sagte meine Mutter. Trotz Windstille und wolkenlosem Himmel habe man plötzlich von ferne ein Gewitter grollen gehört. Ein ungewöhnliches Rumoren, das Mama nicht nur gehört, sondern mit der Frucht ihres Leibes, nämlich mir, gespürt haben will.
»Der Donner hat dich sozusagen hervorgetrieben«, erzählte sie. »Es ging ganz einfach. Du warst gesund und wogst so viel wie ein normal geborenes Kind.«
Die ganze darauf folgende Nacht zum 1. Juli blieb der Nordhimmel ungewöhnlich hell erleuchtet, es gab eigentlich gar keine Nacht: Das Abendlicht ging ins Morgenlicht über. Was sehr sonderbar war, denn die weißen Nächte pflegen Ende Juni vorüber zu sein.
»Der Himmel leuchtete dir zu Ehren!«, scherzte Mama.
Sie gebar mich auf dem harten und allzeit kühlen Ledersofa in Vaters Arbeitszimmer, wo sie von den Geburtswehen überrascht wurde – »mitten hinein in einen blöden Disput über ein altes Blumenbeet und den neuen Gärtner«. An der dem Sofa gegenüberliegenden Wand standen in Eichenholzregalen die Zuckerhüte: jeder ein Pud schwer, gegossen aus dem Zucker einer bestimmten Ernte, mit aufgedruckter Jahreszahl. Die massiven weißen Kegel aus purem Zucker werden das Erste gewesen sein, was ich von dieser Welt zu Gesicht bekam; jedenfalls prägten sie sich meinem kindlichen Gedächtnis zur selben Zeit ein wie die Gesichter von Mutter und Vater.
Man taufte mich auf den Namen Alexander, zu Ehren Seiner Heiligkeit, des legendären russischen Heerführers Alexander Newski, und im Gedenken an Alexander Sawwitsch, meinen Urgroßvater, der die Kaufmannsgeschäfte der Snegirjows begründet hatte. Gerufen wurde ich allerdings auf die verschiedenste Weise: Vater sagte Alexander zu mir, Mutter Schura und die Tante Saschenka; die Schwestern nannten mich Schurjonok; mein ältester Bruder Wassili rief mich Alex, Wanja, der nächstjüngere – Sanja; für Madame Panaget, die Gouvernante, war ich Sashá, Fuhrmann Frol sprach mich mit Lexander Dmitritsch an und Pferdeknecht Gawril mit »kleiner Herr«.
Wir waren sieben Kinder in der Familie: vier Söhne und drei Töchter; eine davon – Nastja – kam mit einem Buckel zur Welt. Ein weiterer Junge starb mit fünf Jahren an Poliomyelitis.
Ich war ein Nachzügler, mein Bruder Wassili schon siebzehn, als ich geboren wurde.
Mein Vater war ein großer, mürrischer Mann mit kahlem Kopf und langen, kräftigen Armen. Ein widersprüchlicher Charakter: energisch, wenn es darauf ankam, grob und herrisch, ansonsten ein skeptischer Grübler, Pedant noch dazu. Manchmal erschien er mir wie eine Maschine, die von Zeit zu Zeit kaputtging, sich jedoch selbst zu reparieren wusste und dann wieder lief wie am Schnürchen. Er vergötterte den Fortschritt, hatte die Verwalter seiner vier Betriebe zum Studium nach England geschickt. Selbst hegte er eine Abneigung gegen andere Länder, meinte immer, dort müsse man nach deren Pfeife tanzen. Er war für Fremdsprachen ausgesprochen unbegabt, sein Französisch bestand aus drei Dutzend angelernten Sätzen. Wie Mutter erzählte, verlor er auf Reisen leicht die Fassung, fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Er entstammte einem alten Kaufmannsgeschlecht, Kornhändler aus Saratow, die mit der Zeit zu Fabrikanten geworden waren. Der großen Snegirjow’schen Sippe gehörten vier Zuckerfabriken, eine Großkonditorei und eine Schifffahrtsgesellschaft. Als junger Mann hatte Vater an der Polytechnischen Fakultät der Saratower Universität studiert, das Studium jedoch im dritten Jahr aus unerfindlichen Gründen hingeworfen. Und war kurz darauf ins Familienunternehmen eingestiegen. Ungefähr alle acht Wochen hatte er einen trübseligen Alkoholabsturz, glücklicherweise nie länger als drei Tage; dabei kam es vor, dass er das Mobiliar demolierte und die Mutter unflätig beschimpfte, doch nie erhob er die Hand gegen sie. Anschließend entschuldigte er sich jedes Mal bei ihr, fuhr erst ins Dampfbad und dann in die Kirche, um zu beichten. Sehr fromm war er allerdings nicht.
Um die Kinder kümmerte er sich nicht im Geringsten. So waren wir der Fürsorge der Mutter, der Ammen und Gouvernanten sowie der Verwandten überlassen, die auf den beiden Gütern in großer Zahl lebten.
Meine Mutter war das Musterbild der russischen Frau, die sich für das Wohl ihrer Kinder und der Familie aufopfert. Sie war bemerkenswert schön (je zur Hälfte Ossetin und Russin – als Letztere von Kosaken am Terek abstammend), begabt mit einem heißen Herzen und einer weiten Seele und schenkte ihre uneigennützige Liebe zuvörderst dem Vater, der sie auf dem Jahrmarkt von Nishni Nowgorod gesehen und sich sofort unsterblich in sie verliebt hatte, und dann uns Kindern. Überdies war Mutter von einer Gastfreundschaft, die an Unverstand grenzte: Jedem zufällig hereinschauenden Besuch wurde das Weiterfahren entschieden unmöglich gemacht.
Zwar war ich das Nesthäkchen der Familie, aber nicht unbedingt ihr Liebling. Der Vater favorisierte den aufgeweckten, doch folgsamen Ilja, in dem er seinen Nachfolger sah, während die Mutter mehr als alle den schönen, zarten Wanja anhimmelte, der seinerseits Bücher, die von Königen handelten, und Quarkkeulchen, mit Sauerkirschen gefüllt, über alles liebte. Wassili, dem die Kraft in den Armen und der Schalk im Nacken saß, galt beim Vater als Tunichtgut (»nichts als Flausen im Kopf«) und ich als Faulpelz. Meine drei Schwestern lagen charakterlich sehr beieinander: lebensfroh und energiegeladen, dabei recht egozentrisch und empfindlich – leicht zum Lachen ebenso wie zum Weinen zu bewegen, schwer wieder davon abzubringen. Alle drei musizierten sie mit großer Hingabe; am weitesten brachte es die bucklige Nastja, die sich ernsthaft anschickte, das Klavierspielen zum Beruf werden zu lassen. Im Verhältnis zum Vater unterschieden sich die Mädchen am meisten: Arischa, die Älteste, vergötterte ihn, Wassilissa, die Mittlere, empfand vor allem Furcht und Nastja, die Jüngste, nichts als Hass.
Die Familie lebte auf vier Orte verstreut: Wassili in Moskau, wo er sich eine Ewigkeit abmühte, Advokat zu werden, Arischa und Wassilissa in Petersburg, Wanja und Ilja in Waskelowo, Nastja und ich in Bassanzy.
Bis zu meinem neunten Lebensjahr lebte ich auf dem Gut und wurde dort auch unterrichtet: Außer der französischen Gouvernante, die mich in Fremdsprachen und Musik unterwies, hatte ich einen Hauslehrer namens Didenko: ein junger Mann von unvorteilhaftem Äußeren und provinziellen Manieren, der mir mit leiser, einschmeichelnder Stimme all das weitergab, was er selber wusste. Die großen Eroberungen der Geschichte sowie die Himmelskörper waren seine beiden Lieblingsthemen. Wenn er von den Feldzügen Hannibals sprach und von Sonnenfinsternissen, war er ein anderer als sonst, seine trüben Augen glänzten. Daher wusste ich beim Eintritt ins Gymnasium Attila von Alexander dem Großen und den Jupiter vom Saturn fein zu unterscheiden; in russischer Sprache und Rechnen sah es schlechter aus.
Meine Kindheit bis zu diesem Moment war eine rundum glückliche Zeit. Die ukrainische Natur in ihrer Wärme und Freigebigkeit war wie eine Wiege für mich: Ich ging mit den Söhnen des Gutsverwalters fischen und Vögel fangen, fuhr im englischen Motorboot des Vaters über den Dnepr, botanisierte mit meiner Französin, ulkte und musizierte mit Nastja, saß während der Rüben- und Getreideernte beim Fuhrmann auf dem Bock, ging mit Mutter und den Tanten zur Kirche, ließ mir vom Pferdeknecht das Reiten beibringen und richtete des Abends mit Didenko das Fernrohr auf die Sterne.
Alljährlich im August versammelte sich die ganze Familie in Waskelowo.
Die südliche Landschaft der Ukraine wich der des russischen Nordens, anstelle von Kastanien und Pappeln war unser weißes Säulenhaus dort mit strengen, düsteren Fichten umstellt. Zwischen ihren jahrhundertealten Stämmen blinkte der See, vom Haus führten viele steinerne Stufen geradewegs zu ihm hinunter. Gern saß ich auf dem bemoosten Granit der untersten und warf, die Beine überm Wasser baumeln lassend, Steine in den See, sah dem sich bildenden Wellenkreis zu, wie er sich zügig vergrößerte, hinwegglitt über die glasklare Oberfläche, zum steinigen Ufer heran.
Der See war stets kühl und glatt. Dafür lärmte und zwitscherte unsere vielköpfige Familie wie ein Vogelschwarm im Frühling. Nur der griesgrämige, wortkarge Vater erschien als einsamer schwarzer Rabe in diesem Schwarm. Ich selbst fühlte mich pudelwohl im Kreis meiner Verwandten, der, so wie die Kreise im Wasser, zusehends größer wurde, denn die Verwandtschaft auf beiden Landgütern hatte beständig neuen Zuwachs und Zulauf. Vaters Reichtum ebenso wie Mutters offene Hand und Barmherzigkeit, die Behaglichkeit des Anwesens und der hier herrschende Wohlstand zogen die Menschen in Scharen an. Allerlei Gnadenbrotempfänger, pilgernde Mönche und versoffene Schauspieler, Kaufmannswitwen und an der Spielsucht gescheiterte Majore schwärmten wie Bienen durch die Gästezimmer in Haupt- und Seitenflügeln. Wenn an normalen Tagen zum Mittagessen gerufen wurde, war für durchschnittlich zwanzig Personen eingedeckt. An Feier- oder Geburtstagen mussten im Speisezimmer des nördlichen Gutshauses drei Tische zusammengerückt werden, und in Bassanzy verlegte man die Tafel gleich in den Garten, unter die Apfelbäume.
Der Vater schritt dagegen nicht ein. Wahrscheinlich sagte dieser Lebensstil ihm zu. Allerdings ließen sich während der ausschweifenden Familienfeste auch keine Zeichen sonderlicher Begeisterung aus seinem Gesicht ablesen. Lachen und weinen konnte er ohnehin nur, wenn er sehr betrunken war. Und nie habe ich das Wort »Glück« aus dem Mund des Vaters gehört. Ob er deswegen unglücklich war? Ich weiß es nicht.
Mama jedenfalls war glücklich, ganz ohne Zweifel. Ihre heitere, beschwingte, philanthropische Natur schwebte und flatterte über allem. Auch wenn sie gern einmal sagte, Glück sei für sie, wenn sie so viel um die Ohren habe, dass keine Zeit zum Nachdenken bleibe.
In diesem menschlichen Bienenkorb also wuchs ich heran – ein gesundes, glückliches Kind.
Genau wie Mama verschwendete ich nicht viel Zeit für müßige Gedanken, wenn ich an heißen Julitagen vom Kutschbock des staubbedeckten Zweispänners sprang und durch die Suite angenehm kühler Zimmer fegte, den Klängen der »Barkarole« entgegen, mit einem Sträußchen Walderdbeeren in der Hand, das ich, auf weitab gelegenen Wiesen gepflückt und mit einem Grashalm zusammengebunden, der Klavier spielenden Nastja überreichte, um ihr gleichzeitig eine Schnecke oder ein Heimchen auf den Buckel zu setzen, was einen Aufschrei nach sich zog, einen Schwapp Milch aus ihrem Glas in mein Gesicht, ein paar flache Hiebe mit Tschaikowskis »Jahreszeiten«, schließlich die Versöhnung und den gemeinsamen Verzehr der süßen Beeren auf dem sonnenwarmen Fensterbrett.
Nur eine Merkwürdigkeit gab es, die mich als Kind ängstigte und fesselte zugleich.
Es war ein Traum, den ich immer wieder träumte. Ich sah mich am Fuß eines gewaltigen Berges, so unabsehbar gewaltig, dass mir die Knie weich wurden. Der Berg war wirklich schrecklich groß. So groß, dass ich zu weichen und zu bröseln begann. Sein Gipfel reichte in den blauen Himmel. Bis dort hinauf war es unglaublich hoch. So hoch, dass ich nachgab und zerging wie ein Brötchen in der warmen Milch. Mit dem Berg musste ich mich abfinden. Er stand da. Wartete darauf, dass ich seinen Gipfel ins Auge fasste. Das war alles, was er von mir wollte. Ich aber brachte es einfach nicht fertig, den Blick zu heben. Wie auch? So geduckt, so am Bröseln und Zergehen. Der Berg aber wollte unbedingt, dass ich schaute. Und ich verstand, dass ich restlos zerbröseln würde, wenn ich nicht schaute. Zu Brotsuppe werden, unwiderruflich. Ich nahm meinen Kopf in die Hände und stemmte ihn nach oben. Er hob sich, ganz, ganz langsam. Und ich schaute, schaute auf den Berg. Doch den Gipfel, den sah ich nicht. Denn er war hoch, so hoch. Und er floh, floh mich auffallend. Ich keuchte, biss die Zähne zusammen, fing doch an zu heulen. Und hob weiter, Stück für Stück, meinen schweren Kopf. Bis mir auf einmal das Rückgrat zerbrach, ich zerfiel in nasse Brocken, klatschte rücklings zu Boden. Und sah den Gipfel. Er lag im LICHT. Ein Leuchten, so strahlend, dass ich darin verschwand. Und das war so schrecklich schön, dass ich erwachte.
Morgens war dieser Traum mir in allen Einzelheiten gewärtig, und ich erzählte ihn meinen Angehörigen beim Frühstück. Die aber waren nicht sehr beeindruckt davon.
»Weniger spinnen, mehr an die frische Luft gehen!«, riet mir Vater auf die brachiale Art, die für ihn typisch war. Mutter segnete mich für die Nacht, besprengte mich mit geweihtem Wasser und legte mir ein Ikonenbildchen Panteleimons, des Heiligen Arztes, unters Kopfkissen. Meine Schwestern fanden an dem Traum nichts Außergewöhnliches. Die Brüder hatten gar nicht erst zugehört.
Tagsüber konnte der rätselhafte Berg dann für mich in den verschiedensten Formen wieder auftauchen: als Schneewehe vor dem Haus, Tortenstück auf dem Teller der Schwester, Wacholderbusch, den der Gärtner zur Pyramide zurechtgestutzt hatte, Nastjas Metronom, ein Zuckerhaufen in Vaters Fabrik oder mein Kopfkissenzipfel.
Die wirklichen Berge interessierten mich hingegen wenig. Der prächtige Atlas mit der Aufschrift Les plus grands fleuves et montagnes du Monde, den Didenko mir zeigte, weckte keine Wiedersehensfreude in mir, denn zwischen Chomolungma, Jungfrau und Ararat fand sich der von mir geschaute Berg nicht. Es waren irgendwelche Berge. Geträumt hatte ich von dem Berg.
Allmählich dann bekam das Paradies meiner Kindheit Risse; das russische Leben begann einzusickern. Zuallererst in Form eines Wortes: Krieg. Ich war sechs, als ich es auf der Terrasse unseres ukrainischen Gutshauses zum ersten Mal hörte. Wir saßen am Mittagstisch, Vater ließ länger auf sich warten, wir hatten auf Mutters Geheiß schon zu essen begonnen, als Vaters Kutsche endlich doch ratternd vorgefahren kam. Zögerlicher als sonst trat er ein: ernst, auf düstere Weise festlich, in seinem Nankinganzug mit Weste, weißem Hut und einer Zeitung in der Hand.
»Es ist Krieg!«, sagte er und warf die Zeitung auf den Tisch. Dann zog er das Taschentuch aus der Tasche, rieb sich damit den langen, kräftigen Hals. »Erst das Habsburger Gesindel, nun die Preußen. Sie möchten sich Serbien einverleiben«, verkündete er.
Die am Tisch sitzenden Männer waren aufgesprungen, umringten den Vater, redeten durcheinander. Nastja und Arischa blickten verwirrt zu Mutter hinüber. Die schien erschrocken zu sein, während ich, an einem zu großen Bissen Pirogge mit Ei würgend, auf die Zeitung starrte. Sie lag vor mir, zwischen der Karaffe mit der Himbeerlimonade und dem Teller mit dem gepökelten Schweinefleisch. Das große schwarze Wort KRIEG war in der Mitte gefaltet. Darunter stand in etwas kleineren Buchstaben das Wort SERBIEN. Es ließ mich an Serpentinen denken, ein Wort, das ich erst neulich in Didenkos Bergbildband kennengelernt hatte. Und Preußen – so hießen bei uns die roten Schaben[1] in der Speisekammer. Bei der Vorstellung, wie so ein gefräßiger roter Schwarm über einen Berghang herfiel und die Serpentinen wegputzte, überlief mich ein Schauder. Ich verschluckte mich und hustete, der unzerkaute Bissen flog mir aus dem Mund auf die Zeitung.
Doch keiner achtete auf mich. Die Männer standen, in gedämpfter Lautstärke schwadronierend, beisammen, Vater in ihrer Mitte, wie immer viel zu steif, das knochige Kinn gereckt, erzählte ihnen etwas von einem Ultimatum Österreich-Ungarns. Die Frauen sagten immer noch nichts.
Ich sah das ausgespuckte Stück Pirogge auf dem schwarzen Wort KRIEG liegen. Und seltsam: Dieser Anblick blieb für mich ein Sinnbild für den Krieg, das mich zeit meines Lebens begleitet hat.
Bald war der Krieg zur Gewohnheit geworden.
Beim Frühstück wurden die neuesten Nachrichten von der Front verlesen. Die Namen der Generäle waren uns schon beinahe so vertraut wie Verwandte. Am besten gefiel mir General Kuropatkin, den ich mir wie den Zwerg Tschernomor in »Ruslan und Ljudmila« vorstellte. Außerdem gefiel mir das Wort »Konterattacke«. Wir waren nach Waskelowo umgezogen; von da fuhren wir des Öfteren zum Bahnhof, um unsere Truppen zu verabschieden, Mama und die Schwestern nähten Weißwäsche für die Verwundeten, schnitten Binden, fertigten Wattetupfer, besuchten die Lazarette und wurden einmal sogar gemeinsam mit der Zarin und den Verwundeten fotografiert. Wassili meldete sich, ungeachtet des väterlichen Einspruchs und der Tränen der Mutter, freiwillig zur Front.
Kurz nach Kriegsausbruch lernte ich zwei weitere Gesellschafter der Menschheit kennen, verlässlich dabei auf all ihren Wegen: die Gewalt und die Liebe.
Im Frühjahr nahm Vater mich und Nastja nach Bassanzy mit. Am Palmsonntag fuhren wir mit den Tanten und einigem sonstigem Anhang in drei Kutschen zur Kirche, die am Rande des Nachbardorfes Kotschanowo stand und sehr hübsch aussah: weiß und hellblau getüncht, Vater hatte für die Renovierung gesorgt. Ich ging gern zur Kirche, fand es dort immer nett und friedlich. Mir gefiel, wie alle sich bekreuzigten und verneigten, wie sie sangen. Es hatte etwas Geheimnisvolles. Während der Messe suchte ich den Erwachsenen fleißig alles nachzutun. Wenn der Pope das Weihwasser versprengte und mein Gesicht ein paar Tropfen abbekam, juchzte ich nicht, sondern blieb still wie alle Übrigen auch. Erst gegen Ende kam Langeweile auf, ich verstand nicht, warum dies alles so lange dauern musste.
Schließlich war die Messe vorbei, und wir verließen inmitten der Menge das Gotteshaus. Da entstand hinter uns ein Gedränge, mehrere Stimmen zankten miteinander. »Die Chochly[2] müssen überall die Ersten sein!«, tönte es auf Russisch und die Erwiderung auf Ukrainisch: »Die Zugezogenen drängeln wieder mal!«
Das Wetter war frühlingshaft warm, die Sonne schien, Reste von Schnee knirschten unter den Füßen. Vater und die Tanten verteilten milde Gaben, während Nastja und ich, schon im Wagen sitzend, das Treiben auf dem Kirchplatz beobachteten. Es herrschte ein großes Gewimmel. Manche waren betrunken. Ein Teil waren ukrainische Bauern, ein Teil Arbeiter aus Vaters Fabrik, die eine Werst vom Dorf entfernt lag, doch die Siedlung für die Beschäftigten, die mein Großvater hatte bauen lassen, befand sich gleich hinter der benachbarten Sandgrube. Die Bauern baldowerten und knackten Kürbiskerne dabei, die Arbeiter rauchten und rissen Witze. Plötzlich ein Aufschrei, eine Ohrfeige klatschte, eine Mütze rollte über den Platz, es kam Bewegung in die Menge, Männer rannten in Richtung Sandgrube, die Frauen kreischend hinterher. Im Nu war der Platz wie leer gefegt, nur die Bettler und die Krüppel waren noch da, dazu die beiden Wachtmeister mit ihren langen Säbeln und unsere Familie.
»Wo wollen die denn alle hin?«, fragte ich Nastja, die immerhin vier Jahre älter war als ich.
»Mikola!«, rief Nastja, noch an der Hostie kauend, und ließ die flache Hand auf den wattierten Rücken des Kutschers klatschen. »Was haben die vor?«
Der Mann auf dem Bock, ein wettergegerbter Ukrainer mit Hängeschnauzbart, wandte sich um und sagte grinsend: »Da haut sich die Teufelsbrut wiederma die Schädel ein, gnä’s Fräulein.«
»Wer wem?«, fuhr Nastja erschrocken auf.
»Einer dem andern.«
»Und warum?«
»Woher soll ich das wissen …«
Wir erhoben uns von den Sitzen und spähten hinunter in die Grube. Dort standen die Männer einander in zwei Reihen gegenüber: Fabrikarbeiter, größtenteils Zuzügler aus dem Russischen, auf der einen Seite, ansässige ukrainische Dorfburschen auf der anderen. Alte, Frauen und Kinder schauten vom Rand der Grube aus zu. Wieder flog eine Mütze, und die Prügelei fing an, untermalt vom Kreischen der Frauen und den Anfeuerungsrufen der Männer. Zum ersten Mal im Leben sah ich, wie Menschen absichtlich aufeinander einschlugen. Bei uns in der Familie wurde nicht geschlagen – von den wenigen Klapsen der Mutter und Katzenköpfen des Vaters abgesehen; das Höchste war, dass einer zur Strafe in der Ecke stehen musste. Es kam vor, dass Vater Mutter anbrüllte, bis die Adern blau hervortraten, dass er einem Diener gegenüber mit dem Fuß aufstampfte, den Verwaltern mit der Faust drohte – doch nie hat er jemanden geschlagen.
Fasziniert starrte ich auf die Prügelei, ohne recht zu begreifen, was vor sich ging. Die da unten schienen mit Wichtigem beschäftigt. Sie taten sich schwer. Doch sie strengten sich an. So sehr, dass sie nah am Heulen waren. Sie ächzten, fluchten, brüllten. Zahlten es – ich wusste nicht, was – einander mit Fäusten heim. Das fand ich entsetzlich und großartig zugleich. Ein Zittern überkam mich. Nastja bemerkte es und umfasste meine Schulter. »Keine Angst, Schurjonok. Das ist grobes Volk. Papa sagt, sie können nichts als saufen und prügeln.«
Ich fasste Nastjas Hand. Sie schien das Treiben auf eine Art zu begreifen, die mir nicht einsichtig war. Auf einmal schien sie nicht mehr meine Schwester zu sein, war mir fern und erwachsen. Und ich war allein. Die Prügelei ging weiter. Jemand fiel in den Schnee, jemand wurde bei den Haaren gezogen, jemand wankte beiseite und spuckte Blut. Nastjas Hand war heiß und fremd.
Schließlich pfiffen die Wachtmeister in ihre Trillerpfeifen, die Alten und die Frauen oben am Grubenrand riefen etwas hinunter.
Die Prügelei hörte auf. Die Beteiligten ließen ab voneinander und gingen ihrer Wege – die Ukrainer nach Kotschanowo, die Arbeiter in die Siedlung. Meine barmherzige Mutter konnte nicht an sich halten. »Ihr Schamlosen!«, rief sie ihnen nach. »Die Rechtgläubigen führen Krieg gegen die Deutschen, und ihr schlagt euch am Feiertag die Köpfe ein!« Dem Vater zuckte ein Lächeln um den schmallippigen Mund. »Lass sie ihr Mütchen kühlen. Das macht sie ruhiger.«
Er fürchtete Streiks, wie sie die russischen Fabriken zuletzt im Jahr 1905 lahmgelegt hatten. Doch durfte er bis jetzt zufrieden sein: Seine Arbeiter waren von der Mobilmachung nicht betroffen, da Zucker zu den strategisch wichtigen Produkten gezählt wurde. Der Krieg versprach ihm einen großen Profit.
Mama setzte sich zu uns, der Kutscher zerrte an den Zügeln, schnalzte mit der Zunge, und die Kutsche fuhr an. Ich ließ Nastjas Hand los. Zwei junge Burschen aus der Fabrik liefen längsseits, die Schöße ihrer offen stehenden groben Bauernmäntel flogen. Der eine hatte ein blau geschlagenes Auge, das jedoch freudig blitzte. Der andere befühlte seine zerschundene Nase. Mama wandte sich missbilligend ab.
»Den Chochly haben wir’s gezeigt, Chef!«, rief der Bursche mit dem blauen Auge, zog mit den spitzen Fingern der Rechten etwas aus der geballten Linken und hielt es zwinkernd und lachend vor mich hin. »Ein Chocholzahn! Kam meiner Faust in die Quere!«
Währenddessen neigte sein Kamerad sich ruckartig nach vorn und schnäuzte heftig aus. Blut spritzte rot leuchtend in den Schnee. Die Burschen waren glücklich. Beide hatten etwas Unsichtbares geschenkt bekommen. Bei einer Prügelei. Und zogen nun damit heim.
Ich aber verstand nicht, was das für ein Geschenk war. Nastja und die anderen Erwachsenen schienen es zu wissen. Verschwiegen es aber. Wie überhaupt so manches.
Die Rätsel der Welt musste ich selber lösen.
Ende Juli zogen wir zurück nach Waskelowo. Eines Mittags, nach zweistündigem Unterricht bei Madame Panaget, trank ich ein Glas warme Milch mit Heidelbeeren und lief in den Garten, um bis zum Essen noch ein wenig herumzustromern. Vor hundertfünfzig Jahren angelegt, hatte dieser Garten nur Reste seiner einstigen Pracht bewahrt, da der vorige Besitzer ihn vollkommen vernachlässigt hatte. Es bereitete mir Spaß, Papierschiffchen auf dem Teich auszusetzen, auf den sich zum Boden neigenden Ästen einer Weide herumzuklettern oder aus der Deckung von Wacholderbüschen Fichtenzapfen auf einen alten marmornen Faun zu werfen. An diesem Tag aber hatte ich zu gar nichts Lust. Nastja war im Haus und spielte Klavier, Mama und die Kinderfrau kochten Marmelade, Vater hatte Ilja und Iwan nach Wyborg mitgenommen, um irgendeine Maschine zu kaufen, Arischa und Wassilissa dösten zwischen Büchern auf dem Sofa. Ich stromerte durch den Garten und hatte den entlegensten Winkel erreicht, als ich plötzlich unser Zimmermädchen Marfuscha erblickte. Sie hatte sich eben durch zwei auseinandergebogene Stangen im Zaun gezwängt und tauchte im angrenzenden Wald unter. Dabei bewegte sie sich so geschwind, wie man es überhaupt nicht von ihr kannte: einer molligen, etwas trägen, immer freundlichen Person mit glupschenden Rehaugen. Mir kam das geheimnisvoll vor, also kroch ich gleichfalls durch den Zaun und nahm die Verfolgung auf. Ihr sittsames blaues Kleid mit weißer Schürze hob sich vom Hintergrund des urwüchsigen Waldes gut sichtbar ab. Ohne sich umzusehen, hastete das Mädchen einen Trampelpfad entlang. Ich lief ihm nach, eine dicke Schicht Nadeln federte unter meinen Füßen. Ringsum dichter alter Fichtenwald. Düster war es und still, nur vereinzelte Vögel im Wechselgesang. Nach einer halben Werst hörte der Wald auf, und ein kleiner Sumpf fing an. Am Waldrand standen drei Hüttchen aus Fichtenzweigen. Alljährlich im Frühling saßen hier Vater und seine Freunde auf Birkhühner an, die in dem Sumpf ihre Balz zu veranstalten pflegten. Aus einer von ihnen ertönte nun ein Pfiff. Marfuscha blieb stehen. Ich versteckte mich hinter einem dicken Fichtenstamm. Gerade noch rechtzeitig, denn Marfuscha blickte sich um, bevor sie in die Hütte kroch.
»Ich dachte schon, du kommst nicht«, war eine männliche Stimme zu vernehmen. Ich erkannte Klim, unseren jungen Diener.
»Bald wird zu Mittag gegessen, die gnä’ Frau kocht Marmelade, herrje, wenn sie’s bloß nicht merkt …«, haspelte Marfuscha.
»Keine Angst, die merkt es schon nicht«, brummte Klim, dann wurde es still.
Auf leisen Sohlen näherte ich mich der Hütte, in der Absicht, die beiden durch lautes Gebrüll aus nächster Nähe zu erschrecken. Ich stand schon unmittelbar daneben, hatte den Mund schon geöffnet – und erstarrte, da ich Klim und Marfuscha durch die trockenen Zweige sah. Auf dem Boden der Hütte war ein Sackleinen ausgebreitet. Darauf knieten die zwei, hielten sich umarmt, und ihre Münder hingen saugend aneinander. Dergleichen hatte ich Menschen noch niemals tun sehen. Mit einer Hand knetete Klim Marfuschas Brust, und sie stöhnte. Das nahm und nahm kein Ende. Marfuschas Arme baumelten kraftlos. Ihre Wangen brannten rot. Endlich fuhren die Münder auseinander, und Klim, ein schmächtiger junger Mann mit Lockenkopf, begann Marfuschas Kleid aufzuknöpfen. Dies war nun gänzlich unbegreiflich. Wusste ich doch, dass nur ein Arzt dazu berechtigt war, Frauen zu entkleiden.
»Warte, ich nehm erst die Schürze ab«, wisperte sie und tat es, hängte das weiße Stück sorgsam an einen Ast.
Bald hatte Klim eine junge, kräftige Brust mit kleinen Brustwarzen freigelegt, die er gierig abzuküssen begann. »Herzchen … mein Herzchen«, brummte er dabei.
Ist er denn noch ein Kind, oder was?, dachte ich.
Marfuscha bebte und atmete heftig. »Klim … mein Schatz … liebst du mich denn auch wirklich?«
Er murmelte etwas und war dabei, das raschelnde blaue Kleid bis ganz unten aufzuknöpfen.
»Nicht so!«, protestierte sie, schob seine Hände weg und hob den Rocksaum in die Höhe.
Ein weißer Unterrock kam zum Vorschein, den Marfuscha nun gleichfalls raffte. Und ich sah die hellen, rundlichen Oberschenkel und dazwischen ein schwarzes kleines Dreieck vor ihrem Schoß. Im nächsten Augenblick hatte Marfuscha sich schon auf den Rücken gelegt.
»Herrje, welche Sünde … Klim, mein Liebster …«
Klim ließ die Hosen herunter, wälzte sich über Marfuscha und ruckelte hektisch auf ihr herum.
»Oi, das gehört sich doch nicht … Klim, hörst du …«
»Sei still«, brummte Klim und hörte nicht auf zu fuhrwerken.
Dann wurden seine Bewegungen zackiger, und er fing an zu knurren wie ein wildes Tier. Marfuscha ihrerseits stöhnte und juchzte, zwischendurch barmte sie: »Au weia, diese Sünde, herrje, herrje …«
Beider Körper zitternd, die Wangen hochrot. Ich war mir darüber im Klaren, dass hier etwas sehr Peinliches, Heimliches geschah, wofür man bestraft werden konnte. Es schien obendrein anzustrengen, wohl gar wehzutun. Doch ich sah auch, dass es den beiden großen Spaß machte.
Bald darauf hörte ich Klim aus vollem Leibe ächzen, so wie ich es von Männern kannte, die mit der schweren Axt ein dickes Scheit Wurzelholz spalten. Dann hörte es auf. Reglos lag er auf Marfuscha wie ein Schlafender in den Federn. Das Mädchen schnaufte immer noch leise, streichelte seinen Lockenkopf. Schließlich regte sich Klim und rappelte sich auf, wischte sich mit dem Jackenärmel über die Lippen.
»Herrje … und wenn nun ein Kindlein draus wird?«, fragte Marfuscha, den Kopf hebend.
Klim blickte sie an, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Kommst du heute Abend wieder?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Herrje, weiß ich, ob ich loskomm!« sagte sie, während sie sich zuknöpfte.
»Komm, wenn es dunkel wird!«, sagte Klim und schniefte.
»Ach, Klim, mein Schwälbchen, was soll nun draus werden?«, jammerte sie und schmiegte sich auf einmal heftig an ihn.
»Was schon, nichts weiter«, murmelte er.
Darauf sie: »Ja, dann lauf ich mal, nicht wahr …«
»Lauf schon, ich komm gleich.« Klim nagte finster an einem Zweiglein.
»Sieh mal nach, ist der Saum hinten etwa feucht?«
»Nein, nein.«
Ich wich ein paar vorsichtige Schritte zurück, drehte um und rannte zum Haus.
Was ich in der Hütte gesehen hatte, erschütterte mich genauso stark wie die Prügelei in der Sandgrube. Beides, so empfand ich in der Tiefe meines kindlichen Wesens, musste für die Menschen eine große Bedeutung haben – sonst wären sie nicht so heftig und leidenschaftlich bei der Sache gewesen.
Wie Kinder in die Welt kamen, wurde mir wenig später von meinem Bruder Wanja erläutert. Hierdurch erfuhr die Szene in der Laubhütte ihre wahre Dimension: Ich begriff, dass die Geburt von Kindern mit jenem Schnaufen zu zweien zu tun hatte, das man so peinlich vor aller Welt verheimlichte. Wanja erklärte, Kinder würden nur nachts gemacht. Also begann ich des Nachts die Ohren zu spitzen. Und einmal, im Vorüberschleichen am elterlichen Schlafzimmer, konnte ich das gleiche Stöhnen und Schnaufen tatsächlich vernehmen. Ich schlich zurück ins Bett, wo ich noch lange wach lag und darüber nachdachte, warum dieses Kinder-in-die-Welt-Setzen eine so wunderliche Betätigung erforderte. Und vor allem: Warum man es heimlich tun musste.
Am nächsten Morgen beim Frühstück, während wir von Marfuscha, Klim und Papas altem Diener Timofej bedient wurden und am Tisch wie üblich die Neuigkeiten von der Front erörtert wurden, stellte ich die Frage in den Raum: »Kriegt Marfuscha eigentlich ein Kind?«
Das Gespräch am Tisch verstummte jäh. Alle sahen Marfuscha an. Sie hielt gerade die Porzellanschüssel, aus der der weißhaarige, knollennasige Timofej mit seiner besorgten Leichenbittermiene den Hirsebrei austeilte. Klim stand in der Ecke des Esszimmers vor dem Samowar und füllte die Gläser mit Tee. Marfuscha errötete noch tiefer als in der Hütte. Die Schüssel in ihren Händen zitterte bedenklich, während Klim verstohlen zu mir herüberspähte und erbleichte.
Mutter rettete die Situation. Vermutlich hatte sie von der Beziehung zwischen dem Diener und dem Zimmermädchen längst etwas mitbekommen.
»Nicht nur eins, mein lieber Schura. Marfuscha bekommt einmal fünf Kinder«, sagte sie trocken. »Drei Jungen und zwei Mädchen.«
»Ganz recht«, fügte der Vater mürrisch an, während er mehr Marmelade als sonst über seinen Brei löffelte. »Und anschließend noch mal fünf. Damit jemand ist, der in den Krieg ziehen kann.«
Beifälliges Gelächter ertönte. Auch Marfuscha versuchte ein Lächeln. Es gelang ihr mehr schlecht als recht.
Mit jedem Monat drang der Krieg ungestümer in unser Leben vor. Wassili kehrte von der Front heim. Genauer gesagt: Man brachte ihn in Vaters Automobil vom Bahnhof gefahren. Das Auto hupte dreimal, wir liefen hinaus, unseren Kriegshelden zu begrüßen, der ein paar kurze, doch bewegende Briefe von der Front geschrieben hatte. Wassili stieg aus und kam, auf Timofej und den Chauffeur gestützt, sehr langsam die Treppe herauf. Er trug noch Uniform – Mantel und Mütze. Sein Gesicht war auffällig gelb. Besorgt trug Timofej ihm den Stock nach, an dem der Bruder zu gehen hatte. In Wassilis Gesicht malte sich ein reuiges Lächeln. Wir stürmten auf ihn zu. Mama schluchzte. Auch der Vater war herausgetreten, blickte Wassili angespannt entgegen, zwinkerte. Sein kräftiges Kinn zuckte.
Bei Lowicz im Polnischen war Wassili in einen Gasangriff der Deutschen geraten. Er hatte eine Chlorvergiftung, doch es war das Schlangenwort Yperit[3], das sich in meinem Kopf festsetzte.
Später, als Wassili bei Tee und Kuchen am flackernden Kamin saß, hörten wir ihn erzählen, wie er vor der Chlorwolke geflohen war, wie er acht Deutsche mit dem Maschinengewehr niedergeschossen, wie eine Granate zwei seiner Frontkameraden auf einmal, den Fähnrich Nikolajew und den Freiwilligen Gwischiani, zerfetzt hatte, wie Wachsoldaten mithilfe eines Zigeunerbraut genannten Haarseils lautlos unschädlich gemacht wurden, wie gegen Läuse vorzugehen war und wie gegen Panzer, über was für kapitale Granatwerfer die Deutschen verfügten und wie viele tote Russen er nach der Brussilow-Offensive in einem großen Weizenfeld hatte liegen sehen.
»In Reih und Glied lagen die, wie hingelegt. Sie waren auf MG-Nester gestoßen. Niedergemäht wie mit der Sense.«
Wir lauschten mit angehaltenem Atem. Das Teeglas in Wassilis gelber Hand zitterte. Ständig musste er sich räuspern, die Augen tränten ihm und waren jetzt immer rot, so als hätte er gerade geheult. Beim Gehen keuchte er und musste Pausen einlegen, in denen er sich auf seinen Stock stützte.
Vater schickte ihn in den Kaukasus nach Pjatigorsk zur Kur.
Ein Jahr darauf beging mein ältester Bruder in Moskau Selbstmord. Schoss sich mit dem Nagant eine Kugel in den Kopf und gleich noch eine mit einem Damenrevolver ins Herz. Der Bruder habe sich aus Liebe zu einer verheirateten Frau erschossen, in die er schon vor dem Krieg aussichtslos verliebt gewesen sei, so behauptete Wanja.
Vaters Reichtum nahm rapide zu, und seine Abhängigkeit von diesem Krieg wurde immer größer. Die Geschäfte liefen hervorragend. Eine Menge neuer Bekannter tauchten auf, vorwiegend Militärs. Er trank mehr und häufiger, war nur noch selten zu Hause, ständig auf Achse, wie er zu sagen pflegte. Um ihn her eine Anzahl energisch auftretender junger Männer mit strichförmigen Schnurrbärten, die er seine Kommissionäre nannte. Es ging schon lange nicht mehr nur um Zucker, er machte in vielerlei. Wenn er ins Telefon brüllte, klangen mir die Ohren von unheimlichen Sätzen wie: »Der amerikanische Gummi wird uns noch die Luft abdrücken«, »der Zwiebacktransport steht im Zollschuppen und schimmelt«, »sechs Wagon Seifenflocken hängen im Knoten fest«, »die Gauner vom Semgor[4] an der Südwestfront lassen mich am langen Arm verhungern« und dergleichen mehr.
Meine Großmutter, die ihre alten Tage still und bodenständig im Moskauer Haus an der Ostoshenka verbrachte, stellte einmal zu Ostern fest: »Durch diesen Krieg hat unser Dima vollends den Kopf verloren: jagt hinter sieben Hasen auf einmal her.«
Und tatsächlich kam mir Vater damals vor, als verfolgte er so aussichtslos wie besessen etwas, das ihm an Wendigkeit überlegen war und darum immer wieder entwischte. Während er selbst durch diese Hatz nicht an Lebendigkeit gewann, sondern verknöcherte, sein ohnehin beherrschtes Gesicht verfinsterte sich zusehends. Wahrscheinlich schlief er überhaupt nicht mehr. Die Augen glänzten ihm fiebrig und flackerten, selbst wenn er mit uns am Tisch saß und Tee trank.
Es verging ein weiteres Jahr.
Inzwischen kam der Krieg schon durch alle Ritzen gekrochen. Er war überall. In den Städten marschierten die Soldatenkolonnen, auf den Bahnhöfen wurden Kanonen und Pferde in Züge verladen. Mama und wir Kinder fuhren nicht mehr nach Bassanzy – dort war es jetzt zu »unruhig«. Die komplette Familie richtete sich in Petersburg ein. Die Verwandten wurden auf den Gütern hinterlassen. Die Hauptstadt in Kriegszeiten lehrte mich drei neue Wörter: Arbeitslosigkeit, Streik, Boykott. Ihre Verkörperung sah ich in den dunklen Menschentrauben auf Petersburgs Straßen, die finster hin und her schwappten und an denen wir, sei es mit der Kutsche oder im Automobil, möglichst rasch vorbeizukommen versuchten.
Petersburg wurde umbenannt in Petrograd.
Die Zeitungen druckten Schmähverse auf die Deutschen, dazu die passenden Karikaturen. Wanja und Ilja brachten sie mit Vorliebe zu Gehör. Deutsche gab es in meinen Augen damals nur zweierlei: Die einen waren kugelrund mit feisten, grinsenden Visagen, gehörntem Helm auf dem Kopf und Säbel in der Hand; die anderen dürr wie Bohnenstangen, mit Reitgerte, Schirmmütze, Monokel und dem Ausdruck säuerlicher Geringschätzung im schmalen Gesicht. Meine große Schwester Arischa brachte aus dem Gymnasium ein patriotisches Lied nach Hause. In der Singstunde hatte die Klasse es gemeinsam komponiert, der Text stammte von irgendeinem Lehrer aus der Provinz:
Steh auf, steh auf, du Riesenland
Heraus zur größten Schlacht!
Den deutschen Horden Widerstand,
Tod der Teutonenmacht![5]
Nastja und Arischa zu vier Händen sorgten für die Begleitung, und ich sang, auf einem Stuhl stehend, mit Inbrunst. Nach dem Umzug in die große Stadt fiel mir auf, wie viel mehr Tempo das Leben hier im Vergleich zu Bassanzy oder Waskelowo hatte: Die Leute liefen schneller und redeten schneller, die Fuhrleute hetzten ihre Gäule und brüllten, Automobile hupten und knatterten, Schüler eilten im Laufschritt ins Gymnasium, Zeitungsverkäufer riefen »unsere Verluste« aus; wenn Vater nach Hause kam, warf er den Pelzmantel von sich, schlang hastig das Essen und schloss sich mit seinem Gehilfen im Arbeitszimmer ein, worauf er mit den Kommissionären eilends wieder von dannen fuhr, manchmal eine ganze Woche wegblieb. Auch Mama bewegte sich mit größerer Eile, wenn sie irgendwohin zum Einkaufen fuhr. Häufiger und überraschender denn je waren wir bei anderen Leuten zu Besuch. Ich gewann viele neue Freunde: Jungen ebenso wie Mädchen.
Verstärkt wurde ich nun auf das Gymnasium vorbereitet. Mit Didenko übte ich Russisch und Rechnen, mit Madame Panaget Deutsch und Französisch. Und die Stunden vergingen, anders als früher, wie im Fluge.
Selbst unsere beiden Möpse Kaiser und Schustrik liefen schneller, bellten lauter und kackten öfter auf den Teppich. Weihnachten 1916 feierten wir in einem großen Haus, das Papas neuen Freunden gehörte. Zu jener Zeit hatte Vater von einem Tag auf den anderen zu reisen aufgehört und war stattdessen einem anderen Dämonen verfallen, der, einem großen Besen gleich, all den »gebrochenen Zucker, transportfertig« und die »Seifenflocken, wagonweise« aus dem Haus gefegt hatte. Es war das Wort »Duma«, das wie der dicke Pazjuk in Gogols Weihnachtsmärchen zur Tür hereinspaziert war und sich für länger bei uns einnistete. Mit ihm kamen Papas neue Freunde – sie kamen oft und blieben bis spät. Sie glichen einander meist ebenso sehr, wie sie sich von Papas hagerer Gestalt unterschieden: klein und flink, stämmig, mit breiten, ausrasierten Nacken, gestutzten Kinn- oder gezwirbelten Schnurrbärten, viel rauchend und unentwegt diskutierend. Hatten sie sich endlich heiser gepafft und gestritten, diktierten sie sich selbst etwas in die Feder, um hinterher noch mit Papa Wein zu trinken und dann ins »Ernest« oder ins »neue Donon« essen zu fahren. Unser Vater war nun ausschließlich mit Politik beschäftigt, ging auf die Versammlungen der mächtigen, mir vollkommen fremden Duma und redete in den Gesprächen mit Mama öfters von einem Geschwür, das demnächst aufbrechen würde, man dürfe nur nicht den Moment verpassen.
Nach Ausbruch des Krieges war der Bankier Rjabow zu Papas engstem Vertrauten in Petrograd geworden. Auch er saß in der Duma.
Die Rjabows hatten eine elfjährige Tochter mit Namen Nike, in die ich mich – zum ersten Mal im Leben – verliebte. Auf jener Weihnachtsmatinee hatten wir Kinder das Krippenspiel aufzuführen: Rjurik, Rjabows Ältester, war Herodes, Nastja der Verkündigungsengel, Wanja, Ilja und Arischa die drei Weisen aus dem Morgenland, Wassilissa die Jungfrau Maria, und irgendein älterer, sitzen gebliebener Schüler spielte den Josef. Verschiedene Kinder, die wir nicht kannten, waren Englein, Teufelchen und die zu tötenden Babys. Nike und ich hatten mehrere Rollen zu spielen: erst Herodes’ Büttel, die nach den Kindern suchten, und dann Ochs und Esel, die dem Christkind in der Krippe mit ihrem Atem Wärme spendeten. Das Jesulein gab übrigens Rjabows jüngster Sohn Wanjuscha. Als er im zweiten Akt glücklich geboren war und Nike und ich mit übergestülpten Kuh- und Eselsmäulern aus Pappmaschee eifrig unseren heißen Atem in die Krippe pusteten, fing Klein Wanjuscha zu heulen an. Wir blickten einander durch unsere Augenlöcher an und prusteten verstohlen. Nikes fröhlich blitzendes schwarzes Auge in der Umrahmung der breiten Eselswimpern, dazu ihr leises Lachen und irgendein süßliches Parfüm bewirkten in mir einen überraschenden Anfall von Zärtlichkeit. Ich ergriff ihre heiße Hand und ließ sie bis zum Ende der Vorstellung nicht mehr los.
Beim Mittagessen gelang es mir, irgendeine Anwärterin auszustechen und den Platz neben ihr zu ergattern. Mein Gefühl für Nike wuchs mit jedem Gang, der auf den Tisch kam. Ich plauderte mit ihr, schwatzte törichtes Zeug. Bei den Plinsen mit Kaviar zwickte ich sie in hysterischem Übermut in den Arm, beim Tee mit Biskuitgebäck nahm ich ihren Finger und tunkte ihn in mein Schälchen Aprikosenmarmelade.
Nike lachte.
Mit diesem Lachen fühlte ich mich verstanden. Anscheinend gefiel ich ihr auch. Nach dem Mittagessen wurde ein Kindermummenschanz veranstaltet, mit Tänzen um den Tannenbaum. Und als die Herren sich nach oben zum Rauchen und Kartenspielen verzogen, die Damen zum Austausch von Neuigkeiten auf die Veranda des Wintergartens, wurden den Kindern zum Zeitvertreib Pfänderspiele vorgeschlagen. Zwei liebe englische Gouvernanten sollten uns dabei helfen.
»Was soll das Pfand in meiner Hand?«, rief die eine von ihnen, rothaarig, mit schrecklich viel Sommersprossen im Gesicht, wobei sie sich Mühe beim Aussprechen der russischen Wörter gab, während sie aus einer sternenbeklebten Schachtel die Zettelchen mit unseren Namen zog.
»Nike anbellen!«, rief ich, die anderen übertönend.
Also wurde sie angebellt, mit Wasser bespritzt, um den Tannenbaum herumgetragen …
Nikes schwarze Augen lachten mich an. Liebend gerne hätte ich mit ihr etwas getan, was alles Übrige ringsum zum Verschwinden gebracht hätte. Ich wusste nicht, was – nur dass es mit der Szene in der Laubhütte, deren Zeuge ich gewesen, absolut nichts zu tun hatte. Als die Ältere von uns beiden wusste Nike besser als ich, wonach mir der Sinn stand. Denn plötzlich musste sie unbedingt ihre Maske wechseln. Hexe wollte sie sein und kein Wolf mehr.
»Komm mit, Sascha, du musst mir helfen!«, sagte sie und lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer.
Dort würdigte sie mich keines Blickes, doch ihr Gesicht glühte vor Erregung, als sie sich vor den lila Sternensack mit den Masken kniete und wie wild darin zu wühlen begann. »Wo ist sie denn bloß … Oh … Mon Dieu! Da ist sie ja!«
Ich sank neben ihr auf die Knie, umfasste ungestüm ihr Genick, zog sie zu mir heran und küsste sie auf die Wange. »Sascha, du bist ja witzig!«, sagte sie, auf die Hexenmaske mit der langen Nase hinunterblickend.
Ich küsste sie noch einmal. Mein Herz klopfte wild. Da drehte sie sich zu mir herum, schloss die Augen und legte ihr Gesicht fest an meines. So hielten wir still. Und zum ersten Mal erlebte ich, dass auch die Zeit stillstehen kann.
Da ertönte eine affektierte Stimme. »Wer versteckt sich denn hier?«, dazu das Rauschen von Kleidern.
Und die vermaledeite Zeit kam wieder in Gang. Mit ihr kam die Herrin des Hauses ins Zimmer, eine weitere Dame mit grünem Fächer in ihrer Begleitung. Ich schaffte es nicht, die Umarmung zu lösen.
»Ein Liebesnest!«, juchzte die Dame begeistert und richtete ihr Lorgnon auf uns. »Nina Pawlowna, sieh dir das an! Ist es nicht reizend?«
Doch Nikes hässliche, zugeknöpfte Mutter war sichtlich anderer Meinung. Sie sah uns aufmerksam an, wie wir aneinandergeschmiegt, mit erhitzten Gesichtern vor ihr hockten.
»Setzt eure Masken auf. Und ab nach unten!«, kommandierte sie.
Wir verwandelten uns zurück in Tiger und Hexe Baba Jaga und stürmten hinunter.
Frau Rjabowa hielt vor meinen Eltern dicht. Doch sie tat alles dafür, dass Nike und ich uns nicht mehr sahen. Meine inständigen Bitten, Nike bitte, bitte besuchen zu dürfen, führten zu nichts: Einmal fühlte Nike sich »unwohl«, das nächste Mal war sie »bei Verwandten zu Gast« oder hatte »fleißig Rechnen zu lernen« – in den Weihnachtsferien!
Sechs Wochen des unerfüllten Begehrens, der Sehnsucht nach meiner schwarzäugigen Liebe machten mich krank. Zuletzt lag ich drei Tage mit hohem Fieber im Bett und fantasierte, fiel in grässliche grellfarbige Albträume, tauchte hin und wieder aus ihnen hervor, rettete mich in die kühlen Hände meiner Mutter, die mir ein feuchtes, mit Wasser und Essig getränktes Tuch auf die Stirn legten oder ein Glas Fruchtsaft darboten. Meinen Berg bekam ich in diesen Träumen kein einziges Mal zu sehen. Ich träumte von einem Menschenmeer, einem uferlosen Ozean aus Stimmen, Gesichtern, Kleidern und Fräcken, der mit mächtigem Wellenschlag auf mich zurollte. Ich versank darin, strampelte, suchte oben zu bleiben, doch die Wellen schlugen immer wieder über mir zusammen. Dabei wusste ich genau, dass Nike irgendwo in der Nähe strampelte. Doch je verzweifelter ich in den Strudeln aus rauschender Seide nach ihr suchte, umso heftiger wirbelte es mich herum, warf mich in endlose Zimmerfluchten, verräucherte Empfangszimmer, stickige Schlafzimmer. Mein Kopf wollte schier bersten von all den Stimmen. Und als ich mich endlich doch zu ihr vorgekämpft hatte, meiner Liebsten in ihrem hübschen weißen Kleid mit der Hexenmaske vorm Gesicht, als ich vor sie hinsprang, die Maske an der langen Höckernase packte und herunterriss – da war ein Eselskopf darunter, und der war echt. Malmte etwas, sah mich mit stumpfen Eselsaugen an. Ich erwachte mit einem Schrei.
Erst am vierten Tag kam ich wieder zu mir.
Weder Mama noch das Kindermädchen waren da. Ich hob den Kopf: Die Vorhänge waren ganz zugezogen, durch die Ritzen drang das Tageslicht. Ich stand auf. Mir schwindelte. Schwankend, im Nachthemd bis zu den Fersen, ging ich zur Tür, zog sie auf und musste blinzeln: Die große Wohnung war von Sonnenlicht durchflutet, das aus dem Gästezimmer zu kommen schien. Dorthin lief ich, die nackten Sohlen klatschten auf dem kühlen Parkett. Im Gästezimmer, mit den Rücken zu mir, stand die ganze Familie versammelt. Das Fenster weit offen, gleißende Frühlingssonne. Alle schauten hinaus. Ich lief zu Mama. Sie ergriff mich, gab mir einen Kuss, umhalste mich mit seltsamer Überschwänglichkeit, nahm mich auf den Arm. Draußen vor dem Fenster lag die vertraute Millionnaja. Sonst wenig belebt, jetzt aber voller Menschen. Die Menge wogte, lärmte, bewegte sich schleppend vorwärts. Rote Stofffetzen hie und da.
»Was ist das, Mama?«, fragte ich.
»Das ist die Revolution, mein Sohn.«
Später wurde darüber in der Familie noch öfters gelacht: Sascha hat die russische Revolution verschlafen.
Inhaltsverzeichnis
Die Revolution
Von ihr war seit Längerem die Rede gewesen. Für mich ereignete sie sich nicht erst an jenem sonnigen Februartag, sondern schon eines Abends im Winter. Ich hatte mit Madame Panaget in einem Ausmalbuch gemalt, ein bisschen auf dem Klavierflügel herumgeklimpert und Milch getrunken, dazu ein paar meiner Lieblingskekse, Marke »CIY&Co.«, verspeist. Blieb nur noch, Mama das Gutenachtgebet aufzusagen und schlafen zu gehen. Aber da kam Vater nach Hause und trat, noch im Pelzmantel, vor Mama hin.
»Das war’s. Die Duma existiert nicht mehr«, sagte er finster. Mama stand schweigend auf.
»Miljukow und Rodsjanko haben erreicht, was sie wollten«, fuhr Vater fort, während er dem Zimmermädchen seinen Mantel in die Arme warf und sich erschöpft in den Sessel fallen ließ. »Sie haben der Duma das Grab geschaufelt, diese Schurken. Und sie hineingestoßen.«
Er schlug mit der Faust auf die Sessellehne.
Mir lief es kalt den Rücken hinunter: Die Duma, dieser unsichtbare Riese Pazjuk, der zwei Jahre mit uns gewohnt hatte, sollte auf einmal tot und verbuddelt sein.
»Und was wird nun, Dmitri?«, fragte Mama.
»Revolution!«, verkündete Vater kopfschüttelnd; es klang düster, doch mit einer Art grimmigem Stolz.
Und ich mit meinen acht Jahren malte mir diese rätselhafte, bedrohliche Revolution als Schneekönigin aus, die auf dem Gipfel eines von den roten Schaben kahl gefressenen Serpentinenberges thronte.
War das Leben in Petrograd schon vor der Revolution hektischer gewesen als anderswo, so drehte es nun völlig durch. Mit einem Mal waren noch viel mehr Leute da, die Straßen beinahe immer verstopft. Nicht nur mit dem Auto war kein Durchkommen, auch die Kutscher hatten ihre Mühe. Und wieder gab es neue Worte zu lernen: Sowdep[6], revolutionäre Massen, Provisorische Regierung, Schlangestehen. Dieser vorher nicht gekannte Sowdep hatte sich nach Vaters Aussage im Taurischen Palast eingenistet, und seine erste Amtshandlung war, sämtliche Weinvorräte auszusaufen und die Silberlöffel aus dem Restaurant zu stehlen. Die revolutionären Massen strömten des Öfteren unter unserem Fenster vorbei, die Provisorische Regierung war ein ständiger Gesprächsgegenstand selbst bei den Köchinnen in unserer Küche, und die Brotschlangen wurden lang und länger. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum die Leute nach Brot anstanden. Die Erklärung der Erwachsenen, es sei nicht genug Brot für alle da, stellte mich nicht zufrieden: Getreide gab es doch in rauen Mengen, die Kornfelder der Ukraine waren endlos groß! Ich war mir sicher, dass Brot genauso unbegrenzt vorhanden war wie Wasser und Himmel. Bei uns zu Mittag blieb jedenfalls immer welches übrig.
Über die Bettler auf den Straßen – »Eine milde Gabe für einen Kanten Brot!« – wunderte ich mich genauso sehr.
Der Sommer 1917, den wir in Waskelowo verbrachten, war wunderschön und wollte lange nicht enden. In keinem zuvor hatte ich mich so behaglich und ungebunden gefühlt. Es war, als würde ich Abschied nehmen vom sorglosen Wohlleben meiner Kindheit, das sich aus diesem Anlass noch einmal in seiner ganzen Pracht und Fülle zeigte: die schwarzen Riesenfichten, der stille See, die Beeren im Wald, der Mittagsschlaf auf der Veranda, das arglose Lachen der Schwestern, die perlenden Läufe auf dem Klavier, die Regenbögen.
Als der Sommer vorüber war, kam ich ans Gymnasium. Um genau zu sein: Ein Chauffeur mit dem komischen Namen Kudlatsch fuhr mich dorthin, Tag für Tag im blauen Automobil. Ins Gymnasium am Krjukow-Kanal gingen vorzugsweise Kinder reicher Leute. Man ließ sich aber nicht bis vors Tor fahren; dies galt als unschicklich. Die Wagen hielten in einiger Entfernung, das restliche Stück lief man zu Fuß. So war es üblich.
Den Unterricht fand ich interessant. Die Lehrer hier hatten mit dem graumausigen Didenko und der stillen Madame Panaget so gar nichts gemein. Sie sprachen wohlgesetzt und zusammenhängend. Am besten gefielen mir der immer fröhliche Mathematiklehrer Terenti Valentinowitsch, der kleine, aber unerhört agile Turnlehrer Monsieur Jacob, genannt: Petit Napoléon, und die etwas laute, immer stark nach Rosenöl duftende Französischlehrerin Jekaterina Samuilowna Babizkaja. Der Direktor des Gymnasiums, Kasimir Jefimowitsch Krebs, ein Hüne mit ungeheuer großem Kopf, Rauschebart, drei Fingern an der linken Hand und einer dumpf rollenden Bassstimme, den die Schüler Nebukadnezar nannten, weckte in mir ein gemischtes Gefühl aus Furcht und Begeisterung.
Doch es war noch kein Vierteljahr meiner Gymnasialzeit vergangen, als eine neue Revolution sich ankündigte. Vater nannte sie das bolschewistische Chaos und prophezeite: »Die Brut hält sich nicht lange.«
Womit er sehr im Irrtum war.
An der Revolution No. 2 war alles anders: Diesmal waren es ausschließlich Soldaten und Matrosen, die durch die Straßen gerannt, galoppiert oder auf Pritschenwagen gefahren kamen. Jeder mit einem Gewehr. Die Einwohner wichen respektvoll zurück, sahen zu, dass sie in der Nähe ihrer Häuser blieben. Nachts waren Schüsse zu hören.
Die Zeit schien sich zu spannen wie ein Flitzbogen. Und schnellte auf einmal los, dass einem Hören und Sehen verging: Menschen, Ereignisse, Jahreszeiten, alles geriet durcheinander.
Trotz des »bolschewistischen Chaos« ging der Unterricht am Gymnasium noch bis zum Frühjahr 1918 normal vonstatten. Zu seinem Abbruch führte ein sehr einfacher Umstand: Der größte Teil der Schüler war mit den vermögenden Eltern inzwischen aus Petersburg, wenn nicht überhaupt aus Russland geflohen.
Unsere Familie war erst im Juli reif zum Davonlaufen. Bis dahin hatte es einschneidende Veränderungen gegeben: Ilja, der schon am Gymnasium ein Faible für den Marxismus entwickelt hatte, war bei den Bolschewiken gelandet. Mit dem Vater hatte er sich überworfen. Mama ließ er über Dritte ein paar Briefe zukommen; darin stand, er kämpfe jetzt für ein freies Russland. Dann hörte man von ihm gar nichts mehr. Wassilissa war zielstrebig die Ehe mit einem schweigsamen, hakennasigen Oberleutnant eingegangen, der wegen einer Kriegsverletzung (Schuss ins linke Knie) aus der Armee ausgeschieden war; ebenso schnell war sie mit ihm von dannen gezogen – auf die Halbinsel Krim, zur Schwiegermutter.
Vater, der mittlerweile alles verloren hatte, was er in Russland besaß, dachte nun zum ersten Mal daran, mit uns nach Warschau umzuziehen. Er habe dort »eine kleine Sache« – ob er damit ein Haus meinte oder ein Geschäft, weiß ich bis heute nicht. Dann sollte es auf einmal noch weiter gehen, bis nach Zürich, da habe er »etwas liegen«. Der Bankier Rjabow und seine Familie waren gleichfalls nach der Schweiz gezogen, wo sie noch vor Ausbruch der Revolutionen ein Haus erworben hatten. Im Sommer 1918 führte der Weg nach Westeuropa über Kiew. Ein gewisser Dymbinski, der einen kleinen Schnurrbart unter der Nase hatte, sollte zuerst Mama und die Schwestern nach Warschau bringen, dann Wanja und mich mit dem Vater, der noch ein paar Wochen in Petersburg ausharren wollte, um »ein paar Sachen zu regeln«. Diese vierzehn Tage sollten unserer Familie zum Verhängnis werden. Denn kaum waren Mama, Nastja und Arischa weg, als Wanja an Bauchtyphus erkrankte. Er lag einen Monat flach, bevor er sich glücklicherweise berappelte; stark abgemagert und mit extrem gelber Haut. Dann wurde Vater von der Tscheka abgeholt. Drei Monate gab es keine Nachricht von ihm. Mamas Schwester, die fromme Tante Flora, nahm Wanja und mich in ihrer Wohnung am Moika-Kanal auf und hielt jeden Tag Fürbitte für den verhafteten Vater. Und das Wunder geschah: Er kam frei. Gebeugt und mit ergrautem Haar. Behauptete aber, er sei in den drei Monaten kein einziges Mal ins Gesicht geschlagen worden.
So war es bereits Winter, als wir in Kiew eintrafen. Wir ließen uns in Lipki nieder, einem reichen, gepflegten Viertel, wo Papas Bruder eine große Wohnung hatte. Onkel Juri war Vaters absoluter Antipode: schnell zu begeistern, unbesonnen und laut; fest gewillt, sein geliebtes Kiew nicht zu verlassen, nahm er uns bei sich auf, als wäre an Krieg und Revolution überhaupt nicht zu denken gewesen. Der Tisch brach schier unter der Last des fetten ukrainischen Essens, der tadellos gekleidete Diener schenkte Champagner ein, während der Onkel, etwas schmaler und grauhaariger als früher auch er, in einem fort redete und auf das Wohl eines mir unbekannten Hetmans anzustoßen wünschte. Nach den Brotschlangen zu Hause mochte man ob der Fülle auf diesem Tisch seinen Augen nicht trauen. Am kuriosesten aber war, dass Mama und die Schwestern, nachdem sie die längste Zeit bei Onkel Juri gewohnt hatten, Anfang November nach Warschau aufgebrochen waren. Ob sie dort wohlbehalten angekommen waren, wusste niemand. Fest stand nur, dass dort auch die Revolution ausgebrochen war und Pilsudski die Unabhängigkeit erklärt hatte. Der Vater war erbost: Brüllte den Onkel an, titulierte ihn einen »Waschlappen«, stampfte mit dem Fuß auf. Onkel Juri suchte ihn zu beschwichtigen, so gut es ging. Er wolle sich beide Hände abhacken lassen, beteuerte er, wenn Mama und die Schwestern nicht am Leben und in Sicherheit seien. Onkel Juri war der erklärte Liebling von uns Kindern. Eine eigene Familie hatte er nicht, war ein unverbesserlicher Junggeselle. Uns himmelte er geradezu an. Und wir liebten ihn wie einen zu groß gewachsenen Altersgenossen und Spielkameraden. Wanja und Ilja hatten ihm schon vor langer Zeit einen komplizierten Spitznamen verpasst. Er entfuhr dem Onkel ganz von selbst jedes Mal, wenn er bei uns in Petersburg zu Besuch war. Denn als Freund gepflegter Restaurationen und Kaffeehäuser suchte er Vater stets noch am ersten Abend zu überreden, mit ihm »irgendwohin« auszugehen. Vater hinwiederum, der wusste, wie solche Ausflüge unweigerlich endeten, pflegte lässig zu entgegnen, es gebe ja nichts, wohin zu gehen sich überhaupt noch lohne. Worauf der Onkel, sein schönes, stolzes Haupt zurückwerfend, vorwurfsvoll die Arme (die ebenso lang waren wie Papas) ausbreitend, an den Fingern aufzuzählen begann: »Dima, ich bitte dich! Ihr habt das Ernest, das Cuba, das alte und das neue Donon – ist das nichts?!«
Es waren die Namen der vier vornehmsten Restaurants in der Stadt. Und die beiden Männer gingen los und kehrten heim am frühen Morgen. Seither hatte Onkel Juri bei uns seinen Namen weg. Wenn seine Kutsche durch das Gutstor von Waskelowo rollte, tanzten Nastja und ich einen Freudentanz durch alle Zimmer.
»Ernest-Cuba-das-alte-und-das-neue-Donon ist da!«
Der Onkel sorgte für uns und versicherte, in ein paar Tagen würden wir gemeinsam nach Warschau aufbrechen. Dymbinski war ständig in der Stadt unterwegs, versuchte, ein paar »verdammt wichtige« Papiere in die Hand zu bekommen, wie er sagte. Das zog sich über Wochen hin: Lange Zeit hoffte der Onkel auf Unterstützung vonseiten einiger Deutscher, mit denen er befreundet war. Plötzlich aber hatten die Deutschen Kiew verlassen, ohne den Onkel zu benachrichtigen. Und Petljura mit seiner »wilden Horde« rückte beängstigend schnell gegen Kiew vor. Von ihm hörte man nur Grausiges. Es hieß, beim Einzug in die Stadt würde er »Offiziere, Juden und Moskali[7] aufknüpfen«. Er war Ukrainer. Und ließ angeblich nur Ukrainer ungeschoren. Ich stellte ihn mir vor wie den bösen Zauberer aus Gogols »Schrecklicher Rache«, dem gruseligsten Märchen auf der ganzen Welt. Kaum waren die Deutschen weg, verschwand auch Dymbinski. Und der sonst so fröhliche und selbstsichere Onkel geriet in Panik. Er packte Vater bei den Schultern und schüttelte ihn: Er solle aus Lipki abhauen, und zwar schleunigst. Denn Onkel Juri war sich sicher, die Petljura-Bande würde ihre Raubzüge genau hier beginnen, im reichsten Viertel der Stadt. Ach was, er könne sich mit der Waffe in der Hand verteidigen!, brüllte der Vater zur Antwort. Kurz darauf aber winkte er ab und fing an zu packen. Im Morgengrauen verließen wir Lipki mit zwei Kaleschen. In der ersten saßen wir, in der zweiten Ernest-Cuba-das-alte-und-das-neue-Donon mit seinem alten Diener Saweli und einem Haufen Gepäck. Es waren wenige Grade unter null. Und es lag, ungewöhnlich für den Dezember, kaum Schnee. Ich hatte in der vom Packen und Streiten geräuschvollen Nacht wenig geschlafen und war todmüde. Döste im Wagen vor mich hin, gegen den Vater gelehnt, die Hände um die »CIY«-Keksdose gekrallt, worin all meine Schätze lagen: ein Satz Buntstifte, ein Schweizer Taschenmesser, eine bleierne Spielpistole mit einer Schachtel Zündhütchen und manches mehr. Zweimal stoppten wir, und ich schrak hoch: Das erste Mal stieg eine kleine, füllige, sehr aufgeregte Dame mit zwei Reisetaschen beim Onkel ein, das zweite Mal, an einer furchtbar holprigen Straße, zwängte sich Dymbinski zu uns in die Kutsche: die Hand verbunden, in grauem Sommermantel und zottiger Lammfellmütze, mit einer Aktentasche. Diese reichte er dem Vater und begann umständlich, mit rauer, murmelnder Stimme etwas zu erklären: Von einem Sanatorium in Puschtsche-Wodiza war die Rede und irgendwelchen Kasernen. Seine Augen waren gerötet, der Geruch der Zottelmütze wirkte auf mich wie ein Schlafpulver. Ich nickte wieder ein. Geweckt wurde ich von einem nahen Donnern. Die beiden Fuhrwerke standen in einer Straße aus einstöckigen Häusern, dazwischen mit Schnee überpuderte Gärten. Eine dicke Frau im Nachthemd mit rotem, halb aufgelöstem Zopf schaute aus einem Fenster, klappte eilig die Läden vor. Das Donnern wiederholte sich, es rückte näher. »Sechs-Zoll-Granaten, mindestens«, sagte Dymbinski und klopfte dem Fuhrmann in den Rücken. »Fahr da rein!«, befahl er.
In seiner Hand steckte plötzlich eine große schwarze Mauserpistole. Fluchend bog der Kutscher in eine Seitengasse. Dort, ein Stück voraus, drei rennende Gestalten in langen Mänteln. Irgendwo hinter den Häusern knallten Schüsse. Kurz darauf hämmerte ein Maschinengewehr. Die Dame im Wagen hinter uns schrie auf und bekreuzigte sich ein ums andere Mal in winzigen, mäusehaften Bewegungen. Dymbinski fluchte auf Polnisch. Der Vater schrie dem Kutscher etwas zu. Der Schlaf zerrte schon wieder an mir, ich gähnte herzhaft und laut. Und da ein Donnerschlag aus nächster Nähe. Dass die Fensterscheiben in den Häusern klirrten. Dass das Pferd prustete und an den Zügeln riss. Dass meine Blechbüchse mit den Schätzen mir aus den Händen rutschte und über die vereiste Straße kollerte.