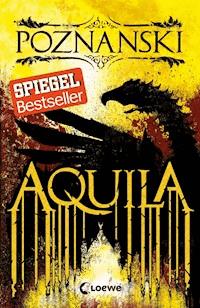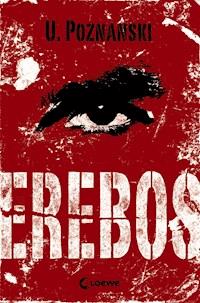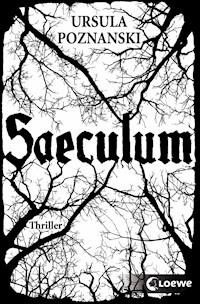12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Eleria
- Sprache: Deutsch
Sei schnell und schau nicht zurück, denn dein Gegner ist der Tod und die Zeit dein Feind. Vertrieben aus der Stadt unter der Stadt, gejagt und dem Tode nah, zwingt ihr Wissen Eleria dazu, erneut alles aufs Spiel zu setzen. Doch mit einem Mal überschattet ein vernichtendes Geheimnis alle unternommenen Anstrengungen. Die Vernichteten ist der dritte und letzte Teil der Eleria-Trilogie. Entdecke die düstere Trilogie von Bestsellerautorin Ursula Poznanski voller Intrigen und Wendungen. Eine mitreißende Dystopie über das Leben nach einer Katastrophe, Parallelgesellschaften und die Suche nach der Wahrheit. Ein Thriller über Macht und Manipulation. Ursula Poznanskis heute noch relevantere Eleria-Trilogie wartet nur darauf, wiederentdeckt zu werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
Kapitel 1 – Wir sehen sie …
Kapitel 2 – Das Gewölbe, in …
Kapitel 3 – Sie kommen zwei …
Kapitel 4 – Wir lassen den …
Kapitel 5 – Sie zerren uns …
Kapitel 6 – Wärme auf meinem …
Kapitel 7 – Der Marsch am …
Kapitel 8 – Im nahen Wald …
Kapitel 9 – Bennok. Der Name …
Kapitel 10 – Bevor wir zu …
Kapitel 11 – »Na los.« Tycho …
Kapitel 12 – Curvelli in Aramonns …
Kapitel 13 – Feuerrote Wolken, die …
Kapitel 14 – Zwei Einschnitte mi‚t …
Kapitel 15 – Die Wirkung meines …
Kapitel 16 – Danach herrscht merkwürdige …
Kapitel 17 – »Du spürst es, …
Kapitel 18 – Ich treffe Andris …
Kapitel 19 – Sieben kleine Glasbehälter, …
Kapitel 20 – Am nächsten Tag …
Kapitel 21 – Wir haben Glück, …
Kapitel 22 – Doch es vergehen …
Kapitel 23 – Es ist, als …
Kapitel 24 – Draußen, zwischen der …
Kapitel 25 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 26 – Das Metall drückt …
Kapitel 27 – Am nächsten Tag …
Kapitel 28 – Die Sieben. Das …
Kapitel 29 – Tycho, dem die …
Kapitel 30 – Das erste Licht …
Kapitel 31 – Es fällt mir …
Kapitel 32 – Vor dem Schlafengehen …
Kapitel 33 – Nachdem Maiossa gegangen …
Kapitel 34 – Aramonn, Andris und …
Kapitel 35 – Ich laufe aus …
Kapitel 36 – Bei jedem Schritt, …
Kapitel 37 – Auch am nächsten …
Kapitel 38 – Draußen atmen wir …
Danksagung
Für alle, die Ria auf ihrem Weg begleitet haben.
1
Wir sehen sie kaum in der Dunkelheit, sie sind Schatten zwischen dem Flackern der Fackeln. Aber wir hören sie. Ein kühler Wind trägt ihre Stimmen und ihr Lachen bis zu unserem Versteck. Sie denken nicht daran, sich schlafen zu legen.
Die dritte Nacht, der dritte Versuch. Wahrscheinlich der dritte Fehlschlag.
Sandors Hand liegt leicht zwischen meinen Schulterblättern und vermittelt mir das trügerische Gefühl, in Sicherheit zu sein.
»Fünf Scharten«, flüstert er. »Links auf der Ruinenmauer zwei Nachtläufer. Und siehst du die drei, die ständig die Position wechseln? Ich glaube, das sind Messack.«
Ich verenge meine Augen, um Genaueres erkennen zu können. Messack. Fast so grausam wie Schlitzer, nur besser organisiert, heißt es. Die Männer nähern sich dem Schein einer Fackel, einer dreht sein Gesicht in unsere Richtung. Blaue Tätowierungen und rote Narben. Er bleibt stehen, hebt das Kinn und schnüffelt.
Tycho, der zu meiner Linken kauert, wird unruhig. Ich greife nach seiner Hand, er darf keinesfalls etwas Unbedachtes tun. Der Messack kann uns nicht wittern, dafür weht der Wind aus der falschen Richtung. Trotzdem dauert es für meinen Geschmack viel zu lange, bis der Mann seinen Weg fortsetzt, und er tut es auch nur zögernd. Als könnte er unsere Anwesenheit spüren.
Unwillig befreit Tycho seine Hand aus meinem Griff. »Jetzt wäre es günstig«, wispert er, »wenn ich schnell bin.«
Ich packe ihn sofort am Arm. »Auf gar keinen Fall!«
Er spannt die Muskeln an, lockert sie aber gleich wieder. »Du hast leicht reden«, höre ich ihn murmeln. Er sieht mich nicht an, sondern starrt auf die Dornenhecke, die nur gute hundert Schritte entfernt, aber trotzdem unerreichbar ist, jedenfalls für uns. Die Feindclans umschwirren sie, als wüssten sie um ihre Bedeutung.
»Geduld«, sagt Sandor und Tycho seufzt entnervt.
Er ist wie ausgewechselt, seit er von Dhalion erfahren hat. Das Wissen, dass ihm nicht nur von außen, sondern auch von seinem eigenen Körper Gefahr droht, macht ihm heftig zu schaffen und er will diesem Zustand ein Ende setzen, jetzt, sofort. Eigentlich schon seit dem Moment, als ich ihm die Zusammenhänge erklärt habe. Den Grund, warum der Sphärenbund alles daransetzt, uns zu töten. Uns und die anderen, die Dhalion in sich tragen.
Die Hecke war meine Rettung und das könnte sie auch für Tycho sein, wenn die Scharten, Nachtläufer und Messack sich endlich dazu entschließen würden weiterzuziehen, aber offenbar gefällt ihnen dieser Ort. Die Ruinen hier sind gut erhalten, jedenfalls machen sie nicht den Eindruck, als würden sie beim ersten Windstoß einstürzen. Das gilt auch für die Mauern, zwischen denen wir uns verstecken, und wahrscheinlich müssen wir froh sein, dass noch niemand diesen Platz mit Beschlag belegt hat. Vor allem der Keller ist uns wichtig, denn hier befindet sich einer der Ausgänge aus der Stadt unter der Stadt, diesem labyrinthischen Gewirr von Gängen, Schächten und Kanälen, die Quirins Reich bilden.
Quirin. Ich verbiete mir den Gedanken an ihn sofort. Es ist ein schlechter Zeitpunkt, um wütend zu werden, ich brauche einen klaren Kopf. Wir müssten unser Leben nicht aufs Spiel setzen, um Tycho zu immunisieren, wenn wir das Serum hätten. Doch Quirin hat es uns nicht gegeben und nun ist er wie vom Erdboden verschluckt, selbst Sandor hat ihn seit Tagen nicht gesehen. Er hat ihn zu sich rufen lassen – als Clanfürst ist das sein Recht –, aber Quirin lässt sich nicht blicken.
Die Messack drehen eine weitere Runde. Sie unterhalten sich, doch ich verstehe nicht, was sie sagen.
Tycho stößt mich sachte an. »Wenn sie uns den Rücken zuwenden, schleiche ich hinüber«, wispert er.
»Auf keinen Fall!« Ich verstärke meinen Griff um seinen Arm. »Wir versuchen es morgen noch einmal, irgendwann werden die Prims weiterziehen, das tun sie doch immer.«
Ich spüre, wie Sandor mich von der Seite ansieht, und ich weiß, warum. Ich habe Prims gesagt, das ist mir lange nicht mehr passiert, erst recht nicht, seit ich erfahren habe, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre. Ein entführtes Kind, das seiner Mutter von einem Sentinel aus den Armen gerissen wurde.
Aber die Scharten, die Messack und vor allem die Schlitzer entsprechen genau dem, was ich mir früher unter Prims vorgestellt habe. Primitive Wilde.
»Ich weiß, was ich tue«, flüstert Tycho gereizt. »Ich bin schnell und ich bin leise. Lass mich los.«
»Kommt nicht infrage, das ist viel zu –«
In diesem Moment treten Neuankömmlinge ins Licht der Fackeln. Keine Außenbewohner diesmal, sondern Sentinel. Drei rote und zwei farblose. Exekutoren also.
Sofort scharen alle anwesenden Clanmitglieder sich um sie.
»Belohnung für gute Arbeit«, sagt einer der Farblosen. »Wir haben euch Lebensmittel mitgebracht und für den, der uns die interessanteste Beobachtung melden kann, gibt es eine Jacke. Thermostoff, darauf seid ihr doch so scharf.«
Die Clanleute drängen zu der Stelle, wo die roten Sentinel das versprochene Essen verteilen.
Mein Interesse gilt eher den Exekutoren – ist jemand dabei, den ich aus Vienna 2 kenne?
Ihre Gesichter liegen im Schatten, ich höre sie lachen, dann wenden sie sich um und drehen uns den Rücken zu.
Das ist der Moment, in dem mir Tycho entwischt.
Ich zische ihm nicht hinterher, dass er zurückkommen soll, das würde es nur schlimmer machen. Ich habe nicht gut genug aufgepasst, nun ist er da draußen, das ist nicht mehr zu ändern, ich kann nur noch hoffen, dass er wirklich so geschickt ist, wie er glaubt.
Sandor hält mich fest, als hätte er Angst, ich könnte Tycho nachlaufen, er zieht mich sogar ein Stück zurück zum Keller, doch ich schüttle den Kopf. Ich muss sehen, was passiert.
Tycho war immer schon wendig und flink und das stellt er jetzt einmal mehr unter Beweis. Bleibt in den Schatten, gleitet von einer dunklen Stelle zur nächsten und hält zwischendurch immer wieder inne. Falls er Geräusche verursacht, werden sie von den Außenbewohnern, die ums Essen streiten, übertönt.
Die größten Sorgen macht mir sein Haarschopf. So hellblond, dass er fast weiß ist – die denkbar ungünstigste Farbe, wenn man in der Finsternis ungesehen bleiben will.
»He!«, ruft einer der Sentinel und mir bleibt beinahe das Herz stehen, doch er hat nicht Tycho gemeint, sondern einen der Scharten, der mit seinem Messer auf einen Nachtläufer losgehen will. Der Sentinel packt ihn am Kragen, tritt ihm in die Kniekehlen und wirft ihn zu Boden. »Die Dornen könnt ihr abstechen, nicht euch gegenseitig. Idioten.«
Der Scharte zischt etwas zwischen den gebleckten Zähnen hervor, was ihm einen weiteren Tritt des Sentinel einbringt. »Ihr tut, was wir sagen, kapiert? Wir haben eine Abmachung.«
Der Tumult hat Tycho Zeit verschafft. Er ist jetzt an der Hecke, genau da, wo die mit Serum getränkten Dornen sich befinden. Kaum zehn Schritte von den Sentineln und den Männern der Feindclans entfernt. Ich halte die Luft an, als könnten meine Atemgeräusche ihn verraten.
»Beobachtungen!«, ruft einer der Exekutoren. Er hat sich auf einen kniehohen Stein gestellt und hebt die Arme. »Wer hat etwas gesehen, das uns nützlich sein kann?«
»Die Dornen haben an einem Tag drei Wildschweine erlegt«, meldet sich ein Nachtläufer. »Sie haben verdammt viel Glück bei der Jagd.«
Tycho hat sich ein Stück aufgerichtet und einen Unterarm entblößt. Er schiebt ihn in das dichte Geäst der Hecke. Es knackt – höre nur ich das?
»Wildschweine sind uns wirklich egal.« Die Freundlichkeit in der Stimme des Exekutors ist nur oberflächlich, darunter liegt eine deutliche Warnung. Er will nicht plaudern und er will nicht für dumm verkauft werden. »Hat jemand das Mädchen gesehen, das wir euch beschrieben haben? Mittelgroß, langes braunes Haar, grüne Augen. Trägt eine weiße Hose und ein blaues Hemd und könnte in Begleitung eines sehr großen Mannes vom Clan Schwarzdorn sein.«
Allgemeines Schulterzucken, Kopfschütteln.
Mein Herz pumpt viel zu schnell und viel zu stark, ich wusste nicht, dass die Sphären noch so intensiv nach mir und Andris suchen.
Einer der Messack wirft ein, dass er ein Mädchen gesehen hat, mit braunen Haaren und allem. Aber in Felljacke und Lederstiefeln und mit einem kleinen Kind an der Hand. »Ich könnte sie töten und dir ihren Kopf bringen.«
Der Exekutor zuckt mit den Schultern. »Wenn es der richtige Kopf ist, belohnen wir dich natürlich.«
Tycho ist halb in der Hecke verschwunden. Er gibt keinen Laut von sich, aber die Äste bewegen sich. Zu sehr auf eine Stelle begrenzt, als dass man es auf den Wind zurückführen könnte.
»Wer sonst hat noch etwas beobachtet?« Der Exekutor sieht auffordernd in die Runde.
»Sie streiten«, brummt einer der Scharten.
»Was? Wer streitet?«
»Die Dornen. Sie haben einen neuen Fürsten. Einen jungen. Das passt einigen nicht und es hat Kämpfe gegeben …«
Dass es so schlimm ist, hat Sandor mir nicht erzählt. Ich halte meine Augen weiterhin fest auf Tycho gerichtet, der sich Zentimeter für Zentimeter wieder aus der Hecke herausarbeitet und erstarrt, als ein Scharte sich aus der Gruppe löst und auf die Hecke zuschlendert. Mir wird eiskalt. Ist ihm etwas aufgefallen? Er hat ein Messer am Gürtel und einen Speer, den er in einem Ledergurt auf dem Rücken trägt – aber bisher hat er noch keine seiner Waffen gezogen. Tycho duckt sich am Boden und bedeckt seinen hellen Schopf, indem er die Jacke darüberzieht.
Der Scharte bleibt an der Hecke stehen, nur fünf Meter links von der Stelle, an der Tycho kauert. Er macht sich an seinem Hosenschlitz zu schaffen und mir wird klar, dass er nur pinkeln muss. Das würde ich wirklich zum Lachen finden, wenn ich nicht wüsste, dass er auf dem Rückweg über Tycho stolpern könnte. Nach allem, was wir überstanden haben, wäre es erbärmlich, aus einem solchen Grund zu sterben.
Die beiden Exekutoren haben sich leise unterhalten, jetzt wendet sich der auf dem Stein wieder den Clanleuten zu. »Streit gibt es also, aha. Hat jemand mitbekommen, worum es dabei genau geht? Nur darum, wer Fürst spielen darf? Oder vielleicht um Wichtigeres?«
Fürst spielen hören die Männer nicht gerne. Plötzlich fühlen sie sich nicht mehr ernst genommen. Ich kann spüren, wie sie sich verschließen, und auch der Exekutor bemerkt die wütenden Blicke. Er versucht einzulenken.
»Ihr seid kluge und aufmerksame Krieger, deshalb haben wir euch als Verbündete ausgewählt. Wir werden euch großzügig belohnen, wenn eure Informationen wertvoll sind. Zum Beispiel«, er räuspert sich, »wüsste ich gerne, ob in letzter Zeit jemand bei den Dornen gestorben ist? An einer Krankheit?«
Der Scharte an der Hecke hat erfolgreich seine Blase entleert, er spuckt noch einmal kräftig aus und schlendert zu den anderen zurück. Um seinen Hals baumelt an einem Lederband ein dünnes Metallrohr. Ich frage mich, wie viele Kerben sich darauf befinden, wie viele Feinde der Mann schon getötet hat. Ein bisschen Pech, und Tycho wäre Anlass für eine weitere Kerbe geworden.
Keiner der Anwesenden weiß von aktuellen Todesfällen im Clan Schwarzdorn. Die Exekutoren sind sichtlich unzufrieden, sie packen die versprochene Thermojacke wieder weg. Murren bei den Clankriegern.
»Leere Versprechungen.« Einer der Nachtläufer wendet sich mit einer verächtlichen Handbewegung ab. »Ich ziehe weiter. Für Lieblinge zu arbeiten, ist eine Schande, die gut bezahlt werden sollte. Wird sie aber nicht.« Er dreht sich noch einmal um, im Licht der Fackeln sehe ich, wie er sein lückenhaftes Gebiss zu einem Lächeln bleckt. »Obwohl wir uns unseren Lohn auch holen könnten.« Seine stachelgespickte Keule zischt in großen Bogen durch die Luft, nach rechts, links, wieder rechts. »Geht ganz schnell und tut fast nicht weh.«
Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich nun auf ihn. Tycho wittert seine Chance und ist klug genug, sie richtig zu nutzen. Langsam kriecht er von der Hecke weg, rücklings, damit er die Männer zwischen den Fackeln im Auge behalten kann.
»Vorsicht.« Eine tonnenschwere Drohung liegt in diesem einen, leise gesprochenen Wort des Exekutors auf dem Felsen. Seine Hand gleitet beiläufig zum Gürtel.
Ich sollte mich freuen, uns kann nichts Besseres passieren, als dass unsere Feinde sich gegenseitig umbringen, trotzdem würde ich mich am liebsten verstecken. Der Keller liegt nur fünf oder sechs Meter hinter mir, dort wartet ein schützendes Labyrinth, undurchschaubar für jeden, der es nicht kennt.
Aber ich werde erst gehen, wenn Tycho wieder bei uns ist.
Als Sandor den Druck seines Arms um meine Schultern verstärkt, bemerke ich, dass ich zittere. Mit seiner freien Hand deutet er etwas, ich glaube, es ist das Zeichen für Deckung. Schwer zu sagen, so finster, wie es um uns herum ist. Vermutlich macht meine Nervosität ihm Sorgen.
Später, deute ich zurück und versuche, ruhiger zu atmen. Warten.
Tycho hat bisher höchstens zwei Meter zurückgelegt, er schiebt sich flach über den Boden, zentimeterweise.
»Gebt heraus, was ihr mitgebracht habt.« Die falsche Sanftheit in der Stimme des Nachtläufers täuscht bestimmt keinen der Männer um ihn herum, am wenigsten die Exekutoren. »Die Jacke. Eure Waffen. Eure Leuchten. Ach ja, und eure Uniformen.« Wieder grinst er. »Ich hab sie lieber sauber, aber wenn es sein muss, nehme ich sie auch mit Blutflecken.« Er hebt die Keule, ein paar der Clanleute lachen.
Der Exekutor auf dem Felsen lächelt nun ebenfalls. Er bewegt sich nicht, sagt nichts. Der tödliche Schuss kommt von seinem Partner, dem zweiten Farblosen.
Der Knall lässt mich zusammenzucken, aber immerhin nicht aufschreien. Allerdings wäre es egal gewesen, denn jeder Schrei würde nun im Brüllen der Clanmänner untergehen.
Der Nachtläufer hat seine Keule fallen gelassen und presst beide Hände gegen seinen Leib, auf Höhe des Magens. Noch während er sich darum müht, auf den Beinen zu bleiben, um dann doch langsam einzuknicken, hebt der Exekutor ein zweites Mal seine Pistole und schießt dem anderen Nachtläufer in den Kopf.
Mit einem Mal ist es ruhig. Die Scharten und Messack weichen zurück, keiner greift nach einer Waffe. Gleichzeitig kommt Bewegung in die roten Sentinel, die bisher das Geschehen regungslos beobachtet haben. Sie stellen sich an die Seite der Exekutoren, aufmerksam, als würden sie auf Befehle warten.
Die Messack verschwinden zuerst. Sie wechseln kurze Blicke, dann tauchen sie ins Dunkel ab. Große, schwere Männer, die erstaunlich leise laufen.
Die Scharten zögern noch. Ich vermute, es liegt daran, dass sie schon länger mit den Sphären zusammenarbeiten. Sie haben nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht.
»Haltet ihr weiterhin für uns die Augen offen?«, fragt der Exekutor von seinem Felsen aus. Es ist eine höfliche Frage, beinahe geschäftsmäßig.
Sie zögern. Einige weichen unter die ersten Bäume am Waldrand zurück. Eine Pause tritt ein, in der auch Tycho, der sich während des Tumults schneller auf uns zubewegt hat, reglos verharrt.
»Ja«, sagt schließlich einer der Scharten. »Wie bisher.«
»Gut. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr bald etwas Interessantes zu berichten hättet.« Der Farblose steigt von seinem Stein und zieht sich die Uniformjacke straff. »Neuankömmlinge. Todesfälle. Auffälliges Verhalten. Wenn ihr wieder einen für uns fangen könntet, wäre uns das auch sehr willkommen.«
Tycho ist nun fast bei uns angelangt. Ich kann ihn atmen hören und sehe die blutigen Schrammen auf seinen Händen. Eine zieht sich quer über seine Stirn.
Nun verteilen die roten Sentinel doch noch Waren an die Scharten – nichts Großartiges, aber ausreichend für ein Zeichen ihres guten Willens. Niemand achtet auf die beiden toten Körper, die Männer steigen darüber, als wären es bloß gefällte Baumstämme.
Ich bekomme Tycho an einem Bein zu packen. Wir ziehen ihn zu uns in den Schatten der Ruinenmauer. Plötzlich bin ich unfassbar wütend auf ihn, würde ihn am liebsten schütteln und fragen, was er sich dabei gedacht hat, sich und uns in solch eine Gefahr zu bringen, aber das muss warten.
Sandor huscht zum Kellereingang, wirft einen prüfenden Blick nach unten, dann winkt er uns zu sich.
Tycho steigt als Erster hinunter, danach ich. Sandor geht zuletzt und verschließt hinter sich die Öffnung mit der schweren Klappe. Erst jetzt schalte ich meine Stablampe ein.
»Ich musste es einfach tun«, sagt Tycho, bevor ich ihn mit Vorwürfen überschütten kann. »Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das Virus war alles, woran ich noch denken konnte. Keine Chance, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, und das ist ziemlich übel in unserer Situation, findest du nicht?« Er wartet, hofft offensichtlich, ich würde nicken, aber den Gefallen tue ich ihm nicht.
»Jetzt ist es wenigstens erledigt«, brummt er und betrachtet die tiefen Kratzer auf seinem Handrücken. Sein Ärmel ist blutverschmiert. »Es hat doch geklappt, oder? Ich war an der richtigen Stelle?«
Diesmal nicke ich.
Sandor geht zu ihm und inspiziert die Verletzungen. »Je stärker sie anschwellen, desto besser ist es. Es hat in letzter Zeit einige Male geregnet, aber angeblich hält sich das Serum gut auf den Dornen. Mach dir keine Sorgen.« Er lächelt und mir fällt auf, wie müde er aussieht. Zu viele Fronten, an denen er kämpfen muss.
»Ich begleite euch noch zum Gewölbe.«
Ich würde ihn gern fragen, wie es um seine Position im Clan steht. Ob der Streit, von dem der Scharte gesprochen hat, eine echte Gefahr darstellt oder ob es nur Yann ist, der Probleme macht. Aber ich habe so eine Ahnung, dass Sandor darüber nicht sprechen will.
»Wer hält im Moment oben die Stellung?«, frage ich stattdessen.
»Andris. Er hat alles im Griff.«
Darauf wette ich. Andris, mein Wolfsgott, mein Schützling und Beschützer zugleich. Die Flucht aus Sphäre Vienna 2 hat uns zusammengeschweißt, ich würde ihn schrecklich gerne wiedersehen.
Vor dem Eingang zu unserem Unterschlupf bleibt Sandor stehen. Wäre Tycho nicht hier, würde ich ihn jetzt in die Arme nehmen, ihn küssen und ihn vielleicht überreden, bis morgen früh bei mir zu bleiben. Die ersten drei Nächte nach meiner Rückkehr aus Vienna 2 waren wir zusammen, nur wir beide, versteckt in einer anderen unterirdischen Kammer. Die Sehnsucht nach diesen Stunden ist manchmal so heftig, dass sie mir fast den Atem nimmt.
Aber Tycho ist hier und es ist undenkbar, dass er von mir und Sandor erfährt, bevor ich nicht mit Aureljo gesprochen habe. Also hebe ich nur halbherzig die Hand zum Abschied und Sandor streicht in einer zufällig wirkenden Geste über meinen Arm. Dann geht er.
2
Das Gewölbe, in dem wir anfangs zu fünft waren, ist für zwei Menschen viel zu groß. Wie einsam es in den Wochen gewesen sein muss, die Tycho allein hier verbracht hat, will ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Er hat mir nichts von dieser Zeit erzählt. Unser Wiedersehen war frostig, zumindest von seiner Seite. Ich wollte ihn umarmen, doch er stieß mich so fest von sich weg, dass ich fast hingefallen wäre. Mittlerweile geht es, wir sprechen und lachen miteinander, aber es ist nicht ganz wie früher. Ich befürchte, Tycho wird es mir ewig übel nehmen, dass ich mich in letzter Minute doch noch Aureljo und Dantorian auf ihrem Weg nach Vienna 2 angeschlossen habe.
Unwillkürlich heftet mein Blick sich auf die Stelle, wo Tomma ihr Lager hatte, neben dem kleinen Vorsprung in der Wand. Seit meiner Rückkehr war ich nicht in den Katakomben, obwohl ich es mir jeden Tag vorgenommen habe. Es wäre jetzt anders als früher, als ich noch dachte, Tommas Tod sei Schicksal gewesen. Viel zu früh, ja; ungerecht, natürlich – aber eben unabwendbar und niemandes Schuld. Was für ein Hohn.
Vor dem Einschlafen nehme ich mir vor, morgen zu ihr zu gehen und diesmal keine Ausreden gelten zu lassen. Es ist ja nicht so, dass ich zu beschäftigt wäre, im Gegenteil: Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wie ich die Aufgaben bewältigen soll, die sich vor mir auftürmen. Das Serum finden. Aureljo und Dantorian retten. Und danach … die Infizierten suchen, die noch am Leben sind – wer weiß, wo überall, wahrscheinlich verstreut über den ganzen Kontinent.
Ich rolle mich in meine Decke und schließe mutlos die Augen. Kein Mensch kann diese Aufgabe bewältigen. Doch zumindest Aureljo und Dantorian werden nicht so enden wie Tomma. Ich werde das Serum bekommen, und wenn ich es Quirin aus den Händen schneiden muss.
Der Lichtkegel meiner Stablampe streicht über weiße Knochen, flache Schädeldecken, leere Augenhöhlen. Einen Moment lang kommt es mir so vor, als würden die Toten mich willkommen heißen, als eine von ihnen. Doch der Eindruck verschwindet, bevor ich mich unbehaglich fühlen kann; dies ist ein Ort des Friedens. Die Kämpfe, die diese Menschen ausgetragen haben, sind vorbei.
So wie Tommas Kampf. Ich berühre den kalten steinernen Deckel ihres Sarges. Die letzten Minuten ihres Lebens drängen sich zurück in mein Gedächtnis: Tommas verzweifeltes Ringen nach Luft, ihre hervorquellenden Augen, die blauen Lippen.
Im Schatten dieser Erinnerungen bin ich heilfroh, dass Tycho sich gestern zur Hecke geschlichen hat, auch wenn es eine Wahnsinnstat war. Heute früh war seine Stirn heiß und drei der Kratzer waren rot und angeschwollen. Dhalion sollte ihm nichts mehr anhaben können.
Dantorian dagegen und Aureljo … sie ahnen noch gar nichts von dem Virus, das sie in sich tragen. Meine Schuld. Ich habe Vienna 2 verlassen, ohne ihnen zu erzählen, was ich zu wissen glaubte. Erst wollte ich sicher sein, dass meine Vermutungen richtig waren. Und nun …
»Was soll ich bloß tun?«, flüstere ich. »Wenn ich Aureljo und Dantorian nicht rette, werden sie genauso sterben wie du. Dabei hätten wir dich nur zur Hecke bringen müssen, als es dir noch besser ging. Du könntest noch hier sein, wenn Quirin nicht …«
Ich unterbreche mich. Mein Bedürfnis, Tomma zu erklären, warum sie sterben musste, ist kindisch. Sie hört mich nicht. Sie wird nie von Quirins Plan erfahren, die Sphären mittels eines Virus anzugreifen, das ursprünglich vom Bund selbst zur Ausrottung der Clans entwickelt wurde. So wie die Dinge stehen, hat dieser Plan gute Chancen auf Verwirklichung; die Krankheit kann jederzeit bei Aureljo oder Dantorian ausbrechen. Niemand in den Sphären weiß, dass sie Virenträger sind, denn natürlich haben wir uns unter falschem Namen eingeschlichen – das war nötig. Ria, Aureljo und Dantorian standen ja auf einer Todesliste, auch wenn damals noch keiner von uns wusste, warum.
»Ich wünschte, ich hätte wenigstens eine Idee.« Meine Worte hallen leise durch den dunklen Raum. Ich setze mich mit dem Rücken zum Sarg und schalte die Stablampe aus, nun ist die Finsternis vollkommen. Sie fühlt sich tröstlich an. »Selbst wenn ich das Serum hätte, müsste ich es nach Vienna 2 bringen, aber dort erkennt man mich sofort. Die Pflegehelferin, die den Prim befreit hat.«
Viel besser wäre es, meine beiden Freunde ins Freie zu locken und ihnen alles zu erklären. Sie zu immunisieren und dann …
Dann leben nach wie vor Dutzende entführte Clankinder in den Sphären, ohne zu wissen, dass sie den Tod in sich tragen. Wenn sie überhaupt noch leben – die Exekutoren sind schon seit Wochen auf der Suche nach ihnen. Keine Frage, was mit denen passiert, die man findet.
Die Betreffenden müssen getötet werden. Die Worte des Exekutors werden mir, fürchte ich, ewig im Kopf klingen. Wie viele Betreffende bereits ihr Leben lassen mussten, will ich gar nicht wissen.
»Es läuft alles schief, Tomma.« Meine Stimme ist ein gespenstisches Flüstern in der Dunkelheit. »Wenn du doch noch hier wärst – ich würde so gern mit dir sprechen. Deine Meinung hören. Deine Ideen waren immer anders als meine und, ehrlich gesagt, oft waren sie besser.«
Ich verstumme. Lausche auf das Schweigen um mich herum. Plötzlich habe ich den Eindruck, als hätte die Stille eine Botschaft: Wir hier sind alle tot. Wir wissen viel mehr als du. Aber warte nur.
Dumm von mir, die Katakomben allein aufzusuchen. Früher hat meine Fantasie sich leicht zügeln lassen, jetzt spielt sie mir Streiche. Ich lache laut auf, um meiner Einbildung ein echtes Geräusch entgegenzusetzen, und es funktioniert. Die Toten verstummen.
Kurz lege ich zum Abschied meine Stirn gegen den kalten Steinsarg, da lässt mich etwas herumfahren. Diesmal ist es keine Einbildung, es sind echte Schritte, die ich höre. Ein Schaben, wie von einem Körper, der an einer Wand entlangstreift.
Hektisch schalte ich meine Stablampe an, folge dem zitternden Lichtstrahl mit den Augen, über dunkle Wand, bleiche Knochen, bis zu einer weißen Gestalt.
Quirin steht im Eingang und sieht mich an. Er wirkt erschöpft.
»Ach, du bist hier«, sagt er, als hätte er nichts anderes erwartet.
Ich stehe auf, ein wenig schwankend. Seit Tagen frage ich mich, wie ich Quirin dazu bringen könnte, noch einmal mit mir zu sprechen. Jetzt steht er vor mir und ich bin nicht so gut vorbereitet, wie ich es gern wäre. Es geht um alles, ich werde meine ganze Überzeugungskraft brauchen.
»Ich wollte Tomma besuchen.« Langsam richte ich mich auf, versuche, Zeit zu gewinnen. Ich muss meine Argumente sortieren.
Quirin tritt einige Schritte näher. »Ich bin fast jeden Tag an ihrem Grab. Und an den Gräbern meiner Freunde, der Menschen, die ich geliebt habe. Es ist tröstlich, findest du nicht?«
Das Gespräch läuft in die falsche Richtung.
»Für mich ist es eher tragisch«, sage ich leise. »Wenn ich daran denke, dass Tomma mit ihrem Leben noch so viel hätte anfangen können. Felder für den Clan anlegen, zum Beispiel.«
Sein Blick gleitet zur Seite, zu den aufgestapelten Knochen. »Den Clan wird es vielleicht nicht mehr lange geben. Sie werden versuchen, uns zu vernichten – in zwei Wochen, zwei Monaten oder zwei Jahren, das spielt keine Rolle. Dann würde es sich nicht mehr lohnen, Felder anzulegen oder Kinder aufzuziehen.«
Jetzt steht Quirin direkt vor mir, ich kann seine rot geäderten Augen sehen. Entweder er schläft wenig oder er weint viel.
»Es gibt noch genau eine Saat, die aufgehen kann. Ich habe sie gesät und ein Teil von mir erträgt das kaum. Aber für die Menschen, die mir anvertraut worden sind, wünsche ich mir, dass sie aufgeht.«
Er hat mir meine Bitte abgeschlagen, bevor ich sie vorbringen konnte.
»Du tötest damit so viel Talent«, versuche ich es dennoch. »Dantorian ist wahrscheinlich der größte Künstler meiner Generation. Aureljo ist jemand, der Frieden stiften will und es auch kann. Gib mir das Serum, wir werden einen anderen Weg finden.«
Eine Zeit lang sieht Quirin mich an, dann schüttelt er den Kopf, langsam, aber entschlossen. »Daran glaube ich nicht mehr. Ich habe gehört, der Sphärenbund transportiert bewaffnete Einheiten in die Nähe unseres Territoriums. Jemand hat Raketenwerfer gesehen. Unsere einzige Chance besteht darin, dass die Krankheit bald ausbricht und so viele Bewohner trifft, dass die Regierung sich auf die Epidemie konzentrieren muss.«
Raketenwerfer. Das wusste ich nicht. Aber stimmt es auch? So wie Quirin es erzählt, scheint es reines Hörensagen.
»Wir könnten ihnen einen Handel anbieten. Das Serum gegen dauerhaften Frieden, gegen einen Vertrag, der den Clans ihre Territorien sichert, auf unbegrenzte Zeit.«
Es klingt naiv, sogar in meinen Ohren. Quirin ist höflich genug, nicht zu lachen.
»Du weißt, dass der Bund sich nicht daran halten würde. Sie müssten nur einen Clanangriff vortäuschen und könnten zurückschlagen, ohne das Gesicht zu verlieren. Es ist so einfach, uns zu betrügen, Ria. Wir sind so hilflos. Und du verlangst, dass ich unsere einzige Chance auf Überleben opfere.« Wieder schüttelt er den Kopf. »Das kann ich nicht.«
Eine neue Idee muss her, ein anderer Weg. Wenn ich Quirin verspreche, dass ich einen Sentinel infiziere, würde er mir dann das Serum für meine Freunde geben?
Ich versuche, es mir bildlich vorzustellen. Ria, die den Tod bringt. Bei einem erwachsenen Mann würde Dhalion innerhalb kürzester Zeit ausbrechen, jedes Tröpfchen, das der Sentinel aushustet, wäre infektiös.
In Gedanken wiederhole ich, was Quirin eben ausgesprochen hat: Das kann ich nicht. Es würden Menschen wie Albina und Osler sterben, Menschen wie Grauko. Nicht einmal für den Tod von Exekutoren wollte ich verantwortlich sein, es fühlt sich falsch an.
»Ich glaube nicht, dass sich Frieden durch Mord erkaufen lässt«, sage ich nach einer langen Pause. »Schon gar nicht durch Massenmord.«
»Vollkommen richtig.« Quirin tritt noch einen Schritt näher und legt eine Hand auf Tommas Sarg. »Ich werde nie wieder Frieden haben. Aber die anderen, die von nichts wissen und an nichts schuld sind, die könnten ihn eines Tages finden.«
Er wird sich nicht umstimmen lassen, ich verschwende meine Energie. Trotzdem kann ich noch nicht aufgeben. »Du hast Sandor mit hineingezogen. Bist du sicher, dass sein Gewissen so belastbar ist wie deins?«
»Sandor hat einen Eid geschworen. Er weiß am besten, wozu die Lieblinge fähig sind.«
Ich lächle unfroh. »Nicht nur die Lieblinge, wie sich gerade zeigt.«
Quirin scheint meine Bemerkung nicht gehört zu haben. »Sandor, hm? Er bedeutet dir viel.«
Natürlich weiß Quirin das spätestens seit der Nacht, als Vilem gestorben ist. Niemand, der uns damals zusammen gesehen hat, hätte daran zweifeln können, dass wir ein Paar sind. Es war die gleiche Nacht, in der Sandor in die Geheimnisse seines Amtes eingeweiht worden war, nur wenige Minuten, nachdem der Fürst aufgehört hatte zu atmen. Eines dieser Geheimnisse betraf den Hintergrund des Dornenrituals und all das hätte uns fast auseinandergebracht.
Ich lasse Quirins Behauptung unkommentiert und kann sehen, wie der Gedanke in seinem Kopf arbeitet.
»Da haben wir einen der Gründe, warum du Aureljo unbedingt retten musst, nicht wahr?« Er blickt zur Seite, auf den Knochenstapel. »Weil tief in deinem Inneren eine Stimme sitzt und flüstert, dass sein Tod manches für dich einfacher machen würde. Für diesen Gedanken verachtest du dich und deshalb wirst du dich noch mehr ins Zeug legen, als du es ohnehin tätest.«
»Unsinn. Wer sagt dir, dass ich nicht längst alles mit Aureljo besprochen habe?«
»Das ist nur so eine Ahnung.« Er hebt entschuldigend die Hände. »Ich denke, du warst vorsichtig genug, ihn nicht vor eurem Aufbruch mit solchen Neuigkeiten zu belasten, und in Vienna 2 hattet ihr wohl größere Probleme als dein Gefühlsleben.«
Leider stimmt das. Doch alles andere ist eine Unterstellung. Ich würde Aureljo auch retten wollen, wenn die Dinge zwischen uns geklärt wären.
»Du wirst mir das Serum also nicht geben.«
»Nein.«
Ich schließe meine Hände zu lockeren Fäusten. Öffne sie wieder. »Ich habe mir lange überlegt, warum die Exekutoren so sehr hinter Jordans Chronik her sind. Die Teile, die ich gefunden habe, sind harmlos, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch brisantere Kapitel gibt.«
Quirin lächelt. Nickt.
»Diese Kapitel hast du, nicht wahr? Die wissenschaftlichen Aufzeichnungen? Dhalions Gencode und die Zusammensetzung des heilenden Impfstoffs?«
»Richtig geraten.« Eine Erinnerung bewegt Quirins Gesicht, er presst die Lippen aufeinander, schluckt. »Soll ich dir erzählen, wie ich darangekommen bin?«
Nein, denke ich, du sollst mir die Seiten geben.
»Jordan hat mir die wichtigsten Kapitel als Bündel unter die Jacke geschoben, da war ich acht. Was sie bedeuteten, wusste ich, er hatte mich die letzten beiden Jahre unterrichtet, mich mit Dhalion vertraut gemacht, mir alles erklärt. ›Bewahre sie auf‹, sagte er. ›Und jetzt renn, versteck dich.‹« Quirin atmet angestrengt ein. »Zwei Tage lang habe ich hier im Finsteren zwischen Knochen gelegen und hatte die ganze Zeit das Bild meines blutenden Großvaters vor Augen. Als ich mich wieder hinauswagte, war er tot.«
»Er ist im Tiefspeicher gestorben, nicht?« Die bräunlich gefleckten, verklebten Bücherhaufen stehen mir wieder vor Augen.
»Ja. Mein Vater meinte, er habe seine Verfolger auf eine falsche Spur locken wollen. Er verschanzte sich zwischen den Regalen und riss Seiten aus dem Rest der Chronik, versteckte sie in anderen Büchern. Die Sentinel taten ihr Bestes, die Seiten zu finden, nachdem sie Jordan getötet hatten.« Quirin hält kurz inne. »Aber sie boten ein zu gutes Ziel für unsere Bogenschützen.«
Ich ahne, worauf er hinauswill.
»Mein Großvater hat mir sein Lebenswerk anvertraut. Er hat es nicht zerstört, was er ganz leicht hätte tun können, sondern er wollte, dass es bestehen bleibt. Seine Nachkommen sollten es nutzen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.«
Ich stoße mich von Tommas Sarg ab, ich will hier weg. »Es wird eine andere Möglichkeit geben, meine Freunde zu retten. Ohne deine Hilfe.«
Er seufzt. »Wenn du wüsstest, was ich weiß – oder was Jordan wusste –, du würdest es dir vielleicht anders überlegen.«
»Dass die Lieblinge egoistische Lügner sind, die über Leichen gehen? Das habe ich begriffen, danke.« Ich hoffe, Quirin kann mein Gesicht sehen, in das ich meine ganze Verachtung gelegt habe. »Aber die Sorte Mensch findet sich auf beiden Seiten der Kuppeln, innen wie außen.«
Seine traurigen Augen können und dürfen mich nicht weichmachen. Er hat gerade beschlossen, meine Freunde sterben zu lassen, einen Tod, für den er selbst vor zwanzig Jahren den Grundstein gelegt hat, mit einem winzigen Stich. Er hätte die Chance, das rückgängig zu machen. Aber das tut er nicht.
»Ich hätte so viel erbarmungsloser sein können«, murmelt er. »Ich hätte von Sphäre zu Sphäre reisen und überall die Wasserversorgung mit Dhalion kontaminieren können. Es ist einfach, weißt du? Ein paar Tropfen reichen; im Wasser vermehrt das Virus sich unfassbar schnell; innerhalb von ein paar Tagen ist jeder Schluck tödlich. Noch besser, sagte Jordan, wirkt infiziertes Blut, weil Dhalion dann bereits mutiert und noch aggressiver ist als in seiner ursprünglichen Form. Wenn man sich auf diese Weise ansteckt, hilft auch kein Serum mehr.« Quirin sieht mich aus verengten Augen an. »Wenn du wüsstest, wie groß die Versuchung für mich an manchen Tagen war. Wie gern ich den Sphären ein für alle Mal ein Ende bereitet hätte.«
Ich lege meine gesamte Abscheu in den Blick, den ich ihm zuwerfe. »Es ist die feigste Art zu töten, die ich mir vorstellen kann. Du hättest alte Menschen umgebracht, Kinder, schwangere Frauen. Und du hättest nicht dabei sein und ihnen beim Sterben zusehen müssen.«
Er lacht. Es ist mir unbegreiflich, wie er das tun kann, aber er lacht. »Ria. Wenn du die ganze Wahrheit kennen würdest … Hast du irgendwann in den Sphären etwas von den Großen Sieben gehört? Oder gelesen? Hat einer deiner Mentoren sie je erwähnt?«
Ich muss mein Gedächtnis nicht lange durchforsten, etwas so Plakatives wie die Großen Sieben hätte ich mir sicherlich gemerkt. »Nein. Was soll das sein? Irgendein Geheimbund oder noch ein paar Wissenschaftler, die effektive Methoden entwickelt haben, um Leute ins Jenseits zu befördern?« Quirin schüttelt den Kopf. »Du würdest es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber –« Er unterbricht sich.
»Na los, raus damit. Erzähl es mir, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich dir glauben will.«
Die Art, wie er zur Seite blickt, sein Zögern, all das sagt mir, dass diese Großen Sieben kein Ablenkungsmanöver sind. Kein Versuch, meine Wut durch Neugier zu ersetzen. Nein, da geht es um etwas, das ihn stark bewegt. Oder um jemanden.
»Hatte ich recht? Ist es ein Geheimbund?«
Er betrachtet mich nachdenklich. »Du würdest es mir nicht glauben«, wiederholt er.
»Du bist mir viel mehr schuldig als nur eine Antwort.« Ich gehe langsam auf ihn zu, bis ich knapp vor ihm stehe. »Behalte meinetwegen dein Geheimnis für dich, aber gib mir das Serum.«
Er schüttelt den Kopf. »Das kann ich nicht.«
Etwas in mir tobt, schlägt gegen innere Wände. »Hast du schon einmal jemanden verloren, der dir nahegestanden hat? Hm? Außer deinen Großvater? Hat man dir schon Menschen gewaltsam genommen und du hast dich immer wieder gefragt, ob du es nicht hättest verhindern können?«
Etwas trübt Quirins Blick. Trauer, die ihn auf einen Schlag uralt aussehen lässt.
»Ja«, antwortet er. »Zumindest diese eine Frage kann ich dir beantworten. Ich hatte einen Bruder, der geraubt wurde. So wie du, wie Aureljo, wie Tycho, wie Tomma. Nur viel früher.«
Ich hake sofort nach. »Dann müsstest du doch verstehen, wie wichtig es für mich ist, meine Freunde zu retten. Sie sind das, was für mich einer Familie am nächsten kommt.«
Ich sehe das Bedauern in seinem Blick, ebenso wie ein Nein, das endgültig ist.
Ich weiß, wann weitere Bemühungen sinnlos sind. Mit schnellen Schritten bin ich an der Tür, ich werde nicht weiter meine Zeit verschwenden, sondern einen anderen Weg finden.
Mit gedämpfter Stimme ruft Quirin mir etwas nach, als ich schon draußen bin. Zwei Worte. Wenn ich mich nicht täusche, lauten sie: Viel Glück.
Mein Kopf liegt an Sandors nackter Schulter, meine Hände streichen über seine Brust, folgen den Narben, die sich darüberziehen. Zwei kurze, eine lange. Am linken Unterarm ein enger Bogen kleiner Vertiefungen.
»Wolfsbiss«, vermute ich und er nickt.
»Das hier«, er führt meine Hand an die bogenförmige Narbe, die sich vom Brustbein nach rechts zieht, »war die Klinge eines Schlitzers. Und das«, meine Finger streichen über einen zackigen Wulst, der quer über Sandors Rippen verläuft, »einer der Scharten mit einer riesigen Glasscherbe. Der Schnitt hat sich entzündet und ist lange nicht verheilt. Ich war fünfzehn und schrecklich wütend, weil ich monatelang nicht mit auf die Jagd durfte.«
Ich presse mich enger an seinen Körper, umschlinge seine Beine mit meinen. Wie viel Zeit verstrichen ist, seit wir uns in den kleinen Lagerraum nahe unserem Versteck geschlichen haben, kann ich nicht abschätzen. Zu viel wahrscheinlich. Ich hoffe, Tycho ist nicht vorzeitig aufgewacht und macht sich Sorgen.
Nur noch fünf Minuten, sage ich mir. Mit geschlossenen Augen ertaste ich unterhalb von Sandors Schlüsselbein die nächste Narbe, dünn und glatt.
»Ein Pfeil, der knapp die Lunge verfehlt hat.« Sandor greift nach meiner Hand, küsst die Fingerspitzen, die Innenfläche. »Das hat jedenfalls Quirin damals behauptet.«
Den Namen will ich jetzt nicht hören. Er zieht sich wie ein Riss durch die Hülle, in die wir uns für ein paar kostbare gemeinsame Stunden eingekapselt haben.
»Ich habe auch eine Narbe«, erkläre ich mit übertriebenem Stolz in der Stimme. »Hier.« Ich suche mit seiner Hand nach der Stelle an meinem Schulterblatt, von der meine Ziehmutter Baja immer behauptet hat, sie sehe aus wie ein Halbmond.
»Ja, die habe ich vorhin schon gespürt.« Sandor zeichnet mit einem Finger die Ränder nach. »Was ist passiert?«
»Tee. Eins der größeren Kinder hat eine Tasse voll kochend heißem Tee vom Tisch gefegt, während ich am Boden gekrabbelt bin. Zum Glück hat mich nicht der ganze Inhalt erwischt und zum Glück nicht im Gesicht.«
»Ja, das wäre schade gewesen«, flüstert er. Seine Lippen streichen über mein Ohr, meinen Hals. Ich brauche meine gesamte Willenskraft, um ihn ein Stück von mir zu schieben.
»Es muss bald hell werden. Ich möchte nicht, dass Tycho aufwacht und ich bin nicht da.«
Während ich unter der Decke hervorkrieche und meine Kleidungsstücke zusammensammle, stützt Sandor sich auf seinen Ellenbogen und beobachtet mich im Licht der beiden Stablampen, die wir rechts und links unserer Lagerstatt postiert haben.
Es ist völlig albern, dass ich rot werde, wenn man bedenkt, wie nahe wir uns gerade waren. Trotzdem.
»Weißt du, wer die Großen Sieben sind?«, frage ich, um Sandors Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken als meine nackte Kehrseite. »Oder was? Quirin hat sie erwähnt. Irgendeine Idee?«
»Nein. Mich interessieren im Moment nur zwei. Wir zwei.« Er steht auf, umfasst mich von hinten, hält mich fast ein wenig zu fest. »Du musst dich nicht mehr lange hier unten verstecken. Ich werde uns einen sicheren Platz zum Leben schaffen. Ich meine, wozu bin ich Fürst?«
Tycho hat nichts gemerkt. Nachdem ich mich zurückgeschlichen habe und unter meine kalte Decke gekrochen bin, dauert es noch eine gute Stunde, bis er sich regt. Wir teilen uns Wasser und Dörrfleisch zum Frühstück und wenden uns dann unserem Hauptproblem zu: dem Serum.
Gemeinsam mit Tycho Pläne zu schmieden, ist eine Wohltat. Er ist klug, kritisch und begeisterungsfähig zugleich; jede meiner Ideen ergänzt er mit eigenen, wertvollen Gedanken.
Schnell haben wir unsere Möglichkeiten auf zwei eingegrenzt: Wir könnten uns auf die Suche nach dem Impfstoff machen – irgendwo in seinen Räumen muss Quirin eine Art Labor versteckt haben, bestehend aus den wissenschaftlichen Geräten, die Jordan aus den Sphären mitgenommen hat. Oder wir könnten uns die Hecke vornehmen, so viele Dornen wie möglich abschneiden und hoffen, dass sich auf ihnen noch ausreichend Wirkstoff befindet, um Aureljo und Dantorian zu immunisieren.
Das wäre ein erster Teilerfolg. Wie wir die anderen retten sollen, von denen wir nicht einmal die Namen wissen, ist mir schleierhaft. Außer …
»Wenn wir Dornen von der Hecke nehmen, haben wir auch Proben des Serums«, überlege ich laut. »Die Wissenschaftler in den Sphären könnten es analysieren und kopieren und das Problem wäre gelöst.«
In Tychos Augen lese ich den gleichen Zweifel, den ich selbst empfinde. Die Macht über das Serum in die Hände des Sphärenbundes legen … damit wäre die Gefahr einer Epidemie aus der Welt, nicht aber das, was der Bund den Clans antut. Die Sphären wären einmal mehr die Gewinner, die Außenbewohner hätten nicht den geringsten Vorteil. Falls es stimmt, was Quirin von neuen, schwer bewaffneten Truppenaufgeboten erzählt, stärken wir die, die ohnehin schon stark sind, obwohl wir eigentlich nur Unschuldige retten wollen.
Der Gedanke kreist in meinem Kopf, bei Tag und Nacht. Unlösbar. Man hat mich gelehrt, Verantwortung zu tragen, aber nicht so unglaublich viel davon.
Tycho lässt sich auf mein ständiges Grübeln nicht ein. Er durchstreift die Katakomben, auf der Suche nach versteckten Winkeln, die ihm bisher entgangen sind. »Irgendwo muss er sein Zeug aufbewahren«, erklärt er mir mehrmals. »Weißt du noch, wir sind ihm früher schon einmal hier unten begegnet und er hat uns vor einer bestimmten Ecke gewarnt, von wegen Einsturzgefahr und so. Ich werde mir das näher ansehen.«
Mir wird übel bei dem Gedanken, dass Tycho unter Tonnen von Schutt begraben werden könnte, wenn er nicht vorsichtig ist, aber ich lasse ihn gewähren. Das Ergebnis ist gleich null.
»Nur zwei leere Kammern«, berichtet er am Abend. »Ziemlich sauber allerdings. Die werden genutzt. Oder wurden es jedenfalls, bis vor Kurzem.«
Für mich wird die Situation mit jedem Tag unerträglicher. Ich fühle mich nutzlos, nutzlos, nutzlos. Und allein. Vor meiner Reise nach Vienna 2 konnte ich immerhin die Bibliothek nach Jordans Chronik durchsuchen. Jetzt weiß ich, dass ich die wichtigen Teile dort nicht finden werde. Die Stadt unter der Stadt hat aufgehört, ein Zufluchtsort zu sein, sie ist ein Kerker, in dem die Zeit stillsteht, während sie an der Oberfläche weiterfließt und ungenutzt verloren geht. Vielleicht ist Aureljo schon krank. Oder aufgeflogen. Vielleicht haben die Scharten die Dornenhecke in Brand gesteckt, um sich nachts daran zu wärmen.
»Nein«, beruhigt mich Sandor bei einem seiner viel zu seltenen Besuche. »Die Hecke ist noch da, die Feindclans leider auch. Nicht mehr an derselben Stelle, aber knapp fünfzig Meter weiter.«
Er sitzt an die Wand gelehnt, seine Worte sind langsam und leise, immer wieder schließen sich seine Augen, bevor er sie mit sichtlicher Anstrengung wieder öffnet.
Ich wage es nicht, ihn zu fragen, weshalb er so erschöpft ist. Auf meinen forschenden Blick hin schüttelt er nur den Kopf. Er hat uns Wasser und Räucherfleisch mitgebracht, sieben der fasrigen, trockenen Moosfladen, dazu ein winziges Stück Ziegenkäse.
»Ich versuche, morgen wieder herzukommen. Spätestens übermorgen.«
Mein Bedürfnis, gegen die Wände zu treten, ist fast unbezwingbar. Egal ob Sandor mich liebt oder nicht, für ihn sind wir eine zusätzliche Last, ein weiteres Problem, das er lösen muss. Tycho und ich, wir sind immunisiert, aber lebendig begraben, hilflos. Zum ersten Mal seit unserer Flucht aus der Magnetbahn frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, die Sentinel mit ihren Klingen und Stachelkeulen hätten Erfolg gehabt.
»Bleibt im Gewölbe.« Trotz seiner Müdigkeit scheint Sandor meinen inneren Aufruhr zu spüren. Er legt seine Hand auf meine, drückt sie. »Es wird nicht mehr lange dauern. Ich finde einen besseren Platz für euch.«
Ich versuche, mich zu erinnern, wie man den Eindruck von Zuversicht vermittelt. Offenes Lächeln, hoch erhobener Kopf, eine Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit in den Augen.
Was ich zustande bringe, ist höchstens ein kläglicher Abklatsch meiner früheren Fähigkeiten, doch es genügt, um Sandor erleichtert durchatmen zu lassen. Er hält mich mit seinem Blick fest und ich wünschte, wir hätten einen Moment für uns, damit ich meine Arme um seinen Nacken legen und mich an ihn drücken könnte. Mir ein paar Sekunden stehlen, die mir vorgaukeln, dass die Dinge gar nicht so schlimm sind.
Doch seit meiner überraschenden Reise zurück in die Sphärenwelt hält Tycho mich ohnehin für unzuverlässig und ich kann mir gut vorstellen, dass er aus so viel plötzlicher Nähe zwischen mir und dem Clanfürst die richtigen Schlüsse ziehen würde. Ich brauche aber Tychos Vertrauen, für alles, was wahrscheinlich noch vor uns liegt.
Sandor bricht kurz danach auf und ich lege mein Gesicht gegen die Stelle, wo sein Rücken die Wand berührt hat. Doch die Steine sind so kalt, als wäre er nie hier gewesen.
3
Sie kommen zwei Tage später und überraschen uns im Schlaf.
Ein Knall lässt mich hochfahren, mein Herz hämmert panisch gegen die Rippen, alles stockdunkel, wo ist meine Lampe?
»Ria?« Tychos belegte Stimme. »Was ist –«
Hektisch wickle ich mich aus meiner Decke, ertaste die Lampe, Schritte nähern sich, jetzt tanzen auch Lichtkegel über die Wand und über meinen Körper.
»Da sind sie!«
»Ich wusste es.«
»He! Wir haben sie!«
Bis sie das Gewölbe stürmen, habe ich es geschafft, mich aufzurichten.
Sechs Dornen, angeführt von Yann, der sich breitbeinig in die Mitte des Raumes stellt. »Glück bei der Jagd, und das schon so früh am Tag.«
Der Lichtstrahl gleitet an mir hoch, bis er genau mein Gesicht trifft. Ich setze eine gelassene, leicht erstaunte Miene auf, muss meinen Kopf aber nach kurzer Zeit wegdrehen. »Du blendest mich.«
Yann tritt einen Schritt näher. »Oooh. Das ist ja verdammt rücksichtslos von mir.«
Seine Begleiter lachen. Noch schenken sie Tycho keine Beachtung, der links von mir kauert, ganz nah an der Wand. Doch gesehen haben sie ihn, keine Frage.
»Ich dachte, ihr seid längst aus unserem Territorium verschwunden.« Der schneidende Unterton in Yanns Stimme macht mir Sorgen. Ein Vorbote von offener Aggression.
»Das waren wir auch«, entgegne ich. »Aber es gab Schwierigkeiten, deshalb sind wir zurückgekommen. Nur für ein paar Tage, wir wollten so bald als möglich wieder aufbrechen.«
Yann schiebt das Kinn vor. Betont gründlich sieht er sich im Raum um. »Wo ist die hübsche Kleine? Habt ihr die nicht wieder mitgebracht?«
Tomma. Es klingt, als hätte er tatsächlich ihren Namen vergessen. »Nein.«
»Warum nicht?«
»Sie ist tot.«
Das lässt ihn kurz innehalten. »Ach? Tja, schade. Sie war wirklich …« Er pfeift, seine Gefährten lachen.
In mir ist keine Wut. Nur Kälte, genug, um das ganze Territorium wieder in Eis erstarren zu lassen. Wie gut, dass es Sandor war, der die sterbende Tomma in seinen Armen gehalten hat, und nicht dieser Drecksack.
»Und die anderen?« Mit zusammengekniffenen Augen blickt Yann sich im Gewölbe um, als würde sich hier irgendjemand verstecken. »Auch tot?«
»Das weiß ich nicht.« Ich kann spüren, dass Tycho neben mir immer nervöser wird, und hoffe, er überlässt das Reden weiterhin mir. »Wir sind getrennt worden und haben uns verloren.«
»Und da dachtet ihr, ihr kriecht wieder unter die Röcke des Clans, hm? Wer hat euch diesen Ort gezeigt?«
Darauf läuft es also hinaus. Wir sind Yann völlig egal, er weiß, dass wir keine Gefahr für ihn darstellen, aber er könnte jemand ganz Gewissem eine Schlinge aus unserer Anwesenheit drehen.
Diese Suppe werde ich ihm versalzen.
»Das war Quirin. Er hat uns eingeladen, für einige Zeit hierzubleiben. Er sagte, wir dürften die Gastfreundschaft der Stadt unter der Stadt für uns in Anspruch nehmen.«
Yann schafft es nicht einmal im Ansatz, seine Enttäuschung angesichts meiner Antwort zu verbergen. »Ich glaube dir kein Wort«, knurrt er.
»Wieso? Er hat uns schon geschützt, als ihr uns den Sphären ausliefern wolltet, und nun hat er es eben ein zweites Mal getan.«
Das war eventuell eine Spur zu forsch. Yann vor seinen Leuten dumm dastehen zu lassen, ist keine gute Idee. Prompt baut er sich vor mir auf, seine Lampe ist kaum noch zehn Zentimeter von meinem Gesicht entfernt.
»Dann hat es mit euch zu tun, dass Quirin verschwunden ist!«
Quirin verschwunden? Die Information trifft mich unvorbereitet. Aber gut, möglicherweise hat er sich letztens nur mir gezeigt, oder Yann lügt. Doch die erstaunten Blicke der Männer bleiben aus, also scheint es zu stimmen.
»Ich wusste nicht, dass er weg ist. Seit wann?«
»Das geht dich nichts an!« Jetzt brüllt er, sichtlich froh darüber, endlich einen Grund zu haben. »Was glaubst du, wer du bist, dass du mir Fragen stellen darfst?«
Scharfer Schmerz, als er mein Haar packt und mich zu sich zieht. »Dich habe ich immer schon für eine Spionin gehalten – deswegen bist du zurückgekommen, hm? Was kriegst du, wenn du uns ans Messer lieferst?«
Es ist eine rhetorische Frage, er will keine Antwort und ich gebe ihm auch keine, sondern warte, bis er loslässt.
Meine Kopfhaut schmerzt, zwischen Yanns Fingern ist ein kleines Büschel Haar zurückgeblieben. »Wir spionieren nicht und wir bleiben auch nicht. Eigentlich wollten wir morgen aufbrechen, aber wie es aussieht, gehen wir besser gleich.«
Es ist ein Versuch, der ihm die Möglichkeit gibt, uns mit einem symbolischen Tritt hinauszuwerfen, uns mit ein paar blauen Flecken davonkommen zu lassen. Doch wie ich befürchtet habe, ist es nicht das, was Yann will.
»Das könnte dir so passen. Ihr geht nirgendwohin.« Er winkt seine Leute heran, die uns packen und aus dem Gewölbe zerren, hinaus in die dunklen Gänge.
Ich habe die Stablampe immer noch in der Hand, klammere mich an sie wie an einen Talisman. Hinter mir höre ich einen Schlag und ein Keuchen, das wahrscheinlich von Tycho kommt. Wehr dich nicht, beschwöre ich ihn stumm.
»Es ist gut, ich stehe ja schon auf«, krächzt er.
Noch ein Schlag. Dann lassen sie ihn offenbar in Ruhe, auf ein Handzeichen von Yann hin.
Das Tempo, mit dem wir durch die Tunnel und Kanäle hetzen, lässt mir kaum Gelegenheit zum Nachdenken, dabei geht es jetzt ums Ganze. Gut möglich, dass sie uns an die Oberfläche schleppen und an den ersten Baum knüpfen, der stark genug ist, uns zu tragen.
Aber das glaube ich nicht.
Der Clan Schwarzdorn verschwendet nichts. Als Leichen sind wir wertlos, als Tauschobjekte dagegen stellen wir eine begehrte Ware dar – ich bin sicher, Yann erinnert sich noch daran, dass die Sphären uns suchen. Trotzdem denke ich, dass er etwas anderes vorhat.
Den Ausstieg, durch den wir nach oben gehen, kenne ich nicht, er führt über eine stählerne Gittertreppe und spuckt uns nahe des Flusses ans Tageslicht. Die Sonne ist eben erst aufgegangen, sie hängt als trüber Lichtschein knapp über dem Horizont, verschleiert von Wolken.
Kaum Wald hier. Mehr Trümmer als Ruinen. Sollte uns die Flucht gelingen, könnten wir uns nirgendwo verstecken, davon abgesehen würden Yanns Jäger uns in kürzester Zeit einholen. Kein Zweifel, dass sie schneller sind als wir.
Über einen Hügel, dann einen Betonweg entlang. Aus einer Ruine lugt ein kleines Mädchen und duckt sich sofort, als unsere Blicke sich begegnen.
Nach etwa zwanzig Minuten kommt das Haupthaus in Sicht.
Sie stoßen uns in die große Halle, den Raum, in dem Versammlungen und Mahlzeiten stattfinden. Eine Zeit lang waren auch wir dabei, wir alle sechs.
»Sagt dem Fürsten, Yann ist hier und hat ihm etwas mitgebracht!« Yann stößt mich zu Boden, mein Kopf verfehlt nur knapp die Tischkante.
Ich stehe nicht wieder auf, das würde ihm nur einen Vorwand liefern, mich ein weiteres Mal anzugreifen. Ein Seitenblick auf Tycho verrät mir, dass sie ihn zu zweit festhalten, er blutet aus der Nase und schickt wütende Blicke durch den Raum.
»Bleib ganz ruhig«, murmle ich in seine Richtung.
Er zögert. Dann ein kurzes Nicken, er hat verstanden, was ich meine, und wird das Reden mir überlassen.
Noch ist die Halle fast leer. Drei alte Frauen wischen über die Tische, ein zahnloser Mann sitzt mir schräg gegenüber und nuckelt an einem Moosfladen. Sein Kopf wackelt auf und ab, trotz unseres geräuschvollen Auftritts beachtet er uns nicht.
Sandor lässt sich Zeit, vielleicht will er klarstellen, wer hier der Anführer ist. Jedenfalls wird Yann von Minute zu Minute wütender. Zwei Mal trifft sein Stiefel meinen Oberschenkel; ich tue, als würde ich es nicht spüren.
Allmählich füllt sich die Halle. Von den Frauen, die in der Ecke links stehen, kenne ich einige vom Sehen, keine mit Namen. Dann betreten ein paar Jäger den Raum, die Yann grüßen.
Erst nach einer gefühlten Ewigkeit tritt Sandor durch die Tür. Direkt hinter ihm Andris, der voll Freude auflacht, auf mich zustürzt und mich auf die Beine stellt.
»Mädchen! Schön, dich wiederzusehen!«
»Nimm die Finger von meiner Gefangenen«, herrscht Yann ihn an.
Langsam und ohne mich loszulassen, dreht Andris den Kopf. »Deiner was?«
»Meiner Gefangenen.« Entschlossen hebt Yann das Kinn, als könnte er es so mit Andris’ riesiger Gestalt besser aufnehmen. »Wir haben unter der Stadt nach Quirin gesucht, stattdessen haben wir die zwei Lieblinge gefunden. Spione. Vielleicht Schlimmeres.« Er blickt sich im Raum um, der jetzt halb voll ist. »Kann doch sein, dass Quirin nicht gegangen ist, sondern … beseitigt wurde.«
Raunen rund um uns herum.
Sandor, der bisher völlig ruhig dagestanden hat, kommt ein paar Schritte näher. Er hebt eine Hand und die Gespräche verstummen. »Ria und Tycho sind keine Spione. Sie haben um Schutz gebeten und ihn bekommen. Das ist alles.«
»Quatsch«, grollt Andris. »Das Mädchen hat mich gerettet, hat mich aus der Glaswelt befreit, das hättet ihr sehen sollen!«
Wieder lacht er und einige Clanleute stimmen mit ein. »Sie war großartig! Hat die Lieblinge total an der Nase herumgeführt. Ohne sie wäre ich tot, da bin ich sicher.«
Die Stimmung in der Halle schlägt um, zu unseren Gunsten. Ich spüre das und Yann geht es ebenso.
»Ist ja witzig«, ruft er, »dass du damit erst jetzt rausrückst. Uns hast du erzählt, du wärst ganz allein entkommen. Bei Nacht und Nebel rausgeschlichen, an den Sentineln vorbei. Wann hast du gelogen, Andris? Damals oder gerade eben?«
Wenn Yann glaubt, Andris damit verunsichern zu können, irrt er sich. »Damals natürlich. Weil Ria es so wollte. Das ist Bescheidenheit, verstehst du? Nicht jeder hat ständig den Drang, sich aufzuspielen!«
»Bescheidenheit. Oder Berechnung.« In gespielter Gleichgültigkeit hebt Yann die Schultern. »Wenn ihr euch so leicht an der Nase herumführen lasst –«
Lautes Krachen unterbricht ihn. Sandor hat einen der Tische umgetreten, er schießt an Tycho, Andris und mir vorbei und packt Yann am Kragen. »Sie sind hier, weil Quirin und ich es ihnen gestattet haben. Sie sind Gäste.«
Ich bin ebenso erstarrt wie Yann und seine Leute. Diese Seite von Sandor habe ich lange nicht mehr erlebt, nicht mehr seit unseren gemeinsamen Stunden unter freiem Himmel; erst recht nicht, seit wir ein Paar sind.
Er lässt seinen Widersacher los und stößt ihn gleichzeitig fort. Seine Gefährten fangen Yann auf und bewahren ihn nur knapp vor dem Hinfallen.
Wahrscheinlich trägt man in den Clans Konflikte auf diese Weise aus, aber klug ist es nicht. Hätte Sandor Yann erlaubt, sein Gesicht zu wahren, gäbe es noch eine Möglichkeit auf Einigung. Doch nach dieser Demütigung will Yann nur noch eine Sache: es Sandor heimzahlen.
Er zieht sein Messer aus dem Gürtel und setzt zum Sprung an, aber da ist schon Andris dazwischengetreten. Er entwindet Yann die Waffe mühelos.
»Dummer kleiner Junge.« Die Gutmütigkeit in seiner Stimme ist nur oberflächlich. »Hast du vergessen, was auf Fürstenmord steht?«
»Er ist kein Fürst. Er verrät uns, merkst du das nicht? Macht gemeinsame Sache mit den Lieblingen.«
Kopfschüttelnd wendet Andris sich ab, das Messer verstaut er in seinem eigenen Gürtel.
Yann ist kreidebleich, seine Hände sind zu verkrampften Fäusten geballt. »Was glotzt du so blöd?«, brüllt er Tycho an und tritt nach ihm. »Du weißt genau, dass ich recht habe. Euch gehören die Köpfe abgeschnitten.«
Als Sandor sich diesmal umdreht, ist er deutlich beherrschter. »Achte auf deine Worte, Yann. Und fass weder Ria noch Tycho wieder an. Du störst den Frieden des Clans, dafür können wir dich ausstoßen.«
»Mich?« Yanns Augen sind nur noch Schlitze, er bleckt die Zähne wie ein Tier vor dem Angriff. »Den Einzigen, der sich nicht täuschen lässt? Damit ihr freie Bahn habt und den Sentineln das Territorium kampflos überlassen könnt?« Er strafft die Schultern, vergewissert sich, dass die Anwesenden ihm zuhören. »Ich habe mit Quirin gesprochen, vor fünf Tagen. Er war besorgt, wollte mir aber nicht sagen, warum. ›Wir gehen schlimmen Zeiten entgegen, unser Schicksal hängt an einem dünnen Faden‹, das waren seine Worte. Und nun ist er weg, spurlos verschwunden.« Übertrieben dramatisch schüttelt Yann den Kopf. »Damals habe ich nicht verstanden, was er meinte, aber jetzt –«
»Ja?«, hakt Sandor nach. »Komm. Lass uns an deinen Erkenntnissen teilhaben. Du denkst, er hatte Angst vor Ria und Tycho? Deshalb hat er ihnen auch in seinem eigenen Reich Unterschlupf gewährt, nicht wahr?«
Wieder spannt sich Yanns Körper, er möchte Sandor am liebsten an die Kehle gehen und kann es nur schlecht verbergen. »Vor zwei Wochen ist Andris zurückgekehrt. Wenn es stimmt, was er sagt, war das Mädchen bei ihm. Seitdem war Quirin besorgt und kurz darauf war er fort. Hat er sich bei jemandem verabschiedet?«
Ratlose Blicke. Kopfschütteln.
»Hat er einem von euch erzählt, dass er vorhat, uns zu verlassen?«
Weiteres Kopfschütteln.
»Ist er je auf Reisen gegangen, ohne dem Clan Bescheid zu geben?«
Nein. Das Unbehagen unter den Anwesenden ist jetzt deutlich zu spüren, Yann hat sie beinahe überzeugt. Er weiß es, entspannt sich sichtlich.
»Wenn ihr mich fragt, ihm ist etwas zugestoßen. Die Lieblinge in den Sphären sind mit Mordwerkzeugen gut ausgerüstet und von Andris wissen wir, dass das Mädchen direkt aus Vienna 2 kam.« Er hebt die Hände. »Zieht eure eigenen Schlüsse oder …«, er tut so, als sei ihm der Gedanke gerade erst gekommen, »oder fragt euren Fürsten, ob er nicht mehr weiß, als er zugibt.«
Niemand tut, was Yann vorschlägt, aber in einigen Dornen hat er Zweifel gesät, das ist unverkennbar.
Sandor winkt Andris zu sich, weist ihn an, uns etwas zu essen zu besorgen und uns anschließend hier im Clanhaus unterzubringen. Er selbst sieht uns kaum an, was mich schmerzt, obwohl er sich natürlich richtig verhält – keiner darf mitbekommen, wie sehr er uns in der Vergangenheit schon unterstützt hat. Wie gut wir einander kennen.
Vor uns teilt Andris die Menge, die im Lauf der Auseinandersetzung immer weiter angewachsen ist, niemand stellt sich ihm in den Weg. Wir haben es beinahe aus der Halle geschafft, da meldet Yann sich noch einmal zu Wort.
»Ich verlange ein Tribunal.«
Die Gespräche im Raum verstummen auf einen Schlag. Andris bleibt so abrupt stehen, dass ich in ihn hineinlaufe.
»Ich klage die Lieblinge an. Ich glaube, dass sie Quirin getötet haben.«
4
Wir lassen den Tumult, der auf Yanns Ankündigung folgt, so schnell wie möglich hinter uns. Andris läuft voraus, bringt uns in ein Zimmer, das dem ähnelt, in dem wir vor Flemings Tod gewohnt haben. Kahle Wände, vernagelte Fenster.
»Ein Tribunal.« Immer wieder schüttelt er den Kopf. »Der Idiot weiß ja gar nicht, was er sagt.«
Ich fürchte, da irrt sich Andris.
»Ein Tribunal ist eine Gerichtsverhandlung?«, mutmaße ich.
»So ungefähr. Es kommen alle zusammen und dann wird entschieden, was mit dem Beschuldigten passieren soll. Es wird laut durcheinandergeschrien, aber am Ende gibt es eigentlich immer ein klares Ergebnis. Das kann so oder so ausfallen.« Andris blickt zur Seite. »Je nachdem, wie viele Freunde man hat.«
Tycho lacht auf. »Tolle Aussichten für uns, wir sind ja rasend beliebt bei den Dornen.«
In meinem Inneren flattert etwas wie ein panisches kleines Tier. »Was kann schlimmstenfalls passieren?«
Andris leckt sich über die Lippen. »Na ja.« Er sieht mir nicht in die Augen. »Alles. Aber das werde ich nicht zulassen, macht euch keine Gedanken. Ich stehe hinter euch.«
Seine Worte sollen beruhigend klingen, verfehlen ihre Wirkung aber völlig, denn Andris’ Sorge schimmert durch jede Silbe.