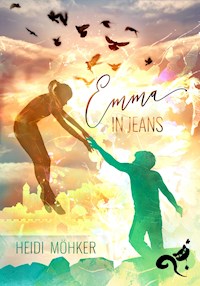
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagshaus el Gato
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unmögliche Liebe zwischen den Zeiten – und zwischen Leben und Tod. Emma kennt die Ewigkeit. Sie verbringt sie allein in ihrer hautengen Jeans, die ihre Mutter ihrnie erlaubt hätte, und mit den Vögeln. Nur manchmal kann sie jemand sehen – so wie Tim. Tim, der keine Ahnung hat, wie es war, in den 60er Jahren jung zu sein. Für den Jeans – egal wie eng – eine Selbstverständlichkeit sind. Und der trotzdem weiß, wie Emma sich damals gefühlt hat. Weil es ihm genauso geht. Weil er sein Leben genau wie Emma beendenwill. Und Emma will alles tun, damit ihm ihr Schicksal erspart bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet: www.verlagshaus-el-gato.de
1. Auflage März 2019
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf - auch teilweise - nur mit
Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Hannelore Nistor
Verwendung: Bildern von iStockphoto
Satz: Verlagshaus el Gato
Lektorat: Alexandra Fauth, Sebastian Heise
Druck: Printed in Europe
ISBN: 978-3-946049-37-1
eISBN: 978-3-946049-38-8
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de.
Vorwort
Wenn bei einem uns nahestehenden Menschen Depressionen mit begleitenden Suizidgedanken auftreten, kann uns das selbst zutiefst hilflos und ohnmächtig machen. Aus Angst davor, etwas falsch zu machen oder etwas zu sagen, was den anderen nur noch mehr runterzieht, ziehen wir uns vielleicht von ihm zurück und verstärken so ungewollt dessen Leidensdruck. Auch meist gut gemeinte Durchhalteparolen scheinen nicht immer hilfreich, vor allem, wenn sie unser Verständnis für den anderen und dessen Not nicht widerspiegeln. Dass eine Depression den gesellschaftlichen Ehrenkodex des „schneller, höher, weiter“ verletzt und daher Betroffene schnell als Loser stigmatisiert werden, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, macht das darüber sprechen noch viel schwerer.
Heidi Möhker gebührt der Dank, sich dieses komplexen und wichtigen Themas in der Geschichte von Emma und Tim angenommen zu haben. Ich wünsche ihr und ihrem Buch, dass sich gerade Jugendliche neu für ihre Freunde und Bekannte sensibilisieren lassen, ihnen mit Verständnis und Geduld und liebevoller Unterstützung zu begegnen. Dazu kann auch einmal der eindringliche Rat gehören, sich fachliche Hilfe bei einem Therapeuten zu suchen oder zum Selbstschutz für eine Zeit in eine Klinik zu gehen. Wenn sowohl Leser wie auch Betroffene in Zukunft einander achtsam wahrnehmen und vorurteilsfrei wertschätzen, wäre das wohl ganz im Sinne der Autorin. Und eine echte Hilfe für Menschen in depressiven Krisen, vor denen ohnehin niemand wirklich gefeit ist.
Christoph Ahrweiler
Psychotherapeut
Vorwort der Autorin
Mehr und mehr verbreitet sich die Erkenntnis, dass Depression und daraus resultierender Suizid(-versuch) nicht aus der Welt verschwinden, indem sie verschwiegen werden. Im Gegenteil, sie stellen zurzeit die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar (Quelle: https://www.frnd.de/infografik-suizid-in-deutschland/). Aufklärung ist notwendig, um achtsam mit den Menschen im eigenen Umfeld umzugehen. Mögliche Symptome müssen aufgezeigt und bekannt gemacht werden, um notfalls Hilfe holen zu können.
Im Roman sind die Gefühle von Emma und Tim sehr stark. Es freut die Autorin, wenn der Leser oder die Leserin die Gefühle nachempfindet. Das ist normal und das ist gewünscht. Sollten bei dir diese Gefühle überhandnehmen, denke bitte immer daran, dass es Emma ist, die an den Ansprüchen ihrer Familie verzweifelt. Es ist Tim, der sich schuldig fühlt und einsam ist. Sollte die Grenze zwischen den Charakteren des Buches und den eigenen Gefühlen verwischen oder wegfallen, solltest du das mit einem guten Freund besprechen. Und rede mit deinen Eltern, einer lieben Verwandten, einem vertrauenswürdigen Lehrer. Solltest du solche Gefühlsveränderungen bei einer Freundin oder einem Freund bemerken, wirke bitte auf den Betroffenen ein, dass er diese Dinge ebenfalls beachtet und unterstütze ihn nach deinen Möglichkeiten – dabei zählt es nicht als „petzen“, wenn du für die Hilfe Unterstützung bei einem Erwachsenen suchst.
Vielleicht meinst du im Moment, dass da niemand ist, der dir zuhören wird. Nicht deine Familie, nicht deine Freunde und auch sonst niemand.
DAS IST NICHT WAHR.
Dieses Gefühl ist nur ein Symptom für eine Krankheit. Es zeigt dir, dass du professionelle Hilfe suchen solltest. Einen Arzt und eine Therapeutin. Denn du könntest erkrankt sein. Nicht an Grippe und nicht an den Windpocken, sondern an einer Depression. Die gute Nachricht: Depression ist heilbar. Tatsächlich kannst du auch mit diesem Gefühl zu deiner Hausärztin gehen. Sie weiß, bei welcher Fachärztin in deiner Nähe du am besten aufgehoben bist.
Falls du nicht zu deinem Hausarzt gehen möchtest, wende dich an eine dieser Organisationen:
• Deutsche Depressionsliga: www.depressionsliga.de/
• Nummer gegen Kummer:
• Em@ilberatung unter www.nummergegenkummer.de
• WEIL- Weiter im Leben:
• Telefonseelsorge 142
• Rat auf Draht 147
• Online-Beratung unter www.weil-graz.org
• Freunde fürs Leben: www.frnd.de. Dort findest du auch eine Liste weiterer telefonischer Beratungsangebote.
• Initiative Tabu Suizid e.V.: tabusuizid.de
Auf diesen Seiten findest du für den Notfall auch erste Tipps zur Selbsthilfe, um aus der ersten Krise herauszukommen. Aber such dir anschließend Hilfe von außen. Das ist wichtig!
Heidi Möhker
She‘s fading away
Away from this world.
Drifting like a feather
She‘s not like the other girls.
She lives in the clouds
And talks to the birds.
Hopeless little one
She‘s not like the other girls, I know.
The Rasmus, Not Like The Other Girls
Not Like The Other Girls
M&T: Aki Hakala, Eero Heinonen, Lauri Yloenen, Pauli Rantasalmi
© Boneless Skeletor Oy / Grotto Entertainment Oy
Mit freundlicher Genehmigung von Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH.
Frühsommer 2018
Es war ein ganz normaler Mittwoch. Tim saß im Linienbus auf der hintersten Bank und starrte aus dem Fenster. Wusste der Teufel, warum Mama sich ausgerechnet heute an ihren Sohn erinnert hatte. Das tat sie eh nur, wenn sie jemanden für Marie brauchte. Wenn sie selbst mal wieder keine Zeit für ihr Wunschkind hatte. Dabei hatte er schon vor sechs Jahren gesagt, dass es ihre Sache war, wenn sie ein zweites Kind bekommen wollte. Er war zehn Jahre als Einzelkind klargekommen. Das hatte er vor sechs Jahren nicht ändern wollen, und das war bis heute so geblieben.
Trotzdem sah er sich jetzt, wo der Bus quer durch die Stadt musste, noch einmal die aufgelaufenen Whatsapp-Nachrichten an. Inzwischen hatte sogar Papa geschrieben! Die ersten Nachrichten von Mama hatte sich Tim schon vor dem Spiel angehört. Sie waren noch als Text gekommen. Sie hatte es immer dringender gemacht, dass Tim sie anrufen sollte. Er hatte nicht geantwortet. Natürlich hatte er nicht geantwortet. Er wollte das Spiel sehen. Tim hatte Sebi versprochen, sein Bestes zu geben, damit der Torwart ihres stärksten Rivalen um den Pokal keinen Ball hielt. Selbst Mamas letzte Whatsapp, eine Sprachnachricht, hatte er einfach weggedrückt. Weil er gewusst hatte, dass er mal wieder als letzter Ersatzspieler herhalten sollte. Dass Mama seinen Wunsch, dieses Spiel zu sehen, mental seiner Mannschaft beizustehen, niedriger einstufen würde, als die plötzliche Notwendigkeit eines billigen Babysitters für seine Schwester. Nur weil Mama ihre Termine nicht ordentlich planen konnte. Jetzt hörte er die Nachricht ab und bereute es sofort.
„Prima, Tim. Da wäre ein einziges Mal deine Hilfe wirklich nötig gewesen. Meinst du, es ist ein Spaß, wenn Maries Tagesmutter sich auf dem Weg zu ihr das Bein bricht? Auf dich braucht man gar nicht zählen! Besten Dank auch. Ich werde jetzt loshetzen und Marie abholen!“
Das Siegerlächeln auf Tims Gesicht, das sich dort nach dem Ausgang der beiden parallel verlaufenden Finalspiele breitgemacht hatte, löste sich auf. Verschlossen starrte er auf das Handy. Er überlegte, die Nachricht zu löschen. Er musste sich kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Doch dann zog er den Daumen, der gerade noch über dem Löschbutton schwebte, zurück. Nein, diese Nachricht würde er Mama vorspielen und ihr ein paar passende Worte dazu sagen. Es war nicht sein Problem, wenn die Eltern ihre Termine nicht mit denen von Marie abstimmen konnten. Sie waren die Eltern und sie sollten für solche Fälle halt auch einen Plan B parat haben. Tim war nur der Bruder und das nicht freiwillig.
Die nächste Nachricht war neu. Sie kam von Papa. Tim strich sich die Haare aus der Stirn.
„Hallo Tim, ich bin es, Papa. Marie ist bei mir. Ruf mich bitte an.“
Tim spürte, wie es hinter seiner Stirn zu klopfen begann. Mama hätte Papa gleich anrufen sollen. Was hatte Tim mit Marie zu schaffen? Sie waren die Eltern! Sollten die sich um ihr Kind kümmern. Sie konnten froh sein, dass Tim alt genug war und nicht auch noch einen Babysitter brauchte. Mit zwei Kleinkindern ständen sie ganz schön blöd da und würden gar nichts mehr auf die Reihe kriegen.
Die nächste Nachricht von Papa lief ab: „Tim, bitte. Ruf mich an.“
Tim schnaubte. Papa sollte nicht meinen, dass er ihm Marie abnahm. Sollte er sich doch mal einen Mittwochnachmittag um sein Kind kümmern, anstatt um die blöden Viecher anderer Leute.
Jetzt erst sah Tim, dass er auch einen verpassten Anruf bekommen hatte. Von Papas Handy. Er biss sich auf die Unterlippe, starrte auf das aufleuchtende Display und konnte sich nicht erinnern, jemals seine Mailbox abgehört zu haben.
Papas Stimme klang sonderbar, aber das konnte auch an der elektronischen Verzerrung liegen. Noch nie hatte Papa ihm auf die Mailbox gesprochen. Eigentlich hatte er ihn noch nie angerufen. Tim strich sich die Haare hinter die Ohren, als er die Kopfhörer einsteckte, und starrte blicklos aus dem Busfenster. „Hallo Tim, hier ist noch mal Papa. Ich weiß, dass du heute deinen Fußballfreunden beim Siegen zusehen wolltest. Das hier ist wirklich wichtig. Ruf bitte an. Ich hab dich lieb.“
Tim merkte erst, dass er die Luft angehalten hatte, als er wieder zu atmen begann. Kurzfristig war der Zorn auf Mama in Angst umgeschlagen. Angst, die aufkommt, wenn Noch-nie-da-Gewesenes eintritt. Ein eigenartiges Gefühl kam hinzu, weil Papa sich an das Spiel erinnerte. Als würde er verstehen, was es für Tim bedeutete. Er schnaubte laut. Als ob! Auch das war nichts als ein neuer Trick, damit er sich meldete. Damit er Papa Marie abnahm. Tim schloss kurz die Augen, versuchte das dunkle Gefühl in seinem Inneren zuzuordnen. Als würde es nicht reichen, dass das, was er da in dem Stadion getan hatte, nicht ganz korrekt gewesen war. Aber ein Sieg seiner Mannschaft allein hätte nicht für den Pokalsieg gereicht. Deswegen hatten Sebi und Tim beschlossen, dass ihr stärkster Konkurrent gleichzeitig sein letztes Spiel verlieren musste. Nur darum war Tim nicht beim Spiel seiner Mannschaft gewesen. Auch wenn klar war, dass er diesmal nicht einmal für die Ersatzbank eingeplant war, hätte er unter anderen Umständen die Mannschaft angefeuert. Der knappe Tabellenstand hatte ihn aber ins andere Stadion getrieben, in dem die anderen beiden Mannschaften zeitgleich spielten. Tim hatte den gegnerischen Torwart zweimal im entscheidenden Moment geblendet. Tim holte den Taschenspiegel aus seiner Hosentasche. Das rosa Plastikteil aus Maries Schminkkoffer. Er ließ es fallen und stieß es mit dem Fuß unter die Sitzreihe vor sich. Er lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe. Der Kopfhörer drückte schmerzhaft ins Ohr. Tim nahm ihn ab, schaltete sein Handy auf lautlos und versenkte es in seiner Tasche. Sein Bus hielt gleich an der Bushaltestelle am Vereinsheim. Der Mannschaftsbus war schon länger da. Spieler, Ersatzspieler, Trainer und alle, die zum Verein gehörten, standen in großen Gruppen zusammen. Immer wieder brach Gesang los: „Wir haben den Pokal!“ oder „We are the champions!“ Tim mischte sich unter den Pulk. Sebi trat zu ihm und klopfte ihm auf die Schulter. „Gut gemacht, alter Ganove!“ Tim versuchte zu grinsen. Er fühlte sich erbärmlich. Es wurde nicht besser.
„Was für eine Lusche von Torwart. Erst die entscheidenden Bälle reinlassen und dann behaupten, ihn hätte die Sonne geblendet.“ Worte, die irgendjemand in den Raum warf.
Tim griff nach einem Bier und wandte sich ab. Suchte Ablenkung.
*
„Toll habt ihr das hinbekommen.“ Vivian legte ihren Kopf auf Tims Schulter. Ihr T-Shirt war so tief ausgeschnitten, dass er den schwarzen BH darunter sehen konnte.
„Hm“, machte Tim nur. Hier im Vereinsheim hatte er sein T-Shirt mit seinem Trikotoberteil getauscht. Es machte ihn zu dem, was er war: ein Teil der Mannschaft.
„In welcher Position hast du denn gespielt?“ Vivian ließ ihre Finger an Tims Arm hinaufwandern. Es fühlte sich an, als würde dort eine Fliege entlanglaufen. Tim musste sich zurückhalten, sie nicht zu verscheuchen. „Ich bin Stürmer“, sagte er, was keine Lüge war. Er war Stürmer, auch wenn er noch nie bei einem Spiel der U17 auf dem Platz gewesen war.
„Hast du auch ein Tor geschossen?“ Vivian ließ ihre andere Hand über seinen Rücken wandern. Das war unangenehm; umso leichter fiel es Tim, bei der Wahrheit zu bleiben. „Nein“, sagte er und rückte ein wenig zur Seite. Er griff nach seiner Flasche. Angestrengt starrte er vor sich hin. Sebi meinte, das mit den Mädchen sei klasse. Was daran so klasse sein sollte, konnte er aber auch nicht erklären. Es lenkte Tim nicht mal ab, dabei brauchte er gerade nichts mehr als Ablenkung. Hinten in der Ecke war sein Freund jedenfalls sehr in die Anatomie eines Mädchens vertieft.
Vivian kam Tim hinterher. Sie hob ihm ihr Gesicht entgegen. Da waren Brackets auf ihren Zähnen, aber daran lag es nicht, dass er auswich. Auch nicht an den kurzen, rot gefärbten Haaren oder der starken Schminke um ihre Augen. Er wusste nicht, woran es lag. Entschlossen murmelte er etwas von „pinkeln“ und wand sich aus ihren Tentakeln.
Im Stehen schien der Alkohol, den er getrunken hatte, seine Wirkung zu vervielfachen. Er kniff kurz die Augen zusammen, um den leichten Schwindel niederzukämpfen. Das Handy blinkte ihm die Uhrzeit entgegen. Zeit zu gehen.
*
Tim war klug genug, seinen Eltern nicht noch Zündstoff zu geben. Dreiundzwanzig Uhr war das Äußerste, was sie unter der Woche gelten ließen. Graubart, der getigerte Familienkater, sprang von der Gartenmauer und strich Tim um die Beine, während er die Tür aufschloss. Er hob den Kater hoch und kraulte ihm das Fell. „Na, wo hast du dich denn herumgetrieben?“ Graubart schnurrte zur Antwort, doch sobald der erste Lichtstrahl durch die Türritze fiel, sprang er zurück auf den Boden und huschte in Richtung seines Futternapfes. Leise trat Tim hinter ihm in den Hausflur, um niemanden zu wecken. Im Wohnzimmer brannte noch Licht. Er zog seine Turnschuhe aus und schob sie vor das Schuhregal, dann steckte er den Kopf durch die Wohnzimmertür, um noch schnell „Gute Nacht“ zu sagen. Aber dazu kam er nicht. Die Worte blieben ihm auf der Zunge kleben.
Mit rot geweinten Augen, das Festnetztelefon in der Hand, saß Papa auf dem Sofa. Neben ihm, den Kopf auf seinem Schoß und die Beine dicht an den Bauch gewinkelt, lag Marie. Die langen hellen Haare fielen ihr strähnig ins Gesicht, wirkten nass und verklebt.
„Tim ist gekommen“, sagte Papa ins Telefon. Seine Stimme klang fremd und eigenartig. Ein Geräusch wie ein Schluchzen kam aus seiner Kehle. Papa weinte doch nicht! Dort saß er aber mit tränenfeuchtem Gesicht. Während er das Telefon zur Seite legte, sah Tim deutlich, wie Papas Hand zitterte. Auch die, mit der er Marie fahrig die Haare aus dem Gesicht strich.
„Ach, Tim“, brachte Papa hervor, bevor er in Tränen ausbrach und den Kopf in den Händen vergrub. Tim stand noch immer in der Tür. Er starrte von Papa zu Marie. Seine Unterlippe zitterte. Er spürte Übelkeit hochsteigen. Doch zu viel Bier, dachte er und schüttelte dabei den Kopf, als wollte er sich selbst widersprechen.
„Sie ist …“, stammelte Papa. „Da war das Auto … Ich weiß nicht.“
Zögernd machte Tim einen Schritt ins Zimmer. Er griff an die Hosentasche, fühlte nach dem Handy. Mama, dachte Tim. „Mama?“, fragte er laut. „Wo ist Mama? Was …?“
Marie regte sich unter Papa. Sie schob ihn von sich, richtete sich auf und rieb sich die Augen. Dann sah sie Tim an. „Mama ist im Himmel.“ Sie zeigte nach oben an die Decke. „Sie spielt jetzt mit den Engeln. Dabei wollte ich ihr doch noch meine Schultüte zeigen.“
Frühjahr 1965
Emma glaubte nicht an Gespenster. Ihr waren nur die Schatten unheimlich, die am Rande des Lichtkegels ihrer Taschenlampe im Keller lauerten. Am meisten fürchtete sie sich davor, in die Augen einer Ratte zu blicken. Der nahe Flusslauf und die Vorräte, die hier lagerten, waren für die Viecher ein richtiges Paradies. Da half auch das ständige Auslegen von Rattenködern nichts. Zu leicht konnten die Nager die Lehmwände des Fachwerkhauses durchknabbern. Das junge Lehrmädchen ließ den Lichtkegel über die Regale wandern. Anschließend nahm Emma den Griff der Lampe zwischen die Zähne und schob mit den Händen die vorderen Kartons auseinander, um einen Blick auf die hinteren zu werfen. Die Fastenzeit näherte sich dem Ende. Die Karwoche begann. Frau Schmidtke wollte den Laden für das Osterfest schmücken. Hier in der hintersten Ecke des Kellers lagerten die Dekorationen. Emma schauderte, als sie hinter den Kisten ein verlassenes Rattennest entdeckte. Sie drückte den Karton mit den ausgeblasenen, bunt angemalten Eiern und den Seidenblumen an sich. Staub und Schimmel würden ihre weiße Schürze verschmutzen und den Zorn der Chefin wecken. Aber der Karton war zu groß und sperrig, als dass sie ihn anders hätte tragen können. Und zu bitten, dass Hannes, der Laufbursche des Ladens, ihr tragen helfen durfte, würde für ebensolchen Ärger sorgen. Emma ließ die Taschenlampe aus ihrem Mund vorsichtig auf den Karton gleiten. Sie balancierte ihn aus und rückte mit dem Kinn die Lampe so, dass das Licht in die richtige Richtung fiel. Es war mühselig, dies alles. Zumal sich schon wieder Haarsträhnen aus ihrem Pferdeschwanz lösten und das Wenige, was sie an Sicht hatte, noch schmälerten.
„Hallo, Kleine.“
Beinahe hätte Emma den Karton fallen gelassen. Die zarten Eierschalen wären zerbrochen und Frau Schmidtke hätte sicher einen ihrer Wutausbrüche bekommen. Emma griff fester zu und starrte in die Dunkelheit hinter dem Lichtkegel, dorthin, wo sie die geisterhaften Schemen von Olaf ausmachen konnte. Der achtzehnjährige Sohn von Schmidtkes Feinkostwaren kam mit langsamen Schritten näher. Er legte seine Hände über Emmas, als wollte er ihr den Karton abnehmen.
„Deine Mutter hat schon den Strauß ins Fenster gestellt.“ Emma ärgerte sich, dass ihre Stimme so leise war. Lauter sagte sie: „Ich soll mich beeilen, hat sie gesagt.“
„Hast du die Ladenglocke nicht bimmeln gehört? Die Müllersche tauscht wieder Klatsch gegen Waren.“ Er nahm ihr den Karton ab und stellte ihn auf den Boden. Olaf kam mit seinem Gesicht noch näher zu ihr heran. „Wer sollte mich jetzt abhalten, diese Zuckerpuppe einmal zu probieren?“ Olafs Atem war das Einzige, was noch zwischen ihnen stand. Unten auf dem Boden beleuchtete das Licht der Taschenlampe fahl den Ausweg, den Olaf Emma versperrte. Sie machte einen Schritt nach hinten und stieß mit dem Rücken gegen das Regal. Die Einweckgläser darin klirrten. Es klang wie Gelächter. Olaf verkürzte den Abstand zu ihr erneut. Er hielt Emma gefangen. Sie wollte unter seinen Armen durchschlüpfen, aber auch diesen Versuch vereitelte Olaf, indem er ihrer Bewegung folgte.
„Wegzoll“, verlangte er und kam mit seinem Mund dem ihren ganz nah.
Die Versuchung war groß. Emma war schon sechzehn und noch ungeküsst. Alle ihre Freundinnen brüsteten sich bereits mit ihrem ersten Kuss, den sie irgendwo hinter einer Hecke oder in einer dunklen Gasse einem Jungen abgerungen hatten. Wie eine gute Praline aus dem Café von Hannes’ Eltern sollte es schmecken. Köstlich sollte es sein. Neugierig hatten sie Emma gemacht. Zu gerne würde auch sie nur ein einziges Mal küssen. Sie wusste auch, welchen Mund sie gerne auf ihrem spüren würde. Emma presste die Lippen zusammen. Olaf kam in ihrer Vorstellung jedenfalls nicht vor. Sie drehte den Kopf weg. Olafs Kuss traf sie am Hals. Er löste seine Hand vom Regal, griff ihr ans Kinn und drehte es zurück in seine Richtung. Die andere bewegte er ganz langsam ihr Bein hinauf und schob den Rock und die Schürze nach oben.
Emma stieß mit dem Fuß gegen den Karton am Boden. Nur die Eier nicht zerbrechen, dachte sie, und dann: Wen interessieren schon die dämlichen Eier?
Im Modeladen von Fräulein Rodert wäre ihr so etwas nicht passiert. Emma besah sich so gerne das Schaufenster. Die Ausstellungspuppen, die wie Brigitte Bardot in Jeans und Ringelshirt gekleidet waren. Frivol, nannte Mutter das. Aber Emma sah mehr. Sie sah, wie die Farben der Kleidung auf die Dekoration abgestimmt waren. Wie Fräulein Rodert mit kleinen Accessoires verstand, das Besondere der Stücke hervorzuheben. Am liebsten stand Emma vor dem Fenster, wenn es dekoriert wurde. Mutter hatte gar nicht versucht zu verstehen, warum Emma dort viel lieber in die Lehre gehen wollte. Mutter sah nur extravagante Kleidung und Trine, die dort von Fräulein Rodert als Verkäuferin ausgebildet wurde. Ein Lehrmädchen aus der Kreisstadt. Und von dem hatte Mutter ihre feste Meinung. Für ein anständiges Mädchen war es jedenfalls unmöglich, in Viola Roderts Laden eine Ausbildung zu machen. Überhaupt, was für ein Gedanke, Verkäuferin zu lernen! In den Haushalt hatte Mutter Emma zur Lehre geschickt. Zu Dr. Lüders und seiner Frau, die Frau Doktor genannt werden musste, obwohl sie auch nur die Volksschule besucht hatte.
Emma wich Olafs Hand aus, so wie sie im Lüderschen Haushalt gelernt hatte, der Hand des Doktors auszuweichen. Gar nicht schlecht war die Lehrstelle dafür gewesen. Olaf war bei Weitem nicht geschickt genug für Emma. Wie von selbst hob sie ihr Knie und traf, wo es schmerzte. Er war selbst schuld, dass er so nah vor ihr stand. Sie hörte, wie er aufheulte, doch da hatte sie sich schon nach dem Karton gebückt und war ins Lebensmittellager hinübergerannt. Sie fühlte mehr, als dass sie es hörte, wie Olaf ihr nachstürzte. Emma spürte, wie ein Ruck durch ihre Schürze ging, wie ihr das Band in den Leib schnitt. Es schmerzte kurz, aber dann gab das vom vielen Waschen spröde Material nach und riss. Emma stolperte, fing sich noch rechtzeitig, sodass die kostbaren Eier nicht auf dem Steinboden des Lagerraums zerbarsten. Sie floh die Treppe hinauf in den Laden.
Frau Schmidtke stand, heftig mit der Müllerschen diskutierend, an der Kartoffelraufe. Mit ausholenden Gesten schrieben die beiden Frauen die Gerüchte des Eifelstädtchens in die Luft. Emma gelang es unbemerkt, den Osterschmuck abzustellen und im Personalraum zu verschwinden. Der fünfzehnjährige Hannes, der mit dicken Backen kauend über seinem Pausenbrot saß, starrte sie an. „Haste dich aber flott dreckig gemacht, Emmachen“, gab er von sich. „Dass dich mal nicht die Chefin erwischt.“ Dabei schob er ihr ganz aus Gewohnheit eine von den beiden Pralinen zu, die seine Mutter ihm immer aus dem heimischen Café zum Pausenbrot einpackte.
Emma schüttelte stumm den Kopf, während sie sich die Köstlichkeit aus Nugat und Pistazien in den Mund steckte. Besser als alle Küsse, die Olaf ihr geben konnte, da war sich Emma sicher. Ihr Geld reichte nicht aus, um sich so etwas Gutes kaufen zu können. Jemand anderen als Hannes, der sie mit Pralinen bedachte, hatte sie nicht. An diesem Tag jedoch hatte sie kaum die Muße, den süßen Kugeln die ihnen angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Heftig riss sie die Schürze von sich. Sie gab nur noch einen besseren Putzlumpen ab, also nahm sie eine neue aus dem Wäscheschrank. Von ihrem Lehrgeld würde sie die abbezahlen müssen. Dabei hatte sie doch endlich mal etwas für sich kaufen wollen. Aber im Moment war es wichtiger, sich den Staub von Händen und Rock zu wischen und den Pferdeschwanz ordentlich zu binden, bevor die Schmidtke Emma zu Gesicht bekam. Zusätzlich fuhr sie sich mit dem kalten Wasser aus der Waschschüssel durchs Gesicht und versuchte, die Scham abzuwaschen, die ihr auf den Wangen glühte.
Olaf trat hinter ihr in den Personalraum. „Verschwinde“, raunzte er Hannes an.
„Nee, mach ich nicht“, quetschte der Angesprochene immer noch kauend heraus. „Hab Pause.“ Noch einmal, wie um seinen Anspruch, an dem Tisch sitzen zu dürfen, zu betonen, biss Hannes kräftig von seiner dicken Stulle ab.
„Verschwinde!“, wiederholte Olaf lauter.
Emma wäre seiner Aufforderung gerne nachgekommen, aber Olaf stand mitten im Türrahmen. Hannes jedoch dachte gar nicht daran, auf Olaf zu hören. Er sah den Sohn seiner Chefin nicht einmal an. „Ich hab Pause“, wiederholte er stur. „Die mach ich auch. Wenn du natürlich gleich selbst die Lieferung mit dem Bollerwagen den Berg hoch ins Kurhotel bringen willst … Der Schulte von der Druckerei hat mich grad erst gefragt, ob ich nicht bei ihm Laufbursche sein will.“
Die Ladenglocke beendete abrupt die Pattsituation. Emma musste zurück, da konnte selbst Olaf sich ihr nicht mehr in den Weg stellen. Er rückte gerade so weit zur Seite, dass sie sich an ihm vorbeizwängen konnte. Mit seinem Mund kam Olaf ihrem Ohr ganz nahe. „Ich krieg dich noch“, zischte er ihr zu. Emma unterdrückte das Zittern, das in ihr aufstieg. Niemals sollte Olaf glauben, sie hätte Angst vor ihm. Sie hatte keine Angst vor ihm. Es war Wut, die sie beinahe zittern ließ. Wut über seine Unverschämtheiten und Wut über die eigene Ohnmacht, weil sie sich gegen ihn nicht so wehren konnte, wie er es verdiente. Schon bei Lüders hatten ihr die Eltern nicht geglaubt, dass der Doktor ihr nachstellte. Sie hatte sechs Teller des guten Geschirrs zerbrechen müssen, doch erst als ihr die Perserkatze aus dem Haus entwischte, war Frau Lüders zu Emmas Eltern gegangen. Dieses unfähige Kind könne sie nicht länger beschäftigen.
Noch einmal fuhr sich Emma durch die Haare und vergewisserte sich, dass keine Strähne aus dem Zopfband gerutscht war. Endlich strich sie die saubere Schürze glatt und sah der neuen Kundin entgegen. „Tante Charlotte!“ Emma spürte ihre Wangen vor Freude glühen, als sie Opa Marls jüngere Schwester sah. „Was darf ich dir geben? Wir haben frischen Salat hereinbekommen. Dank der Gewächshäuser ist er immer früher zu haben.“
Emmas Großtante, die von der ganzen Stadt nur Tante Charlotte genannt wurde, drückte Emmas Arm. „Kaffee“, sagte sie so energisch, dass Emma lachen musste. „Du versuchst doch nicht noch immer, aus dem Kaffeesatz zu lesen, Tante Charlotte“, spottete sie liebevoll. „Das wird nicht einmal Pastor Weiler gefallen, wenn er davon erfahren sollte. Von unserem Kaplan will ich gar nicht reden.“
„Schnickschnack“, wischte die Vierzigjährige die Bedenken weg. „Wen sollte stören, was ich rein zu meinem Vergnügen mache?“ Sie nahm Emma am Arm und ließ sich von ihr hinüber zu den Kaffeesorten führen. „Obwohl in letzter Zeit manchmal beunruhigende Bilder zu sehen sind.“ Charlotte Marl schüttelte ihre angegrauten Haare aus dem Gesicht und lachte schon wieder. „Aber sicher verstehe ich da nur etwas falsch. Und drum, Kind. Gib mir noch von den Printen.“
*
Emma hockte auf ihrem Bett. Es war der einzige Platz im Fachwerkhäuschen, von dem sie sagen konnte, dass es ihr eigener war. Von unten drang das Rattern der Nähmaschine herauf. Mutter verdiente mit Änderungsarbeiten ein wenig Geld dazu. Emma strich gerne über die feinen Stoffe der Kleider und stellte sich dabei vor, einmal so eines zu tragen. Schon als Kind hatte sie es geliebt, zwischen den Stoffen und Schnittmustern zu sitzen und zuzuhören, wie Mutter mit einer Kundin über Vor- und Nachteile von Kleidern und Röcken redete. Vielleicht hatte das in ihr den Wunsch geweckt, Menschen anzukleiden und Verkäuferin in einer Boutique oder gar einem dieser großen Kaufhäuser zu werden. Nachdem Emma die Stellung bei Lüders verloren hatte, ließ Mutter sich jedoch gerade noch dazu umstimmen, Emma eine Lehre in einem Lebensmittelladen machen zu lassen. Emma schüttelte die dummen Gedanken ab und wandte sich wieder den Münzen zu, die vor ihr auf der Bettdecke ausgebreitet lagen. Frau Schmidtkes Vorfreude auf Ostern hatte ungewöhnliche Eigenschaften an ihr zutage gebracht. Bei Emmas Anblick in der neuen Schürze ließ sie kein Donnerwetter wegen mangelnder Achtsamkeit und der Kosten über das Mädchen hereinbrechen. Stattdessen lächelte sie zustimmend und sagte in einem ruhigen Augenblick sogar, dass Emma recht daran getan habe, sich ebenfalls für die Ostereinkäufer herauszuputzen. Frau Schmidtke hatte sogar eigenhändig ein gelbes Haarband aus dem Ständer genommen und es um Emmas Zopf gebunden. „Ein kleines, vorgezogenes Ostergeschenk“, hatte sie gesagt, dabei sollte das Band eigentlich fünfzig Pfennige kosten.
Emma stand auf und ging hinüber zur Kommode. Sie nahm ihr Erspartes und zählte es noch einmal durch, bevor sie es wieder ordentlich einsammelte und in dem kleinen Säckchen unter ihrer Wäsche versteckte. Es musste einfach reichen. Gleich morgen in ihrer Mittagspause würde sie hinübergehen und in dem kleinen Laden von Viola Rodert ihre erste Jeans erstehen. Emma schmiss sich auf das Bett und trommelte mit den Beinen auf die Bettdecke. Ihre erste eigene Jeans! Von ihrem eigenen Geld. Und das, wo sie erst sechzehn war. Selbst den Cousin Franz, der schon in Köln studierte, hatte sie noch nie in einer Nietenhose gesehen. Nur ganz hinten in Emmas Kopf flüsterte eine böse Stimme. Emma machte die Musik ihres Plattenspielers etwas lauter – in der Hoffnung, dass es Peggy March gelingen würde, das schlechte Gewissen zu verdrängen. Doch die Stimme zischte nur noch lauter. „Ungehörig“, nannte sie Emma. „Verschwenderisch! Wo die Mutter sich an der Nähmaschine den Rücken krumm arbeitet und der Vater bei den Neubauten in jeder freien Stunde schwarzarbeitet, damit das Geld langt.“ Emma hielt sich die Augen zu, um die auf der Wand verlegten Strom- und Wasserleitungen nicht sehen zu müssen. Nicht die morschen Fensterrahmen und den bröckelnden Putz, all die Reparaturen, für die das Geld fehlte. Und sie wollte sich etwas kaufen, von dem sie nicht einmal wusste, zu welcher Gelegenheit sie es anziehen sollte. „Böse Emma“, zischte es in ihrem Kopf mit Mutters Stimme. Emma hatte dem nichts entgegenzusetzen als hastig fortgewischte Tränen.
*
Emma drehte sich vor dem hohen Spiegel hin und her.
„Die Jeans steht dir ausgezeichnet“, lobte Trine, das Lehrmädchen. Sie stand mit vor der Brust verschränkten Armen neben ihrer Kundin und schaute Emma lächelnd zu. „Ist das deine erste?“
Emma konnte nur nicken. Trine trug selbst Jeans und ein enges T-Shirt. Aber Trine galt in der Stadt auch als unmöglich, scheinbar ohne sich etwas daraus zu machen. Emma wagte nicht, sich vorzustellen, was ihre Eltern sagen würden, wenn sie in so einer Aufmachung nach Hause käme. Besonders Mutter wäre entsetzt und würde behaupten, dass anständige junge Männer so gekleidete Mädchen niemals ansehen würden. Sie wollte sich nicht einmal ausmalen, was sie allein zu der Hose sagen würde. Mutter trug bis heute nur Röcke. Alles, was sie Emma bisher gestattet hatte, waren weite Cord- oder Stoffhosen. Aber diese Jeans …
„Am besten sitzt sie, wenn du dich mit ihr in die Badewanne setzt“, erklärte Trine. Emma starrte sie entsetzt an. Sie dachte an die samstäglichen Badezeremonien in der heimischen Küche. Wenn auf dem Herd das Wasser erhitzt wurde und erst der Vater und dann nacheinander Mutter und die Kinder in die Zinkwanne stiegen, die sonst im Keller hinter der Waschbütte stand.
Trine lächelte ihr zu. „Aber sie passt dir ja auch so.“
Emma betrachtete ihr Spiegelbild, schaute, wie sich der feste Stoff hauteng an ihre Beine schmiegte. Sie war froh, dass auch die Stimme in ihrem Kopf den Augenblick ehrte, indem sie wenigstens für den Moment Ruhe gab. „Guten Tag, Emma.“
Mit Schwung war Emma aus dem Laden getreten, die Schellen über der Tür bimmelten noch aufgeregt. Die Papiertüte knisterte in ihrer Hand, als wäre die Jeans in ihrem Inneren genauso aufgeregt. Schuldbewusst hielt Emma beim Klang von Kaplan Schweikerts Stimme inne. Zu oft hatte sie ihr sonntags schon bei den Predigten lauschen müssen. In der Messe, wenn Schweikert über Sünde und Buße predigte. Wenn er über die Verführungen des Fleisches und Evas Sündhaftigkeit so anschaulich referierte, dass nicht nur Emma die Schamesröte ins Gesicht stieg. Sie drückte die Tüte an sich, als könnte Schweikert sie ihr wegnehmen. Dabei hatte Emma die Hose bezahlt, mit dem, was übrig geblieben war von ihrem Lehrgeld, nachdem sie Mutter und Vater ihren Anteil gegeben hatte. Emma wusste, dass Pastor Weiler ihrem Kauf wohlwollend begegnet wäre. Aber der gutmütige alte Priester war Seelsorger der Nachbargemeinde und nicht für die Christenkinder in der Stadt zuständig.
„Guten Tag, Herr Kaplan.“ Emma wollte, dass ihre Stimme fest klang und versuchte, den jungen Geistlichen offen anzublicken. Sie merkte selbst, dass ihr beides nicht recht gelang. Später würde sie sich darüber ärgern, jetzt wollte sie nichts anderes als weitergehen, zurück zu Feinkost Schmidtke.
„Ich würde mich freuen, wenn du einen kleinen Moment Zeit für mich hättest, Emma.“ Schweikert mühte sich ein Lächeln ab, sein Blick blieb jedoch streng wie immer. Emma hatte ihn noch nie aufrichtig lächeln sehen. Niemand hatte das. Sie schaute verlegen zum Laden hinüber. Frau Schmidtke trat mit der Stange für die Markise aus der Tür, hängte die Kurbel ein und drehte mit schnellen heftigen Bewegungen das Sonnendach heraus. Das Gestänge quietschte rhythmisch.
Emma straffte auf ihrer Straßenseite die Schultern und lächelte den Kaplan offener an. „Ich muss mich jetzt leider beeilen.“ Sie war erleichtert, dass sie nicht lügen musste. „Frau Schmidtke macht den Laden wieder auf. Ich muss rüber, sonst komme ich zu spät.“
„Du bist sehr pflichtbewusst, Emma.“ Kaplan Schweikert klang nicht, als würde er sie loben. „Natürlich musst du jetzt Frau Schmidtke helfen. Aber es ist ja Karwoche und du warst noch nicht zur Beichte. Warte damit nicht zu lange, und wenn du kommst, nimm dir doch bitte ein bisschen Zeit für ein Gespräch mit mir. Ich bin Seelsorger, Emma.“
Emma nickte, damit der Kaplan sie gehen ließ. Niemals würde sie zu ihm in den Beichtstuhl gehen. Mit Oma hatte sie das schon verabredet. Mit ihr und ihrer Großcousine Tilda zusammen würde sie in Omas Kirche bei Pastor Weiler ihre Beichte ablegen. Der rundgesichtige Seelsorger entsprach eher dem Bild des Beichtvaters, das Emma hatte. Weiler war verständnisvoll, gerecht und hatte ein Einsehen für das, was andere Erwachsene oft als Rebellion der Jugendlichen bezeichneten. Die Tüte schlug Emma gegen die Beine. Sie wusste nicht, was an einer Hose rebellisch sein sollte. Das wussten nur Kaplan Schweikert und Mutter.
Frühsommer 2018
Tim hatte geglaubt, nach Mamas Tod müsste die Welt stillstehen. Jeder müsste wissen, dass er Schuld hatte an ihrem Tod, und mit dem Finger auf ihn zeigen. Keines von beidem geschah. Jeder wollte Tim trösten, doch niemand fand dafür die richtigen Worte. Sie schimpften auf den Autofahrer, sprachen von Raserei; die Tatsache, dass Mama die Ampel missachtet hatte, wurde geflissentlich ignoriert.
Papas Eltern, Oma Tilda und Opa Karl, reisten aus der Eifel an, um mit ihm die Angelegenheiten mit dem Beerdigungsinstitut zu klären. Todesanzeigen mussten verschickt werden. Mamas Chef, Tims Schule, der Kindergarten mussten von irgendjemandem informiert werden … Die Frage nach dem Sarg wurde enorm wichtig – und Trauerkleidung. Papa hatte zwar schwarze Hosen, aber nur bunte Hemden. Marie hatte gar nichts Schwarzes. Und Tims schwarze T-Shirts wollte Oma nicht gelten lassen, wegen der Texte darauf. Tim ließ Oma gewähren – ließ sich wortlos von ihr durch die Stadt ziehen. Es war so egal, was er anzog. Mama hatte es eilig gehabt. Keine schwarze Hose, kein schwarzes Hemd würde etwas daran ändern. Wieder zu Hause zog Tim eines der neuen schwarzen Hemden zu einer schwarzen Hose an. Vor dem großen Spiegel im Elternschlafzimmer, dort, wo früher Mama immer gestanden hatte, bevor die Erwachsenen auf eine Feier gingen, betrachtete er sich. Im Rücken das große Bett, die Decke auf Mamas Seite ordentlich gefaltet. Papas Seite leer. Er schlief seit dem Mittwoch im Gästezimmer.
Ohne jemandem Bescheid zu sagen, ging Tim aus dem Haus. Die Straße hinunter an der Ecke gab es einen Friseursalon. Dort setzte er sich auf einen Stuhl und sah im Spiegel zu, wie die Friseurin seine blonden Haare der Kleidung anpasste.
*
So wortlos, wie er gegangen war, kam er zurück ins Haus, setzte sich zu Oma und Opa, Papa und Marie an den Tisch und aß mit ihnen zu Mittag. Keiner kommentierte die Haare. Papa wischte sich nur wieder über die Augen.
Gleich nach dem Essen verschwand Marie. Tim war es, der sie irgendwann suchen ging; das auch nur, um mit jemandem zu reden, der nicht von Kränzen, Särgen und Grabsteinen sprach.
Marie hockte in ihrem Zimmer auf dem Boden. Die schwarze Dose der Fingermalfarbe hatte sie vor sich hingestellt. Mit der einen Hand hielt sie Graubart Leckerbissen hin. Mit der anderen trug sie die schwarze Farbe dick auf sein ehemals graues Fell auf. Ihre eigenen blonden Haare hatte sie bereits mit der schwarzen Schmiere bedeckt. Schwarze Streifen zogen sich über ihre Wangen. Farbbrösel verschmierten das Laminat um sie herum. Das war das erste Mal, dass Tim die Tränen kamen. Er zog seine kleine Schwester an sich und presste sein Gesicht in ihre schmierig schwarzen Haare.
Es fiel ihm schwer, Maries Werk zu zerstören. Aber als der Kater versuchte, die Farbpaste von seinem Fell zu lecken, verstand selbst Marie, dass es sein musste. Tim hielt Graubart in der Badewanne fest, während Marie mit lauwarmem Wasser aus dem Brausekopf die Farbe herausspülte. Die Katzenkrallen hinterließen dicke blutige Striemen auf Tims Armen. Er schaute zu, wie das Blut sich mit dem schwarzen Wasser vermischte, und wunderte sich, wie gut sich das Brennen anfühlte.
Später half Tim Marie beim Haarewaschen. So etwas hatte er noch nie getan. Schwarze Schlieren liefen über das weiße Porzellanbecken zum Abfluss. Der Schaum verfärbte sich dunkel. Fünfmal musste Tim das Shampoo ausspülen und neues auftragen, bevor der letzte Farbrest beseitigt war.
*
Während der Beerdigung hielt Tim Maries Hand ganz fest in seiner. Der Sarg stand aufgebahrt vor dem Altar. Kränze waren um ihn herum arrangiert – mit roten Rosen, orangefarbenen Gerbera, weißen Nelken und gelben Gladiolen. Der Küster zupfte noch an den schwarzen und weißen Schleifen herum, und drapierte sie so, dass man die Schrift darauf gut lesen konnte:
Für Susanne in treuem Gedenken, Familie Sommer.
Meiner lieben Schwester in Erinnerung, deine Martina.
Unserer Mitarbeiterin Susanne Bertram zum Abschied,
das Kollegium.
Oben auf dem Sarg war ein großes Herz mit Rosen in Mamas Lieblingsfarben Gelb und Orange. Eine weiße Schleife mit schwarzen Buchstaben war daran gebunden, darauf standen ihre Namen – Stefan, Tim und Marie. Nichts konnte das ausdrücken, was sie fühlten.
Von hinten fuhr jemand mit der Hand erst durch Tims schwarze und dann durch Maries blonde Haare.
„Opa Karl“, flüsterte Marie. Tim starrte nur noch eine Idee düsterer auf den Sarg. Er musste das alles über sich ergehen lassen. Er hatte kein Recht, sich gegen irgendetwas zur Wehr zu setzen. Seine Schuld war es, dass Mama dort lag. Ganz allein seine Schuld! Er hätte nur auf ihre Whatsapp reagieren müssen. Hätte er das Spiel Spiel sein lassen und Marie vom Kindergarten abgeholt … Dann wäre Mama nicht bei Rot über die Kreuzung gelaufen, ohne zu schauen, ob ein Auto kommt. Dann hätte der Fahrer sie nicht mit der Motorhaube erwischt. Sie wäre nicht hochgeschleudert worden und auf den Asphalt geprallt. Tim hätte nur auf Mamas Whatsapp reagieren müssen, und das eine Mal Marie vom Kindergarten holen. Er griff in die Seitentasche seiner schwarzen Hose, steckte die Ohrstöpsel in die Ohren und hörte zum hundertsten Mal die Sprachnachricht an.
„Prima, Tim. Da wäre ein einziges Mal deine Hilfe wirklich nötig gewesen. Meinst du, es ist ein Spaß, wenn Maries Tagesmutter sich auf dem Weg zu ihr das Bein bricht? Auf dich braucht man gar nicht zählen! Besten Dank auch. Ich werde jetzt loshetzen und Marie abholen!“
Er zog die Stöpsel wieder heraus und steckte alles zurück in die Tasche. Neben sich hörte er Papa schnäuzen. Bis jetzt hatte er ihm Mamas Nachricht nicht vorgespielt. Marie rutschte näher an ihn heran. Orgelmusik setzte ein. Die Begräbnismesse begann. Tim wünschte sich weit fort.
*
Papa hatte mit Marie und Tim Oma Tilda und Opa Karl zum Bahnhof gebracht. Anschließend hatte Marie den Tisch für das Abendessen gedeckt. Tim hatte sich an den Herd gestellt und die restlichen Kartoffeln des Mittagessens gebraten.
„Prima macht ihr das“, war Papas Kommentar. Dazu, dass sie nur den kleinen Tisch in der Küche gedeckt hatten, sagte er nichts. Marie hatte wie Mama Rosenblüten im Garten geschnitten und sie in einer flachen Schale auf den Tisch gestellt. Dort machten sie jetzt der Wurst und dem Käse den Platz streitig. Beim Einschenken schwappte Marie auch noch die Milch über, das machte im Blumenwasser weiße Schlieren. Papa stand wortlos auf, nahm die Schale und kippte ihren Inhalt in die Toilette. Marie senkte den Kopf tief über den Teller. Sie ließ ihre sonst immer zappelnden Beine beinahe leblos über dem Boden hängen. Tim fasste seine Gabel fester und piekste eine Kartoffel auf. Beinahe war es eine Erlösung, als sich Papas Piepser meldete. Kommentarlos ging Papa hinüber ins Arbeitszimmer zum Telefon. Von dort rief er immer in der Klinik an. Aber seit Mamas Tod war es das erste Mal, dass er gerufen wurde. Seit Mamas Tod war es das erste Mal, dass sie nur zu dritt am Tisch saßen. Keine Oma, kein Opa mehr, die über die Lücke hinwegtäuschten.
Weder Tim noch Marie schauten von ihren Tellern auf, als Papa wieder in die Küche kam. Es war anstrengend, sich auf sein Essen zu konzentrieren. Papa war schon fort, das merkten sie beide. In Gedanken war er bereits in der Klinik bei den Tieren, betrachtete Röntgenbilder und analysierte Blutwerte.
„Marie muss um sieben ins Bett“, sagte er noch. „Morgen ist Kindergarten. Ich weiß nicht, wie lange es dauert.“ Er machte eine Pause. Beinahe hörte Tim ihn denken. „Ich weiß nicht, ob ich zum Frühstück zurück bin“, setzte er dann hinzu. „Du musst Marie am Kindergarten vorbeibringen, Tim.“
Einmal nur hätte Tim seine Schwester abholen müssen, ein einziges Mal. Er wusste das. Er hätte sich nie wieder um sie zu kümmern brauchen. Jetzt konnte er nie wieder Nein sagen. Trotzdem brachte er es nicht über sich, zu nicken.
„Hast du gehört, Tim?“ Papas Stimme wurde drängender. „Nur dieses eine Mal.“
Tim schmiss die Gabel auf den Teller und lachte los. Laut und böse. Er sah seinen Vater an und hatte das Gefühl, ihn zum ersten Mal zu sehen. Eingefallen war er, Falten waren um seine Augen, die dort früher nicht gewesen waren. Seine Haare waren grau, fast weiß. Vielleicht meinte er das auch nur, weil Papa früher nie schwarze Kleidung getragen hatte.
„Das glaubst du doch selbst nicht“, widersprach Tim. „Du weißt genauso gut wie ich, dass das nun immer so sein wird!“
„Tim.“ Papa stand noch immer im Türrahmen, machte keinen Schritt auf ihn zu. Fort war er schon, eigentlich. In der Klinik, bei einem Pferd, einem Hund oder vielleicht einem Kamel aus dem Zoo.
„Ist okay“, sagte Tim. „Wirklich. Ich bring Marie in den Kindergarten. Morgen, übermorgen und immer. Aber lüg uns nicht an! Lüg uns einfach nicht an! Wem, glaubst du, kannst du was vormachen? Dir selbst?“
*
Sie waren allein im Haus. Marie und Tim. Selbst Graubart hatte es vorgezogen, die Nacht auswärts zu verbringen. Immer länger wurden seine Ausgänge, immer weiter der Radius, in dem er sich draußen bewegte. Fast war es, als suchte er Mama, weil doch niemand einem Kater erklären konnte, wo sie nun war. Marie war wieder aus dem Bett gekommen, als Tim noch im Wohnzimmer saß und eigentlich diesen Film sehen wollte. Der war nun wirklich nichts für Sechsjährige.
„Geh rauf“, sagte er zu ihr. „Morgen ist Kindergarten. Du musst schlafen.“
Marie schüttelte den Kopf. Sonst machte sie nichts. Nur mitten im Raum stehen und mit dem Kopf schütteln. Tim wedelte mit der Hand, als wäre sie eine Fliege, die er so verscheuchen konnte. Konnte er aber nicht.
„Verpiss dich“, knurrte er deshalb. Da liefen Tränen über ihr Gesicht.
„Scheiße!“ Mit der Faust schlug Tim auf die Sofalehne, dass der Staub nur so aufwirbelte. Marie stand da in ihrem dünnen Nachthemd und zitterte. „Was, wenn Mama von oben doch nicht auf uns aufpasst?“, flüsterte sie. „Was, wenn wir doch allein sind?“
„Wir sind nicht allein!“ Tim sagte es viel zu laut. Während der Film noch über den Bildschirm flimmerte, sprang er auf und drückte sie fest an sich. „Wir sind nicht allein“, sagte er leiser. „Du und ich. Wie kannst du sagen, wir wären allein?“
Er hatte keine andere Möglichkeit, als Marie mit in sein Bett zu nehmen. Erst da unter seiner Decke hörte ihr Zittern auf. Endlich schlief sie und ihr ruhiger Atem neben ihm brachte auch Tim zur Ruhe. Ihre Wärme erinnerte ihn daran, dass er nicht wirklich allein war. Er wusste nicht, ob ihm das lieber gewesen wäre.
Frühjahr 1965
Mutter und Lenchen hatten sich schon die guten Mäntel übergezogen. Emma trödelte, dabei wusste sie, wie schnell Mutter ungeduldig wurde. Nach der Beichte musste sie weiter am Kleid der Frau Bürgermeisterin arbeiten. Zu Ostern sollte es fertig sein und bis dahin waren es nur noch vier Tage.
Emma hatte gesagt, dass sie mit Oma zur Beichte wollte. Wie gerne hätte sie ein Telefon im Haus gehabt, damit Oma selbst mit Mutter darüber sprechen konnte. Aber das nächste Telefon gab es erst bei Sengsmeiers am Ende der Straße. Das nutzten sie nur in wirklich wichtigen Angelegenheiten. In Angelegenheiten, die Mutter für wichtig befand.
Emma strich noch einmal über den derben blauen Stoff ihrer Jeans, bevor sie wehmütig die Schranktüren schloss. Niemandem hatte sie ihren Schatz gezeigt, nicht einmal Lenchen, ihrer zehnjährigen Schwester, die mit ihr die Kammer teilte. Sie strich den Wollstoff ihres Kleides glatt und zog den Mantel darüber. Als einziges Zugeständnis an ihre Eitelkeit ließ sie die braunen Schnürschuhe stehen und zog ihre guten blauen Pumps an. Schließlich würden sie in die Kirche gehen.
*
Ihre Schritte hallten laut auf dem Kopfsteinpflaster. Mutter warf Emma einen mahnenden Blick zu. Emma packte ihre Handtasche fester, als könnte ihr das Halt geben. Mutter und Schwester hatte sie noch nicht gesagt, dass Kaplan Schweikert sie im Anschluss an die Beichte sprechen wollte. Hoffentlich kamen vor Ostern so viele Beichtkinder, dass der Kaplan keine Zeit für ein Gespräch hatte. Könnte sie doch nur bei Oma zur Beichte, dann bräuchte sie sich keine Gedanken machen. Aber Mutter zog Schweikerts Strenge vor. Pastor Weiler war in ihren Augen viel zu nachgiebig.
Mutter stieg die Stufen zur Kirche hinauf. Die drei Marls knieten sich in eine Bankreihe neben den Beichtstühlen. Mutter und Töchter schlugen das Kreuzzeichen und senkten den Kopf zum Gebet. Emma war sich sicher, dass ihre Mutter tatsächlich das „Gegrüßet seist du, Maria“ murmelte. Bei Lenchen wusste sie es nicht genau.
*
Als Lenchen den Beichtstuhl verließ und sich zurück in die Bank kniete, um ihre Bußgebete zu leisten, stupste Mutter Emma in die Seite. Beim Hineingehen zog Emma den Vorhang des Beichtstuhls hinter sich zu und ließ sich auf dem Büßerbänkchen erneut auf den Knien nieder. Hinter dem Gitter konnte sie schemenhaft die Gestalt Schweikerts ausmachen. Hier drinnen war es noch düsterer als im Kirchenschiff. Emma machte das Kreuzzeichen und flüsterte in Richtung Gitter: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
Ebenso leise und ungewohnt eindringlich kam die tiefe Stimme des Kaplans zu ihr zurück: „Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit.“
„Amen“, antwortete Emma, ohne den Sinn seiner Worte zu verstehen.
„Nun bekenne offen und ehrlich alle deine Sünden, Kind, dass ich dich lossprechen kann von ihnen.“
Emma runzelte die Stirn. Sie wusste, dass die eindringlichen Worte des Kaplans ihr etwas sagen sollten. Sie wusste nur nicht, ob es diesmal mehr war als das Übliche. Ein hochgezogener Rocksaum war in den Augen des Kaplans bereits ein Zeichen für Wollust. Eine hübsche Haarschleife eines für Eitelkeit. Im Firmunterricht hatten die anderen Mädchen im letzten Jahr über Schweikert gelästert. Für Schweikert müsse eine Frau in Sack und Asche gehen. Jede andere mache sich für ihn der sieben Todsünden gleichzeitig schuldig.
Ein ungeduldiges Hüsteln von der anderen Seite des Gitters mahnte Emma, sich auf die Beichtregeln zu besinnen. Im Gesangbuch der Kirche war ein offizielles Sündenregister abgedruckt. Für Schweikert war die Beichtpflicht erst erfüllt, wenn es abgearbeitet war. Emma hangelte sich von einem Punkt, der ihr einfiel, zum nächsten. „Ich bekenne, mich der Eitelkeit schuldig gemacht zu haben, als ich vor dem Spiegel die neu gelieferten Haarschleifen ausprobierte. Ich bekenne ebenfalls, mich des Geizes schuldig gemacht zu haben, als ich meiner Schwester nichts von der Schokolade abgegeben habe, die ich von einer Kundin geschenkt bekam. Ich bekenne, mich der Genusssucht schuldig gemacht und das Fasten gebrochen zu haben, als es mir nicht gelang, die Schokolade bis Ostern zu verwahren.“
Mühsam arbeitete Emma das Sündenregister ab, ohne wirklich etwas zu bereuen. Das einzige Schuldgefühl, das in ihrem Bauch nagte, kam von all diesen ausgedachten Verfehlungen. Lügen sollte sie einem Kaplan eigentlich nicht erzählen. Sie war erleichtert, als sie endlich mit den Worten „Ich bereue, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Erbarme dich meiner, o Herr“ diese Farce beenden konnte. Ihr war bewusst, dass sie all die Dinge verschwiegen hatte, die in ihren eigenen Augen der Beichte bedurften. Nichts hatte sie gesagt von ihrer Sehnsucht nach dem ersten Kuss. Verschwiegen hatte sie den Blick, den sie auf Hannes nackten Oberkörper erhaschen konnte. Tief in ihr vergraben blieb, wie sehr sie diesen Blick genossen hatte. Während Schweikert die Worte der Lossprechung über Emma sagte, fragte sie sich, ob auch eine unvollständige Beichte ihren Zweck erfüllte. Sie hoffte es jedenfalls.
„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden“, schloss Schweikert unterdessen. „Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden.“ Er machte eine kurze Pause. „Bitte komm gleich zu mir in die Sakristei, Emma.“
Obwohl Emma damit gerechnet hatte, fragte sie sich, ob es etwas mit all ihren ausgelassenen Sünden zu tun hatte. Sie hatte Zeit genug dazu, während sie die ihr aufgetragenen Vaterunser betete und Mutter mit der Beichte an der Reihe war.
*
Das Klackern ihrer Pumps hallte durch die Kirche, als Emma durch den Mittelgang zur Tür der Sakristei ging. Sie wünschte sich, sie hätte ihre Schnürschuhe angezogen. Mit den Blicken der übrigen Beichtkinder in ihrem Rücken wollte sie sich gar nicht vorstellen, was die von ihr dachten. Sicher meinten sie, Emma habe etwas ganz Schlimmes zu beichten gehabt, wenn sie nach der Beichte zum Kaplan in die Sakristei musste.
„Was wollen Sie denn mit mir besprechen?“, fragte sie, gleich nachdem die Tür hinter ihr geschlossen war.
„Setz dich erst einmal, Emma.“
„Lenchen und die Mutter warten vor der Kirche, Herr Kaplan.“
Kaplan Schweikert schob ihr einen Stuhl hin und setzte sich ihr gegenüber an den kleinen Tisch, der inmitten des Raumes stand. Emma blieb nichts anderes übrig, als sich ebenfalls zu setzen. Sorgfältig strich sie Mantel und Wollkleid gerade, damit der anschuldigende Blick des Kaplans nur ja nicht auf eines ihrer Knie fallen konnte.
„Emma, du hast mich enttäuscht.“
Emma starrte auf die Spitzen ihrer blauen Pumps und überlegte, worauf der Kaplan sich beziehen könnte. Er konnte nichts von ihren geheimen Gedanken wissen. Nein, selbst er konnte das nicht.
„Du hast deine schlimmsten Sünden nicht gebeichtet.“ Seine Stimme wurde strenger und passte gar nicht zu dem väterlichen Tätscheln seiner Hand auf ihrem Arm. Am liebsten hätte sie ihren Arm fortgezogen. Stattdessen verteidigte sie sich mit einer neuerlichen Lüge: „Ich habe alles gebeichtet!“
Schweikert schüttelte den Kopf. „Auch Lügen gehören zu den Sünden, Emma. Im Firmunterricht warst du so ein fleißiges, gläubiges Kind. Was ist mit dir passiert?“
„Ich bin immer noch fleißig – und gläubig.“ Sie kniff die Lippen zusammen – war doch zumindest Letzteres nicht ganz die Wahrheit. Eine neue Lüge zu all den vielen, zu denen sie sich durch den Kaplan und die Beichte gezwungen sah.
Der Kaplan stand auf und trat hinter ihren Stuhl. Schwer legte er seine Hände auf ihre Schultern. „Geh in dich, Kind. Du bist in diesen Tagen nicht die Einzige, die zur Beichte kommt.“
Trotz des Unbehagens, das seine Berührung in ihr auslöste, hätte Emma beinahe laut gelacht. Natürlich war sie nicht die Einzige. Es war Karwoche. Jeder, der in der Osternacht die Kommunion empfangen wollte, musste zur Beichte. Und die Kommunion wollte jeder empfangen, allein um nicht dem Gerede in der Stadt anheimzufallen.
„Ein Junge hat mir gebeichtet“, wurde der Kaplan deutlicher. „Du musst dafür um Vergebung bitten, Emma. Zumindest diesen armen Jungen führst du in Versuchung. Bedrängst ihn durch deine Eitelkeit …“
Emmas Lachen übertönte die weiteren Worte des Kaplans. Erst als er sie fest an den Schultern rüttelte, gelang es ihr, sich zusammenzureißen.
„Du musst in dich gehen, Kind.“ Der Kaplan packte immer fester zu. Emma versuchte, sich ebenfalls von ihrem Stuhl zu erheben, aber Schweikert drückte sie auf ihren Sitz. „Du bist auf dem falschen Weg, Emma. Ein Mädchen ist gehalten, auf sich zu achten. Durch falsche Kleidung sind die jungen Männer gegen ihren Willen rasch in Versuchung geführt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was du in dem Laden erstanden hast, aus dem ich dich gestern kommen sah.“
„Der Laden?“ Emma dachte an die blaue Hose, die friedlich daheim im Schrank lag, deren rauen Stoff sie fast noch unter ihren Händen fühlte. „Ich habe mir nur eine Hose gekauft, fester Stoff, für … für Wanderungen, wenn wir im Juni Walderdbeeren pflücken und so …“
„Für Wanderungen?“
„Zum Beispiel.“
„Emma!“ Die Hände lasteten auf ihren Schultern wie die Schuld der Sünden, die er ihr unterstellte. „Du wärst so nah an diesem Jungen vorbeigegangen, dass deine Haare durch sein Gesicht strichen. Sogar im Schritt hättest du ihn berührt!“
Emmas Schultern bebten, sie schlug die Hände vors Gesicht und versuchte, die Geräusche, die ihrem Mund entwichen, zu ersticken. Olaf, dachte sie. Schweikert konnte einzig und allein von Olaf sprechen.
„Bereust du jetzt deine Sünden?“
Mit schnellen Schritten trat Schweikert um sie herum, riss ihre Hände vom Gesicht und blickte sie erwartungsvoll an. Emma konnte ihr Gelächter nicht länger verstecken. Unnatürlich laut hallte es von den Wänden der Sakristei wider.
„Emma!“ Schweikert war fassungslos. „Deine Beichte war völlig nutzlos.“
Noch immer wurde Emma von Lachen geschüttelt, doch der Ernst in der Stimme des Kaplans entging ihr nicht. „Ich habe“, sie musste Luft holen, „nichts getan. Er stand in der Tür.“ Wieder zwang dieser innere Drang, laut loszuprusten, sie dazu, innezuhalten. „Er wusste doch, dass ich in den Laden musste. Er hätte zur Seite gehen sollen. Und ich habe … ich habe mich gegen ihn gewehrt, ich habe mir seine Zudringlichkeiten vom Hals halten müssen. Dieser Junge wäre derjenige, der seine Schuld beichten müsste.“
„Er hat mir gebeichtet, mein Kind.“
„Hat er auch die Wahrheit gesagt?“, fragte Emma ungeachtet all der Lügen, die sie selbst von sich gegeben hatte. Kaplan Schweikert schüttelte langsam den Kopf. „Emma Elisabeth Marl, du musst sehr gut auf dich achtgeben. Die Sünde ist in dir. Ich bete für dich, dass du sie besiegst.“
„Aber …“
Schweikert schickte sie mit strenger Miene hinaus.
Frühsommer 2018
„Verdammt, Marie“, fluchte Tim. Er warf ihr die Jacke zu. „Mach schon! Ich schreibe gleich in der ersten Stunde eine Mathearbeit. Da muss ich pünktlich sein!“
„Ich finde aber meine Haarspange nicht!“
„Dann gehst du eben mit offenen Haaren!“
„Das darf ich nicht, heute ist Sport und da muss ich einen Zopf haben, sonst klebt mir die Erzieherin die Haare mit Tesafilm zusammen!“
„Macht die im Leben nicht!“
„Macht sie doch!“
„Oh, verdammt!“ Mehr als ein neuerlicher Fluch fiel Tim nicht ein. Abschneiden sollte man diese Haare, die sowieso nur Ärger machten, beim Bürsten und Waschen und überhaupt. Er sah auf die Uhr, doch dadurch wurde seine Laune auch nicht besser.
„Ich hab sie!“, jubelte Marie und rannte, ihren Teddybärrucksack auf dem Rücken, an ihm vorbei aus der Tür hinaus. „Wo bleibst du denn?“
Tim knallte die Haustür zu und sparte sich so den dritten Fluch. Er warf sich seine Tasche über die Schulter und verfiel in Laufschritt. „Komm schon!“, mahnte er seine Schwester. „Wir müssen jetzt rennen, ich muss anschließend noch zu meinem Bus laufen.“
„Ich hab Seitenstechen!“ Marie blieb einfach mitten auf dem Bürgersteig stehen. Tim nahm ihre Hand und zog sie hinter sich her. An Laufen war nicht mehr zu denken. Als sie endlich am Kindergarten ankamen, zeigte ein Blick auf die Uhr, dass Tims Bus fort war. Der nächste kam erst in zwanzig Minuten. Er lief zur U-Bahn-Haltestelle, um mit ein bisschen Glück wenigstens halbwegs pünktlich in der Schule anzukommen. Doch als Tims Bahn einfahren sollte, knarzte der Lautsprecher los: „Rauchbildung im Tunnel. Bahnverkehr eingestellt. Rauchbildung. Bitte verlassen Sie den Bahnsteig und weichen auf die Buslinien aus.“
*
„Die Mathearbeit hast du geschwänzt!“ Tim war am Nachmittag noch nicht zur Tür herein, als sein Vater ihn mit diesen Worten begrüßte. „Kannst du mir mal sagen, was du im Moment im Kopf hast? Dein Klassenlehrer hat mich in der Klinik angerufen!“
„Oh, entschuldige“, gab Tim zurück. „Ich hatte vergessen, ihm zu sagen, dass das natürlich nicht geht.“
Papas Hand zuckte. Tim sah es und Papa bemerkte seinen Blick. Er steckte die Hand erst hinter den Rücken, dann hielt er sie mit der anderen vor dem Bauch fest. Als wäre es die Hand, die schlagen wollte. Als könnte eine Hand Tim von ganz allein eine Ohrfeige verpassen.
„Tu dir keinen Zwang an.“ Tim starrte seinem Vater trotzig ins Gesicht. „Schlag ruhig, wenn es dich erleichtert. Ändern tut es doch nichts.“
„Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Meinst du nicht, dass Mamas Tod uns alle getroffen hat?“ Mit der linken hielt Papa die rechte Hand fest, damit sie sich nicht selbstständig machte.
Tim schnaubte spöttisch. „Ich soll mich zusammenreißen?“ Er schüttelte den Kopf. „Ich bin auf meinem Zimmer. Mathe lernen. Jetzt, wo du hier bist, kannst du ja das Mittagessen kochen und Marie heute Nachmittag zum Schwimmen bringen. Alles kann ich nämlich auch nicht.“
*
Tim wollte die Zahlen lesen. Die Formeln verstehen. Aber vor seinen Augen verschwamm alles. Die Buchseite wellte sich bereits vor Nässe. Blöd war das. Da hatte er einmal Zeit, schon schlichen sich dumme Gedanken in seinen Kopf. Er ging an die Stereoanlage und drehte die Musik laut auf. Joggen sollte er, Fußballtraining wäre jetzt gut. Alles war besser als denken. Er griff nach seinem Smartphone. Auf Whatsapp hatte Sebi eine Sprachnachricht geschickt: „Mensch, Alter! Mathe war scheißschwer! Hast du ein Schwein, dass Lehrer armen Waisen nichts tun. Unsereinem hätte Haucke den Kopf abgerissen. Kommst du wenigstens zum Training? Wenn du dauernd fehlst, schaffst du es nie in die erste Mannschaft!“
Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Für seinen besten Freund hatte er keine Worte. Andere schrieben ihm gar nicht mehr, behandelten ihn auch in der Schule wie einen Alien. Als wäre Tim jemand anderes, nur weil er die Mutter verloren hatte.
Es klopfte an der Tür. Graubart und Papa kamen herein. Der Kater sprang zielsicher auf Tims Schoß. Schnurrend rieb er seinen Kopf an Tims Hand. Noch halb in der Tür fragte Papa: „Darf ich?“ Tim zuckte die Schultern. Er konzentrierte sich auf das Fell des Katers.
Vorsichtig stakste Papa herein. Er versuchte Kickerhefte und alte Socken, die wahllos über den Fußboden verstreut waren, zu vermeiden und schaufelte sich einen Sessel frei, in den er sich fallen ließ. „Marie ist schwimmen“, sagte er. „Frau Neuberger hat sie mitgenommen. Laura geht in die gleiche Gruppe.“
Tim hob nur noch einmal seine Schultern und tat, als suche er das dichte Katzenfell nach Zecken ab.
„Es läuft im Moment nicht so gut bei uns“, begann Papa aufs Neue. „Ich mache meine Sache wohl nicht so toll.“
Tim seufzte laut und drehte sich auf seinem Schreibtischstuhl zu ihm. Die Bewegung verscheuchte Graubart, der mit wenigen Sätzen wieder zur Tür hinaus war.
„Was willst du?“ Tim starrte dem Kater enttäuscht hinterher. Umso anstrengender war es für ihn, einen abweisenden Blick aufzusetzen, als er sich zu seinem Vater umdrehte. Er zeigte auf seinen Schreibtisch. „Ich soll morgen die Arbeit nachschreiben. Mathe ist nicht mein Fall. Also sag jetzt, was du willst, damit ich hier weitermachen kann.“
Tim sah, wie Papa tief Luft holte, wie er sich aufrichtete, innerlich, für das, was er sagen wollte. Er hat noch keine Neue, dachte Tim. Nein, so schnell hat Papa noch keine Neue. Mama ist gerade erst drei Wochen … So schnell geht das nicht.
Dabei wusste er, wie schnell das ging. Damals, als er sich in Jana aus der Achten verliebt hatte, da hatte es auch gereicht, sie ein- oder zweimal im Bus zu sehen. Nur hatte er da nicht den Mut, mit irgendjemandem drüber zu reden. Nicht einmal mit Sebi. Vor allem nicht mit Sebi. Auch über Mama hatte er mit Sebi noch nicht geredet. Mit niemandem hatte er darüber geredet. Nicht einmal denken wollte er daran.
„Ich hab mit Oma gesprochen“, sagte Papa. „Als sie noch hier war, hat sie es schon vorgeschlagen. Aber da habe ich noch gedacht, wir kriegen das allein hin.“ Er schüttelte den Kopf. „Nichts kriegen wir allein hin. Hier nicht, und in der Klinik klappt auch nichts mehr.“ Papa kniff die Lippen zusammen und schaute Tim tatsächlich in die Augen. „Eine OP habe ich vergeigt. Reine Routine war das, aber meine Hände haben gezittert. Ich konnte das Skalpell nicht halten. Was soll ich in der Klinik, wenn ich nicht mal mehr operieren kann?“
Tim sah seinen Papa nur an. Er sagte nichts. Was hätte er auch dazu sagen sollen? Natürlich klappte nichts mehr. Wie sollte es das auch, wenn doch Mama nicht mehr da war. Mama, die dafür gesorgt hatte, dass alles reibungslos lief.
„Oma hat schon mit Opa gesprochen. Meinem Vater wird seine Arbeit auch allmählich zu viel. Die beiden würden sich sehr freuen.“
Tim hörte, was Papa sagte, aber die Worte machten keinen Sinn. Das Wichtigste schien an ihm vorbeizugehen. „Was hat Oma mit Opa besprochen?“, hakte er nach. Tim beugte sich auf seinem Stuhl nach vorne in Richtung Papa, als könnte er so verhindern, dass ein Wort zwischen ihnen verloren ging.
„Dass wir zu ihnen ziehen.“ Papa schüttelte sich kurz, als würde ihm jetzt erst bewusst, dass er laut mit Tim gesprochen hatte. „Habe ich nicht gesagt, dass Oma das vorgeschlagen hat? Wir sollen bei ihnen wohnen. Oma könnte sich um euch kümmern, wenn ich Opa in der Tierarztpraxis unterstütze. Keine großen OPs für mich und Marie und du, ihr kämt pünktlich überallhin.“
„Du machst Witze!“, platzte Tim heraus. Er starrte seinen Vater an, wollte, dass dieser die Worte zurücknahm. „Wir ziehen nicht in die Eifel! Das kann nicht dein Ernst sein! Die wissen doch nicht mal, wie man Fußball schreibt, geschweige denn, dass die von irgendwas anderem eine Ahnung haben!“
Papa verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich auf dem Sessel zurück. „Dir hat es doch immer gut gefallen, wenn wir die beiden dort besucht haben. Oma Eifel hast du gesagt. Und Wochen später wolltest du noch Printen essen.“
„Wann soll das denn gewesen sein?“, wehrte Tim ab. „Hör mal, die haben noch nicht mal ein Kino und in den Kneipen läuft nur Heino und so’n Scheiß! Der Altersdurchschnitt liegt über Achtzig!“
„Dann wird es ja Zeit, dass frisches Blut in die Stadt kommt und du ihnen sagst, was derzeit angesagt ist!“ Entschlossen stand Papa vom Sessel auf. „Ich habe Oma jedenfalls zugesagt. Ich kann nicht arbeiten und mich um Marie kümmern. Dort haben wir die Hilfe, die wir brauchen!“
„Die du brauchst!“ Mit einer heftigen Armbewegung fegte Tim Mathebuch und -heft von seinem Schreibtisch. „Zu gütig, dass du dir wenigstens die Mühe gemacht hast, mich zu informieren. Soll ich jetzt gleich die Koffer packen oder fahren wir erst morgen?“
„Nächsten Monat, mit Beginn der Schulferien“, gab Papa zurück. Tim starrte auf den Kalender mit den Spielern der Nationalmannschaft an seiner Wand. Vier Wochen leuchteten ihm rot entgegen. Drei Wochen der WM konnte er noch mit seinen Fußballfreunden mitfiebern, dann würde er in der Provinz versauern, wo es weit und breit keine Fußballfreunde und noch nicht mal mehr eine Bundesliga-Mannschaft gab.
Frühjahr 1965
„Oma, ich kann nicht in der Stadt zur Ostermette gehen.“ Gleich am nächsten Tag hatte Emma sich nach Ladenschluss auf ihr Fahrrad geschwungen. Mit einem Paket Lebensmittel auf dem Gepäckträger war sie den Berg hinauf zur Großmutter geradelt. „Wenn ich dem Kaplan nicht bis Samstag irgendeinen Unsinn über meine Lasterhaftigkeit beichte, wird er mir sicherlich die Kommunion verweigern.“
Emma vergrub ihren Kopf im Schoß der Großmutter. Ihren ganzen Kummer erzählte sie in die bunte Schürze. „Was sollen denn all die Leute von mir denken, wenn ich die heilige Kommunion nicht empfangen darf?“
„Ach, kleine Emma.“ Wie früher, wenn sich Emma das Knie aufgerissen hatte, strich Großmutter ihr über die Haare. „Die Leute reden immer. Wichtig ist doch, dass du weißt, dass du nichts getan hast.“
„Oma, es ist unfair! Warum soll ich schuld sein, wenn der Olaf sich blöd benimmt? Das ist nicht gerecht.“ Emma richtete sich auf und schaute ihre Großmutter mit aufrichtiger Empörung an. Ermunternd tätschelte ihr Oma die Wange. „So hättest du das dem Kaplan sagen müssen, das hätte ihm eher den Wind aus den Segeln genommen als dein Gekicher.“ Oma seufzte. „Das kommt, weil der Kaplan von euch Mädchen keine Ahnung hat. In seinem ganzen Leben ist es immer nur nach seinen Wünschen gegangen. Als Einzelkind seiner ehrgeizigen Eltern, im Priesterseminar, dem die Worte der Bibel mehr gelten als die Gedanken von jungen Menschen. Rücksichtnahme und Empathie sind ihm nicht vorgelebt worden.“
„Da kann ich doch nichts dafür!“ Emma musste schon wieder lachen, als sie sich vorstellte, wie der Kaplan von großen Geschwistern geneckt würde.
„Ach, Kind.“ Auch Oma stimmte in Emmas Gelächter mit ein. „Du leistest mir jedenfalls dieses Jahr in der Osternacht in meiner Kirche Gesellschaft. Pastor Weiler wird nicht auf die Idee kommen, irgendjemandem die Kommunion zu verweigern.“
*





























