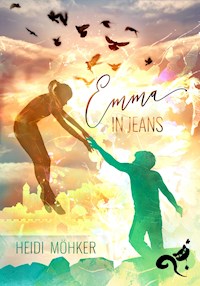Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Henny Broich möchte im Jahre 1900 beweisen, dass sie als Frau ebenso mündig ist wie ein Mann. Im aktuellen Fall gelingt es der Krankenpflegerin mit ihren Mitteln, die Morde an Bonner Hoteliers aufzuklären, bei denen ihr Vater, Theodor Broich, und ihr neuer Freund Oskar Moosfeld Opfer oder Täter sein könnten. Zugleich lehrt sie ihre Freundin Meta Bruchmann, zu ihren Talenten zu stehen, denn Metas Torten sind die allerbesten in der Stadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Foto: Privat
Heidi Möhker, Jahrgang 1968, lebt in Rheinbach bei Bonn. Mitglied im »Syndikat«, der Vereinigung der deutschsprachigen Krimiautoren und -innen, und bei den »Mörderischen Schwestern«, die für die Förderung des von Frauen geschriebenen, deutschsprachigen Krimis eintreten. Ihr Debütkrimi Zwiebelangst erschien 2016. Fräulein Broich ist ihr erster historischer Krimi.
Heidi Möhker
Fräulein Broich
Rheinland-Krimi
Zweite überarbeitete Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018–2019 by cmz-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-912626, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat:Beate Kohmann, Bonn
Schlussredaktion:Clemens Wojaczek, Rheinbach
Satz(Aldine 401 BT 11 auf 14,5 Punkt)mit Adobe InDesign CS 5.5:Winrich C.-W. Clasen, Rheinbach
Papier (90g Lux Creamy mit 1,8f. Vol.):Arctic Paper S.A., Poznań / Polen
Umschlagbilder(Alte Rheinbrücke Bonn, Postkarte von 1908;Civil War Lady, 1863; The U.S. National Archives, Washington / USA;Kolorierung von Olga Shirnina, Moskau / Russland)
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
Gesamtherstellung:Bookpress.eu, Olsztyn / Polen
eISBN 978-3-87062-324-1
301–600 • 20190201
www.cmz.de
Für Papa (1928–2018)
Inhalt
Die Hauptpersonen
Tochter aus gutem Hause
Ein ganz normaler Dienstauftrag
Verlorene Tochter
Haus Moosfeld
Bei Henni
Die unbarmherzigen Schwestern
Im Haus Moosfeld
Hotel Rheineck
Im Korsett ohne Dienstmädchen
Morgendämmerung
Erste Befragung
Arbeitsfrühstück
Die Hochzeitstorte
Die Wunden
Hochzeit
Ein Angebot
Heimatlos
Dunkle Gassen
Leichenfund
Das zweite Opfer
Trajektanleger
Neuer Alltag I
Ein freier Abend
Missverständnisse
Neuer Alltag II
Begegnung
Konspirative Treffen I
Zahltag
Konspirative Treffen II
Verbandswechsel
Die Suche
Verdächtigungen
Zweite Befragung
Oskar
Herbert
Beweise
Suche nach der Tochter
Diplomatie
Mikroskopieren
Vermisste Person I
Zirzen
Tochter gefunden
Hygienisches Institut
Ruß und Ruß
Vermisste Person II
Feierabend
Heimkehr des Hausherrn
Der Morgen im Hotel
Der Morgen im Haus Moosfeld
Heimkehr der verlorenen Tochter
Casselsruhe
Überfall
Erkenntnisse
Stachelbeertorte
Im Namen des Gesetzes
Abreise
Ein Telefonat
Wenn es Nacht wird in Berlin
Ein weiteres Telefonat
Ein Ende, das ein Anfang ist
Nachbemerkungen
Die Hauptpersonen
Hotel Rheineck
Theodor Broich, Besitzer des Hotels Rheineck in Bonn
Charlotte Broich, seine Gattin
Henni Broich, Tochter des Hauses
Ferdinand, Erster Hausdiener
Louisa, Erstes Hausmädchen
Gasthof Schiffsgasse
Rudolf Moosfeld (»der alte Moosfeld«), Besitzer des Gasthofs
Oskar Moosfeld, Sohn des alten Moosfeld
Herbert Bruchmann, Schwiegersohn des alten Moosfeld
Meta Bruchmann, Tochter des alten Moosfeld, Ehefrau von Herbert
Hotel Rheingold
Heinrich Zimmer, Hotelier des Hotels Rheingold
Eduard Zimmer, sein Sohn
Hotel Zum Goldenen Stern
Herr Hansen, Besitzer
Wilhelmine Hansen, seine Tochter
Hotel Borussia
Herr Seebold, Besitzer
Hotel Siebengebirgsblick
Herr Mahler, Besitzer
Hotel von Grafenberg, Berlin
Mechthild von Grafenberg, Hoteliersgattin
Thomas von Grafenberg, Sohn des Hauses
Polizeiverwaltung der Stadt Bonn
Karl August Timmermann, Städtischer Beigeordneter
Inspektor Paul Czerwinski
Historische Figuren im Handlungsrahmen, deren Namen und Funktion der Geschichte entliehen sind, deren Charakter aber frei erfunden ist:
Wilhelm Spiritus (1854–1931), Oberbürgermeister von Bonn in den Jahren 1891–1919
Professor Theodor von der Golz (1836–1905), Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf und Professor für Landwirtschaft und Agrarpolitik
Professor Eduard Friedrich Wilhelm Pflüger (1829–1910), Professor für Physiologie an der Bonner Universität
Anna Wilhelmine Julie Schubring (1843–1917), die junge Pastoren-Witwe gründete 1870 in Bonn eine »höhere Töchterschule«
Herr Hauptmann, Verleger des Reiseführers, der anlässlich des Katholikentages 1900 herausgegeben worden ist
Professor Dittmar Finkler (1852–1912), Professor am provisorischen Hygienischen Institut
Familie Neusser, Verlegerfamilie aus Bonn (General-Anzeiger)
Wilhelmine Minna Theodore Marie Cauer (1841–1922), Frauenrechtlerin in Berlin
Marie Cauer (1861–1950), Stieftochter von Marie Cauer, kämpft für eine Regelung in der Krankenpflege
Tochter aus gutem Hause
Schau den Herren nicht immer so provozierend ins Gesicht, Henni. Das schickt sich nicht!« Charlotte Broich stand aufmerksam daneben und überwachte mit Argusaugen, wie das Dienstmädchen mit festen Strichen Henriettes Haare bürstete. »Hast du die Gräfin Kessenich am letzten Sonntag beim Kirchgang gesehen, Louisa? So eine Hochsteckfrisur schwebt mir vor. Der Nacken soll frei bleiben, damit diese dezente Linie zur Geltung kommt. Feminin, aber doch devot. – Henni, du darfst den Kopf nicht zu aufrecht halten. Denke daran: Gerade, aber doch mit dem Blick nach unten.«
Henni schloss die Augen und versuchte die Stimme der Mutter auszublenden. Sie zuckte leicht beim Ziepen der Bürste an einem Haarknoten. Ihre Kopfhaut spannte, so fest hatte Louisa die Haare gepackt. Das alles war jedoch nicht das Unangenehme an der Situation. Henni fühlte sich wie eine Kuh auf dem Viehmarkt. Ein letztes Striegeln, bevor die Versteigerung beginnen würde. Bloß gab es in ihrem Fall nur einen Bieter: Eduard Zimmer. Der Sohn von Hotelier Heinrich Zimmer. Geschäftspartner und Geldgeber von Hennis Vater. Henni hatte sehr gut verstanden, worum es an diesem Nachmittag gehen sollte. Da Vater nicht imstande war, das Darlehen abzutragen, bot er die Tochter als Unterpfand an. Das schickte sich.
»Und mach nicht so ein Gesicht, meine Liebe.« Mutter hielt Henni probeweise Perlohrringe an. Es waren die guten aus dem Erbe der Großmutter. Für Hennis Hochzeit waren sie gedacht gewesen. »Du siehst so entzückend aus, wenn du lächelst. Dann tu das bitte auch.«
Henni atmete angestrengt. Sie zog ihre Mundwinkel hinauf und starrte ihr Spiegelbild an. Wer war diese Frau da, die zuließ, dass so mit ihr umgegangen wurde? Hinter ihr steckte das Dienstmädchen geschickt eine Haarsträhne nach der anderen mit Nadeln auf dem Kopf fest. Alles kam an den Platz, der ihm zugedacht war. Strähne um Strähne wurde die Frisur perfektioniert.
Frau Broich legte die Perlohrringe ins Schmuckkästchen zurück und kam mit zwei in Gold eingefassten Bernsteinen wieder. Nach einem kurzen Anhalten steckte sie diese Henni zufrieden in die Ohrläppchen. Es piekte, als sie daneben stach und neu ansetzte. Henni unterdrückte einen Aufschrei. Als einzige Abwehr hob sie ihre Hand.
»Gleich hab ich es.« Mutter schlug die Hand weg und werkelte weiter im Duett mit Louisa. »Ich möchte gleich auch keine Geschichten über Wundheilung und leidende Patienten hören, mein liebes Fräulein. Sprich über das milde Winterwetter. Auch Themen wie Religion verbieten sich. Zu heikel ist es, zwischen den Protestanten und den verschiedenen Katholiken zu unterscheiden. Ach, hoffentlich gibt es dieses Jahr in der Stadt keine Unruhe. Wenigstens für Hotelgäste wird gesorgt sein. – Und erzähle bloß nicht, dass du so verblendet bist und zur Universität gehen willst. Davon verstehst du nichts!«
»Doch, Mutter, ich verstehe ganz gut, was die Professoren an der Universität den Studenten erzählen. Es würde wenig Sinn haben, als Gasthörerin hinzugehen, um mir lediglich deren schlechtsitzende Anzüge anzusehen.«
Die Mutter hob abwehrend die Hände.
»Kein Wort davon. Der liebe Eduard soll doch einen guten Eindruck von dir bekommen.«
»Es wäre wohl angemessener, ihm einen ehrlichen zu vermitteln!«
Herausgeputzt im blassblauen Gesellschaftskleid hockte Henriette Broich am Fenster ihres Zimmers. Der Blick ging hinaus auf den Rhein und hinüber zur Beueler Seite. Wenn sie sich ein wenig vorlehnte, konnte sie noch ein Stückchen vom Petersberg erkennen. Es war ein schöner Ausblick, der sie ihre gesamte Kindheit und Jugend begleitet hatte. Henni wusste das durchaus zu schätzen. Noch mehr schätzte sie jedoch, zu lernen. Das Wissen, das sie in der Pflegeschule gesammelt hatte, wollte sie anwenden. Außerdem hoffte sie darauf, eines Tages nicht nur als Gasthörerin die Universität zu besuchen. Henni schaute zur Tür. Die Situation wirkte doch ein wenig melodramatisch, befand sie und ärgerte sich ein bisschen, das Drama nicht genießen zu können. Gleich würde sich entscheiden, wie Hennis Leben weiterging. Schritt sie artig durch die Tür des Ballsaales, blieb ihr die Aussicht aus dem Fenster erhalten. Sie würde die Eltern glücklich machen. Eduard wäre eine gute Partie. Oder suchte sie selber herauszufinden, wo ihr Glück liegen könnte?
Sie dachte an ihre Freundin Wilhelmine Hansen. Ein leichtes Lächeln tauchte auf Hennis Gesicht auf. Sie erhaschte einen kurzen Blick darauf im Spiegel. Es war das erste ehrliche Lächeln an diesem Tag. Sie befürchtete, es würde das letzte bleiben. Es war furchtbar.
Wilhelmine hatte das Glück, schon morgen den Mann heiraten zu dürfen, den sie liebte. So wie bei Wilhelmine hatte es sich Henni immer gewünscht. Sich erst verlieben und dann den Mann ehelichen.
Den ihr zugedachten Bräutigam hatte Henni allerdings erst wenige Male gesehen, und dabei hatte Eduard Zimmer keinen sonderlichen Eindruck bei ihr hinterlassen. Dagegen war der blasse Sommergast aus Berlin, der ihr im letzten Jahr während seines Aufenthaltes in Bonn den Hof gemacht hatte, noch ein unterhaltsamer Geck gewesen. Von ihm wusste sie zumindest, dass er ihren Musikgeschmack teilte.
Henni starrte weiter die Tür an. Sie merkte gar nicht, wie ihr Tränen über das Gesicht liefen, bis eine sich von der Wange löste und auf ihren Handrücken fiel. Fassungslos starrte sie den Tropfen an. Soviel zu einem der Momente, die zu den glücklichsten im Leben einer Frau zählen sollten.
Sie konnte es nicht. Sie konnte unmöglich durch diese Tür gehen. In dieser Aufmachung. Ein Präsent für den Herrn. Schmuck verpackt. Ein hübsch verpackter Geschenkkarton, auf dessen Inhalt es nicht ankam. Aber Henni war stolz auf ihr Inneres. Ihre Wünsche, ihre Werte und ihr Wissen. Wie hatte sie mit den anderen Gasthörerinnen an der Universität über dieses elende neue Bürgerliche Gesetzbuch debattiert! Ein Affront den Frauen gegenüber, ihren Rechten und allem, was sie als Menschen ausmachte. Nichts waren sie. Seit dem ersten Tag des neuen Jahrhunderts waren sie fest an den Mann gebunden und rechtlos, sobald sie sich ihm als Ehefrau an die Seite stellten. Henni lachte bitter auf. Unterordnen traf es eher.
Das konnten ihre Eltern nicht von ihr verlangen. Sie sprang auf, unfähig, sich länger zu disziplinieren. Sie musste tätig werden, genau jetzt, bevor sie lebenslänglich in der Falle saß.
Henni klingelte nach einem Dienstboten, wohl wissend, dass Louisa bei ihrer Mutter nun ebenfalls letzte Hand an Frisur und Garderobe legte und nur eines der anderen Zimmermädchen kommen würde. Sie forderte zwei Reisetaschen an.
Es war ein seltsames Gefühl, sich im vertrauten Zimmer umzusehen und zu entscheiden, was davon in ein neues Leben mitgenommen werden sollte. Ihre Bücher legte Henni zuerst in eine der Taschen, die nun schon prall gefüllt war. Ihre Garderobe war ihr dagegen nicht so wichtig. Schnell musste es gehen, wollte sie aus dem Haus sein, bevor die Eltern ihr Vorhaben auch nur ahnten.
Ein ganz normaler Dienstauftrag
Oskar Moosfeld rutschte tiefer in seine Dienstjacke. Der graue Stoff kratze am Kinn. Unangenehm, aber nicht so unangenehm wie der Winterwind, der in diesen ersten Januartagen des neuen Jahrhunderts über die Bonner Plätze fegte. Der Münsterplatz wurde zu dieser Stunde bereits durch Gaslaternen erhellt, Oskars Schatten huschte mit von Lichtkegel zu Lichtkegel. Wenigstens war ihm beim strammen Marsch mit dem Karren warm geworden. Die Herrschaften sollten nur nicht davon ausgehen, dass er ihr Gepäck rechtzeitig zum Bahnhof bringen konnte und dass sie die nächste Eisenbahn erreichten. Da hätten die sich früher melden müssen. Andererseits konnte sich Oskar keinen anderen Grund für den Auszug aus dem Rheineck denken.
Das Hotel hatte einen guten Ruf, ein Wechsel in ein noch besseres Haus schied daher fast sicher aus. Rumpelnd brachte er die Karre am Fuß der Freitreppe vor dem Hotelgebäude zum Stehen.
»Da sind Sie ja endlich!«
Erst jetzt bemerkte der Dienstmann die kleine Frau, die am Fuß der Treppe neben zwei Taschen hockte und nun aufstand. Der Rock rutschte von allein in seine Position, keine Handbewegung, die etwas richten musste, wie das sonst bei den Damen der Gesellschaft üblich war. Sein Blick glitt höher. Der Pelzmantel – von welchem Tier der Pelz stammte, konnte er nicht erkennen – ließ darauf schließen, dass es sich nicht um eine Dienstmagd handelte. Auch die Haare waren wohl einmal entsprechend kunstvoll hochgesteckt worden. Jetzt wirkten sie allerdings etwas derangiert – etliche Strähnen hingen der Dame – irgendwie kam Oskar zu dem Schluss, dass es sich um eine solche handeln musste – nun wirr ins Gesicht. Sie pustete sie geräuschvoll zur Seite und setzte nach mehreren Anläufen einen breiten Hut auf die Pracht. Trotz der Bemühungen wirkte dieser seltsam fehl am Platze.
»Können wir dann gehen?«
Ihre Worte rissen ihn aus seinen Gedanken.
Sie zeigte auf die Taschen. »Dafür hätten Sie nicht gleich eine Karre mitbringen müssen.« Sie zuckte mit den Achseln. »Naja, vielleicht ist es besser so. Nehmen Sie die größere Tasche. Da sind meine Bücher drin.« Sie griff sich die kleinere, die offensichtlich leicht war, so schwungvoll hob sie sie auf.
Oskar machte einen Schritt auf die andere Tasche zu und bückte sich. Er wollte sie ebenso lässig auf die Karre heben. Es riss ihn nur heftig im Rücken. »Was zum …« So gerade konnte er noch einen Fluch unterdrücken.
»Bücher.« Sie bückte sich neben ihn.
Er konnte sehen, wie sich unter dem Pelz ihr Rücken straffte. Wie die Waden sich unter dem Rock durchdrückten und wie ihr Gesicht sich anspannte. Trotzdem wirkte es in keiner Weise angestrengt, als sie die Tasche anhob, die drei Schritte zur Karre machte und dort wieder abstellte.
Die Dämmerung war inzwischen in Dunkelheit übergegangen. Die Tür des Hotels schwang auf. Musik aus dem Tanzsaal drang kurz nach draußen.
»Henni!« Eine Dame stand ganz oben auf den Stufen und sah zu ihnen herunter. Ihr Kleid war elegant und viel zu dünn für die Jahreszeit, die Tageszeit und für draußen sowieso. »Henriette Broich. Komm wieder rein!«
Er schaute zu seiner Auftraggeberin. Sie rollte mit den Augen.
»Mama, ich habe meine Entscheidung getroffen.«
Sie hob nicht einmal ihre Stimme. Machte keine Anstalten, zu der Dame oben an der Treppe zu gehen.
»Ich bin Krankenschwester. Eine Pflegerin. Ich sehe nicht, was daran schlecht sein soll. Keinesfalls so schlecht, wie einen dahergelaufenen Hotelierssohn zu heiraten. Ich werde mich nicht aus Geschäftsgründen mit irgendjemandem vermählen lassen.«
»Niemand will dich aus Geschäftsgründen vermählen!«
»Ja, sicher.«
Oskars Kundin hob die zweite Tasche wieder an.
»Es ist reiner Zufall, dass Herr Zimmer die Renovierungskosten für das Hotel vorgestreckt hat …« Sie drehte sich um.
Im Zwielicht der Laternen konnte Oskar den Ausdruck auf ihrem Gesicht nicht deuten. Vielleicht bildete er sich die Tränen darauf ein. Vielleicht war es auch nur der Nieselregen, der sich darauf niedergelassen hatte.
»Henni!« Zögernd kam die Dame zwei Treppenstufen nach unten.
»Gehen Sie rein, liebe Frau Mama! Sie werden nur krank – und mich lässt der Herr Papa dann sicher nicht zu Ihnen!«
Fräulein Broich ging mit festen Schritten in Richtung der neuen Rheinbrücke.
Oskar griff beherzt nach seiner Karre und schob sie hinter ihr her.
»Kein Kommentar!« Sie warf ihm die Worte hin, als er sie eingeholt hatte.
»Ich sag ja gar nichts.« Er sah grimmig vor sich auf die Straße. »Nur fragen, wo es hingeht, wird man schon dürfen.«
»Zum Johannes Hospital. Ins Schwesternwohnheim.«
Die Holzräder ratterten über das Kopfsteinpflaster, während Oskar den Karren stumm und stoisch vor sich herschob. Vom Rhein her stiegen Nebelschwaden auf, die vor dem gelben Licht der Gaslaternen zu tanzen schienen. Im Schatten erhob sich der Bogen der neuen Brücke, verband sie mit Beuel, irgendwie und irgendwie nicht. Die Bonner allein hatten sie bauen lassen. Sie allein hatten die Kosten getragen. Nur weil die Brücke nicht im Beueler Zentrum, sondern weiter nördlich in den Feldern endete, hatten die Beueler ihre Beteiligung verweigert. Dabei hatten die Bonner schon die ganze Planung und Ausschreibung geleistet.
»Glauben Sie mir, dass ich noch nicht das Bröckemännche gesehen habe?«
Das Fräulein Broich war stehengeblieben und starrte über den breiten Strom auf das gegenüberliegende Ufer. Sie stellte die Tasche ab. Ihr Hut rutschte ihr beim Bücken ins Gesicht. Sie schob ihn zurück, zog eine lange Hutnadel aus dem Ungetüm und steckte sie energisch neu zurecht. Oskar schauderte bei dem Anblick. Woher wollte so eine Nadel wissen, wo die Haarpracht endete und die Kopfhaut, der Schädel begann? Sie blickte ihn an.
»Haben Sie das Bröckemännche schon gesehen?«
Oskar machte eine unbestimmte Bewegung mit dem Kopf.
»Hauptsache ist doch, die Beueler sehen es, von hinten, wie es sich eben gehört.« Dafür war es schließlich auf Beueler Seite über dem Pfosten am Fußgängerbereich angebracht worden, und darum streckte es den Bewohnern der rechten Rheinseite den blanken Hintern entgegen. Als Dank für die fehlende Beteiligung am Bau.
Sie schnaubte neben ihm.
»Wie’s sich gehört.« Sie nahm ihre Tasche wieder auf. »Wie’s sich gehört.« Sie schritt weiter, straffte die Schultern und ging mit erhobenem Kopf vor ihm her. Sie zeigte eine Spur von Traurigkeit, von Trotz, von dem auch die energischen Schritte, die angespannten Fäuste am Griff der Tasche und die streng im Takt der Schritte mitschwingenden Arme nicht ablenken konnten.
»Ja meinen Sie denn, die Beueler müssten sich nicht am Brückenbau beteiligen? Finanziell?« Oskar packte die Karre und schob sie hinter dem Fräulein her. »Die nutzen die Brücke genauso wie wir!«
»Die Brücke!« Sie warf das Wort hin, wie ein Almosen einem lästigen Bettler vor dem Münster. »Wer stellt denn all die dummen Regeln auf, an die wir uns dann halten sollen? Halten die sich für so viel klüger als wir anderen? Dumm ist das. Das ist dumm. Das!«
Oskar kratzte sich mit der einen Hand unter seiner Dienstmütze. Die Karre rumpelte weiter gleichmäßig über das Pflaster. Mit ihrem Schritt hielt er mühelos mit. Bei ihren Gedanken hatte er da eher Schwierigkeiten.
»Ich glaube, es lohnt sich bei so vielen Regeln gar nicht, sich darüber aufzuregen.« Er rückte seine Mütze mehr in die Stirn. »Das macht mehr Ärger als die Regeln selbst.«
Fräulein Broich blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Kopfschüttelnd. »Das kann auch nur ein Mann sagen!«
Sie liefen unter der Brücke durch. Rechts von ihnen, zum Strom hin, erhob sich der Fuß des Pfeilers aus hellen, großen Steinquadern. Über ihnen, auf dem Überbau, befand sich nun das Zollhäuschen, an dem jeder Passant zwei Pfennig Wegzoll leisten musste. Von dort spannte sich weiter nach rechts der Brückenbogen, nach links war das Widerlager, wo die Flussquerung in die Straße überging. Sie konnten beide die Blicke nicht von dem eindrucksvollen Bau wenden. Im Schatten des Pfeilers stand ein Pärchen. Es küsste sich in der Öffentlichkeit, als gäbe es kein Morgen. Oskar schob seine Karre schneller und schloss mit seiner Kundin auf, wobei er sich zwischen Fräulein Broichs Blick und den vermeintlich liederlichen Anblick schob.
Sie bemerkte offenbar sein Vorhaben, denn ihre Mundwinkel hoben sich. Zu einem Lächeln?
»Ist das nichts für eine Dame?«
Fräulein Broich ließ sich etwas zurückfallen und hatte wieder freie Sicht. »Mir scheint, als sei auch eine Dame an dem Tun dort beteiligt. Warum sollte eine Dame es also nicht sehen?«
Spöttisch, schloss Oskar. Das war nicht wirklich der Ansatz eines Lächelns – obwohl ihr ein Lächeln bestimmt gut gestanden hätte –, das war unverkennbarer Spott, der ihm galt, den er nicht auf sich sitzen lassen wollte. Auch wenn sie seine Auftraggeberin war, aus dem gehobenen Bürgertum kam und er nur ein Dienstmann war. Ein Beamter zwar, aber einer der geringsten, niedrigsten. Dennoch konnte sie ihn ernst nehmen und musste nicht darüber spotten, wenn er als Mann versuchte, sie zu schützen. Er kam, genau wie sie, aus einer Gastronomen-Familie. War die Wirtschaft seiner Familie auch kleiner, dann lag es nicht an ihrer Herkunft oder dem Stand, sondern an dem Talent von Oskars Vater, das Geld, das einmal da gewesen war, nicht in das Hotel zu stecken, sondern ins Glücksspiel. »Ich muss gestehen, dass ich jetzt weder hier noch da eine Dame sehen kann, keine wirkliche jedenfalls.« Und es war ihm ernst, als er das sagte. Trotzdem stahl sich da ein Lächeln auf jenes Gesicht, machte es weich und sanft. Und schön. Wirklich schön. Keine ordentliche Frisur und keine Kosmetik konnte das erreichen. Er merkte, dass er sie schon ungebührlich lange betrachtete. Angezogen von dem aufflackernden Lächeln. Er räusperte sich. Griff erneut nach dem Handlauf des Karrens und schob wieder an.
Fräulein Broich blieb kurz zurück, Oskar vergewisserte sich nicht, ob sie noch das Paar anstarrte, ob ihr Blick ihm selbst folgte oder dem Rhein. Zu sehr war er damit beschäftigt, die Karre aus dem Weg einer heraneilenden Kutsche zu bringen. Oskar schalt sich selbst, dass er nicht besser achtgegeben hatte, sonst hätte er schon bei dem Trappeln herannahender Hufe die Fahrspur geräumt. Auch Fräulein Broich schien durch das Fuhrwerk aufgeschreckt. Sie schloss wieder zu ihm auf. Ihre Schritte waren schnell und wurden schneller. Übermütig. In Gedanken verglich er sie mit dem schwerfälligen Gang seiner Schwester Meta. Müden, verbesserte er sich. Meta war nicht schwerfällig. Sie war flink und beweglich, aber müde und grau von Arbeit und Sorgen. Auch ihr würde ein Lächeln gut stehen. Er schob das Bild seiner Schwester fort und blickte sich wieder zu seiner Kundin um. Noch bevor er seine Karre wieder anschieben konnte, war sie bereits unter der Brücke durch und hielt nun ihr Gesicht in den stärker werdenden Regen. Gleich darauf trafen auch ihn die dicken Tropfen. Auch wenn dieser Winter sich recht mild anließ im Rheinland, der Januar war entschieden kein guter Monat am Rhein.
»Wir sollten gleich die nächste Gasse nehmen. Stadteinwärts, weg vom Strom. Da ist wenigstens der Wind nicht mehr so stark.«
»Ach, der Wind!« Sie schüttelte den Kopf. »Der Wind bläst einem wenigstens den Gehorsam aus dem Kopf. Macht ihn frei für eigene Gedanken!«
Mit der freien Hand hielt sie ihren Pelzmantel unter dem Kinn zusammen. Sie sah ihn an, als nehme sie Oskar zum ersten Mal wahr. Richtig wahr. Und Oskar war sich mit einem Mal all seiner Unzulänglichkeiten bewusst: seiner zu langen, fahlen Haare, die unter der abgenutzten Dienstmütze hervorlugten, des Schnurrbarts, der sich nie davon überzeugen ließ, in hübschem Bogen nach oben zu zeigen, des unrasierten Kinns, der abgenutzten Ellbogen seiner grauen Jacke, der leicht fleckigen Hose, die er Meta noch nicht auf den großen Wäschehaufen hatte legen wollen, und der mit Straßenschmutz befleckten Schuhe. Ein Dienstmann. Mensch zweiter Klasse. Dritter vielleicht in ihren Augen. In seinen auch. In den Momenten, in denen er darüber nachdachte, was er wollte mit seinem Leben. Wenn die Pläne, die er machte, immer höher und glorreicher wurden und ihm bewusst wurde, dass sein Leben dahinfloss, fort, mit dem Wasser des Rheins. Unerbittlich. Er war Ende Zwanzig und Dienstmann. Da fiel man langsam in die dritte Klasse zurück, wenn man nicht weiterkam im Beruf. Im Leben.
Er wich ihrem Blick aus. Es war nie schön, sich mit den Augen der feinen Leute zu betrachten. Er war Oskar Moosfeld, Dienstmann in städtischer Anstellung, Beamter also. Er hatte ein festes Gehalt. Seine Familie besaß eine Wirtschaft, gut besucht, wenn auch nicht vom besten Publikum, aber das lag nicht an der Lage des Hauses und nicht an Metas Küche. Ganz bestimmt nicht an Metas Küche. Die war die allerbeste von ganz Bonn. Und das sagte er nicht als ihr Bruder. Das sagte er als Kenner, als Genießer. Wenn der Vater und der vermaledeite Schwager nicht das Geld versaufen und im Spiel verjubeln würden, dann könnten auch sie elektrische Leitungen verlegen und fließendes Wasser in den Badezimmern vorweisen. Eine Zentralheizung statt Kohleöfen in einzelnen Zimmern. Dann könnten auch sie den Gästen die Annehmlichkeiten der neuen Zeit bieten. Aber bei ihnen hatte es noch nicht einmal für einen Fernsprechapparat gereicht.
Fräulein Broich sah ihn noch immer an. Starrte sogar. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war nicht zu deuten, irritierte ihn. Ihre Haut sah im Licht der Laternen bleicher aus. Sie hob ihre Hand, zeigte auf ihn. Ihr Verhalten irritierte ihn, und er fühlte, wie aus seiner Verwirrung Ärger wurde. Zu viele Regeln waren Fräulein Broich offensichtlich aus dem Kopf geweht worden. Nützliche Regeln, die für Ordnung sorgten und das zwischenmenschliche Leben unterschiedlicher Klassen organisierten. Mit ausgestrecktem Arm kam sie nun auf ihn zu. Lief an ihm und seiner Karre vorbei, zurück in Richtung Brücke.
»Fräulein Broich!« Oskar hatte keine Lust, für irgendeinen Botengang unnötig lange durch dieses Sauwetter zu müssen. »Das Johannes …«
»Halten Sie meine Tasche!«
Henni traute ihrer eigenen Wahrnehmung nicht. Das konnte nicht sein. Dieses Kleiderbündel dort – sicher war es nur der Wind, der es bewegt hatte. Sie ließ die Tasche einfach fallen, eilte zum Brückenfuß zurück und beugte sich über den Haufen Lumpen dort am Boden. Sie hörte undeutlich, wie der Dienstmann ihr zögerlich folgte. Ihre Aufmerksamkeit war jedoch allein auf die Gestalt vor ihr gerichtet. Sie streckte die Hand aus. Viel zu zaghaft, wie sie sich selbst schalt. Da brauchte jemand ihre Hilfe. Sie war ausgebildet für genau solche Situationen. Jetzt mussten ihre Handgriffe sitzen. Nicht in der Theorie. In den Büchern konnte einem kein Lehrmeister vermitteln, wie es war, vor Ort zu sein. Einen Menschen vor sich zu haben. Ein schlagendes Herz, das Blut aus einer Wunde pumpte.
Rot durchtränkt war der Stoff der Jacke. So heftig sie selbst atmete, der Brustkorb dieses Menschen bewegte sich kaum noch.
»Fräulein Broich!« Die Stimme des Dienstmannes wehte zu ihr herüber. Seine Schritte hallten unter der Brücke wider. Dann stand er an ihrer Seite. – Sie spürte seine Hand auf ihrer Schulter. Er versuchte, sie von dem Verletzten fortzuschieben. Offenbar hatte er noch immer nicht begriffen, dass hier ein Leben zu retten war.
»Rufen Sie den Nachtwächter!« Mehr Worte hatte sie nicht, lieber ließ sie ihre Hände arbeiten. Sie öffnete den Mantel und zog den Kragen des Hemdes auf. In Frack und Zylinder, als käme er gerade vom Abendkonzert in der Beethovenhalle, lag dort der gnädige Herr Hansen, der Vater ihrer besten Freundin Wilhelmine und Besitzer des Hotels »Zum goldenen Stern«. Bestes Hotel am Markt, gleich neben dem Rathaus. Dort, wo Bürgermeister Wilhelm Spiritus gerne seine Ehrengäste unterbrachte. Das Haar unter dem Zylinder war rot von Blut. Vom Haaransatz über die Wangen zäh geronnen. Die Augen waren geschlossen. Henni öffnete die Knopfleiste des steifen weißen Hemdes, löste den hohen Kragen und fühlte nach dem Puls.
»Nun machen Sie schon! Rufen Sie den Nachtwächter und einen Arzt!« Ohne den Dienstmann anzusehen, schnauzte sie ihre Anordnungen. »Eile ist nötig!« Sie zog mit einer kräftigen Bewegung den Schal unter Herrn Hansen hervor, knüllte ihn zusammen und drückte ihn fest auf die Wunde am Hals. Hoffentlich konnte sie so die Blutung stoppen.
Verlorene Tochter
Charlotte Elisabeth Broich stand oben auf der Freitreppe vor dem Hotel Rheineck und sah ihr einziges Kind an der Seite des Dienstmanns am Rhein entlang entschwinden. Sie hörte, wie hinter ihr das Eingangsportal geöffnet wurde. Mit einem Hauch warmer Luft drang die Musik aus dem Ballsaal durch die Halle nach draußen.
»Wünschen gnädige Frau Ihren Mantel?«
Der Klang der Stimme veranlasste Charlotte Broich, sich gerade aufzurichten. Sie atmete durch. Die Winterluft kühlte ihre aufgebrachte Stimmung. Die Gänsehaut auf ihren Armen verschwand. Ferdinands Stimme erinnerte Menschen an Konventionen wie ein Korsett den Körper an eine ordentliche Haltung. Ob Hotelgast, Liftboy, Zimmermädchen oder auch Charlotte Broich, Hausherrin, Gattin des Hoteliers Theodor Broich, des Besitzers des Hotels Rheineck, eines der besten Häuser in Bonn, der ehemaligen Hauptstadt der Rheinprovinz und Universitätsstadt. Blühende Rentier-Stadt am deutschen Rhein.
Charlotte Broich blickte ein letztes Mal ihrer Tochter nach, dann drehte sie sich um. Während der Portier ihr die Tür aufhielt, nickte sie ihm zu. Es gab nichts zu sagen.
Langsam durchquerte sie die Hotelhalle. Setzte das Lächeln auf, das sich für die Gattin des Chefs gehörte. Sie ging vorbei an der Rezeption mit der schönen neuen Mahagonitheke. Die weit geschwungene Treppe hinauf in die Etagen. Links war der neue Aufzug, vor dessen schmiedeeisernem Gitter der Liftboy wichtigtuerisch auf seinen Einsatz wartete. Sie mühte sich, nicht an all das Geld zu denken, das ihr Gatte Theodor Broich im letzten Jahr dafür ausgegeben hatte. Geld, das nicht ihres war. Investitionen nannte er es, mit Hinweis auf die Touristen, die der Rhein, das Siebengebirge und in diesem Jahr auch der in Bonn stattfindende Katholikentag anlockten. Ganz links waren die großen Flügeltüren zum Ballsaal. Ferdinand ging ihr bereits voraus und öffnete auch diese. Zur Musik des Tanzorchesters bewegten sich festlich gekleidete Paare im Dreivierteltakt über das Parkett, als wäre in der Zwischenzeit nichts geschehen. Bürgermeister Spiritus vollführte just eine gewagte Drehung mit seiner Gattin. Baurat Schulze führte die Mutter des Stadtdechanten in eine sanfte Rechtskurve und Hotelier Heinrich Zimmer presste im Walzerschritt eine dieser aufgebrezelten Bürgerfrauen viel zu eng an seine Brust. Abseits standen einige Offiziere des in der Sterntorkaserne niedergelassenen Husarenregiments und sprachen intensiv in die Rotweinkelche in ihren Händen.
Theodor Broich saß mit Heinrich Zimmers Sohn Eduard am Rande der Tanzfläche. Die Satinkragen ihrer Fräcke glänzten silbern im Licht der elektrischen Kerzen, die überall an den Wänden neu angebracht waren. Henni hatte eben noch viel leuchtender gestrahlt. Selbstbewusster. Zu selbstbewusst für den Vater, für Eduard, für jeden. Als Tochter eines guten Hauses musste das Kind doch wissen …
Charlotte Broich setzte ein Lächeln auf, hob den Kopf ein wenig höher und ging am Rande der Tanzfläche entlang auf die beiden zu. Kaum wurde sie bemerkt, wandte sich der Blick ihres Gatten ihr entgegen. Er hob fragend die Augenbrauen. Sagte so mehr, als sie jemals laut von ihm hören würde. Charlotte Broich atmete zunächst tief durch. Ihre Worte richtete sie jedoch an den Mann, der heute ihrer Tochter eigentlich als möglicher Gatte präsentiert werden sollte.
»Eduard. Lassen Sie sich von meinem Gatten nicht an so einem schönen Abend mit Geschäften aufhalten. Ich sehe es den jungen Damen unter unseren Gästen an, wie sie sich danach sehnen, von einem so feinen Herrn wie Ihnen über das Parkett geführt zu werden.«
Eduard erhob sich höflich von seinem Stuhl und bot ihr den Platz an. Er machte eine leichte Verbeugung, nahm die ihm dargebotene Hand und hauchte mit dezent gespitzten Lippen einen Kuss auf ihren Rücken. Charlotte Broich lächelte. Sie spürte die Anspannung mit jeder Faser ihres Körpers. Sie wussten alle, was für diesen Abend ursprünglich vorgesehen war. Sie hoffte, Eduard sei nun höflich genug, es nicht zu thematisieren. Er richtete sich wieder auf, hielt noch immer ihre Hand, schaute nun aber, mit unverhohlener Irritation, zu Theodor Broich hinüber.
»Ich hatte bisher auf Ihr Fräulein Tochter gewartet, Henriette. Mir wurde schon so viel über ihre Eleganz berichtet. Ich hoffte, mich heute selbst an ihrem Anblick erfreuen zu dürfen.«
Das Lächeln in Theodor Broichs Gesicht schien festgefroren. Er räusperte sich.
»Ja, nun …« Sein Blick wanderte hilflos zu Charlotte. Sie seufzte.
»Mein lieber Eduard.« Sie schüttelte den Kopf. Senkte ihn, als würde Kummer sie drücken, anderer Kummer als in Wirklichkeit. »Meine liebe Tochter lässt sich entschuldigen. Zu ihrem großen Bedauern wurde sie zu einem Patienten gerufen. Sie wissen, dass das gute Kind es sich nicht hat nehmen lassen, in der Zeit zwischen Mädchenschule und Eheleben als Krankenschwester seine soziale Pflicht zu erfüllen?«
Theodor Broich hatte seine Hände fest auf die Knie gestemmt, als hielte er sich so auf dem Stuhl. Hinderte sich selbst daran aufzuspringen und dem Kind, dem unwürdigen, nachzulaufen. Wer weiß, was er sonst mit ihr täte. Er, dem gegenüber seiner Tochter so selten die Hand ausgerutscht war. Zu selten vielleicht. Der eine oder andere Klaps zur rechten Zeit hätte vielleicht dieses Desaster verhindern können. Aber das mochte Charlotte Broich im Nachhinein nicht verurteilen. Sie sah, wie Theodors Blick durch den Saal schweifte. Er folgte den Tänzern. Nicht im Rhythmus der Walzermusik, nicht amüsiert oder auch nur ein wenig unterhalten. Er wirkte eher wie ein Dompteur im Zirkus. Charlotte Broich musste jetzt mit ihm reden. Die Wogen in seinem Inneren glätten. Den Weg bereiten, auf dem Henni wieder in den Haushalt zurückkehren konnte – sollte sie es wollen. Sie verbot sich, sich etwas anderes überhaupt nur vorzustellen. Sie zwang sich, nun erst einmal jeden Gedanken an Theodors Unwillen aus ihren Gedanken zu verbannen. Vornehmlich galt es, dem Hotelierssohn die vermeintliche Schmach als etwas Positives zu verkaufen.
»Die Gäste unseres Hotels konnten bereits gelegentlich vom pflegerischen Wissen unserer Tochter profitieren. Sie verstehen? Ein verstauchter Fuß nach einer Wanderung im Siebengebirge hier, ein winterlicher Infekt da. Henni ist so einfühlsam im Umgang mit ihren Patienten.«
Ihr Mann starrte sie an, als erzähle sie Geschichten über Afrika. Sie legte ihre Hand auf seinen Arm.
»Nicht wahr, mein lieber Theodor?« Sie drückte ihn fest, um das zu vermitteln, was sie in Eduards Beisein kaum in ihre Stimme legen konnte. Ihr Gatte schaute auf die Stelle, an der sie ihn berührte. Sein Blick wanderte hinauf zu ihrem Gesicht. Sie mühte sich um einen gelassenen Ausdruck. Hoffte, dass es ihr trotz der Gefühle in ihrem Inneren gelang.
»Ja, ja.« Theodor Broich sah nun Eduard an. »Sehr einfühlsam, das Kind. Sehr einfühlsam.«
Charlotte Broich hoffte, der geprellte junge Mann legte die mangelnde Empathie in der Stimme ihres Mannes nicht zu Lasten des angepriesenen Kindes aus. Sie hoffte, die Chance auf diese Verbindung sei noch nicht ganz verloren.
»Ach, schauen Sie, lieber Eduard.« Verschwörerisch beugte sich Charlotte Broich erneut dem jungen Mann zu. »Drüben neben dem Tanzorchester steht das Fräulein Kessenich. Sie winkt mit ihrer Tanzkarte.« Sie drohte ihm spielerisch mit dem erhobenen Zeigefinger. »Kann es sein, dass Sie der jungen Dame einen Tanz versprochen haben, ohne dieses Versprechen bisher eingelöst zu haben?«
Der Verdacht war naheliegend. Neben all dem, was Eltern bei der Heiratsvermittlung für ihre Töchter beachten mussten, galt es auch die richtige Balance zwischen deren Anpreisen und dem Abwarten von Anträgen zu finden. Die gnädige Frau Kessenich jedoch pries ihre Tochter bei allen Gelegenheiten an wie saures Bier. Die jungen Herren der Stadt waren entsprechend abgeschreckt. solches Vorgehen hätte selbst einer größeren Schönheit schaden können. Charlotte Broich wusste, dass auch Eduard bei anderen Gelegenheiten um einen Tanz mit Fräulein Kessenich herumzukommen suchte. Die Erleichterung, die ihm jetzt bei ihrem Hinweis so offensichtlich im Gesicht stand, war, trotz allem, schmerzlich.
Sie sah dem jungen Mann nach, wie er sich entfernte. Hoffte, ihr Gatte würde das zwischen ihnen stehende Thema aufgreifen. Theodor Broich wippte jedoch neben ihr mit den Füßen im Takt einer Melodie. Es war nicht die der Tanzmusik, die das Orchester gerade spielte. Das Kinn: mit dem grauen Bart nach Kaiserart vorgereckt. Die Hände: nun beide locker auf den Knien ruhend. Charlotte Broich hatte neben ihm das Gefühl, selbst in den afrikanischen Kolonien nicht weiter von ihm entfernt sein zu können. Ihr Gesicht lächelte zur Tanzfläche hinüber und bekam das eine oder andere Lächeln eines vorbeidefilierenden Tanzpaares zurück. Ihr Hals aber fühlte sich eng an. Zu eng, um all die Worte herunterzuschlucken, die sie nicht laut gegen ihren Gatten sagen konnte. Sie schluckte einiges. Nicht alles.
»Jetzt siehst du, was geschieht, wenn man das Kind zu sehr gewähren lässt. Ich hab dir gleich gesagt, dass zu viele Freiheiten nicht gut sein können. Ja, wenn die Welt eine andere wäre!«
Ohne ihn anzusehen, weiter für die Gäste lächelnd, warf sie ihm die Worte hin, die nicht mehr zu schlucken waren. Wenn die Welt eine andere wäre, dann wäre es auch für Frauen eine Ehre, zu arbeiten. Nicht nur in der Wohlfahrtspflege, den karitativen Vereinen. Doch wusste man gleich, dass eine arbeitende Frau entweder eine alte Jungfer war, der es nicht gelungen war, einen Mann für sich zu gewinnen, oder aber sie lebte im Elend der Arbeiterklasse und schuftete in einer der Fabriken, weil es ihrem Mann nicht gelang, die Familie allein zu ernähren. Wie man es auch betrachtete, Arbeit gereichte einer Dame nicht zur Ehre. Bürgermeister Spiritus hatte das Pech (oder das Glück – das sollte er selbst besser beurteilen können) gerade neben ihnen aufzutauchen, noch erhitzt vom letzten Walzer mit seiner Gattin. Charlotte Broich legte ihre Hand auf seinen Arm und lächelte ihn an. »Zu freundlich von Ihnen, Herr Bürgermeister. Wie könnte ich einen Tanz mit Ihnen abschlagen?«
Sie ließ sich von ihm davonführen, in den hopsenden Rheinländer mit den anderen Paaren. Der Rhythmus änderte nicht die Umstände, er änderte aber die Gedanken – wenigstens für die Dauer der Musik.
Auf seinem Platz am Rand der Tanzfläche kaute Theodor Broich an den Worten, die seine Frau nicht mehr hatte schlucken wollen. Und so, wie er kaute, schienen sie selbst für ihn ein dicker Brocken zu sein. Seine Weibsleute waren heute alle beide schwierig. Benahmen sich wie störrische Eselinnen. Ungehörig. Verzogen allesamt. Gut hatte er es mit ihnen gemeint. Immer. Zu gut. Wie kam es, dass sie auf einmal beide nicht mehr wissen wollten, wo ihr Platz war? Auf Gedanken kamen – Gedanken! Als ob diese kleinen Köpfchen mehr konnten, als Frisuren zu präsentieren und fein auszusehen. Das wenigstens taten sie alle beide. Seine Frau in ihrem Alter – 45 wurde sie jetzt bald – noch immer. Gerade jetzt, wie sie sich vom Bürgermeister über das Parkett führen ließ. Eine Augenweide. Broich genoss auf seine Art die Blicke, die die übrigen Männer am Rande der Tanzfläche seiner Gattin zudachten. Erkannten sie doch seinen ausgewählt guten Geschmack an. Theodor Broich vermochte den Neid seiner Mitmenschen durchaus zu genießen. Solange er sich seiner Pfründe sicher war, trug er sie gern zur Schau und ließ andere am Anblick teilhaben. Der heutige Nachmittag jedoch hatte an seinem Innersten gerüttelt. Nichts schien mehr sicher. Selbst seine Gattin wirkte bei aller Umsicht, mit der sie soeben die heikle Situation gemeistert hatte, mit einem Mal bedrohlich.
Er wandte den Blick von der Tanzfläche ab, suchte die Umstehenden ab, bis er Ferdinand an der Wand neben der Flügeltür zur Halle stehen sah. Er nickte dem Faktotum zu. Einer, der verstand, seinem Herrn zu Diensten zu sein. Einer, der nicht rüttelte an dem, was war, am Status, an der gesellschaftlichen Ordnung, an allem. Ferdinand schritt umgehend durch die Menge wie Moses einst durchs Meer. Wobei sich Moses gewiss unsicherer gefühlt hatte als das Faktotum des Rheinecks. Dafür fühlte Theodor Broich sich bei weitem nicht mit biblischen Kräften gesegnet. Vor allem nicht souverän und sicher.
»Ich möchte immer wissen, was dieses Fraumensch treibt.«
»Seien Sie unbesorgt, gnädiger Herr. Ich werde darauf achten, immer informiert zu sein. Gerade lässt sich Fräulein Henni von einem Dienstmann der Stadt ins Schwesternwohnheim der barmherzigen Schwestern des Johannishospitals begleiten.«
»Gut, Ferdinand. Bestens. Behalte das weiter im Blick.« Theodor Broich räusperte sich. »Ihre gute Frau Mutter sorgt sich sonst sehr.«
»Gewiss, gnädiger Herr. Seien Sie unbesorgt.«
Broich sah durchaus, wie Ferdinand seinen Rücken Bürgermeister Spiritus zukehrte, der Charlotte gerade mit einer gekonnten Rechtsdrehung über das Parkett schob und ihre Augen leuchten ließ. Abwesend nickte er dem Faktotum zu, suchte Ablenkung unter den männlichen Gästen, den Geschäftspartnern und Honoratioren der Stadt. Der Herr Professor von der Goltz, Direktor der Königlich Landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf, nahm seinen Blick auf. Dies erinnerte Broich an ihren letzten Disput in der Lese, dem Haus der Bonner Lesegesellschaft, bei dem sie über eines der Bücher doch wieder zur Religion gekommen waren – ein Thema, das er umso mehr zu vermeiden suchte, je mehr Glaubensrichtungen sich um die Gunst der Bonner Bürger stritten. Als wären die Protestanten nicht genug, versprachen nun auch Altkatholiken, mehr über Gottes Willen zu wissen als der Papst in Rom. Ein Thema, das Theodor Broich auch mit den Gästen seines Hotels streng zu meiden suchte. In diesem Jahr, mit der im September anstehenden Katholikenversammlung, wurde ihm das noch schwerer gemacht als ohnehin.
In dem Bestreben, einem neuerlichen Disput mit dem Professor zu entgehen – einem Disput, bei dem er sich niemals als Sieger fühlen konnte, soviel war ihm bewusst –, wurde Broich auf einen Aufruhr an der Saaltür aufmerksam. Kein dramatischer Aufruhr, eher der Beginn einer Erregung, die Ferdinand gewohnt souverän in die Halle zurückdrängte, die dennoch von Bedeutung schien, denn – und das war ungewöhnlich – das Faktotum suchte gezielt die Aufmerksamkeit des Hoteliers zu erlangen. Erleichtert nickte Theodor Broich daher dem Professor mit in Bedauern wiegendem Kopfe zu und wandte sich zum Ausgang.
»Gnädiger Herr.« Auch sonst überfiel Ferdinand den Hotelier nicht gleich in solcher Art. »Der Botenjunge berichtet gerade. Hotelier Hansen wurde an der neuen Brücke überfallen. Ihr Fräulein Tochter fand ihn auf ihrem Weg. Die Nachtwächter und die Gendarmerie sind alarmiert. Der Herr Doktor ist gerufen. Fräulein Henni leistet dem wohl schwer Verletzten Beistand, bis der Doktor und die Polizei eintreffen.«
Theodor Broich stand aufgerichtet in der Halle seines Hotels. Ferdinands Blick war ihm durchaus bewusst. Der Angestellte wartete auf eine Entscheidung. An der Rezeption stand ein Paar mittleren Alters, umgeben von Gepäckstücken. Ein Dienstmann schob sich gerade durch die Glastür wieder hinaus. Zwei Hotelboys ergriffen Koffer und klemmten sich Taschen unter den Arm, bemüht, das Gepäck mit so wenig Gängen wie möglich in die Suite der Herrschaften zu tragen. Herr Konrad, der Rezeptionist, beugte sich für die notwendigen Eintragungen über das Gastbuch. Ein Pulk Zimmermädchen umstand einen Boy, der unpassend durchnässt auf einem der Sessel hockte, die den Hotelgästen vorbehalten waren.
»Soll Thomas Ihnen den Weg zeigen?« Ferdinand deutete auf den Jungen.
Broich schüttelte den Kopf und wedelte dabei mit der einen Hand durch die Halle. »Ich finde den Weg in mein Büro selbst – und das hier, Ferdinand«, er wedelte heftiger, »das hier bringen Sie umgehend in Ordnung. – Junge! Fort. Die Halle ist für die Gäste!«
Auf seinem Weg durch die Halle in Richtung der Seitentreppe, die zu den Wirtschaftsräumen und seinem Büro führte, lief Theodor Broich Eduards Vater, Heinrich Zimmer, über den Weg. Unwillkürlich richtete er sich noch mehr auf, als es in dem steifen Cut ohnehin schon nötig war. Seit dem Disput über Hennis ungehöriges Benehmen war dies der Moment, den er am meisten gefürchtet hatte. Im Kopf ratterten die Zahlen des letzten Monats herunter. Im Winter war die Auslastung seiner Gästezimmer immer gering. In den letzten beiden Monaten hatte er Heinrich Zimmer lediglich die Zinsen seines Darlehens zurückzahlen können. Die Tilgung stundete er ihm – wo sie doch bald eine Familie wären, wie Zimmer gesagt hatte. Hennis Extravaganzen kamen alles andere als passend.
»Werter Freund!« Zimmer hob seine Stimme an und klang fest und selbstsicher.
»Heinrich!« Theodor Broich wirkte nur halb so souverän. »Auf einen Whisky unter Vätern!«
Er deutete in Richtung Büro und atmete auf, als ihm Heinrich folgte.
»Das ist wohl eher eine Unterredung unter Geschäftspartnern.«
Das war nicht die Erwiderung, auf die Theodor Broich gehofft hatte. Er zwirbelte seinen Schnurrbart, der zu seinem Leidwesen so schlaff herabhing, wie er sich fühlte. »Mein lieber Heinrich«, angestrengt mühte er sich um passende Worte, während er die Glaskaraffe mit dem feinen Single Malt entkorkte. Ein Stammgast aus dem schottischen Hochland hatte ihn im letzten Sommer mitgebracht. Theodor Broich goss in zwei der bereitstehenden Gläser je zwei Fingerbreit ein. Er überlegte, nach Eis zu klingeln, entschied sich dann aber dagegen. Keine unnötigen Lauscher herbeirufen.
»Deine Tochter wolltest du uns vorstellen. So sehr hast du ihre Sanftmut angepriesen, die Vereinigung unserer beiden Häuser. Wie gut es für unsere Geschäfte wäre – und dann ist die Dame nicht anwesend. Ein Kranker wichtiger als mein Sohn! Mein lieber Theodor, auch meine Langmut ist endlich. Absprachen sollten eingehalten werden. Innerhalb der Familienverflechtungen ebenso wie unter Geschäftsleuten. Ich hoffe, deine Tochter widersetzt sich nicht deinen Plänen für ihre Zukunft.«
»Na, na.« Theodor Broich setzte seine Stimme so tief wie möglich an und reichte seinem Gegenüber ein Glas. »Da interpretierst du jetzt aber ein bisschen viel in einen kleinen, hübschen Kopf.« Er hob sein Glas in Heinrichs Richtung und nahm dann einen tiefen Schluck. Der gute Tropfen belebte seine Sinne. Jetzt galt es, Wogen zu glätten und vor allem die Geschäfte zu retten, die wichtiger waren als die Sentimentalitäten der Weibsleute.
»Du hast es noch nicht gehört!« Theodor Broich jubelte still dem Glas zu und dankte Gott für die Eingebung. Eine kleine Wissenslücke könnte Wogen glätten. Eine Auslassung von kaum mehr als einer Stunde. »Weißt du denn noch nicht? Herr Hansen ist überfallen worden. An der Rheinbrücke. Das Kind – mein Kind, das liebe Kind – hat ihn gefunden. Verletzt. Schwerverwundet. Wie es scheint hat Henriette Herrn Hansen soeben das Leben gerettet. Heinrich, ich bitte dich. Da kannst du nicht erwarten, dass sie den Kopf frei hat für schöne Worte eines galanten jungen Mann. Lass ihm Zeit, dem Kind. Lass uns erst einmal auf die Gesundheit und die baldige Genesung des guten Hansen anstoßen. Wobei …?«
»Was!« Theodor konnte nicht anders als zu bemerken, wie die Gesichtsfarbe aus Heinrichs Gesicht wich.
»Was ist mit Hansen? Mein lieber Theodor! Woher hast du diese Nachricht?«
Mit kurzen Worten berichtete Theodor Broich dem anderen das Wenige, das er selbst wusste.
»Und er hat überlebt?« Zimmer hakte nach, nachdem Broich geendet hatte. »Wie arg ist es? Liegt er im Sterben?«
Broich schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. »Guter Gott, nein! Das Kind hat ihm da vielleicht das Leben gerettet!« Die Idee begeisterte ihn. »Du siehst, mein lieber Heinrich. Es ist ein nützliches Wissen für die Frau an der Seite eines Hoteliers. So engagiert ist das Kind. Es ist ihm ein Herzenswunsch, sich für die Kranken einzusetzen. Natürlich wird meine Tochter in der Ehe nicht mehr für andere Leute arbeiten. Meine gute Charlotte war ihr immer ein Vorbild darin, sich dem Gatten zu fügen und die Familie an oberste Stelle zu setzen.«
Auch Heinrich Zimmer nahm einen Schluck des Gerstenwassers aus dem Hochland. Er schien ihn mehr zu besänftigen als Theodor Broichs Worte.
»So wunderbar es ist, dass deine Tochter den guten Hansen retten konnte, ich befürchte, du unterschätzt die Folgen der Bildung, die du so leichtsinnig deiner Tochter gewährt hast.«
Da musste Theodor Broich auflachen.
»Was? Die Höhere-Töchter-Schule? Hauswirtschaft und ein wenig Literatur?«
»Was auch immer … Professor Pflüger sagte mir – als wir uns zufällig in der Lese begegneten – ich solle mit dieser Verlobung vorsichtig sein. Deine Tochter Henni habe sich tatsächlich als Gasthörerin in der medizinischen Fakultät eingetragen. Wo kommen wir da hin, wenn Weibsleute meinen, sie hätten genug Verstand im Kopf, um solche Plätze ehrlichen jungen Männern streitig zu machen?«
Theodor Broich musste trotz seiner Sorgen abermals aufrichtig und herzhaft lachen, mochte es an so einem Tag auch unschicklich wirken. Sicherheitshalber setzte er sein Glas auf seinem Schreibtisch ab und ließ sich in den hochlehnigen Ledersessel fallen.
»Ach, Heinrich!« Theodor Broich wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und lachte noch immer. »Das meinst du jetzt nicht ernst!«
Zornesfalten bildeten sich auf der Stirn seines Gegenübers. Heinrich Zimmer starrte böse von oben auf ihn herab.
»Doch, das ist mein voller Ernst. Warum sollte Professor Pflüger lügen? Und kennengelernt hat er deine Tochter auch bereits, als sie ihm nämlich am Bett der alten Mutter von Bürgermeister Spiritus erzählen wollte, wie die Dame richtig zu pflegen sei! Eine Verwechslung ist da wohl ausgeschlossen!«
Beschwichtigend hob Theodor Broich die Arme. »Ja, ja. Kennen tut der meine Henni schon. Aber Heinrich! Bitte. Lass das Kind zwei oder drei Vorlesungen besuchen, dann stellt es schon fest, dass es sich damit übernimmt und besser an seinem Platz bleibt!«
Zimmer nahm sein schweres Glas, hielt es gegen das Licht und betrachtete die Färbung des Whiskys. Dann richtete er seinen Blick auf Theodor und betrachtete ihn auf die gleiche eindringliche Weise.
Unsicher geworden, strich dieser über seinen Bart und versuchte, den Blick standhaft zu erwidern.
»Wir werden sehen, Theodor.« Heinrich Zimmers Stimme war so leise, als spreche er zu sich selbst. »Wir werden sehen. – Solange wir am Ende bekommen, was vereinbart worden ist, solange soll es gut sein. Unsere Geschäfte solltest du jedenfalls im Auge behalten. So gern ich dir das Darlehen gewährt habe – und du weißt, dass meine Zinsen günstiger waren als eine Bank sie dir jemals zugestanden hätte – trotzdem erwarte ich pünktliche Rückzahlung. Um jeden Preis.«
Charlotte Broich hatte sich bereits von besseren Tänzern über eine Tanzfläche führen lassen. Um ihre Stimmung zu heben und vor allem, um ihrem Gatten zu entkommen, reichte Bürgermeister Spiritius aber allemal. Dem Rheinländer war eine Polka gefolgt und darauf ein Wiener Walzer. Nun war sie angenehm erhitzt und bedankte sich artig für die geschenkten Minuten. Ein Getränk war von Nöten. Sie schauten sich nach einem Kellner um, dabei wünschte sie sich, es wäre noch wie früher üblich, stets einen Fächer bei sich zu tragen. Es war doch unschicklich, sich mit der Hand Luft zuzuwedeln. Zunächst hielt sie es für ein besonderes Entgegenkommen und nahm sich schon vor, den Kellner, der sich ihr von sich aus näherte, Ferdinand gegenüber lobend zu erwähnen. Sie vergaß den Gedanken wieder, als er sich mit dem mit Champagnerschalen bestellten Tablett so zu ihr stellte, dass er ihr, von den Umstehenden unbemerkt, ins Ohr raunen konnte.
»Ein Malheur, gnädige Frau. Ein Unglück, dem Ihr Fräulein Tochter an der Brücke begegnete. Sie leistet Hilfe. Herr Ferdinand wird Ihnen in der Halle alles berichten.«
Charlotte Broich war froh, noch so erhitzt zu sein, dass sie nicht blass werden konnte. Sie nickte dem Kellner zu, nahm, als wäre es um nichts anderes gegangen, eine Schale an sich und schlenderte am Rand der Tanzfläche entlang in Richtung Halle. Hier und da nickte sie noch einem der Gäste zu, den Herren in den dunklen Fräcken, den Damen in ihren eleganten Abendroben. Sie hoffte, ganz den Anschein zu erwecken, nichts weiter als etwas Abkühlung zu suchen. Solange der Schein nur gewahrt wurde …
Ihre Finger griffen fester um den Stiel der Schale. Sie wünschte sich ein Whiskyglas, so eines, wie die Männer in den Rauchsalons in den Händen halten konnten. Eines, das man kräftig drücken konnte, ohne es zu zerbrechen, und wenn man es zerbrechen wollte, dann konnte man es mit ausreichend Schwung an eine Wand schmettern, wo es dann auch klirrend zerschellen würde. Und Eindruck geben würde von der Intensität der Gefühle, die einem zustehen sollten in solchen Situationen. Diese Champagnerschalen eigneten sich nicht für aufbegehrende Gefühle. Für Ausbrüche. Für die Umwandlung von Erregung in Tätlichkeiten. Sie waren dazu gedacht, die Form zu waren. Den Schein. Den schönen Schein der Frauen.
In der Halle wurde Charlotte Broich von Ferdinand dezent zu einem etwas abseits stehenden Sessel geführt. Während sie sich dort, um Haltung bemüht, am Champagnerglas festhielt, berichtete das Faktotum ihr über den Stand der Dinge.
»Der heutige Tag hat es in sich, Ferdinand.«
Sie fühlte noch immer, wie ihr der Schweiß aus den Poren trat. Doch mochte dies nicht mehr der Hitze des Tanzens zuzuschreiben sein. Sie atmete so tief durch, wie es das Korsett gerade zuließ. Wenigstens hielt es sie gerade. Besonders jetzt war das notwendig. Charlotte Broich nippte etwas länger als schicklich an ihrem Getränk.
»Hätte das Kind sich nicht wünschen können, Lehrerin zu werden?« Sie schaute Ferdinand über den Rand des Glases an. »Lehrerin ist ein so ehrenwerter Beruf. An der privaten Höheren Töchterschule von Frau Pastorin Schubring. Ferdinand, das wäre etwas gewesen, da hätte man das Kind unterstützen können. Dagegen hätte selbst der gnädige Herr nichts einzuwenden gehabt … Aber Pflegerin in einem dieser Hospitäler? Was sie da für Infektionen mit nach Hause – mit ins Hotel bringen könnte … Und dann gleich ein Überfall! Der gute Herr Hansen …«
Charlotte Broich merkte selbst, dass sie sich in Rage redete. Zu viele Worte machte und doch nicht zu dem Punkt kam, der ihr wichtig war.
Ferdinand nahm gewohnt souverän die Champagnerschale an sich. Seine behandschuhte Hand ergriff das Glas, gerade bevor sie es erneut zu einem viel zu intensiven Schluck an die Lippen setzen konnte.
»Fräulein Henni hatte sicherlich nicht die Absicht, heute Abend Herrn Hansen zu begegnen.« Ferdinand reichte ihr Glas einem vorbeikommenden Kellner. »Und ich möchte doch betonen, für Herrn Hansen war es ein großes Glück, dass das gnädige Fräulein dort vorbeikam. Noch kämpft er um sein Leben. Sowie ich unseren Thomas verstanden habe, lebt der Herr nur noch, weil Fräulein Henni ihm ein Tuch auf die Wunde drückte.«
»Nicht!« Leise und eindringlich kamen die Worte aus Charlotte Broichs Mund. Sie wollte sich gar nicht vorstellen, wie es dort war, an der kalten, dunklen Brücke im Regen. Auf dem Straßenpflaster … zu deutlich traten ihr Bilder vor Augen, die sie abzuschütteln versuchte. Abwehrend hatte sie die Hände gehoben. »Bitte, Ferdinand, senden Sie zwei starke Männer von unseren Angestellten aus. Sie mögen bitte meine Tochter weiter geleiten. Wo auch immer sie jetzt noch hinzugehen gedenkt. Darf ich nun die Hoffnung haben, dass sie heimkehrt?«
Als Ferdinand zu einer Entgegnung ansetzen wollte, winkte sie erneut ab.