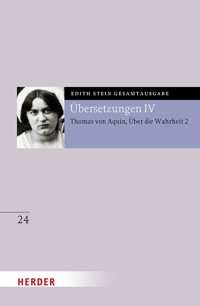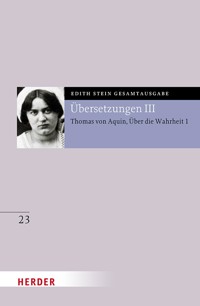Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Endliches und ewiges Sein" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. "Endliches und ewiges Sein" ist ein Grundriss der Ontologie. Edith Stein setzte sich darin mit dem Denken von Thomas von Aquin, Husserl und Heidegger auseinander. Inhalt: Die Frage nach dem Sein Akt und Potenz als Seinsweisen Wesenhaftes und wirkliches Sein Wesen – Substanz, Form und Stoff Seiendes als solches Der Sinn des Seins Das Abbild der Dreifaltigkeit in der Schöpfung Sinn und Begründung des Einzelseins Edith Stein (1891-1942), war eine deutsche Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft, die 1922 zur katholischen Kirche konvertierte und 1933 Unbeschuhte Karmelitin wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie "als Jüdin und Christin" zum Opfer des Holocaust. Sie wird in der katholischen Kirche als Heilige und Märtyrin der Kirche verehrt. Teilen der evangelischen Kirche gilt sie als Glaubenszeugin. Papst Johannes Paul II. sprach Teresia Benedicta vom Kreuz am 1. Mai 1987 selig und am 11. Oktober 1998 heilig. Ihr römisch-katholischer und evangelischer Gedenktag ist der 9. August. Sie gilt als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden. Wie sehr Edith Stein sich ihrer Herkunft bis zuletzt verbunden fühlen musste, zeigt eine der letzten von ihr überlieferten Äußerungen: "Komm, wir gehen für unser Volk!", als sie und ihre Schwester aus dem Karmel in Echt von der Gestapo zur Vernichtung abgeholt wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Endliches und ewiges Sein
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung: Die Frage nach dem Sein
§ 1. Erste Einführung in die Akt- und Potenzlehre des heiligen Thomas von Aquino
Als Zugangsweg soll eine erste vorläufige Darstellung der Akt- und PotenzLehre des hl. Thomas von Aquino dienen. Es ist ein gewagtes Unternehmen, aus einem geschlossenen System ein einzelnes Begriffspaar herauszugreifen, um ihm auf den Grund zu kommen. Denn das »Organon« des Philosophierens ist eines, und die Einzelbegriffe, die man herauslösen kann, sind so verflochten, daß jeder von den andern erhellt wird und keiner außerhalb des Zusammenhanges erschöpft werden kann. Aber das liegt im Wesen alles menschlichen Philosophierens: die Wahrheit ist nur eine, aber sie legt sich für uns in Wahrheiten auseinander, die wir Schritt für Schritt erobern müssen; wir müssen an einem Punkt in die Tiefe gehen, damit sich uns größere Werte erschließe; aber wenn sich ein größerer Umkreis erschlossen hat, dann wird sich am Ausgangspunkt eine neue Tiefe auftun.
Der Gegensatz von Potenz (Möglichkeit, Vermögen, Macht) und Akt (Wirklichkeit, Wirksamkeit, Wirken) hängt mit den letzten Fragen des Seins zusammen. Die Erörterung dieser Begriffe führt sofort ins Herz der thomistischen Philosophie.
Die erste Frage, die Thomas in den »Quaestiones disputatae de potentia« stellt, ist: Besitzt Gott Potenz? Und in der Antwort enthüllt sich ein Doppelsinn von Potenz und Akt. Das ganze System der Grundbegriffe wird durchschnitten von einer radikalen Scheidelinie, die – vom Sein angefangen – jeden einzelnen durchspaltet, so daß er diesseits und jenseits ein verschiedenes Gesicht zeigt: nichts kann im gleichen Sinn von Gott und Geschöpfen gesagt werden. Wenn trotzdem die gleichen Ausdrücke für beide gebraucht werden dürfen, so liegt es daran, daß diese Termini zwar nicht einsinnig (univok), aber auch nicht schlechthin zweideutig (äquivok) sind, sondern in einem Übereinstimmungsverhältnis stehend (analog). Und so könnte man der Scheidelinie selbst den Namen »Analogia entis« geben, die Bezeichnung für das Verhältnis von Gott und Geschöpf.
Man kann und muß bei Gott von Potenz sprechen, aber diese Potenz steht nicht im Gegensatz zum Akt. Man muß zwischen aktiver und passiver Potenz scheiden, und Gottes Potenz ist aktiv. Gottes Akt ist auch nicht im selben Sinn Akt wie ein geschöpflicher Akt. Geschöpflicher Akt – in einer der verschiedenen, aber auch innerlich zusammenhängenden Bedeutungen des Wortes – ist Wirken, Tätigkeit, die anhebt und aufhört und eine passive Potenz als ihre Seinsgrundlage voraussetzt. Gottes Wirken hebt nicht an und hört nicht auf, es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit; es ist sein unwandelbares Sein selbst. Nichts ist in ihm, was nicht Akt wäre, er ist »actus purus«. Darum ist für den Akt keine Potenz als Seinsgrund vorausgesetzt; gewiß keine passive Fähigkeit, die von außen her in Bewegung gebracht, »aktiviert« werden müßte. Aber auch die aktive Potenz, die ihm zugesprochen wird, besteht nicht neben und außerhalb des Aktes: sein »Können«, seine »Macht« wirkt sich in dem Akt aus. Und wenn er nach außen hin – in der Schöpfung und in der Erhaltung und Leitung der erschaffenen Welt – nicht alles wirkt, was er wirken könnte, wozu er die Macht hat, wenn hier Können und Vollbringen scheinbar auseinandertreten, so ist in der Tat doch kein Mehr der Potenz gegenüber dem Akt, keine unausgewirkte Potenz vorhanden, denn die Selbstbeschränkung der Macht in ihrer Wirkung nach außen ist selbst Akt und selbst Auswirkung der Macht. Gottes Potenz ist nur eine, und Sein Akt ist nur einer, und in diesem Akt ist diese Potenz vollständig ausgewirkt.
§ 2. Die Frage nach dem Sein im Wandel der Zeiten
Wem scholastisches Denken fremd ist, der mag den Eindruck gewinnen, daß es sich um eine theologische Fragestellung handle, weil von »Schöpfer« und »Geschöpf« die Rede sei. Die späteren Ausführungen werden zeigen, daß diesen Ausdrücken ein Sinn zukommt, der sich rein philosophisch fassen läßt, obwohl dieser Sinn sich erst den Denkern erschlossen hat, die durch die Offenbarung Gott als den Schöpfer kennen gelernt hatten. Mit seiner Lehre von Akt und Potenz steht der hl. Thomas durchaus auf dem Boden der aristotelischen Philosophie. Die Herausarbeitung dieses Gegensatzes durch Aristoteles bedeutete einen gewaltigen Fortschritt in der Behandlung der Frage, die das griechische Denken von seinen Anfängen an beherrscht hatte: der Frage nach dem ersten und nach dem wahren Sein.
Καὶ δὴ καὶ τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ αἰεὶ ζητούμενον καὶ αἰεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν, τοῦτό ἐστι, τίϚ ἡ οὐσία. (Die von altersher und ebenso heute und allezeit aufgeworfene und immer ungelöste Frage: Was ist das Seiende? ist dasselbe wie die Frage: Was ist die οὐσία?Metaphysik des Aristoteles bezeichnet werden, jener merkwürdigen Schrift, in der das jahrhundertelange Ringen des griechischen Geistes um die »immer ungelöste Frage« ihren gesammelten Ausdruck gefunden hat. Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit und überhaupt nicht meine Aufgabe, zu zeigen, wie sich das Ganze, das man als das »philosophische System« des Aristoteles bezeichnet, gebildet hat. Ich halte es wohl für möglich, daß es aus dieser Frage wie aus einem triebkräftigen Keim hervorgewachsen ist. Und das ungestüme Verlangen der Philosophiebeflissenen späterer Jahrhunderte nach einer Erklärung des Aristoteles ist wohl begreiflich, wenn man bedenkt, daß im Mittelpunkt seines Denkens eine Frage stand, die ihm bestimmt schien, die ewige »Verlegenheit« (das ist ja ἀπορία) der Philosophie zu sein.
Der hl. Thomas hat die Frage nach dem Sein aufgegriffen, wie er sie bei Aristoteles fand. Seine Auffassung der Philosophie als einer Wissenschaft, die rein auf Grund der natürlichen Vernunft vorgeht, gestattete ihm diese Anknüpfung. Andererseits war in den christlichen Jahrhunderten durch die Zusammenarbeit von Philosophie und Theologie die Philosophie vor Tatsachen und Aufgaben gestellt worden, von denen sie in ihrem vorchristlichen Zustand noch nichts geahnt hatte: Aristoteles wußte nichts von einer Schöpfung, nichts von einem Gottmenschen, der zwei Naturen in einer Person vereinte, nichts von einer dreifaltigen Gottheit, von einer Natur in drei Personen. Die Seinslehre, soweit er sie geführt hatte, reichte nicht aus, um diesen Glaubenswahrheiten gerecht zu werden. Schon bei Boëthius fand Thomas Anknüpfungspunkte zur Fortbildung der aristotelischen Seinslehre, noch bessere Stützen bot ihm Avicenna (für den wenigstens der Schöpfungsgedanke als Antrieb in Betracht kam). Er ging dem arabischen Denker auf seinen Wegen ebenso furchtlos und ebenso besonnen nach wie dem griechischen und schritt sicher zwischen seinen Irrtümern und denen seines Gegners Averroës hindurch, bei beiden »alles prüfend und das Beste behaltend«.
Das opusculum »De ente et essentia«, von dem jungen Baccalaureus Thomas in Paris auf Bitten seiner »Brüder und Gefährten« geschrieben, zeigt den engsten Anschluß an die Metaphysik des Aristoteles. Schon der Titel erinnert deutlich an den Satz, den ich als Leitmotiv der Metaphysik bezeichnet habe: denn ens ist ὄν und essentia steht für οὐσία. Es ist ein Grundriß der Seinslehre des Heiligen, dem er in den Hauptzügen treu geblieben ist, wenn er auch unermüdlich daran weitergearbeitet hat, bis er einige Monate vor seinem Tode die Arbeit an seiner Summa abbrach, weil ihm Gott Dinge geoffenbart hatte, denen gegenüber ihm alles, was er geschrieben hatte, wie ein wenig Spreu erschien. Schon in diesem Jugendwerk ist der entscheidendste Schritt über Aristoteles hinaus getan: es wird innerhalb des Seienden (ens) zwischen dem Sein (esse) und dem Wesen (essentia) geschieden. Mit dieser Scheidung ist erst das Sein als solches erfaßt – gesondert von dem, was ist –, und zwar in der Weise, daß es Endliches und Unendliches umfaßt, aber zugleich den Abgrund, der dieses und jenes trennt. Von hier aus eröffnete sich ein Weg, die ganze Mannigfaltigkeit des Seienden in den Griff zu bekommen.
Wenn wir die Frage nach dem Sein als das Beherrschende sowohl im griechischen wie im mittelalterlichen Denken ansehen können, als das Unterscheidende aber, daß den Griechen diese Frage angesichts der natürlichen Gegebenheit der geschaffenen Welt aufging, daß sie sich aber den christlichen Denkern (in gewissem Umfang auch den jüdischen und islamitischen) erweiterte durch die übernatürliche Welt der Offenbarungstatsachen, so ist das von der Überlieferung gelöste neuzeitliche Denken dadurch gekennzeichnet, daß es an Stelle der Seinsfrage die Erkenntnisfrage in den Mittelpunkt stellte und die Verbindung mit dem Glauben und der Theologie wieder löste. Es ließe sich wohl zeigen, daß es auch der modernen Philosophie im Grunde um das wahre Sein zu tun war und daß sie mit ihrem Aufgreifen von Gedankenansätzen, die gleichfalls bis in die Anfänge der griechischen Philosophie zurückreichen und notwendige Erkenntnisrichtungen bezeichnen, wertvolle Dienste für die Seinsfrage geleistet hat. Schwererwiegend war die vollständige Loslösung von der offenbarten Wahrheit. Die »moderne Philosophie« sah in der offenbarten Wahrheit keinen Maßstab mehr, mit dem sie ihre Ergebnisse zu prüfen hätte. Sie war auch nicht mehr bereit, sich von der Theologie Aufgaben stellen zu lassen, um sie dann mit ihren eigenen Mitteln zu lösen. Sie betrachtete es nicht nur als ihre Pflicht, sich auf das »natürliche Licht« der Vernunft zu beschränken, sondern auch, nicht über die Welt der natürlichen Erfahrung hinauszugreifen. Sie wollte in jedem Sinne selbstherrliche (»autonome«) Wissenschaft sein. Das hat dahin geführt, daß sie weitgehend auch gott-lose Wissenschaft wurde. Und es führte zur Spaltung der Philosophie in zwei Heerlager, die getrennt marschierten, verschiedene Sprachen redeten und gar nicht mehr darum bemüht waren, einander zu verstehen: die »moderne« Philosophie und die katholische Schulphilosophie, die sich selbst als die philosophia perennis betrachtete, von Außenstehenden aber wie eine Privatangelegenheit der theologischen Fakultäten, der Priesterseminare und Ordenskollegien angesehen wurde. Die »philosophia perennis« erschien wie ein starres Begriffssystem, das als toter Besitz von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben wurde. Der Strom des Lebens aber hatte sich ein anderes Bett gegraben. Die letzten Jahrzehnte haben darin einen Umschwung gebracht, der sich von verschiedenen Seiten her vorbereitete. Zunächst auf katholischer Seite. Um zu verstehen, was sich hier vollzog, muß man bedenken, daß die »katholische Philosophie« (und »katholische Wissenschaft« überhaupt) nicht gleichbedeutend war mit der Philosophie der Katholiken. Das katholische Geistesleben war weitgehend vom »modernen« abhängig geworden und hatte den Zusammenhang mit seiner großen Vergangenheit verloren. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat darin eine wirkliche Renaissance gebracht, eine Wiedergeburt durch das Untertauchen in den besten Quellen. Ist es nicht erstaunlich, daß es erst der Erlasse Leos XIII. und Pius' XI. bedurfte, um das Thomasstudium wieder zu beleben, daß es nötig war, erst einmal für brauchbare Druckausgaben zu sorgen, daß in den Bibliotheken noch eine Fülle ungedruckten und völlig unbekannten handschriftlichen Materials zu entdecken war und daß eine umfassende Übersetzungstätigkeit erst in den allerletzten Jahren eingesetzt hat? All das sind Aufgaben, die in Angriff genommen und z. T. bewundernswert gefördert wurden, aber noch keineswegs zu Ende geführt sind. Es sind aber doch bis heute schon Ausgrabungsarbeiten geleistet worden, die eine vergessene Welt – eine reiche, heiß bewegte, voll lebendiger und fruchtbarer Keime – zu Tage gefördert haben. Die aufblühende moderne Geisteswissenschaft, selbst eine Frucht des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, hat wesentlich zum Gelingen dieser Unternehmungen beigetragen. Wir wissen heute, daß der »Thomismus« nicht als ein fertiges Begriffssystem aus dem Haupt seines Meisters entsprungen ist. Wir kennen ihn als ein lebendiges Geistesgebilde, dessen Werden und Wachsen wir verfolgen können. Es will von uns innerlich angeeignet werden und in uns neues Leben gewinnen. Wir wissen, daß die großen Denker des christlichen Mittelalters um dieselben Fragen gerungen haben, um die es auch uns geht, und daß sie uns vieles zu sagen haben, was uns helfen kann.
Denn das ist die andere Seite der Sache: etwa zur selben Zeit, in der die »christliche Philosophie« aus ihrem Dornröschenschlaf erwachte, machte die »moderne Philosophie« die Entdeckung, daß es auf dem Wege, den sie seit etwa drei Jahrhunderten verfolgte, nicht mehr weiterging. Aus dem Versanden im Materialismus suchte sie zunächst Rettung durch die Rückkehr zu Kant, aber das reichte nicht aus. Der Neukantianismus verschiedener Prägung wurde abgelöst durch die Richtungen, die wieder dem Seienden zugewandt waren. Sie brachten den verachteten alten Namen Ontologie (Seinslehre) wieder zu Ehren. Sie kam zuerst als Wesensphilosophie (die Phänomenologie Husserls und Schelers); dann stellte sich ihr die Existenzphilosophie Heideggers zur Seite und Hedwig Conrad-Martius' Seinslehre als deren Gegenpol. Die wiedergeborene Philosophie des Mittelalters und die neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts – können sie sich in einem Strombett der philosophia perennis zusammenfinden? Noch sprechen sie verschiedene Sprachen, und es wird erst eine Sprache gefunden werden müssen, in der sie sich verständigen können.
§ 3. Schwierigkeiten des sprachlichen Ausdruckes
Damit ist ein Punkt berührt, der für den Philosophen der Gegenwart ein wahres Kreuz bedeutet. Wir leben wirklich in einer babylonischen Sprachverwirrung. Man kann kaum einen Ausdruck gebrauchen, ohne fürchten zu müssen, daß der andere etwas ganz anderes darunter versteht, als man selbst meint. Die meisten »Fachausdrücke« sind mehrfach geschichtlich belastet. Ich habe in den kurzen vorbereitenden Ausführungen absichtlich den hl. Thomas in seiner Sprache reden lassen und die Namen »Potenz« und »Akt« nicht übertragen. Es ist nicht meine Absicht, dabei stehen zu bleiben. Es sind seit einigen Jahren in Deutschland Bestrebungen am Werk, der Philosophie eine eigene – deutsche – Sprache zu schaffen. Die mittelhochdeutschen Schriften der großen Mystiker bilden eine wertvolle Grundlage. Ein kühner Vorstoß in dieser Richtung ist die deutsche Ausgabe der Summa theologica des hl. Thomas von Joseph Bernhart. Die Summa-Übersetzung des Katholischen Akademikerverbandes strebt dasselbe, nur in viel gemäßigterer Form an. Diese Versuche zeigen aber zugleich die Gefahren einer solchen Verdeutschung. Wer sich im Übersetzen aus fremden Sprachen versucht hat, weiß, wieviel Unübersetzbares es gibt – obgleich andererseits die Möglichkeit viel weiter geht als das, womit man sich vielfach zufrieden gibt –, und wer darüber nachgedacht hat, was die Sprache und was Sprachen sind, der weiß auch, daß es gar nicht anders sein kann. Die Sprachen wachsen aus dem Geist der Völker hervor als Niederschlag und Ausdrucksform ihres Lebens, die Mannigfaltigkeit und die Eigenart der Völker muß sich darin spiegeln. Die Griechen, die ein philosophisches Volk waren, hatten sich auch eine philosophische Sprache geschaffen. Wo aber sollten die Römer eine philosophische Sprache hernehmen? Sie holten sich ihre Philosophie auf den griechischen Universitäten, von ihren griechischen Gästen oder Sklaven und waren wohl noch am besten daran, solange sie griechisch lasen und schrieben. Sobald sie aber daran gingen, eine römische Literatur zu schaffen, mußten sie sich bitter plagen, um ihrer Sprache das abzunötigen, was ihr fehlte. Seneca schreibt darüber an Lucilius: »Du wirst die römische Beschränktheit noch mehr verurteilen, wenn Du erfährst, daß es eine einzelne Silbe gibt, die ich nicht übersetzen kann. Du fragst, welche das sei: ὄν (das Seiende). Ich komme Dir schwerfällig vor: es liegt nahe zu übersetzen: ›Quod est‹ (was ist). Doch ich sehe einen erheblichen Unterschied zwischen beiden: ich muß einen zusammengesetzten Ausdruck für ein einzelnes Wort (verbum pro vocabulo) setzen; wenn es aber nicht zu umgehen ist, werde ich ›Quod est‹ setzen.« Auf die Bildung »ens« (Seiendes) ist Seneca noch nicht verfallen. (Boëthius verwendet sie bereits, wenn er auch meist noch »quod est« sagt.) Sie wäre ihm wohl auch gar zu barbarisch erschienen. Schon den Ausdruck »essentia« (Wesen) wagte er einem Mann von Geschmack nicht ohne weiteres zuzumuten. Er schickt eine bewegliche Klage über die Armut der lateinischen Sprache voraus und fährt dann fort: »›Was soll diese lange Einleitung?‹ fragst Du. ›Worauf läuft sie hinaus?‹ Ich will es Dir nicht verheimlichen: ich möchte, daß Du, wenn möglich, mit gnädigen Ohren den Ausdruck ›essentia‹ anhörst; sonst werde ich ihn auch vor ungnädigen aussprechen … Was soll man für οὐσία sagen – das notwendige Ding, die Natur, die die Grundlage für alles in sich enthält? Ich bitte Dich also, erlaube mir, dies Wort zu gebrauchen. Indessen will ich mir Mühe geben, von dem zugestandenen Recht den sparsamsten Gebrauch zu machen: vielleicht werde ich mich sogar mit der Erlaubnis begnügen.«
Sehen wir hier nicht wie in einem klaren Spiegel die Schwierigkeiten, mit denen wir selbst zu kämpfen haben? Freilich über Armut der deutschen Sprache haben wir uns nicht zu beklagen. Darin sind wir dem Griechischen gegenüber weit besser daran als die Römer. Unsere Schwierigkeit im Verhältnis zur lateinischen Sprache ist die entgegengesetzte: es ist von vornherein aussichtslos, ihre vieles umspannenden Ausdrücke mit je einem deutschen Wort wiedergeben zu wollen. Man wird immer nur eine Seite der Sache treffen und in manchen Zusammenhängen zu bedenklichen Sinnentstellungen kommen. Was tun? Natürlich von dem Reichtum unserer Sprache Gebrauch machen und, so weit nötig und möglich, an verschiedenen Stellen verschiedene Ausdrücke setzen, die den verschiedenen Bedeutungszusammenhängen gerecht werden. Aber das hat auch seine Gefahren. Es wird einmal nur einem Übersetzer möglich sein, der nicht nur die Sprachen – die eigene Muttersprache und die fremde – sicher beherrscht, sondern auch in der Gedankenwelt des betreffenden Werkes und seines Verfassers zu Hause ist und überdies selbst in unmittelbarer Fühlung mit den sachlichen Fragen lebt, um die es geht. Welcher Übersetzer wird sich aber all das zutrauen? Um nicht in die Gefahr zu kommen, seine eigenen persönlichen Einfälle statt der wahren Meinung des Verfassers darzubieten, wird er in vielen Fällen auf den lateinischen Ausdruck zurückgreifen müssen. Mitunter ist es auch darum nötig, weil wir trotz des größeren Reichtums der deutschen Sprache doch für manche Begriffe keinen ganz entsprechenden Ausdruck haben. Der wichtigste Grund aber, der mir einen völligen Verzicht auf die lateinischen Fachausdrücke unmöglich erscheinen läßt, ist noch ein anderer. Die Wortkargheit des Lateinischen ist nicht Armut schlechthin, es liegt darin auch eine Stärke. Wenn das Griechische mit der Freiheit und Leichtigkeit seiner Ausdrucksmöglichkeiten die Sprache der lebendigen Denkbewegung ist, so ist das Lateinische mit seiner strengen Gesetzlichkeit und herben Knappheit berufen zur Formung scharf geprägter Ausdrücke für zusammenfassende Ergebnisse. Die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen, die durch ein lateinisches Wort ausgedrückt werden, ist keine beliebige, sondern eine geordnete, sinnmäßig zusammenhängende. Diese für die sachlichen Zusammenhänge, für die Ordnung des Seienden überaus aufschlußreichen Sinneinheiten geben wir preis, wenn wir uns der lateinischen »Terminologie« einfach entledigen. Wir verzichten auf das reife Ergebnis einer jahrhundertelangen Gedankenarbeit und eines Volksgeistes, der mit seiner Eigenart – wie jeder Volksgeist – zu besonderer Leistung für die ganze Menschheit berufen war. Wer wollte sich vermessen, mit leichter Hand etwas anderes an die Stelle zu setzen?
Also: das eine tun und das andere nicht lassen. Was sich in deutschen Worten sagen läßt: dafür eigene, möglichst angemessene Ausdrücke suchen, aber das feste Grundgerüst der überlieferten Schulsprache beibehalten und durchblicken lassen, es zur Richtschnur nehmen und darauf zurückgreifen, so oft die Gefahr einer Sinnesverfälschung oder bedenklicher Einseitigkeit droht. (Man muß nämlich auch erwägen, daß das Bedeutungsganze, dem eine Teilbedeutung entnommen ist, ihr eine Färbung verleiht, die bei der Absonderung leicht verloren geht.)
Damit könnten wir uns zufrieden geben, wenn es sich nur um das Verhältnis der deutschen Sprache zur lateinischen handelte. Nun wissen wir aber, daß die lateinische Terminologie der griechischen nachgebildet ist und mit welchen Schwierigkeiten diese Nachbildung zu kämpfen hatte. Wir werden am ehesten Aussicht haben, den Sinn der lateinischen Ausdrücke recht zu verstehen und ihn in deutschen Worten treffend wiederzugeben, wenn wir auf den griechischen Ursprung zurückgehen. Sowenig die griechische Philosophie durch die Scholastik entbehrlich geworden ist, so wenig die griechische Sprache durch die lateinische.
Ein sehr erleuchtendes Beispiel für das Gesagte bilden gerade die Namen Potenz und Akt, von denen die Erörterung ausging. In dem Wort »Akt« ist zusammengefaßt, was die griechischen Worte ἐνέργεια, ἔργον, ἐντελέχεια ausdrücken. (Es könnten noch andere hinzugefügt werden, aber eine erschöpfende Aufzählung ist hier weder nötig noch angebracht.)
Ἐνέργεια (Energie) bezeichnet das wirkliche Sein im Gegensatz zum möglichen: δύναμιϚ. Der Möglichkeit nach z. B. ist die Hermesgestalt in dem Holz, aus dem sie geschnitzt werden kann, wirklich aber erst die ausgearbeitete; möglich ist wissenschaftliches Denken bei dem, der die Fähigkeit dazu hat, auch wenn er nicht gerade denkt; wirklich ist es im Vollzug, und so ist ἐνέργεια Wirksamkeit. Die Möglichkeit oder Fähigkeit (δύναμιϚ, Potenz) hat die Wirklichkeit zum Ziel (τέλοϚ) – so die Denkfähigkeit das Denken; wenn die Verwirklichung der Möglichkeit ein »Werk« ist, wird sie auch ἔργον genannt. Dabei ist sowohl an solches gedacht, was mit seinem Sein in dem Wirkenden beschlossen bleibt – wie das Denken im Denkenden – als auch an Ergebnisse des Wirkens, die ein eigenes Dasein haben: z. B. das Haus, das durch die Tätigkeit des Baumeisters entsteht. Im ersten Fall ist es besonders deutlich, daß ἐνέργεια und ἔργον (Wirksamkeit und Werk) eins sind. Und weil im wirklichen Sein die Möglichkeit ihr Ziel erreicht hat, wird es auch ἐντελέχεια (Entelechie) genannt, was wir etwa mit Seinsvollendung wiedergeben können.
Zur sachlichen Erörterung all dieser Begriffe ist hier noch nicht der Ort. Es sollte nur gezeigt werden, wie die Heranziehung der griechischen Texte uns helfen kann, der Sinnmannigfaltigkeit eines lateinischen Ausdruckes auf die Spur zu kommen und treffende deutsche Worte zu finden. Wirklichkeit, Wirksamkeit, Werk, Tätigkeit, Seinsvollendung – es mangelt uns wahrhaftig nicht an Ausdrucksmöglichkeiten. Aber das Beispiel zeigt wohl auch, wie bedenklich es wäre, einen dieser Ausdrücke an allen Stellen für das lateinische Wort »actus« einzusetzen. Wer z. B. von der modernen Philosophie herkommt und gewöhnt ist, unter »Akt« die frei vollzogene geistige Tat zu verstehen, wäre den ärgsten Mißverständnissen ausgesetzt, wenn er in den Werken der Scholastik überall diesen Sinn zu Grunde legen wollte.
Es soll in den folgenden Untersuchungen der Versuch gemacht werden, nach den entwickelten Grundsätzen vorzugehen. Wo scholastische Gedankengänge den Ausgangspunkt bilden, da sollen sie zunächst auch in den scholastischen Ausdrücken dargeboten werden. Aber um uns zu vergewissern, daß wir den sachlichen Sinn erfaßt haben und uns nicht bloß in Worten bewegen, wollen wir den jeweiligen Zusammenhängen entsprechende eigene Ausdrücke suchen. Dabei soll uns das Forschen nach den Ursprüngen der scholastischen Begriffe behilflich sein: nach den geschichtlichen Ursprüngen, mehr aber noch nach den sachlichen Ursprüngen, die sich uns nur erschließen, wenn wir die alte, immer wieder neu gestellte und niemals ganz gelöste Frage nach dem Seienden und nach der οὐσία selbst in Angriff nehmen. Wir wollen dabei mit den alten Meistern lebendig mitzudenken suchen, aber nicht nur mit den alten Meistern, sondern auch mit denen, die in unserer Zeit die Frage auf ihre Weise wieder aufgegriffen haben. Dies letzte Hilfsmittel ist ein sachlich gerechtfertigtes, weil die Philosophen, bei denen aus innerer Notwendigkeit heraus – nicht durch die Anleitung einer schulmäßigen Überlieferung – die Seinsfragen wieder zum Durchbruch kamen, in der unmittelbarsten Nähe dazu leben und uns helfen können, die ursprünglichen Antriebe der alten Meister zu verstehen. Es ist aber insbesondere der gebotene Weg für die Verfasserin, die in der Schule Edmund Husserls ihre philosophische Heimat und in der Sprache der Phänomenologen ihre philosophische Muttersprache hat. Sie muß versuchen, von diesem Ausgangspunkt den Weg in den großen Dom der Scholastik zu finden. Sie glaubt das Ziel soweit zu kennen, als es nötig ist, um sich von ihm auf dem Wege leiten zu lassen.
§ 4. Sinn und Möglichkeit einer »Christlichen Philosophie«
Wie es scheint, gibt es aber für die Verständigung zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher Philosophie ein noch viel größeres Hindernis als die Verschiedenheit der Sprache: das ist die verschiedene Einstellung zu der Frage nach dem Verhältnis von Wissen und Glauben, Philosophie und Theologie. Ob es erlaubt sei, von einer »Christlichen Philosophie« zu sprechen, darüber sind sich – wie schon erwähnt wurde – die katholischen Philosophen und Theologen auch untereinander nicht einig. Aber ob man nun die Philosophie als eine rein natürliche Wissenschaft ansieht – d. h. als eine Wissenschaft, deren einzige rechtmäßige Erkenntnisquelle die natürliche Erfahrung und Vernunft ist –, oder ob man ihr das Recht einräumt, aus der Offenbarung zu schöpfen: daran ist jedenfalls kein Zweifel, daß die Philosophie der großen Kirchenlehrer des Mittelalters sich »im Schatten« der Glaubenslehre entwickelt hat. Sie hat in der offenbarten Wahrheit den Maßstab aller Wahrheit gesehen; sie war eifrig bemüht, die Aufgaben zu lösen, die ihr durch die Glaubenslehren gestellt wurden; sie vertraute auf den Glauben als auf eine Kraft, die dem menschlichen Verstand auch bei seiner natürlichen Arbeit größere Sicherheit gebe. In all diesen Punkten hat sich die »moderne« Philosophie von ihr geschieden. Gibt es für so verschiedene Richtungen eine gemeinsame Arbeitsmöglichkeit? Gerade der hl. Thomas hat diese Möglichkeit entschieden bejaht. Daß er an eine Philosophie auf Grund der bloßen natürlichen Vernunft, ohne Zuhilfenahme der offenbarten Wahrheit glaubte, das beweist schon sein Verhältnis zu Aristoteles und den Arabern. Es geht auch deutlich hervor aus seiner »Summa contra gentiles«, die man die »Philosophische Summe« zu nennen pflegt. Hier spricht er davon, daß es den Heiden und Mohammedanern gegenüber, mit denen man keine gemeinsame Schriftgrundlage habe (wie mit den Juden das A.T., mit den Irrgläubigen das N.T.), notwendig sei, »auf die natürliche Vernunft zurückzugreifen, der alle zustimmen müssen«. Es gibt zwei Wege zur Wahrheit, und wenn die natürliche Vernunft nicht bis zur höchsten und letzten Wahrheit gelangen kann, so doch bis zu einer Stufe, von der aus schon die Ausschließung bestimmter Irrtümer und der Nachweis eines Zusammenstimmens der natürlich beweisbaren und der Glaubenswahrheit möglich wird.
Wenn es so nach der Überzeugung des Heiligen einen gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Arbeitsgebiet für alle Wahrheitssucher gibt, so ist es ebenso klar, daß für ihn nicht etwa natürliches Wissen und Glauben, Philosophie und Theologie getrennt nebeneinander stehen, als gingen sie einander nichts an. Seine Absicht geht ja gerade in der sogenannten »philosophischen Summe« auf den Erweis der Wahrheit des katholischen Glaubens und die Widerlegung der entgegenstehenden Irrtümer. Und daß für ihn die Glaubenswahrheit Maßstab aller Wahrheit ist, dafür legt fast jede Seite seiner Schriften Zeugnis ab: ein einfaches »Sed haec sunt contra fidem« {{» Aber das ist gegen den Glauben«}} gilt ihm als vollkommen hinreichende Widerlegung auch der größten philosophischen Autorität.
Jacques Maritain weist in seiner Darstellung der thomistischen Lösung darauf hin, daß es für die Frage nach Sinn und Möglichkeit einer »christlichen Philosophie« wichtig sei, zwischen »Natur« und »Zustand« der Philosophie zu unterscheiden. Ihrer Natur nach sei die Philosophie von Glauben und Theologie völlig unabhängig. Aber die Natur verwirklicht sich jeweils unter bestimmten geschichtlichen Bedingungen. Und mit Rücksicht auf ihre Verwirklichung könne man von einem christlichen Zustand der Philosophie sprechen. Um klarzumachen, was er unter der »Natur der Philosophie« – d. h. unter dem, »was sie in sich selbst ist« – versteht, weist er darauf hin, daß »nach dem heiligen Thomas von Aquin die Substanzen in absoluter Weise und durch sich selber in ihrem besonderen, ihrem eigentümlichen Wesen bestimmt sind, die Betätigungsmöglichkeiten der Substanzen hingegen … durch die den Substanzen wesensmäßig entsprechenden Akte und diese wiederum durch die den Akten zugeordneten Objekte. Wenn sich nun in uns jene bestimmte Ausprägung und auf Entfaltung hindrängende Gestaltung des Geistes ausbildet, die den Namen Philosophie trägt, so bezieht sie sich – wie jegliches Erkennen, Forschen und Urteilen – mit Wesensnotwendigkeit auf etwas Gegenständliches, sie läßt den Verstand auf die Natur dieses Gegenständlichen eingehen, und sie empfängt ihre besondere Charakterisierung durch nichts als durch dieses Gegenständliche. So ist also die Philosophie einzig und allein von ihrem Gegenstand her in ihrer Eigenart bestimmt. Das Gegenständliche, dem sie sich auf Grund ihres Wesens zuwendet (keineswegs etwa das Subjekt, in welchem sie Wohnung nimmt), ist das bestimmende Moment für ihre Natur«. Wir möchten in der Klärungsarbeit noch etwas weiter gehen. Die Philosophie wird hier als eine »Ausprägung und … Gestaltung des Geistes« in Anspruch genommen, als eine Art des »Erkennens, Forschens und Urteilens«, darum auf etwas Gegenständliches bezogen und »durch nichts als durch dieses Gegenständliche« seiner Art nach gekennzeichnet. Eine Ausprägung des Geistes: das ist eine Festlegung in einer bestimmten Richtung, auf eine bestimmte Betätigungsmöglichkeit (die Formung der »Potenz« zum »Habitus«). Wenn man von »Erkennen, Forschen, Urteilen« spricht, denkt man aber weniger an eine dauernde Geisteshaltung als an den entsprechenden »Akt«, die lebendige Betätigung. Unter Philosophie kann man beides verstehen: das lebendige Philosophieren und die dauernde Geisteshaltung. (Der Philosoph ist auch Philosoph in den Augenblicken, in denen er nicht philosophiert.) Darüber hinaus aber noch ein Drittes – und ich möchte sogar sagen, dies Dritte in erster Linie: Philosophie als Wissenschaft. Das lateinische Wort ›scientia‹ bedeutet zugleich »Wissen« (und dies sowohl als »Habitus« wie als »Akt«) und »Wissenschaft«. Und der theologische Sprachgebrauch verwendet auch den Ausdruck »Wissenschaft« im Sinne von »Wissen« (so, wenn von der Wissenschaft als einer Gabe des Heiligen Geistes gesprochen wird). Die moderne Logik und Wissenschaftstheorie aber versteht unter Wissenschaft ein gedankliches Gebilde, das ein von den einzelnen denkenden Geistern unabhängiges Dasein hat, ein innerlich zusammenhängendes, nach bestimmten Gesetzen geordnetes Gebäude von Begriffen, Urteilen, Beweisen. Das, was eine Wissenschaft zu einem innerlich einheitlichen und zusammenhängenden Ganzen macht und von anderen abgrenzt, ist ihre Bezogenheit auf ein bestimmtes Gegenstandsgebiet und die Bedingtheit durch dieses Gebiet, das ihrem ganzen Verfahren die Regel vorschreibt. Wenn Wissenschaft als Gebilde zu fassen ist, das nicht von einem einzelnen denkenden Geist abhängig und an ihn gebunden ist, so setzt sie doch das Gegenüber eines Seienden und erkennender Geister – sogar bestimmt gearteter, nämlich in schrittweisem Vorgehen erkennender Geister – voraus. Fassen wir Wissenschaft in diesem Sinn, so bleibt dem Wort immer noch ein Doppelsinn, der dem Unterschied von »Natur« und »Zustand« entspricht. Es kann einmal darunter das verstanden werden, was jeweils als geschichtliche Tatsache vorliegt, z. B. die Mathematik in ihrem gegenwärtigen Stande. Von ihr gilt, was Husserl sagt: »Objektiven Bestand hat die Wissenschaft nur in ihrer Literatur, nur in der Form von Schriftwerken hat sie ein eigenes, wenn auch zu dem Menschen und seinen intellektuellen Betätigungen beziehungsreiches Dasein; in dieser Form pflanzt sie sich durch die Jahrtausende fort und überdauert die Individuen, Generationen und Nationen. Sie repräsentiert so eine Summe äußerer Veranstaltungen, die, wie sie aus Wissensakten vieler Einzelner hervorgegangen sind, wieder in eben solche Akte ungezählter Individuen übergehen können …« Etwas vorher heißt es: »Wissenschaft geht, wie der Name besagt, auf Wissen.« Und bald danach: »Im Wissen aber besitzen wir die Wahrheit.« Die Wissenschaft in ihrem jeweiligen Zustand ist der Niederschlag alles dessen, was der Menschengeist zur Erforschung der Wahrheit getan hat, in Gebilden, die sich von dem forschenden Geist abgelöst haben und die nun ein eigenes Dasein führen. Was daran sinnenfällig ist, das ist Ausdruck eines Sinnes, der verstanden werden will. Die Wissenschaft in ihrem jeweiligen Zustand ist immer ein Bruchstück; und es gehören dazu auch alle Irrtümer, Umwege und Entstellungen der Wahrheit, denen der Menschengeist bei seinen Bemühungen verfallen ist.
Davon zu unterscheiden ist die Wissenschaft, wie sie ihrer »Natur« nach ist, oder (wie ich lieber sagen möchte) die Wissenschaft als Idee. Wir können uns denken, daß ein Sachgebiet vollständig erforscht wäre (obgleich wir wissen, daß der menschliche Geist in seinem irdischen Bemühen tatsächlich niemals diese Vollendung erreichen wird), daß alles, was sich überhaupt darüber aussagen läßt, in Form wahrer Sätze vorläge und daß all diese Sätze in dem sachgemäß geforderten Begründungszusammenhang stünden oder – was dasselbe besagt – die Einheit einer »geschlossenen Theorie« bildeten. Das wäre eine Wissenschaft in idealer Vollendung, »ohne Makel und Runzel« {{Eph 5, 27}}. Für unsere Erfahrung als geschichtliches Gebilde wird es so etwas niemals geben: es ist das Leitbild, dem wir uns mit all unserem Forschen und Mühen zu nähern suchen. Es ist aber darüber hinaus zu fragen, wieweit ein solches Leitbild sinnvoll sei: ob es überhaupt ein Sachgebiet gebe, das sich durch eine Wissenschaft »ausschöpfen« lasse, ob es für alle Sachgebiete in Betracht komme oder nur für bestimmt geartete. Um diese Fragestellung verständlich zu machen, müssen wir (wiederum späteren ausführlichen Erörterungen vorgreifend) kurz überlegen, was denn wohl unter der »Wahrheit« zu verstehen sei, die wir im Wissen besitzen. Ich weiß, daß in unserem Garten jetzt die Kirschen blühen. Der Satz »Die Kirschen blühen …« ist wahr. Die Kirschen blühen »in Wahrheit«. Der Satz als sprachliches Gebilde ist Ausdruck eines Sinnes, den ich mit meinem Wissen umfasse; er baut sich aus einer Reihe von verständlichen Ausdrücken auf. Daß ich diesen Sinn wissend umfasse (und nicht etwa bloß meinend), besagt, daß der Satz nicht bloß Ausdruck eines verständlichen Sinnes ist, sondern daß er »wahr« ist oder daß ihm etwas »in Wahrheit« entspricht. »Wahr« bedeutet in diesen beiden Wendungen nicht ganz dasselbe, aber die beiden Bedeutungen stehen in einem inneren Zusammenhang. Wenn man – wie es sprachüblich ist – von »Wahrheiten« spricht, so meint man damit »wahre Sätze«. Das ist eine ungenaue Ausdrucksweise. Der Satz ist nicht »eine Wahrheit« (veritas), sondern »ein Wahres« (verum). Seine Wahrheit (im strengen Sinn) besteht darin, daß er mit einem Seienden in Übereinstimmung ist oder daß ihm etwas entspricht, was unabhängig von ihm besteht. Der Wahrheit des Satzes liegt das wahre – d. h. das in sich begründete und den Satz begründende – Sein zugrunde. Das wahre Sein ist es, worauf alle Wissenschaft abzielt. Es liegt aller Wissenschaft voraus, nicht nur der menschlichen Wissenschaft als einer Veranstaltung zur Gewinnung von richtigem Wissen und damit zugleich von wahren Sätzen und als des greifbaren Niederschlages aller dahinzielenden Bemühungen, sondern selbst noch der Wissenschaft als Idee. Der Satz beschäftigt sich mit einem Gegenstand, von dem er etwas aussagt und den wir den »Satz-Gegenstand« nennen. Was aber der Satz, seinem eigentlichen Abzielen nach, »setzt« oder behauptet, ist nicht dieser Gegenstand (in unserem Beispiel: »die Kirschen«), auch nicht das, was er von dem Gegenstand aussagt (»blühen«), sondern der ganze »bestehende Sachverhalt« (»Die Kirschen blühen …«). Sätze sind Ausdruck bestehender Sachverhalte und haben in ihnen ihre Seinsgrundlage. Die Sachverhalte wiederum sind nicht in sich selbst begründet, sondern haben ihre Seinsgrundlage in »Gegenständen« (in einem besonderen Sinne des Wortes). Jedem Gegenstand gehört ein Bereich von Sachverhalten zu, in denen sich sein innerer Aufbau und die Beziehungen, in denen er vermöge seinem Standort im Zusammenhang des Seienden sich befindet, auseinanderlegen. Jedem Sachverhalt wiederum gehört ein Bereich von Sätzen zu, in denen er Ausdruck finden kann. (Daß es für denselben Sachverhalt eine Mannigfaltigkeit von Ausdrucksmöglichkeiten gibt, das liegt an der Sinnfülle der einzelnen Sachverhaltsglieder.) Schon die Sachverhalte sind mit ihrer Gliederung bezogen auf die mögliche Erkenntnis schrittweise vorgehender Geister. Das ist aber nicht so zu verstehen, als würden sie vom erkennenden Geist »erzeugt«: vielmehr schreiben sie ihm die Regel seines Verfahrens vor. In den Sachverhalten sind auch die Sätze als Ausdrucksmöglichkeiten schon begründet, und in dieser Weise »gibt es« sie, ehe sie von einem Menschengeist gedacht und in den »Stoff« einer menschlichen Sprache, in Laute oder Schriftzeichen, hineingeformt werden. Unter der »Wissenschaft als Idee«, die aller menschlichen Wissenschaft zugrunde liegt, ist also der »reine« (gleichsam noch körperlose) Ausdruck aller Sachverhalte zu verstehen, in denen sich das Seiende gemäß seiner eigenen Ordnung auseinanderlegt. Es ist aber nun die Frage, ob »alle Sachverhalte«, die dem Seienden entsprechen würden, und schon der Bereich von Sachverhalten, die einem einzelnen Gegenstand entsprechen, als ein abschließbares Ganzes zu denken sind, das seinen Gegenstand erschöpfen würde. Es kann hier dahingestellt bleiben, wie es sich damit bei den Sachgebieten verhalten mag, die von den »exakten« Wissenschaften behandelt werden. Jedenfalls ist sie zu verneinen für die wirkliche Welt in ihrer Fülle, die für eine zergliedernde Erkenntnis unausschöpfbar ist. Und wenn es so ist, dann ist jede »Wirklichkeitswissenschaft« (als Wissenschaft von der vollen Wirklichkeit) schon ihrer Idee nach etwas, was niemals zum Abschluß kommen wird.
Daß es eine Mannigfaltigkeit von Wissenschaften gibt, ist begründet in der Teilung des Seienden in eine Reihe von gattungs- und artmäßig in sich geeinten und gegeneinander abgegrenzten Gegenstandsgebieten. Die Frage ist nun, welches das Gegenstandsgebiet der Philosophie sei. Maritain sagt: »Was man sich auch für eine Vorstellung von der Philosophie bilden mag: Wenn man nicht das von sich aus für die natürlichen Kräfte des menschlichen Geistes Zugängliche für den Zuständigkeitsbereich der Philosophie hält, definiert man nicht die Philosophie, sondern man leugnet sie.« Das ist im Sinne der klaren Scheidung von Philosophie und Theologie zu verstehen, wie der hl. Thomas sie am Anfang der »Summa theologica« gibt: daß die »philosophischen Wissenschaften … im Bereich der menschlichen Vernunft bleiben«, die Theologie dagegen »auf göttlicher Offenbarung beruht«. Hier ist offenbar unter Philosophie alle natürliche Wissenschaft verstanden. Das entspricht dem Wissenschaftsbetrieb des Mittelalters, das noch keine scharfe Trennungslinie zwischen den Sondergebieten der weltlichen Wissenschaften kannte. Es entspricht aber nicht mehr der Auffassung der Gegenwart, die mit einer Reihe von völlig getrennten »Fächern« – nach Gegenstand und Methode durchaus voneinander unterschieden – zu rechnen hat und der Philosophie eine eigentümliche Stellung gegenüber allen »Einzelwissenschaften« zuweist. Während z. B. Mathematik und Geschichte völlig unbekümmert umeinander arbeiten können und tatsächlich arbeiten, ist die Philosophie genötigt, sich sowohl um die Mathematik als um die Geschichte zu kümmern. Und wenn der durchschnittliche Mathematiker und Geschichtsforscher innerhalb seiner Wissenschaft den gebahnten Weg geht, ohne der Philosophie, der Mathematik oder Geschichte Beachtung zu schenken, so werden doch immer Zeiten kommen, in denen die Einzelwissenschaft der Besinnung auf ihre philosophischen Grundlagen bedarf, um zur Klarheit über ihre eigenen Aufgaben zu kommen. Keine Wissenschaft darf willkürlich vorgehen – ihr Verfahren wird ihr durch die Natur ihres Sachgebietes vorgeschrieben. Darum stehen an den Anfängen der Wissenschaften meist schöpferische Geister, die sich ernstlich um die Klärung ihrer Grundbegriffe bemühen (man denke an Galilei und Newton oder auch an Schillers und noch Leopold von Rankes Bemühungen um den Sinn der Geschichte). Ist aber einmal das Verfahren (die »Methode«) begründet, dann besteht die Möglichkeit, es handwerksmäßig zu erlernen und auszuüben. Und es läßt
sich nicht leugnen, daß es »Wissenschaften« gibt, die ihre Arbeit ohne ausreichende vorausgehende Klärung gleich einer abenteuerlichen Entdekkungsfahrt auf unbekanntem Wege in ein unbekanntes Land unternommen haben. Für sie wird früher oder später allemal eine Zeit der Ratlosigkeit kommen, in der sie nicht mehr aus noch ein wissen. Dann gibt es keine andere Rettung als die Besinnung auf die eigenen Grundlagen und die Prüfung des bisher geübten Verfahrens sowie seiner Ergebnisse an diesen Grundlagen. So war der große Umbruch, in dem sich die Psychologie seit der letzten Jahrhundertwende befindet, unvermeidlich infolge des erstaunlichen salto mortale, mit dem die Psychologie des 19. Jahrhunderts den Seelenbegriff übersprungen hat. Die Klärung der Grundlagen aller Wissenschaften ist Aufgabe der Philosophie. Sie hat das zu untersuchen, was die Einzelwissenschaften als bekannt und selbstverständlich aus dem vorwissenschaftlichen Denken übernehmen. Und wo der Einzelwissenschaftler selbst solche Arbeit leistet – der Mathematiker, der über die Natur der Zahl, der Geschichtsforscher, der über den Sinn der Geschichte nachdenkt –, da verfährt er als Philosoph. Von hier aus können wir verstehen, warum der hl. Thomas die Philosophie (oder »Weisheit« im Sinne einer natürlichen Vorstufe der übernatürlichen Geistesgabe) als »perfectum opus rationis« (vollkommene Vernunftleistung) bezeichnet. Sie begnügt sich nicht mit einer vorläufigen Klärung, sondern ihr Ziel ist letzte Klarheit; sie will λόγον διδόναι (Rechenschaft geben) bis auf die letzten erreichbaren Gründe. Und wenn die Welt der Erfahrung mit der Fülle dessen, was sie den Sinnen und dem Verstand darbietet, den natürlichen Wissenstrieb reizt und »Gesichtspunkte« an die Hand gibt, sie nach dieser oder jener Richtung zu durchforschen, so will sie durchstoßen bis zum letzten Verständlichen, zum Sein selbst, zum Aufbau des Seienden als solchen und der wesensmäßigen Teilung des Seienden nach Gattungen und Arten, um von da aus zu sachgemäßen Fragestellungen und Forschungsweisen zu gelangen. Die Untersuchung des Seins und des Seienden als solchen ist Aufgabe dessen, was Aristoteles in seiner Metaphysik als »erste Philosophie« bezeichnet hat und was daher später »Metaphysik« genannt wurde. Die Behandlung der verschiedenen Grundgattungen des Seienden fällt den Teilgebieten der Philosophie zu, die für die Einzelwissenschaften grundlegend sind. Durch sie stellt sich nun auch wieder der Zusammenhang zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften her: wenn einmal die Arbeit der Philosophie vollendet wäre und alle Einzelwissenschaften auf der von ihr geschaffenen Grundlage aufgebaut, dann wären sie wahrhaft philosophische Wissenschaften, und wir hätten eine Einheit der Wissenschaft, die der Einheit des Seienden entspräche. Aber das ist wiederum ein Idealzustand, dem die menschliche Wissenschaft zusteuert, ohne ihn je erreichen zu können. Solange wir »in via« sind, werden Philosophie und Einzelwissenschaften als getrennte Forschungsrichtungen arbeiten müssen. Aber sie sind berufen, einander beständig neue Aufgaben zu stellen und sich wechselseitig durch ihre Ergebnisse zu befruchten, zu vertiefen und zu fördern. Wenn wir aber einmal »in patria« sind, dann wird das »Stückwerk« irdischer Weisheit und Wissenschaft abgelöst durch das »Vollkommene« der göttlichen Weisheit, die uns in einem Blicke schauen läßt, was der menschliche Verstand in seinem jahrtausendelangen Mühen zusammenzutragen suchte.
Nach der Klärung dessen, was wir unter Philosophie zu verstehen haben, können wir weiter fragen, was der »christliche Zustand« der Philosophie bedeuten mag. Maritain macht Verschiedenes geltend, was durch diesen Namen bezeichnet werden kann. Durch die Gnade wird der Geist des Menschen gereinigt und gestärkt und ist Irrtümern weniger ausgesetzt als im gefallenen Zustand, wenn auch keineswegs völlig dagegen gesichert: das betrifft die Philosophie als Geisteshaltung (Habitus) und Geistestätigkeit (Akt). Die Glaubenslehre bereichert aber auch die Philosophie um Begriffe, die ihr tatsächlich fremd geblieben sind, solange sie nicht aus dieser Quelle schöpfte, obwohl sie an sich von ihr entdeckt werden könnten: z. B. den der Schöpfung. Das betrifft die Philosophie als Wissenschaft: das, was uns als Philosophie der christlichen Zeit überliefert ist, enthält Bausteine, die aus der christlichen Gedankenwelt stammen. Darüber hinaus hat schließlich die Welt selbst dadurch, daß sie mit den Augen des Glaubens gesehen wird, einen neuen Sinn bekommen. »Als Gegebenheit ist … nunmehr eine Welt dargeboten, die das Werk des ,Wortes‹, der zweiten göttlichen Person ist, in der alles zu den endlichen Geistwesen, die sich als Geistwesen wissen, vom unendlichen Geist redet.« Damit ergibt sich aber für die Philosophie in ihrem »christlichen Zustand« eine neue Sicht ihrer eigenen Natur: das, was Maritain mit Gabriel Marcel als einen »Skandal« für die Vernunft bezeichnet – die »Tatsache, daß die Gültigkeit des Offenbarungsgutes jenseits aller Erfahrbarkeit liegt, die auf rein menschlichen Grundlagen möglich ist …« Wenn der Philosoph seinem Ziel, das Seiende aus seinen letzten Gründen zu verstehen, nicht untreu werden will, so wird er durch seinen Glauben genötigt, seine Betrachtungen über den Bereich dessen hinaus, was ihm natürlicherweise zugänglich ist, auszudehnen. Es gibt Seiendes, das der natürlichen Erfahrung und Vernunft unzugänglich ist, das uns aber durch die Offenbarung bekannt gemacht wird und den Geist, der es aufnimmt, vor neue Aufgaben stellt. »Über das Sinnenhafte holt sich die Philosophie bei den Naturwissenschaften Auskunft, wie sollte sie sich über das Göttliche nicht beim Glauben und bei der Theologie Auskunft holen? ›Die religiösen Tatsachen oder die definierten Dogmen‹, sagt Malebranche, ›sind meine Erfahrungen …‹ ; (nachdem ich sie als gültig erkannt habe), ›gebrauche ich meinen Geist (ihnen gegenüber) in derselben Weise wie jene, die Physik studieren‹.« Was die natürliche Vernunft als das »erste Seiende« erreicht, darüber geben ihr Glaube und Theologie Aufschlüsse, zu denen sie von sich aus nicht gelangen könnte, und zugleich über das Verhältnis, in dem alles Seiende zum ersten Seienden steht. Die Vernunft würde zur Unvernunft, wenn sie sich darauf versteifen wollte, bei dem stehen zu bleiben, was sie mit ihrem eigenen Licht entdecken kann, und die Augen vor dem zu schließen, was ein höheres Licht ihr sichtbar macht. Denn das muß betont werden: Was uns die Offenbarung mitteilt, ist nicht ein schlechthin Unverständliches, sondern ein verständlicher Sinn: nicht aus natürlichen Tatsachen zu begreifen und zu beweisen; überhaupt nicht zu »begreifen« (d. h. begrifflich auszuschöpfen), weil es ein Unermeßliches und Unerschöpfliches ist und nur jeweils soviel von sich faßbar macht, als es erfaßt haben will; aber in sich selbst verständlich und für uns verständlich in dem Maße, wie uns Licht gegeben wird, und Grundlage für ein neues Verständnis der natürlichen Tatsachen, die sich eben damit als nicht bloß natürliche Tatsachen enthüllen. Was Maritain für das menschliche Handeln ausgeführt hat: daß es so genommen werden müsse, wie es auf Grund des Sündenfalles und der Erlösung tatsächlich sei, und daß sich die Moral darum nicht als reine Philosophie vollenden lasse, sondern nur in Abhängigkeit von der Theologie, d. h. durch Ergänzung ihrer eigenen Grundwahrheiten von der Theologie her, das scheint mir – in einer gewissen Abwandlung und Erweiterung – von allem Seienden und von der gesamten Philosophie zu gelten. Die Grundwahrheiten unseres Glaubens – von der Schöpfung, vom Sündenfall, von der Erlösung und Vollendung – zeigen alles Seiende in einem Licht, wonach es unmöglich erscheint, daß eine reine Philosophie, d. h. eine Philosophie aus bloß natürlicher Vernunft, imstande sein sollte, sich selbst zu vollenden, d. h. ein »perfectum opus rationis« zu leisten. Sie bedarf der Ergänzung von der Theologie her, ohne dadurch Theologie zu werden. Wenn es Aufgabe der Theologie ist, die Offenbarungstatsachen als solche festzustellen und ihren eigenen Sinn und Zusammenhang herauszuarbeiten, so ist es Aufgabe der Philosophie, das, was sie mit ihren eigenen Mitteln erarbeitet hat, mit dem, was ihr Glaube und Theologie bieten, in Einklang zu bringen – im Sinne eines Verständnisses des Seienden aus seinen letzten Gründen. In Einklang bringen – das bedeutet zunächst das rein Negative, daß für den gläubigen Philosophen die offenbarte Wahrheit ein Maßstab ist, dem er seine eigene Einsicht unterzuordnen hat: er gibt eine vermeintliche Entdeckung preis, sobald er selbst erkennt oder durch den Ausspruch der Kirche darauf hingewiesen wird, daß sie mit der Glaubenslehre unvereinbar sei. So sehr der Philosoph auf klare Einsicht als letzte Bürgschaft innerhalb seines eigenen Verfahrens bedacht sein muß, so begehrenswert muß ihm – angesichts der unleugbaren Irrtumsmöglichkeit bei aller rein menschlichen Erkenntnis – um der Wahrheit willen die Nachprüfung durch eine übernatürlich erleuchtete und dadurch irrtumsfreie höchste Autorität erscheinen. Gewiß wird er sich ihr nur unterwerfen können, wenn er gläubig ist. Aber es muß auch dem Ungläubigen einleuchten, daß der Gläubige sich ihr nicht nur als Gläubiger, sondern auch als Philosoph unterwerfen muß.
Die Berücksichtigung der offenbarten Wahrheit kann ferner darin bestehen, daß der Philosoph in ihr Aufgaben für sich entdeckt, die ihm ohne ihre Kenntnis entgangen waren. P. A. R. Motte O.P. hat in seinem Vortrag in Juvisy darauf hingewiesen, daß die Glaubenslehre von Gott und der Schöpfung der Philosophie Anlaß gab zur Scheidung von Wesen und Dasein, die Lehre von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und von der Menschwerdung zur Scheidung von Natur und Person, die Lehre von der Hl. Eucharistie zur scharfen begrifflichen Herausarbeitung von Substanz und Akzidens. Die Begegnung mit einem bis dahin unbekannten Seienden zeigt das Seiende und das Sein als solches von einer neuen Seite. Die Offenbarung spricht in einer dem natürlichen Menschenverstand zugänglichen Sprache und bietet Stoff zu einer rein philosophischen Begriffsbildung, die von den Offenbarungstatsachen als solchen ganz absehen kann und deren Ergebnis Gemeingut aller späteren Philosophie wird (z. B. die Begriffe »Person« und »Substanz«).
Diese beiden Arten der Berücksichtigung von Glaubenswahrheiten zeigen die Philosophie in ihrem jeweiligen Zustand – als geschichtliches Gebilde – in Abhängigkeit von Glauben und Theologie als von äußeren Bedingungen ihrer Verwirklichung. Sie ergeben »Christliche Philosophie« in dem Sinne, in dem der Thomismus so genannt werden kann, aber keine christliche Philosophie, die die offenbarte Wahrheit als solche in ihren Gehalt mit aufnimmt. Wenn dagegen die Philosophie in der Erforschung des Seienden auf Fragen stößt, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht beantworten kann (z. B. die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Seele), und wenn sie sich dann die Antworten zu eigen macht, die sie in der Glaubenslehre findet, um so zu einer umfassenderen Erkenntnis des Seienden zu gelangen, dann haben wir eine christliche Philosophie, die den Glauben als Erkenntnisquelle benutzt. Sie ist dann nicht mehr »reine« und »autonome« Philosophie. Es scheint mir aber nicht berechtigt, sie nun als Theologie anzusprechen. Wenn in einem geschichtlichen Werk über das Geistesleben des 20. Jahrhunderts die Umwandlung der modernen Physik durch den Einfluß der Einsteinschen Relativitätstheorie dargestellt wird, dann muß der Geschichtsforscher beim Naturwissenschaftler in die Schule gehen; sein Werk wird aber dadurch, daß er das Gelernte hineinarbeitet, kein naturwissenschaftliches. Das Ausschlaggebende ist die leitende Absicht. Das Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie ist nicht genau dasselbe, weil es dem Geschichtsforscher nicht um die Richtigkeit oder Falschheit der Einsteinschen Theorie zu tun ist, sondern nur um ihren geschichtlichen Einfluß. Dem Philosophen aber geht es, wenn er eine Anleihe bei der Theologie macht, um die offenbarte Wahrheit als Wahrheit. Das Gemeinsame ist, daß in beiden Fällen eine andere Wissenschaft in Anspruch genommen werden muß, um in der eigenen weiterzukommen, und daß auf Grund des erlangten Hilfsmittels dann auf dem eigenen Gebiet weitergearbeitet wird. Allerdings kann die Philosophie für das, was sie mit Hilfe der Glaubenslehre feststellt, nicht die Einsichtigkeit in Anspruch nehmen, die das Kennzeichen ihrer eigenen, selbständigen Ergebnisse ist (sofern es sich um echte philosophische Erkenntnis handelt). Was aus der Zusammenschau von Glaubenswahrheit und philosophischer Erkenntnis stammt, das trägt den Stempel der doppelten Erkenntnisquelle, und der Glaube ist ein »dunkles Licht«. Er gibt uns etwas zu verstehen, aber nur, um uns auf etwas hinzuweisen, was für uns unfaßlich bleibt. Weil der letzte Grund alles Seienden ein unergründlicher ist, darum rückt alles, was von ihm her gesehen wird, in das »dunkle Licht« des Glaubens und des Geheimnisses, und alles Begreifliche bekommt einen unbegreiflichen Hintergrund. Das ist es, was P. Przywara als »reductio ad mysterium« bezeichnet hat. Wir stimmen mit ihm – wie aus den letzten Ausführungen ersichtlich ist – auch darin überein, daß die Philosophie »durch Theologie, nicht als Theologie« vollendet werde. Dagegen vermochte ich bei ihm nicht klar zu ersehen, von welcher Seite die Vereinigung von »Theologie und Philosophie innerhalb einer Metaphysik« erfolgt. Der »Form-Primat« der Theologie ist gewiß anzuerkennen in dem Sinn, daß der letzte Richterspruch über die Wahrheit sowohl theologischer als philosophischer Sätze der Theologie – in ihrer höchsten Bedeutung als Sprechen Gottes durch das kirchliche Lehramt – zusteht. Aber gerade weil die Philosophie (nicht die Theologie) einer inhaltlichen Ergänzung bedarf, fällt ihr die Aufgabe zu, die Einheit einer umfassenden Lehre herzustellen. So ist nach unserer Auffassung »christliche Philosophie« nicht bloß der Name für die Geisteshaltung des christlichen Philosophen, auch nicht bloß die Bezeichnung für die tatsächlich vorliegenden Lehrgebäude christlicher Denker – es bezeichnet darüber hinaus das Ideal eines »perfectum opus rationis«, dem es gelungen wäre, die Gesamtheit dessen, was natürliche Vernunft und Offenbarung uns zugänglich machen, zu einer Einheit zusammenzufassen. Das Streben nach diesem Ziel fand seinen Niederschlag in den »Summen« des Mittelalters; diese großen Gesamtdarstellungen waren die angemessene äußere Form einer auf das Ganze gerichteten Forschung. Die Verwirklichung dieses Ideals aber – in dem Sinn, daß alles Seiende in seiner Einheit und in seiner Fülle erfaßt wäre – entzieht sich grundsätzlich aller menschlichen Wissenschaft: schon das endliche Wirkliche ist etwas, was sich begrifflich nicht ausschöpfen läßt, um so mehr das unendliche Sein Gottes. Die reine Philosophie als Wissenschaft vom Seienden und vom Sein aus seinen letzten Gründen, soweit die natürliche Vernunft des Menschen reicht, ist auch in ihrer denkbar größten Vollendung wesenhaft ein Unvollendetes. Sie ist zunächst offen zur Theologie hin und kann von daher ergänzt werden. Aber auch die Theologie ist kein geschlossenes und je abschließbares Gedankengebilde. Sie entfaltet sich geschichtlich als fortschreitende gedankliche Aneignung und Durchdringung des überlieferten Offenbarungsgutes. Darüber hinaus aber ist zu bedenken, daß die Offenbarung nicht die unendliche Fülle der göttlichen Wahrheit in sich befaßt. Gott teilt sich dem Menschengeist mit in dem Maß und in der Weise, wie es Seiner Weisheit entspricht. Es steht bei Ihm, das Maß zu erweitern. Es steht bei Ihm, die Offenbarung in einer Form zu geben, die der menschlichen Denkweise angemessen ist: dem schrittweisen Erkennen, der begrifflichen und urteilsmäßigen Fassung; oder den Menschen über seine natürliche Denkweise hinauszuheben zu einer völlig anderen Erkenntnisart, zu einem Teilhaben an der göttlichen Schau, die in einem einfachen Blick alles umfaßt. Die vollendete Erfüllung dessen, worauf die Philosophie, als Streben nach Weisheit, abzielt, ist allein die göttliche Weisheit selbst, die einfache Schau, mit der Gott sich selbst und alles Geschaffene umfaßt. Die für einen geschaffenen Geist – freilich nicht aus eigener Kraft – erreichbare höchste Verwirklichung ist die »selige Schau«, die Gott ihm schenkt, indem Er ihn mit sich vereinigt: er gewinnt Anteil an der göttlichen Erkenntnis, indem er das göttliche Leben mitlebt. Die größte Annäherung an dieses höchste Ziel ist während des Erdenlebens die mystische Schau. Es gibt aber auch eine Vorstufe, zu der nicht diese höchste Begnadung nötig ist, und das ist der echte lebendige Glaube. Nach der Lehre der Kirche ist »der Glaube eine übernatürliche Tugend, durch die wir, auf die Eingebung und mit dem Beistand der göttlichen Gnade, für wahr halten, was Gott offenbart und uns durch die Kirche gelehrt hat, nicht wegen der inneren, sachlichen Wahrheit, die wir mit dem Licht der natürlichen Vernunft erkennen würden, sondern wegen der Autorität des offenbarenden Gottes selbst, der weder getäuscht werden noch täuschen kann«. Der theologische Sprachgebrauch bezeichnet als Glauben nicht nur die Tugend (fides, qua creditur), sondern auch das, was wir glauben, die offenbarte Wahrheit (fides, quae creditur), und schließlich die lebendige Betätigung der Tugend, das Glauben (credere) oder den »Glaubensakt«. Und dieses lebendige Glauben ist es, das wir jetzt im Auge haben. Es ist darin Verschiedenes enthalten: indem wir auf die Autorität Gottes hin die Glaubenswahrheiten annehmen, halten wir sie für wahr, und eben damit schenken wir Gott Glauben (credere Deo). Wir können aber nicht Gott Glauben schenken, ohne an Gott zu glauben (credere Deum), d. h. zu glauben, daß Gott ist und Gott ist: das höchste und damit vollkommen wahrhaftige Wesen, das wir mit dem Namen »Gott« meinen. Die Glaubenswahrheiten annehmen heißt darum Gott annehmen, denn Gott ist der eigentliche Gegenstand des Glaubens, von dem die Glaubenswahrheiten handeln. Gott annehmen, das heißt aber auch, sich Gott im Glauben zuwenden oder »zu Gott hin glauben« (credere in Deum), Gott zustreben. So ist der Glaube ein Ergreifen Gottes. Das Ergreifen aber setzt ein Ergriffenwerden voraus: wir können nicht glauben ohne Gnade. Und Gnade ist Anteil am göttlichen Leben. Wenn wir uns der Gnade öffnen, den Glauben annehmen, haben wir den »Anfang des ewigen Lebens in uns«.
Wir nehmen den Glauben auf das Zeugnis Gottes hin an und gewinnen dadurch Erkenntnisse, ohne einzusehen: wir können die Glaubenswahrheiten nicht als in sich selbst einleuchtend annehmen wie notwendige Vernunftwahrheiten oder auch wie Tatsachen der sinnlichen Wahrnehmung: wir können sie auch nicht nach logischen Gesetzen aus unmittelbar einleuchtenden Wahrheiten ableiten. Das ist der eine Grund, warum der Glaube ein »dunkles Licht« genannt wird. Es kommt aber hinzu, daß er als »credere Deum« und »credere in Deum« immer über alles hinausstrebt, was offenbarte Wahrheit ist, Wahrheit, von Gott in der Weise des menschlichen Erkennens in Begriffe und Urteile gefaßt, in Worten und Sätzen ausgedrückt. Er will mehr als einzelne Wahrheiten von Gott, er will Ihn selbst, der die Wahrheit ist, den ganzen Gott, und ergreift Ihn, ohne zu sehen: »obgleich's bei Nacht ist«. Das ist die tiefere Dunkelheit des Glaubens gegenüber der ewigen Klarheit, der er zustrebt. Von dieser doppelten Dunkelheit spricht unser hl. Vater Johannes vom Kreuz, wenn er sagt: »… das Vorwärtsschreiten des Verstandes ist ein Mehrsichbefestigen im Glauben; und so ist das Vorwärtsgehen ein Verfinstertwerden, da der Glaube Finsternis für den Verstand ist.« Dennoch ist es ein Vorwärtsschreiten: ein Hinausgehen über alle begrifflich faßbare Einzelerkenntnis hinein in das einfache Umfassen der Einen Wahrheit. Darum steht der Glaube der göttlichen Weisheit näher als alle philosophische und selbst theologische Wissenschaft. Weil uns aber das Gehen im Dunkeln schwer wird, darum ist jeder Strahl des Lichtes, das als ein Vorbote der künftigen Klarheit in unsere Nacht fällt, eine unschätzbare Hilfe, um an unserem Weg nicht irre zu werden. Und selbst das kleine Licht der natürlichen Vernunft vermag wertvolle Dienste zu leisten. Eine »Christliche Philosophie« wird es als ihre vornehmste Aufgabe ansehen, Wegbereiterin des Glaubens zu sein. Gerade darum war es dem hl. Thomas so sehr am Herzen gelegen, eine reine Philosophie auf Grund der natürlichen Vernunft aufzubauen: weil sich nur so ein Stück gemeinsamen Weges mit den Ungläubigen ergibt; wenn sie einwilligen, diese Strecke mit uns zu gehen, werden sie sich in der Folge vielleicht noch etwas weiter führen lassen, als es ihre ursprüngliche Absicht war. Vom Standpunkt der »Christlichen Philosophie« besteht also kein Bedenken gegen eine gemeinsame Arbeit. Sie kann in die Schule der Griechen und der Modernen gehen und nach dem Grundsatz: »Prüfet alles und das Beste behaltet« sich aneignen, was ihren Maßstäben standhält. Sie kann andererseits zur Verfügung stellen, was sie selbst zu geben hat, und den andern Nachprüfung und Auswahl überlassen. Es besteht für den Ungläubigen kein sachlicher Grund, gegen die Ergebnisse ihres natürlichen Verfahrens mißtrauisch zu sein, weil sie außer an den obersten Vernunftwahrheiten auch an der Glaubenswahrheit gemessen sind. Es bleibt ihm selbst unbenommen, den Maßstab der Vernunft in aller Strenge zu handhaben und alles abzulehnen, was ihm nicht genügt. Es steht ferner bei ihm, ob er weiter mitgehen und auch die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen will, die mit Hilfe der Offenbarung gewonnen sind. Er wird die verwendeten Glaubenswahrheiten nicht als »Sätze« (Thesen) annehmen wie der Gläubige, sondern nur als »Ansätze« (Hypothesen). Aber ob die Folgerungen, die daraus gezogen werden, den Vernunftwahrheiten entsprechen oder nicht, dafür gibt es wieder auf beiden Seiten einen gemeinsamen Maßstab. Ob er dann die Zusammenschau, die sich für den gläubigen Philosophen aus natürlicher Vernunft und Offenbarung ergibt, mitvollziehen kann und ob er damit ein tieferes und umfassenderes Verständnis des Seienden gewinnen wird, das dürfte er ruhig abwarten. Wenn er so vorurteilsfrei ist, wie es nach seiner Überzeugung der Philosoph sein soll, so wird er vor dem Versuch jedenfalls nicht zurückschrecken.