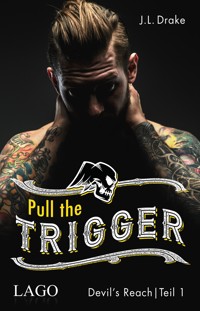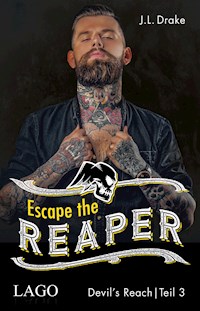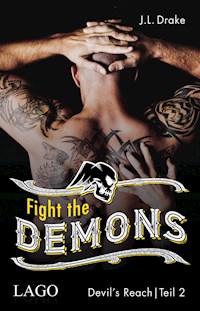Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Du kannst dich immer fallen lassen, Savannah, denn ich werde dich auffangen." (Cole Logan) Savannah Miller, die 27-jährige Tochter des Mayors von New York, wird von der großen Kidnapper-Gruppe Los Sirvientes Del Diablo entführt. Sieben Monate wird sie in Tijuana, Mexiko, in Gefangenschaft gehalten, wobei sie jegliches Zeitgefühl verliert. Als sie sich schon beinahe selbst aufgegeben hat, naht ihre Rettung. Die Shadow Group, eine Spezialeinheit der US-Army, befreit Savannah und stellt sie unter ihren Schutz. In einem abgelegenen Haus wird sie vorerst in Sicherheit gebracht. Doch die Außenwelt und auch ihre Familie dürfen nicht erfahren, dass sie dort ist – denn das könnte sie in Gefahr bringen. Cole Logan, das obere Mitglied der Shadow Group, ist persönlich für Savannah verantwortlich und schafft es schnell, ihr Vertrauen zu gewinnen Als Anführer der Shadow Group und Workaholic hatte Cole bisher keinen Sinn für romantische Gefühle. Aber bei Savannah scheint alles anders zu sein. Und auch Savannah spürt mehr als pures Vertrauen – seine erotische Anziehungskraft lässt sie in seinen Händen zerfallen und sich ganz der Lust der Verführung hingeben. Doch wird Cole Savannah und sich selbst in Gefahr bringen, wenn er seinen kühlen, klaren Kopf verliert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2020
© 2016 by Lago, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© 2015 by J. L. Drake
Die englische Originalausgabe erschien 2015 bei Limitless Publishing, LLC, Kailua, HI 96734, unter dem Titel Broken, Broken Trilogy, Book One.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Alfons Winkelmann
Redaktion: Carina Heer
Umschlaggestaltung: Laura Osswald in Anlehung an Redbird Designs
Umschlagabbildung: Shutterstock/Maksim Shmeljov
Satz: Georg Stadler, München
ISBN Print: 978-3-95761-133-8
ISBN E-Book (PDF): 978-3-95762-074-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-95762-073-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Mutter, die zusammen mit mir von Anfang an dieser Geschichte gefolgt ist. Riesigen Dank für die grenzenlose Unterstützung, die du mir bei allem gewährt hast, was ich jemals ausprobiert habe.
Ich liebe dich.
Prolog
Betrug
Täuschung
Unwahrheit
Verfälschung
Erfindung
Mythos
Fabel
Flunkerei
… wie man es auch dreht und wendet, es meint immer dasselbe: Lügen.
Kapitel 1
Savannah
Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin – vier Monate, vielleicht auch fünf. Die Zeit vergeht sehr seltsam, wenn man kein rechtes Mittel hat, sie zu messen. Anfangs maß ich die Zeit anhand der Mahlzeiten, die ich erhielt, aber die kamen nach einer Weile seltener und weniger zuverlässig. Sicher weiß ich nur, dass ich eine volle Jahreszeit hier bin, denn die Männer gingen dazu über, statt langärmeliger Hemden T-Shirts zu tragen.
Mein Gefängnis ist ein kleiner Raum mit einem rostigen Bett, das jedes Mal quietscht, wenn ich mich bewege. Ein winziger Holztisch mit einem Hocker steht in der einen Ecke, und eine Toilette und ein Waschbecken verbergen sich hinter einem zerschlissenen Vorhang in der anderen. Keine Fenster, kein Fernseher, nichts zu lesen außer ein zerfleddertes Exemplar von Wiseguy von Nicholas Pileggi – Der Mob von innen. Ein Mafioso packt aus. Früher habe ich nicht gern Krimis gelesen, aber inzwischen kenne ich jedes einzelne Wort in- und auswendig.
Ich höre das vertraute Geräusch des Schlüssels, der das Schloss öffnet, und spüre das flaue Gefühl im Magen. Ich zerre an meinem verfilzten Pullover und schlinge ihn etwas enger um meinen Bauch – als ob das etwas dabei nutzen könnte, mich vor ihnen zu schützen.
Ich höre seine Boots über den Hartholzboden scharren, und der Schweiß bricht mir im Nacken aus. Scheiße,er ist es. Beim Anblick seiner Wurstfinger, die ein Tablett mit Essen für mich festhalten, bekomme ich eine Gänsehaut. Sein behaarter Bauch schiebt sich unter dem T-Shirt hervor und wölbt sich über seine Jeans. Sobald sein Blick auf mich fällt, grinst er mich schräg an.
»Hola chica, wie geht’s dir heute?« Seine Stimme ist rau und sein Akzent schwer, aber ich verstehe jedes Wort. Seine Körpersprache allein reicht dazu aus. »Ich hab dich was gefragt«, brüllt er mich an.
»Gut«, erwidere ich durch den Kloß in meiner Kehle.
Er steht da und hält das Tablett über mir. Schließlich hebe ich die Augen und sehe ihn an. Sein höhnisches Grinsen zeigt mir, wie sehr er es genießt, diese Macht über mich zu haben. Ich habe genügend Begegnungen mit diesem Mann gehabt, um zu wissen, dass er nicht gehen wird, ohne zuvor etwas als Gegenleistung bekommen zu haben. Zum Glück war es bisher noch nie etwas Sexuelles – eher so gewisse Verwirrspiele. Was nicht heißt, dass er nie entsprechende Andeutungen gemacht hätte. Ich spüre das Zittern meines Körpers, und zittrige Finger zerren am Saum meines Baumwollnachthemds, das auf halbem Oberschenkel endet. Ich brauche ihn ja nicht auf irgendwelche Gedanken bringen. Sein Blick fällt hinab auf meine Beine, und er leckt sich die Lippen.
»Bettle!«, befiehlt er gedehnt.
Mein Mund wird trocken. Er liebt diesen Teil. Für ihn bin ich ein Tier. Er nennt mich »perra«, das ist Spanisch und heißt »Hündin«. Ich spüre die Wut in mir aufsteigen und versuche zugleich, mich zurückzuhalten, aber ich kann nicht anders. Inzwischen macht es mir nichts mehr aus.
Ich schenke ihm mein lieblichstes Lächeln, das ich aufbringen kann. »Verpiss dich!« Ich habe seit meiner Ankunft hier nie mehr als absolut nötig mit ihm gesprochen. Dieser Hinweis muss genügen, um zu verstehen, dass ihn meine Wortwahl jetzt umhaut. Normalerweise tue ich, was er von mir verlangt, während ich mir insgeheim die vielen Möglichkeiten vorstelle, diesen Mann umzubringen. Ich versuche, mich zu benehmen, denn ich möchte meine ersten paar Tage hier nicht noch einmal erleben. Der unglaubliche Schmerz, nachdem sie mich blutig geprügelt hatten, als ich nicht getan hatte, was verlangt worden war, hat mich rasch klug gemacht.
Mein gegenwärtiger Adrenalinschub ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn ich sehe, wie sich seine Augen zu Schlitzen verengen und er sein Kinn anspannt. Plötzlich schleudert er das Tablett quer durch den Raum, sodass das Geschirr an der Wand zerbricht.
»Kein Essen für dich, lengua de mierda!«, zischt er und kommt einen Schritt auf mich zu. Ich lege die Hände über die Ohren und ziehe die Knie an meine Brust. Dieser Mann ist kräftig genug, dass er mich mit einer Hand hochnehmen und durch den Raum schleudern könnte, sodass es mir ebenso ergeht wie dem Tablett. Er packt eine Handvoll meines Haars und zerrt mich durch den Raum, wobei meine Knie immer wieder auf den Fußboden schlagen, wie bei einer Stoffpuppe. Den Schmerz spüre ich kaum – vielmehr denke ich daran, dass dieser zwei Meter große, mehr als hundertfünfzig Kilo schwere Mann stinkwütend ist. Warum musste ich auch so clever sein? Das Einzige, was für mich spricht, ist die Tatsache, dass sie mich bisher noch nicht getötet haben. Es ist kein Geheimnis, dass mein Vater viel Geld hat, und alle kennen seinen Namen – er bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von New York City.
Er lässt mich fallen. Mit der Stirn knalle ich auf den Boden, und mir klingeln die Ohren. Mit aller Kraft versuche ich, mich hochzustemmen, aber sein Stiefel drückt fest auf meinen Rücken und zwingt mich nach unten. Ich wimmere, und mein Blick konzentriert sich auf etwas knapp außer Reichweite. Ich höre, wie er sich den Hosengürtel herauszieht, und mein Herz schlägt rascher – nein, nein, nein! Das kann nicht sein. Wenn ich nur einen halben Meter nach rechts käme … unter Aufbietung all dessen, was ich an Kräften habe, werfe ich mich nach vorn.
»Wohin willst du denn?« Seine Stimme ist ruhig – oh, so ruhig. Meine Finger schlingen sich um eine Glasscherbe, und ich stecke meine Hand unter meine Brust, um sie zu verstecken. »Komm.« Er beugt sich herab, packt mich an den Füßen, wirft mich herum und zerrt mich zurück zum Bett. Ich kreische protestierend. Ich trete um mich und drehe und winde mich, aber sein Griff ist allzu fest. »Streitlustiges kleines Ding, nicht wahr?« Er kichert, beugt sich über mich und will mich packen, und da ergreife ich die Gelegenheit. Ich schieße hoch und treibe ihm das scharfe Stück Glas in den Hals. Vor Schock bekommt er große Augen, und er fällt mit einem lauten Plumps zur Seite. Fluchend versucht er, das Ding aus seinem Hals zu ziehen. Ich komme mühsam auf die Beine und renne zur offenen Tür.
Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich muss, aber es ist mir auch gleichgültig – zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich dieses Zimmer verlassen. Ich renne, so schnell meine Füße mich tragen. Ich bin unterzuckert und mir ist schwindelig, aber ich renne weiter – das ist meine Chance. Körperliche Aktivität war so lange nicht Teil meiner Welt, dass es meinem Gehirn schwerfällt abzuwarten, während meine Beine verzweifelt ihr Bestes geben. Der Flur ist lang und von zahlreichen Türen gesäumt. Die Tapete ist an einige Stellen heruntergerissen, und die Beleuchtung ist schwach. Es sieht wie ein verlassenes Hotel aus, aber wo sind die Fenster? Immer wieder renne ich um Ecken, mit den Händen halte ich mich an den Wänden aufrecht, wenn meine Knie schwach werden. Ich habe kein Gefühl für die Richtung, jeder Flur sieht aus wie der letzte. Ich höre Stimmen lauter werden, und mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ich ziehe und drücke am nächsten Türknauf, aber er gibt nicht nach. Heiße Tränen rinnen mir die Wangen herab, ich gerate in Panik und Schluchzer überwältigen mich. Ich dränge sie mühsam zurück, aber ich merke, dass ich mich selbst aufgebe – ich habe eine Chance zur Flucht, und ich bekomme nicht mal eine gottverdammte Tür auf! Ein schweres Klicken, gefolgt von einem Summen, lässt mich erstarren. Dann flackern die Lampen und erlöschen.
Ich lege eine Hand über den Mund, um meinen Aufschrei zu ersticken. Meine Hände zittern ebenso heftig, wie meine Zähne klappern. Ich drücke mich mit dem Rücken an die Tür, da ich etwas benötige, das mich aufrecht hält. Ein helles Flackern links von mir zieht meinen Blick auf sich, aber es erlischt rasch, und ihm folgt ein schwacher orangefarbener Schimmer. Jemand steht etwa drei Meter von mir entfernt und raucht eine fette Zigarre. Ich schließe die Augen und spreche ein stilles Gebet. Als ich sie wieder öffne, sehe ich mich einem niederträchtigen Augenpaar – nur Zentimeter von mir entfernt – gegenüber. Ich bin außerstande, mich zu rühren. Ich kenne diesen Mann. Ich habe ihn ein paarmal zuvor gesehen, und ich glaube, er ist hier der Boss. Er qualmt weiter, sodass sich meine Nase mit dem ekelerregenden Geruch seiner Montecristo füllt. Ich würde diesen Geruch überall wiedererkennen. Mein Vater hat oft Partys gegeben, und es war anscheinend die beliebteste Zigarre bei seinen Gästen.
Meine Knie geben nach, während ich ihn weiterhin schweigend anstarre. Ich höre, wie sich seine Schulter in seinem Jackett bewegt, als er die Hand hebt und mich fest am Kinn packt. Mit beiläufiger Leichtigkeit lässt er sein Feuerzeug aufschnappen. Er hält es hoch und inspiziert die schwellende Beule über meinem Auge. Die Flamme erlischt, und ich spüre seine Hand, die sich in einem schraubstockartigen Griff um meinen Nacken legt. Er schiebt mich vor sich her. Offensichtlich kennt er das Gebäude gut, denn es ist nach wie vor finster um uns, und er lenkt mich, ohne zu zögern. Außer meinem hämmernden Herzen und meinen kurzen, abgerissenen Atemzügen höre ich nichts.
Schließlich bleiben wir an einer Tür stehen. Er drückt sie auf und stößt mich hindurch. Ich stolpere voran und falle auf die Knie. Plötzlich geht das Licht an, und ich sehe mich dem fetten Mann gegenüber, um dessen Hals jetzt ein weißer Verband liegt. Er hält seinen Gürtel in der Hand und lässt ihn um des Effekts willen klatschen.
Das Letzte, was ich noch wahrnehme, ist, dass ich auf ein Sofa gestoßen werde, und dann das erste Klatschen des Gürtels auf meinem Hinterteil. Das ist ein Schmerz, den ich nie vergessen werde. Er gräbt sich mir dauerhaft ins Gedächtnis ein. Zum Glück gleite ich an einen gesegneten Ort, einen, den ich mit offenen Armen willkommen heiße.
Ich erwache mit rasenden Schmerzen, und die leiseste Bewegung lässt mich aufschluchzen, was jedoch noch mehr schmerzt. Mein Gehirn ist umnebelt. Ich kann kaum einen Gedanken formen – sogar das Atmen fällt mir schwer. Ich benötige etliche Momente, bis ich begreife, dass ich wieder in meinem Gefängnis bin und mit dem Gesicht nach unten auf dem quietschenden Bett liege. Ich reiße mich nicht mehr zusammen und gestatte den Tränen zu fließen. Ich brauche etwas, woran ich denken kann, etwas, worauf ich mich konzentrieren kann. Ich erinnere mich an den Tag meiner Ankunft hier. Mein Gott – das scheint schon so lange her zu sein.
»Hallo, mein Süßer«, sage ich schnurrend zu meinem geliebten Kaffeebecher mit der Aufschrift »Bitte erst mit mir sprechen, wenn dieser Becher leer ist«. Ich stelle ihn in die Maschine und drücke den Knopf. Meine Freundin Lynn macht sich darüber lustig, dass ich erst richtig in die Gänge komme, wenn ich mindestens einen großen Becher Kaffee intus habe. Sie hat mir diesen Becher zu meinem sechsundzwanzigsten Geburtstag zusammen mit einem Flugticket zu den Fidschi-Inseln geschenkt, und zwar für uns beide, damit wir meiner verrückten Welt entfliehen konnten. Mann, was war das für ein Urlaub! Ich höre, wie sich die Wohnungstür öffnet.
»Du kannst dich auf was gefasst machen, Savi!«, ruft Lynn, als sie meine Küche betritt. Sie hält eine Zeitschrift in der Hand und zeigt mir die Titelseite. Gleich nachdem ich die Schlagzeile gelesen habe, weiß ich, dass ich in der Scheiße stecke.
»Oh nein!« Ich reiße sie ihr aus den Fingern.
»Oh doch.« Sie seufzt, geht an mir vorbei und öffnet ein Schränkchen. »Also hat er dich noch nicht angerufen, wenn ich es richtig verstehe?«
Ich schüttele den Kopf, während ich entsetzt das Foto studiere. US WEEKLY zeigt ein Foto von mir von letzter Nacht in einer Bar, wie ich mich über einen Tisch beuge und dabei meinen Hintern entblöße. Die Schlagzeile lautet: »Tochter des Bürgermeisters enthüllt alles!«
»Ich habe nach meinem Portemonnaie gegriffen!«, rufe ich. »Es ist nicht mal mein Hintern – das ist Photoshop …«
»Das weiß ich, aber wird dir dein allerliebster Papi das glauben?« Sie schlürft ihren Kaffee und beäugt mich dabei voller Sorge. »Vielleicht solltest du ihm zuvorkommen und ihn anrufen. Das macht einen besseren Eindruck.«
Lynn und ich sind schon seit Ewigkeiten Freundinnen. Wir sind uns an dem Tag auf der Mittelschule begegnet, als wir beide nachsitzen mussten, weil wir vorlaut gewesen waren, und haben uns sofort angefreundet. Sie hat all den Ruhm und die Neugier der Öffentlichkeit zusammen mit mir erlebt. Sie ist mein Fels in der Brandung, wie ich der ihre bin, und wir sehen in der anderen die Schwester, die wir nie hatten. Vielleicht hat sie recht. Ich schiebe die Zeitschrift beiseite, greife nach meiner Handtasche und hole mein Handy heraus. Dreimal Läuten später höre ich seine Stimme.
»Dad – wie geht’s dir heute Morgen?« Am anderen Ende der Leitung nur Schweigen. »Bist du da?«
»Was ist der Grund, weshalb ich meine Tochter auf der Titelseite eines weiteren Trash-Magazins anstarre?«
Scheiße! Scheiße! Scheiße!
»Dad, sieh mal, du weißt, dass ich nicht viel ausgegangen bin. Ich bin nach den Ereignissen vom letzten Jahr so vorsichtig gewesen. Aber hier trügt der Schein …«
»Mach dir nicht die Mühe, Savannah. Hast du eine Ahnung, welchen Schaden du da angerichtet hast? Ich habe drei Leute darauf angesetzt, die ihre Zeit mit solchem Mist vergeuden!«
»Dad, bitte, lass es mich erklären …«
»Nein, Savi, das besprechen wir morgen Abend beim Essen.« Damit ist die Leitung tot.
Ich werfe das Handy auf den Küchentresen und reibe mir mit beiden Händen das Gesicht. Lynn legt mir sanft die Hand auf den Rücken und lässt mir ein paar Augenblicke, die Sache zu verarbeiten. Ich seufze und fahre mir mit den Händen durchs Haar. Lynn tritt vor mich und bringt mich dazu, sie anzusehen.
»Komm schon, Savi, hauen wir ab.«
Nach einer heißen Dusche bin ich wieder etwas besser beieinander. Ich hole mein Lieblingskleid in Marineblau heraus, dazu schwarze Stiefel und einen schwarzen Kurzmantel.
»Okay, okay, hör auf, an dir herumzuzupfen«, stöhnt Lynn von der Tür her. »Du siehst gut aus.«
»Wenn ich am Ende so aussehe, als ob ich einen Kater hätte, und die Medien mich dabei erwischen, würden sie diese Geschichte bestimmt amüsant finden. Das weißt du doch.« Sie ergreift meine Schultern und betrachtet mich im Spiegel.
»Wen interessiert’s, was irgendwer denkt, Savi? Alle, die dein wahres Ich kennen, wissen, dass du ein Herz aus Gold hast … und eine scharfe Zunge, um Leuten die Meinung zu sagen.« Sie grinst. »Wie soll man dich da nicht lieben?«
»Ich bin schon große Klasse«, scherze ich, und wir gehen Arm in Arm zur Tür hinaus. Draußen im Flur müssen wir zwei Malern ausweichen, und als ich den Rufknopf am Aufzug drücke, werfe ich einen Blick auf einen der Männer. Er trägt eine massive Gürtelschnalle mit der Aufschrift ›Texas‹, darüber ein Longhornkopf.
»Er ist weit weg von zu Hause«, brummele ich. Lynn schüttelt den Kopf über mich.
»Oh, bitte.« Sie lacht angesichts meiner Blickrichtung. »Die gibt’s überall zu Dutzenden.« Sie schiebt uns in den Aufzug. Ich seufze, da ich der Außenwelt nicht entgegentreten möchte.
»Bereit?«, fragt sie und setzt ihre Sonnenbrille auf.
»Schätze schon.«
»Hör auf, dir Sorgen zu machen, Savannah«, sagt Lynn, während sie zugleich in ihr Bagel beißt. »Dein Dad wird drüber wegkommen. Du kennst ihn doch.«
»Ja, allerdings. Ich möchte ihn bloß nicht enttäuschen, insbesondere mit so etwas. Ich bin so vorsichtig gewesen.« Ich denke an das letzte Mal, als ich es auf die Titelseite einer Zeitschrift geschafft habe. Ich war über einen Betrunkenen gestolpert und aufs Gesicht gefallen. Das war ein gefundenes Fressen für die Regenbogenpresse, und der Krach mit meinem Vater war noch größer gewesen. In den Augen der Öffentlichkeit geht alles bloß ums Image, und das hängt mir, ehrlich gesagt, so ziemlich zum Hals heraus. Bei der Vorstellung, dass das noch weitere vier Jahre so gehen soll, möchte ich am liebsten schreiend davonlaufen.
»Irgendwelche Pläne für heute Abend?«, fragt Lynn und wirft die Serviette auf ihren Teller.
»Ja, da läuft so ein Arbeitsessen, an dem ich teilnehmen muss. Wir versuchen, uns einen weiteren Kunden zu angeln.«
Sie verzieht das Gesicht. »Klingt nach … Spaß.« Lynn hat das Glück, als freiberufliche Künstlerin in ihrem eigenen Atelier zu arbeiten, während ich für eine Werbeagentur tätig bin. Obwohl ich mir jahrelang in der Uni den Hintern wund gearbeitet habe, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass sie mich wegen der Verbindungen zum Bürgermeister ausnutzen, um neue Kunden zu bekommen.
Nach dem Tod meiner Mutter vor sechs Jahren, nach einem langen Kampf gegen den Krebs, bin ich geistig und körperlich ausgelaugt gewesen. Als mein Vater immer mehr in die Politik gedrängt ist, habe ich ihren Mädchennamen angenommen. Die Leute sollten nicht gleich von vornherein wissen, wer ich bin. Anfangs hat mein Vater das nicht verstanden, aber jetzt ist es ihm wohl sehr recht. Ich brauchte einfach bloß Zeit und Privatsphäre, um mit meinem Leben weiterzumachen und meinen Kummer zu überwinden.
Später an diesem Abend ertappe ich mich dabei, die Gedanken schweifen zu lassen, statt meine Aufmerksamkeit auf das Gespräch am Tisch zu richten. Da sitze ich also hier bei einem weiteren noblen Abendessen mit Chefs, die noch langweiliger als langweilig sind und über Dinge sprechen, die mich nicht im Entferntesten interessieren. Sie beziehen mich kaum einmal ins Gespräch ein und fragen nie nach meiner Meinung. Ich sitze bloß da und gebe mir Mühe, nicht zu zeigen, was ich denke. Wie zum Beispiel, dass Mr Roths Krawatte immer wieder in seine Suppe taucht und dass seine Frau so tut, als würde sie es nicht bemerken. Sie versucht, ein schadenfrohes Grinsen zu verbergen – wenn ich es also recht verstehe, kommen sie daheim nicht sonderlich gut miteinander aus. Das ist zumindest ein bisschen amüsant. Ich sehe zum Fenster hinaus und hinüber zum Central Park. Oh, was gäbe ich nicht alles dafür, jetzt über die verschneiten Wege zu laufen!
»Wo Sie auch sein mögen, darf ich mit dazukommen?«, fragt Joe Might und beugt sich so nahe heran, dass nur ich ihn hören kann.
»Tut mir leid.«
Er lächelt. »Sie sehen so aus, als wären Sie irgendwo ganz woanders.«
Oh. Ich bin echt verlegen, weil ich von unserem hoffentlich zukünftigen Kunden beim Tagträumen ertappt werde. Das sieht nicht gut für mich aus.
»Tut mir wirklich leid.« Ich ziehe die Nase kraus. Es ist mir unendlich peinlich. Toll gemacht, Savi!
»Nicht nötig.« Er zieht seine Hand unter dem Tisch hervor und zeigt mir das Handy, mit dem er Online-Poker gespielt hat. Ich gebe mir Mühe, mein Lachen zu verbergen. Er grinst und zuckt die Achseln. »Wir alle wissen, dass die Sache schon längst durch ist, oder?«
»Vermutlich, nicht?«, sage ich mit einem Seufzen. »Ich wünschte bloß, ich könnte etwas Härteres bekommen.« Ich zeige auf mein Glas Pinot Grigio. Ich trinke eigentlich nicht, aber dieses Abendessen ist wirklich unangenehm. Er blinzelt mir zu, bevor er sich räuspert.
»Entschuldigen Sie mich, meine Herrschaften – aber ich muss mich ein wenig mit Miss Miller unterhalten.« Bevor ich weiß, was los ist, zieht er mich aus dem Stuhl hoch und führt mich quer durch das Restaurant und zur Eingangstür hinaus. Er reicht dem Hausdiener sein Ticket, und Augenblicke später sitze ich in den rehbraunen Plüschsitzen seiner roten Corvette. »Also«, sagt er mit einem Grinsen, »sorgen wir mal dafür, dass Sie etwas Härteres bekommen – zu trinken, will ich sagen.« Ich kann bloß nicken wie ein Schwachkopf.
Nach ein paar Drinks in einem Scottish Pub beschließe ich, lieber heimzugehen, bevor ich noch mehr Probleme mit der Presse bekomme. Es gibt bloß den Barkeeper und einen einsamen Mann in der Ecke, aber es wäre, weiß Gott, ihr großer Tag, wenn sie mich nach den Ereignissen der vergangenen Tage in einem weiteren Pub vorfinden.
»Dann darf ich Sie wenigstens zu Ihrem Wagen zurückfahren«, sagt Joe, der dabei ist, seine Jacke überzustreifen. Er ist ein gut aussehender Mann – sein braunes, mit Gel gestyltes Haar und die hellen Augen sind eine hübsche Kombination. Ich schätze ihn auf Mitte dreißig.
»Das ist nicht nötig. Ich kann ein Taxi nehmen.«
»Unsinn. Ich habe Sie entführt, da ist es nur rechtens, dass ich Sie auch wieder zurückbringe.« Er winkt zur Tür. »Steht Ihr Auto bei der Arbeit?«
Ich schüttele den Kopf, während ich mir die Handtasche über die Schulter hänge. »Heute früh hat mich eine Freundin abgesetzt.«
»Dann nach Hause?«
Ich nicke, und wir gehen hinaus. Die Fahrt ist nett. Er erzählt mir viel über seine Firma und stellt ein paar Fragen zu meiner Position.
»Also faxen Sie mir diese Arbeitsproben zu, sobald Sie können?«, fragt er, als ich mich zum offenen Fenster hinabbeuge, um mich zu verabschieden.
»Ja, das werde ich. Gute Nacht, Joe, und Danke für den lustigen Abend – und fürs Mitnehmen!« Ich gehe zu meinem Apartmenthaus hinüber und beschließe dabei, meinen Laptop mit den entsprechenden Dateien lieber jetzt aus dem Auto zu holen statt morgen.
Während ich zum Parkplatz laufe, lasse ich meine Gedanken schweifen. Ich bin müde und mache mir Sorgen darum, wie mein Tag angefangen hat. Die Vorstellung, Dad erneut enttäuscht zu haben, lastet schwer auf mir. Anscheinend passiert das jetzt jede Woche. Entweder sind es die Medien oder etwas, das ich in seiner Gegenwart äußere oder tue. Mein Gott, wie ich meine Mutter vermisse! Sie war so lieb und verständnisvoll. Ihr wäre es gleichgültig gewesen, wenn ich das Falsche zum Dinner getragen oder etwas Unpassendes während eines Geschäftsessens gesagt hätte. Ich bin schließlich auch bloß ein Mensch. Ich habe nie Teil des öffentlichen Lebens sein wollen – nicht ein einziges Mal!
Ich trete hinaus auf einen stillen Parkplatz. Zum Glück steht mein Wagen nicht weit weg, da mir allmählich die Füße in den hohen Stiefeln schmerzen. Ich öffne den Kofferraum, greife nach meiner Laptoptasche und spüre auf einmal jemanden hinter mir. Ich will mich umdrehen, aber mir wird ein dunkles Stück Stoff übers Gesicht geschlagen. Eine Hand legt sich über meinen Mund, sodass ich nicht schreien kann. Meine Füße heben sich vom Boden, jemand wirft mich über seine Schulter, und etwas Kaltes und Hartes schlägt gegen meine Schienbeine. Mein ganzer Körper besteht nur noch aus Angst. Die Luft wird mir gewaltsam aus den Lungen getrieben, als mein Angreifer mich grob in ein Fahrzeug wirft. Ich spüre die Bewegung, als wir davonjagen. Ich kann nicht fassen, dass das geschieht! Ich bin völlig neben mir.
Jemand fesselt mir in rasender Eile Hand- und Fußgelenke. Ich kann um mich herum bloß Schatten ausmachen und höre männliche Ächzlaute und schweres Atmen. Die Furcht hat mich völlig ergriffen, und ich habe anscheinend die Fähigkeit zum Sprechen verloren. Jemand packt meine Schultern und hält mich fest, während ein anderer sich über mich beugt. Mit aller Macht ziehe ich die Beine an mich und knalle sie einem von ihnen in den Schritt. Sein Gekreisch ist ohrenbetäubend, er fällt zurück, und dann spüre ich den Stich einer Nadel, und alles verschwimmt mir vor den Augen.
Das ist alles, woran ich mich von meinem letzten Tag erinnere, an dem ich mit meinem Vater, mit meiner besten Freundin, meinen Kollegen gesprochen und das Tageslicht gesehen habe.
Kapitel 2
Ich versuche, mich vom Bett zu wälzen, da ich einen staubtrockenen Mund habe und dringendst Wasser benötige. Meine Knie knicken unter mir weg, als ich den langen Weg zum Waschbecken antrete. Normalerweise erscheint mir mein Gefängnis so klein, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, einhundert Meter von der Wand entfernt zu sein. Ich muss ganz schön Prügel bekommen haben. Mein ganzer Körper tut weh.
Schließlich erreiche ich das Spülbecken und packe den rostigen Zinnbehälter. Wasser hat nie so gut geschmeckt. Ich befeuchte mir die Lippen und lasse es meine Kehle hinabrinnen, bevor ich zu einem Ball der Schmerzen zusammensinke. Ich beginne zu schluchzen, weil ich weiß, dass ich hier nie mehr rauskommen werde. Ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm mein Rücken aussieht. Er ist feucht und brennt fürchterlich, mein Kopf pocht und meine Handgelenke sind empfindlich. Er muss mich festgebunden haben, während er … mir rutscht das Herz in die Hose. Langsam schiebe ich die Hand zum Saum meines Nachthemds hinab und ziehe ihn hoch. Ich stoße einen kleinen zischenden Seufzer der Erleichterung aus, als ich sehe, dass ich nach wie vor dieselbe Unterhose trage wie gestern. Mein Äußeres mag beschädigt sein, aber alles Übrige ist noch intakt und unbefleckt, zumindest für den Augenblick. Emotional bin ich jedoch erschöpft. Wie aus Furcht, geschlagen zu werden, bedecke ich hier auf dem Fußboden mein Gesicht, um nachzudenken. Ich bin viel zu lange behandelt worden wie etwas, das weniger wert ist als Vieh. Meine Kidnapper werden ihrer krankhaften Machtspielchen mit mir anscheinend niemals müde. Hin und wieder darf ich baden, und währenddessen machen sie jede Menge Fotos und Videos. Ich habe eine Zahnbürste, die eklig geworden ist, und ein Stück Seife, von dem kaum noch etwas übrig ist. Mein Essen, wenn sie mir etwas zugestehen wollen, besteht aus einer Art Suppe und hartem Brot. Das Wasser ist stets warm, und Schmutzflöckchen schwimmen darin herum.
Gelegentlich bringen sie einen Arzt mit, der mich untersuchen soll. Zweimal haben sie mir eine Flüssigkeit gespritzt. Ich machte mir eher Sorgen darum, ob die Nadel sauber war, als um das, was sie mir gegeben haben. Einmal habe ich versucht, den Arzt um Hilfe zu bitten, aber er tat so, als würde er mich nicht verstehen. Ich weiß, dass er mich verstanden hat, weil er bei der Erwähnung meines Zuhauses zusammengezuckt ist und mir nicht in die Augen sehen wollte. Alles, was ich bekam, war ein Stoß in die Rippen von einem der Männer und Ermahnungen auf Spanisch wegen meines Versuchs zu sprechen.
Meine einzige Wahl wird ein Hungerstreik sein. Ich kann nicht mehr, und so wird zumindest mein Tod meiner Kontrolle unterliegen.
Draußen vor meiner Tür höre ich Schritte. Beim Klirren des Schlosses beginnt mein Körper automatisch zu zittern. Und tatsächlich kehrt der fette Bursche mit meinem Essenstablett zurück. Er setzt es lautstark auf dem Tisch ab und funkelt mich dann an. »Macht’s aua?«, fragt er mit einem Lachen. Ich will ihn anspringen und ihm ein weiteres Stück vom Glas in den Hals stoßen. Beim nächsten Mal werde ich daran denken, es wieder rauszuziehen und immer wieder zuzustechen, bis dieses fette Schwein tot ist.
»Nein. Und dir?«, zische ich zurück. Echt, was habe ich denn zu verlieren? Ihm fällt die Kinnlade herab, und seine Hand zuckt zu seinem Hals hoch, aber er hält sich zurück. Stattdessen nimmt er mein Wasserglas, gießt den Inhalt auf den Boden und macht dasselbe mit meiner Suppe, dann wirft er das Brot hinterher und beobachtet mich dabei mit einem unverschämten Grinsen. Vor wenigen Tagen wäre mir das Herz gebrochen, aber heute spielt es meinem Entschluss in die Hände und ich lächele ihn einfach bloß an. Arschloch.
Wenige Stunden später höre ich den vertrauten Schlüssel im Schloss. Die Beleuchtung ist so schwach, dass ich kaum etwas erkenne. Jemand bringt ein neues Tablett mit Essen – ich höre das Scharren auf dem Boden, als er es abstellt. Er kommt auf mein Bett zu. Ich rieche den vertrauten Geruch von Montecristo und weiß, dass es der Mann mit der Zigarre ist.
»Du musst etwas essen«, sagt er grob. Ich rühre mich nicht. Ich liege bloß da und fühle mich völlig zerschlagen. Er wirft mir ein Stück Brot zu. Es prallt von meiner Schulter ab. »Iss, perra.« Er geht und schlägt dabei die Tür hinter sich zu.
Nach einer Weile rücke ich schließlich zu dem Tablett hinüber und übergebe mich fast beim Anblick der immer gleichen Mahlzeit, mit der sie mich seit scheinbar ewigen Zeiten mittags und abends füttern – eine dünne Suppe mit Fleischstückchen. Wie ich diese Typen kenne, ist es wahrscheinlich Ratte oder Opossum. Das bestärkt meinen Entschluss, nichts zu essen. Ich trinke einen Schluck Wasser und spüre, wie mir irgendwelcher Dreck die Kehle hinabrinnt. Ich huste, schlucke die aufsteigende Galle hinab und stolpere zum Bett zurück.
Fünf weitere Mahlzeiten werden mir gebracht, fünf Mahlzeiten, die unberührt bleiben. Obwohl mein Körper mich anbettelt zu essen, bleibt meine Willenskraft ungebrochen. Unnötig zu sagen, dass ich mich beschissen fühle.
Meine Mutter besucht mich oft und flüstert mir ermutigende Worte zu. Ich weiß, dass mein Körper auf diese Weise lediglich versucht, mit dem Verhungern zurechtzukommen, aber auf irgendeiner Ebene freue ich mich darüber, sie wiederzusehen. Sie ist genau so, wie ich sie in Erinnerung habe – groß, dunkelhaarig, perfekte Zähne und dunkle Augen. Ihre Berührung ist so real, dass ich die Wärme ihrer Hand auf meinem Gesicht spüre.
»Ich liebe dich, Savi. Das weißt du, nicht wahr?«, sagt sie. »Ich bin hier für dich.« Sie berührt meine Brust direkt über dem Herzen. »Mein kleiner Engel.«
Ich ziehe die Knie an meine Brust und schluchze, als die Erinnerung verblasst.
Ich wünsche, ich wäre im Augenblick zu einer derartigen Liebe imstande. Liebe und Vertrauen waren die Dinge, die ich nie verlieren wollte, das hatte ich mir versprochen. Doch ich habe beides viele Male ausprobiert, nur um immer wieder betrogen zu werden. Es ist immer eine Falle.
Ich liege im Bett und starre an die Decke, beobachte, wie sie in meinem verschwommenen Blick sichtbar wird und wieder entschwindet. Da glaube ich, ein Knallen zu hören, gefolgt von lauten Rufen. Wenn ich etwas klarer bei Sinnen wäre, würde ich vielleicht verstehen, was da vor sich geht, aber in meinem gegenwärtigen Zustand ist es mir eigentlich völlig gleichgültig.
Eine Reihe von Ereignissen geschieht scheinbar gleichzeitig. Es gibt einen weiteren Knall, meine Tür fliegt auf, und ein helles Licht bewegt sich im ganzen Raum umher. Ein Mann, ganz in Schwarz, mit einem Helm auf dem Kopf und einer Schutzbrille kommt näher. Es erfordert beträchtliche Anstrengung, aber ich drehe den Kopf zu ihm hinüber. Das blitzende Licht gleitet über mein Gesicht, sodass ich blinzeln muss. Er hält einen Augenblick inne, dann ruft er etwas in ein Funkgerät an seinem Hals. Er streckt die Arme aus und hebt mich aus dem Bett. Ich stöhne, als seine Hand meinen Rücken berührt. Ich weiß nicht, ob ich träume oder nicht, ich bin außerstande, alles zu verarbeiten – mein Gehirn funktioniert nicht richtig.
Der Mann trägt mich einen langen Flur hinab. Vor uns stehen ein paar andere Männer in demselben schwarzen Outfit. Sie haben die Waffen gehoben und sind schussbereit. Obwohl ich so erschöpft bin, bin ich jetzt hellwach und befürchte, mich in jenem Raum wiederzufinden, wenn ich die Augen schließe. Über ein Treppenhaus gehen wir zu hölzernen Doppeltüren, die so aussehen, als seien sie gewaltsam geöffnet worden. Ich bin außerstande zu sprechen und befürchte nach wie vor zu träumen.
Die Luft ist kalt, es ist dunkel und es regnet offenbar. Es scheint wirklich wahr zu sein. Ich spüre Feuchtigkeit auf meinem Gesicht, und die frische, kalte Luft ist so wunderbar. Ich möchte vor Freude über dieses Gefühl weinen. Drei schwarze Fahrzeuge warten draußen. Ich werde ins mittlere gesetzt, nach mir steigen der Mann, der mich getragen hat, und drei andere ein: der Fahrer, ein Mann auf dem Beifahrersitz und ein weiterer in Schwarz hinter uns, der in die entgegengesetzte Richtung schaut. Ich werde rasch angeschnallt und in eine Decke gehüllt. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, wie sauber die Decke riecht. Wir fahren von dem Gebäude weg. Ich habe keine Kraft, und mein Kopf führt scheinbar ein Eigenleben. Er fällt hierhin und dorthin, bis er eine gemütliche Stelle auf der Decke findet. Ich beobachte, wie die Hände des Fahrers über das Lenkrad gleiten und absolut ruhig wirken. Nachdem wir ein gutes Stück vom Haus entfernt sind, reißt sich der Mann, der mich getragen hat, die Schutzbrille und den Helm herab. Er fährt sich mit den Händen durch das schwarze Haar und sieht mich von oben bis unten an. Es überrascht mich, dass er nur wenige Jahre älter als ich ist, vielleicht Anfang dreißig.
»Savannah? Alles ist in Ordnung, Sie sind in Sicherheit«, sagt er leise und mit ruhiger Stimme. Ich starre ihn bloß an. Ich habe gehört, was er gesagt hat, aber mein Gehirn hat es anscheinend nicht registriert. Ich fürchte mich nach wie vor zu glauben, dass ich wirklich aus meinem Gefängnis gerettet worden bin. Vielleicht ist es bloß ein mieser Trick. Einen Moment lang mustert er mein Gesicht, dann streckt er die Hand nach mir aus. Ich zucke zusammen und schließe kurz die Augen. Er zieht die Hand zurück, zeigt jedoch auf meine Stirn. »Sieht aus, als würde das wehtun. Alles in Ordnung mit Ihnen? Tut es Ihnen sonst noch irgendwo weh?«
Ich möchte ihm von meinem Rücken erzählen, bin jedoch immer noch außerstande zu sprechen.
»Der Jet ist bereit, Sir«, sagt der Fahrer in den Rückspiegel. Der Mann neben mir nickt.
»Gut. Sag ihnen, wir sind in zehn Minuten da.«
»Ja, Sir.«
Mir wird schwindelig. Der Hungerstreik fordert seinen Tribut. Ich lasse den Kopf gegen das Fenster fallen und beobachte, wie winzige Regentropfen über die Scheibe rinnen. Ich erkenne nichts wieder. Häuser und Straßen sehen anders aus und erinnern mich an nichts. Ich frage mich, wo ich bin und wohin ich fahre.
Wieder spüre ich einen kühlen Lufthauch, als ich aus dem Auto gehoben werde. Der Regen ist kalt, fühlt sich jedoch wundervoll an. Mein Kopf schlägt gegen die Schulter des Mannes, der mich trägt. Mir ist keine Kraft geblieben. Die Regentropfen prallen von meinem Gesicht ab und waschen einen Teil des Schmutzes ab.
Wenn das hier ein Traum ist, ist es der beste, den ich je geträumt habe.
Ich werde auf ein warmes Ledersofa in einem Flugzeug gelegt und sehe zu, wie zehn andere in Schwarz gekleidete Männer die Maschine betreten und ihre Plätze einnehmen. Sie sehen wie Mitglieder eines Einsatzkommandos aus. Meine Sicht verschwimmt, und ich bin so müde.
»Bleiben Sie bei mir, Savannah.« Die Stimme erklingt direkt neben mir. Ich zwinge mich, die Augen zu öffnen, und erkenne den Mann, der mich hergetragen hat und jetzt auf mich herabblickt. Seine unglaublich dunklen Augen sehen in die meinen und halten einen Moment lang die Verbindung. Eine Stimme ertönt über einen Lautsprecher, und binnen weniger Minuten spüre ich eine Bewegung, und der Mann, der mich getragen hat, ist verschwunden. Beim Brummen des Flugzeugs werden mir die Lider schwer. Ich muss gegen den Schlaf ankämpfen, solange ich kann. Ich spüre, wie ich in die Leere gleite, und mein letzter bewusster Gedanke ist, dass ich Fliegen eigentlich hasse.
Das beruhigende Geräusch raschelnder Blätter holt mich ins Bewusstsein zurück. Ich bewege den Kopf ein wenig, reibe meine Wange über das weichste Kissen, das ich je gespürt habe. Der schwache Duft frischer Rosen erfüllt meine Nase. Kann das stimmen? Flatternd heben sich meine Lider. Ich blinzele mehrmals, um das sanfte Sonnenlicht in mich aufzunehmen, das das Zimmer erhellt. Die Wand auf der einen Seite besteht aus großen Fenstern mit drei Türen, die sich auf einen Balkon öffnen. Ein elfenbeinfarbener Vorhang flattert im sanften Wind und weht mir den Blumenduft der Rosen in der Glasvase in meine gierige Nase. Ich spüre einen Zug an meinem Arm und begreife, dass mir links ein intravenöser Zugang gelegt worden ist. Der Beutel, der an einem Ständer neben mir hängt, ist fast leer. Ich erfasse das riesige Schlittenbett mit der frappierend roten Bettwäsche und dem Federbett, das sich wie im Himmel anfühlt. Ich bin überwältigt, schließe die Augen und schlummere wieder ein.
Als ich wieder zu mir komme, ist es dunkel, der Infusionsbeutel ist gewechselt worden und jemand hat ein Feuer im Kamin angezündet. Das freundliche Geräusch knisternden Holzes lässt mich fast in Tränen ausbrechen – es ist mehr als beruhigend für meine Seele. Ist das hier der Himmel? Tot zu sein, damit könnte ich mich gut abfinden. Ich höre ein Quietschen und erstarre.
Rechts von mir öffnet sich eine hölzerne Tür. Eine ältere Dame, vielleicht Mitte fünfzig, mit langer Hose und Bluse, tritt mit einem Tablett ein. Erschrocken richte ich mich mühsam auf und Schmerz durchflutet mich. Ich zucke zusammen. Traurigkeit verdunkelt ihr Gesicht.
»Oh, nein, meine Liebe.« Ihre Stimme ist sanft. »Bitte, haben Sie keine Angst. Ich habe mich seit drei Tagen um Sie gekümmert.« Ich sehe sie verständnislos an. Drei Tage! Ich ziehe die Knie an meine Brust und schlinge die Arme darum, wobei ich zusammenzucke. Der Schmerz ist eine weitere Erinnerung an die Hölle, die ich durchgemacht habe. Sie setzt das Tablett auf den Tisch und hebt die Hände. »Ich bin Abigail. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich weiß, dass Sie viel durchgemacht haben, aber jetzt sind Sie in Sicherheit. Ich wollte Ihnen etwas zu essen bringen und vielleicht ein paar Fragen beantworten.« Sie hebt die Brauen, weil sie weiß, dass ich interessiert bin. »Darf ich mich hinsetzen?« Sie zeigt auf einen Schaukelstuhl. Ich schlucke den Kloß in meiner Kehle herab. Zumindest scheint sie ziemlich nett zu sein. Langsam nicke ich und sehe zu, wie sie den Stuhl heranzieht, sorgfältig darauf bedacht, keine jähen Bewegungen zu machen. Ich weiß, ich sollte sie mit offenen Armen begrüßen – und diesen Ort –, doch stattdessen möchte ich mich zu einem Ball zusammenrollen, um mich zu schützen. So sehr ich auch glauben möchte, dass ich in Sicherheit bin.
»So, das ist doch schon besser.« Sie lächelt warm. »Vielen Dank. Bitte nennen Sie mich Abigail oder Abby wie alle hier.«
Alle? Wer ist sonst noch hier? Ich blicke mich um und erfasse das Zimmer jetzt mit einem kritischeren Blick. Es ist riesig und hat eine hohe gewölbte Decke.
»Ich wette, Sie fragen sich, warum Sie hier sind«, sagt Abby. Ich wende mich wieder ihr zu. »Sie sind in einem sicheren Versteck. Hier wird Ihnen niemand etwas antun. Sie waren extrem dehydratisiert und unterernährt, aber Sie sind jung und Ihr Körper regeneriert sich schnell. Ihr Rücken …« Sie schnalzt mit der Zunge und sieht mich traurig an. »Ihr Rücken wird vermutlich immer noch stark schmerzen, aber er wird bald verheilt sein. Es wird einige Zeit brauchen, bis Sie Ihre Kraft zurückgewonnen haben und sich wie Ihr altes Selbst fühlen.«
Einen Moment lang starre ich sie an, dann sehe ich zum Fenster hinaus und überlege, wo ich genau bin.
Sie lächelt, da sie meine Verwirrung spürt. »Sie sind in North Dakota, Savannah.« Sie hält einen Augenblick inne, damit diese Information in mich einsinken kann. Heilige Scheiße! Okay. Atme. »Ich weiß, Sie müssen jetzt viel verarbeiten, aber sobald Sie sich besser fühlen, kann ich Ihnen mehr sagen. Sie müssen sich wirklich ausruhen.«
Ausruhen, ja, das klingt nach einer guten Idee. Auf einmal bin ich wieder sehr müde.
»Zuerst jedoch, Savannah, meinen Sie nicht, Sie könnten mir zuliebe etwas essen?«
Oh mein Gott, essen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in Sicherheit bin. Essen steht außer Frage.
»Sie haben viel an Gewicht verloren und Ihr Körper ist stark angegriffen. Sie müssen ihm wirklich helfen, indem Sie etwas essen.« Sie reicht mir mit einem Nicken einen kleinen Salzcracker. »Wir machen ganz kleine Schritte.« Langsam strecke ich die Hand danach aus. Als ich ihn in der Hand habe, sehe ich, wie sie mich hoffnungsvoll anblickt. Ich halte ihn an die Nase und schnüffele, um zu erkennen, ob er mit etwas getränkt ist. Er riecht nicht komisch. Ich lecke kurz und vorsichtig daran. Er schmeckt normal.
Plötzlich fliegt die Tür auf und ein riesiger Mann kommt hereingeschritten. Ich lasse den Cracker sofort fallen, ziehe mir die Decke hoch bis ans Kinn und werfe Abigail einen entsetzten Blick zu. Sie wirkt angesichts des jähen Erscheinens unseres Eindringlings ebenso schockiert, wie ich mich fühle. »York, wie kannst du nur so hier hereinplatzen? Du hast uns zu Tode erschreckt!«
Mit einem leicht höhnischen Grinsen schlendert er heran. »Cole hat mir gesagt, dass sie angekommen ist, und ich wollte mich vergewissern, dass sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnt.«
»Ihr geht’s gut. Jetzt verschwinde, bitte.« Ihre Haltung sagt mir, dass sie sich zuvor schon gegen ihn durchgesetzt hat. Er beugt sich zur Seite, um einen besseren Blick auf mich zu bekommen, und stößt einen bewundernden Pfiff aus.
»Meine Güte, ist die hübsch. Eine wirkliche Verbesserung gegenüber der letzten, nicht wahr?«
Der letzten? Wo zum Teufel bin ich? Mir ist übel. Ich sehe eine Schüssel auf dem Fußboden, beuge mich über die Bettkante und würge alles aus meinem Magen hervor, was dort vielleicht drin gewesen sein konnte.
»Oh nein«, stöhnt Abigail und kommt, mir zu helfen. »Hier, Savannah, ich werde Ihnen helfen.« Sie hält mir das lange Haar aus dem Weg. Als ich fertig bin, kühlt sie mit einem Tuch mein Gesicht. Es fühlt sich wunderbar an, dass sich jemand um mich kümmert, obwohl ich in meiner Wachsamkeit nicht nachlassen darf. Ich behalte stets alles im Blick und lasse lieber niemanden zu nahe an mich herankommen. Viele Fragen schießen mir durch den Kopf. Bin ich in Sicherheit? Wo ist mein Vater, zum Teufel?
»Geh! Sofort!«, zischt Abigail York an, der sich von meiner Kotzshow nicht hat aus der Fassung bringen lassen. »Weiß Cole, dass du hier bist?«, fragt sie, und in ihren Worten schwingt mehr als alles andere eine Anschuldigung mit. Das gibt ihm anscheinend zu denken, und einen Augenblick lang flackert Besorgnis über sein Gesicht.
»Schön.« Er schüttelt den Kopf und lächelt mir dann zu. »Bis später, du Hübsche.«
Dieser Mann bereitet mir ernsthaft Unbehagen. Abigail hat offenbar mitbekommen, was ich empfinde, da sie die Decke fest um mich zieht.
»Machen Sie sich wegen ihm keine Sorgen. Er ist nicht allzu häufig hier, und wenn, dann hält Cole ein wachsames Auge auf ihn gerichtet.« Cole? »Hier geschieht nichts, ohne dass Cole davon weiß. Deswegen ist er so gut in dem, was er tut.«
Und was genau ist das? Ich möchte Fragen stellen, finde jedoch meine Stimme nicht, ebenso wenig wie die Kraft, wach zu bleiben. Ich bin ausgelaugt. Ich schließe die Augen und horche auf das beruhigende Geräusch von Abigails Schaukelstuhl.
Die nächsten Tage bleibe ich im Bett und fühle mich von Tag zu Tag etwas besser. Sehr hilfreich hierbei sind, und da bin ich mir sicher, die Flüssigkeiten, die sie mir zuführen. Ich hatte keinen weiteren unerwarteten Besuch, und Abigails beständige, tröstliche Gegenwart und ihre sorgfältige Pflege tragen einen großen Teil zu meiner Genesung bei. Sie ist so nett zu mir, aber das war Maria auch. Ich bin nach wie vor auf der Hut. Jeder hat seinen eigenen Plan. Sie versucht, mich zum Reden zu bringen, aber ich kann’s nicht – Schweigen fällt mir im Augenblick leichter. Den ganzen Tag über kommt und geht sie, öffnet Fenster und Türen und lässt die warme Sonne zu mir herein. Die Luft selbst ist kühl, aber das macht mir nichts aus. Es ist wunderbar. Manchmal landet ein Vogel draußen vor dem Fenster, und sein Lied erinnert mich daran, wie sehr ich den Aufenthalt im Freien vermisse.
Am achten Tag bin ich richtig zufrieden – wow, ich bemerke plötzlich wieder, wie die Zeit vergeht –, weil ich ohne intravenösen Zugang erwache. Ich überprüfe meinen Körper, Gliedmaße um Gliedmaße. Mein Rücken schmerzt nach wie vor höllisch, aber wenigstens sind die hämmernden Kopfschmerzen verschwunden. Ich habe das Gefühl, dass ich aufstehen und umhergehen muss, also schiebe ich langsam die Beine über die Bettkante. Sie zittern, als sie mein Gewicht tragen müssen, aber sie lassen mich nicht im Stich. Die Tür geht langsam auf, und Abigail tritt mit einem strahlenden Lächeln ein.
»Na, sieh mal einer an.« Sie hebt beide Hände ans Gesicht. »Sie stehen!« Ich spüre, wie ein kleines Lächeln an meinen Lippen zupft, aber ich verscheuche es rasch – ich darf mich nicht allzu behaglich fühlen. Ich kann niemandem vertrauen. Sie kommt an meine Seite und legt vorsichtig meinen Arm über ihre Schultern. Ich schreie vor Schmerz auf, und sie lässt mich schnell los. »Ihr Rücken?«
Ich sehe sie nicht an. Ich will an ihrer Schulter weinen und sie an mich heranlassen, aber ich kann es einfach nicht. Ich weiß es besser. Abigail führt mich ins Bad. Ich bin selbst von mir überrascht, wie stabil ich bin, als wir dort eintreffen. Sie dreht mich um und zieht mir sanft mein bis oben zugeknöpftes Nachthemd von den Schultern. Ich lasse es einfach bis knapp über meinen Hintern nach unten sinken, während ich meine Vorderseite mit den Armen bedecke, die immer noch in den Ärmeln stecken. Sie steckt mein Haar mit einem Clip fest. Ich sehe, wie sie mich beäugt, aber sie sagt nichts.
»Abby, ich wollte …« Die Stimme hält auf einmal inne. Ich schaue auf und sehe im Spiegel meinen Retter, der mit großen Augen dort steht. Abigail bedeckt mich rasch mit einem Handtuch.
»Bitte, Logan, einen Moment noch.« Sein Blick im Spiegel begegnet dem meinen, Traurigkeit zeigt sich darin und dann … Ärger? Er zieht sich zurück – zur Schlafzimmertür hinaus.
»Ja, natürlich. Entschuldigt bitte«, murmelt er auf dem Weg hinaus. Der Name des Mannes, der mich getragen hat, ist also Logan.
Abigail lässt warmes Wasser in die tiefe Wanne laufen und hilft mir erst aus den restlichen Kleidern und dann in die Wanne. Ich schreie auf, als das Wasser meine Wunden berührt. Abigail schüttet weiter Epsomsalz ins Wasser.
»Lassen Sie sich richtig durchweichen, meine Liebe. Die Schmerzen werden bald nachlassen.« Sie wäscht mir sanft das Haar, hilft mir dabei, meinen Körper sauber zu schrubben, lässt das Wasser ablaufen und füllt die Wanne dann mit frischem warmem Wasser. Ein Gedanke geht mir durch den Kopf – in meinem früheren Leben hätte ich mich sehr unbehaglich gefühlt, wenn eine Fremde mich gewaschen hätte. Nach meinen Erlebnissen in meinem ehemaligen Gefängnis denke ich kaum darüber nach.
Ich halte mir eine Haarsträhne vors Gesicht und sehe, wie schäbig sie aussieht. Meine Nägel sind abgebrochen und meine Füße rau geworden. Alles Dinge, die bis vor Kurzem ganz anders gewesen sind. Zwar war ich keines dieser Mädchen, die jeden Monat Stunden im Spa verbringen, aber ich habe schon auf mein Aussehen geachtet. Jetzt jedoch – ich schließe die Augen und lasse die Tränen laufen. Ich ähnele in nichts meinem alten Selbst, fühle auch nichts davon. Ich bin jetzt eine andere, und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich komme mir völlig verloren vor.
Abigail überlässt mich meinen Tränen und kehrt später zurück, um mir das Haar zu trocknen und mich zurück ins Bett zu stecken. Ich bemerke, dass sie das Bettzeug gewechselt hat. Es ist ein wunderbares Gefühl, sauber zu sein.
Sie stellt eine Schüssel mit frischen Trauben und Erdbeeren neben mein Bett.
»Nur, wenn Sie sich dafür bereit fühlen, meine Liebe«, warnt sie mich und geht, damit ich mich ausruhen kann.
Am folgenden Tag bringt Abigail einen neuen Besucher zu mir. Es ist eine große Frau, die eine Brille mit dicken Gläsern und einem modischen grünen Rahmen trägt. Sie lächelt mich an.
»Hallo, Savannah, ich bin Mel. Jemand hat mir gesagt, dass Sie etwas aufgehübscht werden möchten.« Strahlend klopft sie auf einen mittelgroßen Koffer mit Punkten darauf, den sie hinter sich hergezogen hat. Ich wende mich rasch Abigail zu, die ebenfalls fröhlich grinst. Sie tritt heran, um mir aus dem Bett zu helfen, und zieht mir einen kuscheligen Bademantel über die Schultern.
Ich werde in einen Ledersessel mitten in meiner riesigen Suite verfrachtet, die Füße werden auf einen Hocker gestellt, und ich habe einen Blick hinaus auf die Berge. Ich stoße einen behaglichen Seufzer aus. Wow, geschieht das wirklich? Es fühlt sich immer noch wie ein glücklicher Traum an.
»Jede Frau verdient es, hin und wieder umsorgt zu werden«, erklärt Abigail. »Es hilft uns innerlich mehr, als sich äußerlich zeigt, also entspannen Sie sich einfach und lassen Sie Mels Magie auf sich wirken.« Es macht mich nervös, mit jemand Unbekanntem allein gelassen zu werden. Ich fühle mich daher besser, als Abigail einen Stuhl heranzieht, um die Prozedur zu überwachen.
Mel behandelt mich wie eine zarte Blume, die zerbröseln würde, wenn man sie zu rau anfasst. Sie hat ja keine Ahnung davon, dass ich für Gott weiß wie lange Zeit wie jemandes Perra behandelt worden bin. Ihre Tätigkeit wirkt beruhigend auf meine Nerven. Bald entspanne ich mich und genieße es, wie der Kamm durch mein frisch gewaschenes Haar fährt. Sie schneidet hier und dort Stufen hinein, fragt nicht nach, wie ich es normalerweise trage. Nachdem mein Haar geföhnt und frisiert ist, geht sie zu meinen Nägeln über, feilt und poliert. Sie lackiert sie in einem tiefen Purpurrot, tut dann dasselbe bei meinen Zehennägeln. Als Mel fertig ist, strahlt Abigail mich entzückt an. Sie dankt Mel und bringt sie hinaus.
Ich sitze im Sessel und betrachte meine Hände und Füße. Der ganze Schmutz und Dreck ist verschwunden, und sie sehen hübsch aus. Wow, sie sehen wieder normal aus.
»Ich hoffe, das war alles in Ordnung so, Savannah«, sagt Abigail und kommt wieder ins Zimmer zurück. »Ich weiß nicht, ob Sie müde sind, aber ich muss mich ans Mittagessen machen. Ich lasse Sie jetzt allein. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich einfach«, sagt sie und zeigt auf die Gegensprechanlage. Mit diesen Worten verschwindet sie.
Ich stehe da, blicke in den Spiegel, und mein Herz macht einen Sprung – da bin ich, die alte Savannah, das frisch geschnittene Haar reicht mir bis auf den Rücken, auf halbem Weg leicht gewellt, matte Lichter durchziehen das ganze Haar. Ich fahre mit den Fingern durch etwas, das sich wie Seide anfühlt. Wenn es sich innerlich doch auch nur wie die alte Savannah anfühlen würde! Nein, übertreib’s nicht … das ist ein Anfang. Ich blicke zu Boden und denke an das letzte Mal, als jemand mich gewaschen und mir das Haar gemacht hat. Ich schüttele den Kopf und dränge diesen Gedanken gewaltsam zurück. Okay, ich muss dieses Zimmer verlassen.
Ich gehe auf den Kleiderschrank zu – in der Hoffnung, etwas Passendes zu finden. Zu meiner Überraschung ist alles in meiner Größe, sogar die Schuhe. Während ich einen pinkfarbenen Kaschmirpulli überstreife, der meinem Rücken richtig guttut, und in hellbraune Leggins und flache Schuhe schlüpfe, sehe ich, wie dünn ich geworden bin. Mein Gott, wie lang war ich weg? Ein letzter Blick in den Spiegel, und ich habe das Gefühl, dass ich wieder unter Leute gehen kann. Ich komme mir jetzt etwas mehr wie ein Mensch vor.
Ich öffne die Tür und trete in einen langen Flur. Meine Hände werden rasch eiskalt, als mir klar wird, dass ich keine Ahnung habe, wohin es geht. Ich hole tief Luft und wende mich nach links. Zum Glück entdecke ich sofort ein großes Treppenhaus, das sich spiralförmig zu einer Eingangshalle hinabwindet. Ich höre jemanden mit leiser Stimme sprechen, und bei dem, was ich höre, wird mir übel. Ich möchte kehrtmachen und wieder die Treppe hinaufsteigen, aber ich gehe weiter. Atme, Savi.
»Es müssen etwa zehn bis fünfzehn Schläge auf ihren armen Rücken gewesen sein, und sie ist ein so zartes Ding«, höre ich Abigail sagen. »Ich glaube, in dieser Hinsicht irrst du dich, Logan – sie ist so unschuldig, wie man nur sein kann.«
Irren?
Ich gehe um die Ecke und finde sie in der Küche vor, und ihre beiden Köpfe drehen sich zu mir um. Der Mann, der mich getragen hat – ich meine Logan –, springt mir ins Auge. Bei meinem Anblick fällt ihm die Kinnlade herab. Mir wird klar, dass er wirklich ein gut aussehender Mann ist, mit seinem kurz geschnittenen Haar, den dunklen Augen und den breiten Schultern. Instinktiv senke ich den Blick – da ich von meinen Kidnappern gelernt habe, Blickkontakt zu meiden. Da ich spüre, dass ihnen meine Reaktion Unbehagen bereitet, zwinge ich mich, aufzuschauen.
»Savannah«, sagt Abigail warm. »Sie sehen wunderschön aus. Es freut mich, dass Sie die Sachen gefunden haben.«
Logan zieht einen Stuhl für mich heraus. »Noch mal hallo, Savannah. Sie sehen hübsch aus. Offensichtlich hat Mel Sie unter ihren Händen gehabt. Setzen Sie sich doch, bitte.«
Einen Augenblick lang zögere ich und folge dann seiner Aufforderung. Er stellt einen Teller mit Schinken, Eiern, Toast und Kartoffelpuffern vor mich, dazu ein Glas Orangensaft. Mir dreht sich der Magen um, aber ich kämpfe die Übelkeit zurück. Sie setzen sich links und rechts neben mich an den Tisch, trinken Kaffee und sprechen über dies und das. Ich weiß, dass sie versuchen, sich mir zuliebe normal zu geben, aber es funktioniert nicht. Offen gestanden ist das alles etwas merkwürdig. Ich muss mich einfach fragen, was hier los ist: Wo sind wir hier eigentlich? So viele Fragen erfüllen meine Gedanken und verursachen mir leichte Kopfschmerzen. Ich reibe mir über die Stelle, wo die Beule war – jetzt ist da bloß zarte Haut. Ich sehe, wie Logan mich beobachtet, und seine Augen haben eine seltsame Wirkung auf mich. Ich kann das Gefühl nicht recht unterbringen.
»Sie müssen wirklich etwas essen, meine Liebe«, sagt Abigail.
Sie hat recht, aber irgendwie kann ich den Willen dazu nicht aufbringen. Ich möchte einfach schreien. Vielleicht war es ein Fehler gewesen herunterzukommen. Sie setzen ihr Gespräch fort, während ich mir eine Scheibe Toast nehme und aus alter Gewohnheit daran rieche. Sie ist anscheinend in Ordnung. Der erste Bissen ist okay, aber der zweite wird rasch zurückgewiesen. Essen und Stress existieren in meiner Welt nicht mehr nebeneinander. Ich höre Abigail seufzen, als sie ihren Becher auf seine Untertasse zurückstellt.
»Soll ich Sie jetzt ein wenig durchs Gelände führen, meine Liebe?«
Gern, aber ich habe auch kiloweise Fragen, und ich weiß nicht, wo oder wie ich anfangen soll. Logan versteht anscheinend mein Dilemma, und er wendet sich mir zu, den Kaffeebecher zwischen den Händen. »Savannah, Sie müssen völlig verwirrt sein und fragen sich sicherlich, wo Sie sind und was hier geschieht. Wir setzen uns heute Nachmittag zusammen, sagen wir, gegen vier. Ist das in Ordnung für Sie?« Ich nicke langsam und weiß nicht so recht, warum er nicht einfach hier und jetzt mit mir reden kann. »Abigail zeigt Ihnen, wo mein Büro ist.« Mit diesem Worten blickt er auf seine Uhr und steht auf. »Schönen Tag noch, meine Damen.«
»Dir auch, ich werde Savannah um vier zu dir schicken«, sagt Abigail. Nachdem er gegangen ist, sammelt sie mein Geschirr ein. »Kommen Sie, meine Liebe, wir machen uns auf den Weg.« Sie hält inne und beschreibt mit der Hand einen Kreis um sich. »Zuerst die Küche.« Sie ist größer als mein gesamtes Apartment und bietet einen Ausblick auf einen See vor zwei Bergen. »Hier gibt es immer etwas zu essen. Bedienen Sie sich, bitte. Wenn Sie etwas möchten, das nicht da ist, sagen Sie mir einfach Bescheid, und wir besorgen es.« Sie öffnet den riesigen Kühlschrank aus Edelstahl, der mit allem vollgepackt ist, was man sich denken kann.
»Hier arbeiten immer mindestens elf Leute, dazu kommen diejenigen, die hier die ganze Zeit über leben, also ist der Kühlschrank in der Regel gut gefüllt.« Ich schüttele den Kopf. Ich bin froh, dass ich nicht den Lebensmitteleinkauf tätigen muss. »Hinter der Tür da ist ein Weinkeller, wenn Sie mal gern ein Glas trinken möchten.« Sie zwinkert mir zu. Wein, wow, das ist etwas, woran ich lange Zeit nicht mehr gedacht habe, da meine Getränkekarte normalerweise meist Wasser, Wasser und Wasser umfasste. Plötzlich kann ich meine Lieblingssorte, den Châteauneuf-du-Pape, fast schmecken. Hmm, diesen Weinkeller werde ich ganz bestimmt mal inspizieren. Ich konzentriere mich wieder auf die Küche und bemerke, dass Abigail mit einem kleinen Lächeln auf dem Gesicht an die Marmorinsel gelehnt dasteht und mir etwas Zeit lässt. Dann fährt sie fort: »Normalerweise koche ich. Es ist ziemlich anstrengend, jedoch Teil meiner Pflichten, zu denen auch gehört, dafür zu sorgen, dass Sie es hier bequem haben.« Wiederum lächelt sie. Eine weitere Bemerkung, bei der mir klar wird, dass ich eine Weile hier sein werde, und wiederum gehen mir viele Fragen durch den Kopf. Ich muss wirklich anfangen zu sprechen, aber die Mauer, die ich zu meinem eigenen Schutz errichtet habe, lässt das nicht zu.
»Kommen Sie, gehen wir weiter.«
Ich folge ihr in ein prächtiges Wohnzimmer, vor dem Fenster nichts als gebirgiges freies Land. Es fällt mit schwer zu begreifen, wo ich bin, aber dieser Ort ist spektakulär. Ich bin in New York City geboren und aufgewachsen, daher ist dieses ganze Land faszinierend. Das Wohnzimmer hat eine hohe Decke mit Holzbalken und einem prächtigen Kamin. Der ganze Raum besteht aus dunklem Holz und Stein. Die Sofas sind rot mit großen schwarzen Decken. Mitten im Zimmer liegt ein gewaltiger hellbrauner Läufer. Ein Muster der Ureinwohner ist mit schwarzem Faden darin eingewoben. Er bildet das alles verbindende Zentrum des Wohnzimmers. Obwohl das Zimmer so gewaltig ist, verströmt es dennoch Gemütlichkeit. Ich bemerke flauschiges weißes Fell auf dem Boden neben dem Sofabein. Jemand muss ein Haustier haben.
Wir gehen weiter ins Esszimmer und haben denselben wunderschönen Blick über den See vor uns wie in der Küche. Ein gewaltiger Holztisch, der so aussieht, als könnten dort mindestens dreißig Personen sitzen, nimmt den größten Teil des Raums ein. Drei gusseiserne Kronleuchter hängen darüber. Mir fällt auch eine Überwachungskamera an der Decke auf. Ich wende rasch den Blick ab, weil ich nicht weiß, wer mich beobachtet.
In der oberen Etage zeigt mir Abigail sämtliche Schlafzimmer, auch das meine. Danach gehen wir über eine Treppenflucht in der Nähe der Küche ins Erdgeschoss. Hier liegen ein Swimmingpool, ein Fitnessraum und ein Unterhaltungsraum. Mir fällt auf, wie übergroß alles ist, und ich komme mir etwas exponiert vor. Ich möchte einen kleinen Raum finden und mich in eine Decke hüllen.