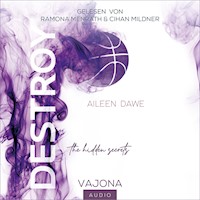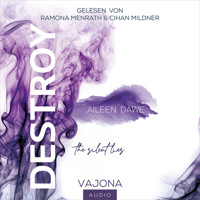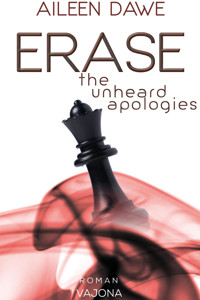
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Verborgen vom Licht, kann ich dich sehen, dass ich Beweise vernichte, wirst du flehen.« Illegales Online-Schach gehört zum Alltag von Everleigh Donovan, die mit dem erspielten Geld ihre Heimat Blackcoast Bay verlassen will. Sie wiegt sich in Sicherheit, bis eine neue Herausforderin die Spielregeln verändert und die Stadt in ihr Spielfeld verwandelt. Die Hackerin zwingt Everleigh, für jeden Schachzug Aufgaben zu erfüllen, die sie an ihre Grenzen treiben. Eine davon ist Coven Shaw, der neue Dozent der Universität. Obwohl er sich auf seinen Job konzentrieren sollte, bringt dieser ihn immer weiter in Bedrängnis – denn er muss ein Geheimnis wahren, das ihn tiefer ins Darknet verstrickt, als er zugeben darf … »Spiel mit mir, Everleigh. Ich werde dich vernichten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aileen Dawe
ERASE the unheard apologies
ERASE the unheard apologies
© 2024 VAJONA Verlag GmbH
Originalausgabe bei VAJONA Verlag GmbH
Lektorat: Vanessa Lipinski
Korrektorat: Désirée Kläschen und Susann Chemnitzer
Umschlaggestaltung: VAJONA Verlag GmbH unter
Verwendung von Motiven von 123rf
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für all diejenigen, denen gesagt wurde,
sie seien schwach.
Kämpft. Haltet durch.
Denn nur der Bauer hat beim Schach die
Möglichkeit, zu einer anderen Spielfigur zu werden.
Hinweis
Die Aufgaben der gesichtslosen Herausforderin sind teilweise an die Blue Whale Challenge angelehnt, die 2017 für mehrere Suizidfälle in Europa gesorgt hat. In diesem Roman wird in keiner Weise Selbstverletzung thematisiert, er beinhaltet aber dennoch Themen, die triggern können. Diese umfassen: Tod durch Ertrinken, Herzstillstand und Wiederbelebungsmaßnahmen, emotionale Folter und körperliche Misshandlung durch Fremdeinwirkung.
PROLOG
Wasser schlug über mir zusammen, die Kälte schnürte mir den Brustkorb zu. Es war so dunkel, dass ich nur verschwommene Umrisse ausmachen konnte. Der Countdown hingegen leuchtete so grell, dass er mich blendete. Nicht weit von mir entfernt erkannte ich ihre zierliche Gestalt und tauchte ihr entgegen. Die Kraft des Ozeans zerrte an mir wie der Wind an den Wolken, wollte mich von ihr fernhalten, um uns endgültig zu entzweien. Flehend streckte sie die Hand nach mir aus. Ich ergriff sie und hielt sie fest, bis ich bei ihr war, die Panik in ihren Augen erkannte. Kleine Bläschen drangen aus ihrer Nase und perlten Richtung Oberfläche. Eine stumme Warnung, dass ihr die Luft ausging.
Sofort drückte ich meinen Mund auf ihren und gab ihr einen Teil des Sauerstoffs, den ich selbst so dringend brauchte. Sie deutete auf ihr Handgelenk. Ihr Armband hatte sich in der eisernen Kette verkeilt. Mit den Fingerspitzen ertastete ich den Anhänger, den ich ihr geschenkt hatte. Ein Symbol dafür, dass wir einander nicht verlieren würden. Und jetzt … Jetzt sollte er der Grund sein, wieso wir uns verlieren würden.
Ich zerrte an dem Karabiner. Versuchte, ihre Hand von dem Armband zu lösen, aber egal, was ich tat, es gelang mir nicht. Ich versuchte es erneut. Wieder und wieder. Bis eine Berührung an meiner Hand mich innehalten ließ. Sie schüttelte den Kopf, ein zaghaftes und trauriges Lächeln auf den Lippen, das die Verzweiflung wie ein loderndes Feuer in mir schürte.
Nein. Nein, nein, nein. Dass sie mich zurückhielt, konnte nur eins bedeuten – sie resignierte. Aber ich … Ich konnte, wollte, durfte das nicht. Sie musste leben. Sie war mein Leben.
Verweigerung kollidierte mit beißendem Zweifel, dem ich keinen Raum geben wollte. Doch sie krampfte, ihr Körper bebte. Das Leuchten wich immer mehr aus ihren ozeanblauen Augen. Ich riss verzweifelt an ihrem Arm – und mit einem Mal verschwand der Widerstand.
Eine Sekunde verging, bis ich verstand. Schnell umfasste ich ihre Taille und drückte sie mit aller Kraft nach oben. Ich wollte ihr folgen, aber ein Funkeln zog meine Aufmerksamkeit auf sich.
Das Armband. Es sank in die Tiefe. Eine Endgültigkeit, die ich noch verhindern konnte. Ehe mir bewusst wurde, was ich tat, holte ich Schwung. Unerträglicher Druck legte sich auf meinen Brustkorb, je länger ich tauchte. Dieses Gefühl schoss in meine Arme, meine Beine. Winzige Dolche bohrten sich mit dem steigenden Wasserdruck in meinen Kopf.
Ich hatte nur eine Chance. Meine Haut prickelte, auch meine Gliedmaßen fühlten sich taub an, aber ich würde jetzt nicht aufgeben. Entschlossen stieß ich die Hand nach vorn, umfing das erkaltete Silber, bis ich es gänzlich umschloss. Erleichterung durchströmte mich und ich seufzte auf. Ein Fehler. Salz benetzte meine Zunge, erinnerte mich daran, dass ich mich unter Wasser befand, dass meine Lunge um Sauerstoff flehte.
Ich musste atmen, aber konnte nicht. Nicht, solange es nichts zum Atmen gab. Obwohl alles in mir danach schrie, diesem Reflex nachzugeben, kämpfte ich dagegen an. Ich sah hoch. Ruderte mit den Armen und schlug verzweifelt um mich, um an die Oberfläche zu gelangen. Doch mit jeder Sekunde, die verging, schwand die Kraft aus meinen Muskeln. Ich wollte atmen. Musste atmen und durfte nicht. Doch der Schmerz wurde übermächtig.
Ich krümmte mich. Würgte, hustete, würgte und hustete. Wasser füllte meine Lunge. Mein Wille löste sich von meinem Verstand. Leere breitete sich in meinem Kopf aus und die Erkenntnis sickerte in mein Bewusstsein.
Ich ertrank. Ich starb.
Dann wurde mein Sichtfeld schwarz.
Kapitel 1
Everleigh
Schachmatt. Ein Wort, an dem ich alles liebte. Um das ich spielte. Für das ich kämpfte – jeden Tag. Siegessicher betrachtete ich den schwarzen Turm, der nur darauf wartete, dass ich den entscheidenden Zug ausführte. Langsam bewegte ich den Cursor hin zu der Figur, unwissend, ob sich mein Gegner seiner drohenden Niederlage gerade bewusst wurde oder nichtsahnend seinen nächsten Zug plante.
Nur noch ein Fehler. Meine Fingerspitzen kribbelten erwartungsvoll. Dann habe ich gewonnen.
Die Pause, die mir während des Wartens aufgezwungen wurde, nutzte ich nicht, um zu entspannen. Stattdessen wägte ich die verschiedenen Möglichkeiten miteinander ab, die mein Gegner wählen konnte. Dabei versuchte ich, so gut es ging, mich in seine Denkweise hineinzuversetzen und mir auszumalen, wie der weitere Verlauf aussehen könnte. Diesen Vorgang wiederholte ich so lange, bis ein Spiel für beendet erklärt wurde – ganz egal, ob ich das Feld als Gewinnerin oder Verliererin verließ. Letzteres galt eher als Ausnahme, war aber dennoch nie auszuschließen. Wenn es dann doch passierte, spornte mich das nur an, es das nächste Mal anders zu machen. Nicht besser, sondern überlegter. Nur dadurch erhielt man die Chance, Schach zu verstehen. Die Wahl des Gegenspielers mochte Glück geschuldet sein, aber das Spiel selbst lebte von Strategie. Taktik entschied über den Ausgang, und die meines aktuellen Gegners konnte man … ziemlich leicht durchschauen. Abwartend starrte ich auf das digitale Spielfeld, während die Zeit langsam ablief. Ihm blieben nur noch ein paar Sekunden für diesen Zug. Untätigkeit würde bedeuten, dass der Sieg automatisch auf mich überging.
Eine Entscheidung. Zwei Möglichkeiten – aufgeben oder weitermachen.
Kurz bevor der Countdown endete, bewegte sich die weiße Dame schließlich auf meinen Springer zu und schickte ihn aus dem Spiel.
Ich musste ein Lächeln unterdrücken.
Gesichtslos oder nicht, bei meinem Gegenüber handelte es sich zweifellos um einen Anfänger. Sonst wäre er nicht auf diese Finte hereingefallen.
Einen Atemzug lang genoss ich meine Überlegenheit, ehe ich den schwarzen Turm über das Feld dirigierte.
Direkt vor den weißen König. Schach.
Zwar könnte er sich aus dieser Situation befreien, indem er meinen Turm vom Feld beförderte. Sobald er das allerdings tat, würde mein Läufer ihn schachmatt setzen. Oder mein verbliebener Springer.
Oder meine Dame.
Eine für ihn aussichtslose Konstellation. Und das bedeutete …
Ein Fenster öffnete sich auf meinem Bildschirm, in dem mir die Nachricht verkündet wurde, von der ich bereits wusste: Du hast gewonnen.
Doch nicht diese Tatsache rief in mir das Gefühl der Genugtuung hervor, sondern die wachsende Zahl seitlich des Spielfelds. Die Ziffern sprangen in die Höhe und formten sich zu einem Ergebnis, auf das ich stolz sein konnte.
Dreitausendachthundert Dollar nach nur einem Sommer. Zwar hatte ich das Geld noch nicht in der Hand, aber das Wissen darüber, es zu besitzen, gab mir Sicherheit. Auf diese Weise konnte ich Geld verdienen und es gleichzeitig vor den Augen aller verstecken. Vor den Augen meiner Familie.
Eine Familie, die nicht mit der Wimper zucken und mir alles Geld der Welt geben würde, wenn ich nur danach fragte.
Aber ich wollte nicht fragen. Denn das würde erfordern, sie in mein Vorhaben einzuweihen, die Stadt nach meinem Abschluss zu verlassen und mich endlich nur auf mich zu konzentrieren.
Ich musste das allein schaffen.
Weil ich allein sein wollte.
Bevor ich mich weiter in meinen Gedanken verstricken konnte, blinkte ein neues Fenster auf meinem Bildschirm auf. Überrascht starrte ich darauf. Eine neue Herausforderung. Von demselben Spieler.
So eine Wiederholung war nicht unüblich, aber normalerweise machte der Gewinner den ersten Schritt. In diesem Fall jedoch kam sie von der Person, die gerade hundert Dollar an mich verloren hatte.
Unentschlossen checkte ich die Uhrzeit. Kurz vor halb sechs. Vielleicht sollte es mich wundern, dass jemand so erpicht darauf war, so früh so nachlässig mit seinem Geld umzugehen, aber wenn ich ihn ein weiteres Mal täuschen könnte, dann –
»Guten Morgen«, durchbrach eine vertraute Stimme die Ruhe, die mich bis eben umgeben hatte. Kurz darauf wurde es hell in der Küche, woraufhin ich meine Augen zusammenkniff und gegen das unerwartete Licht anblinzelte. Meine Schwester Neyla stand im Türrahmen und wirkte überrascht, mich in aller Früh an der Kochinsel sitzend vorzufinden. Ich verlagerte das Gewicht und wurde mir dadurch meiner schmerzenden Gliedmaßen nur allzu bewusst. Diese Hocker waren definitiv nicht für längeres Sitzen ausgelegt. Immerhin saß ich hier schon seit einer Stunde. Neyla, die mich mit Argusaugen beobachtete, konnte mir das anscheinend ansehen. »Warum bist du nicht oben?«
Weil ich dachte, mich hier besser konzentrieren zu können.
Statt ihr das aber zu sagen, fing ich den Blick meiner Schwester auf. Sie hatte ihr dunkelbraunes Haar zu einem strengen Zopf gebunden, die hohen Wangenknochen schimmerten rosig auf ihrer blassen Haut. Im Gegensatz zu mir hatte sie nichts von dem gebräunten Teint unserer Eltern geerbt, dafür kamen ihre strahlend blauen Augen noch intensiver zur Geltung. Jedes Mal hatte ich das Gefühl, in mein Spiegelbild zu sehen und trotzdem keine einzige Gemeinsamkeit zu finden.
Wir waren Zwillinge. Doch selbst das änderte nichts an der Tatsache, dass wir uns nicht nahestanden. Nicht so, wie es Zwillingen nachgesagt wurde. Nicht mehr.
Neyla, die immer noch keine Antwort von mir erhalten hatte, löste sich aus ihrer Starre und umrundete die Kochinsel.
»Du bist früh auf«, entgegnete ich, weil mir die Ringe unter ihren Augen nicht entgingen, die dunkle Schatten auf ihre Wangen warfen und auf ihrer mondhellen Haut besonders auffielen.
Als hätte sie auf diese Bemerkung gewartet, seufzte Neyla und nahm ein Glas aus dem Regal, das sie unter den Kaffeevollautomaten stellte. »Ich konnte nicht schlafen.«
»Da sind wir schon zwei«, murmelte ich, doch die Worte wurden vom Kreischen des Mahlwerks verschluckt, das lautstark losratterte. Der Duft nach frisch gemahlenem Kaffee erfüllte den Raum. Ungefähr eine Minute später, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, drehte sich meine Schwester zu mir um. Den fertigen Kaffee in der einen Hand, eine Flasche Sirup in der anderen, steuerte sie den Platz neben mir an.
Bevor Neyla einen Blick auf den Bildschirm erhaschen konnte, klappte ich mein Notebook zu und schob es in meinen Rucksack. Dabei nahm ich wahr, wie Neyla sich anspannte und ins Stocken geriet. Unsicherheit dominierte ihre Stimme, als sie fragte: »Willst du schon los?«
Damit traf meine Schwester den Nagel auf den Kopf. Nur hatte meine Aufbruchstimmung nichts mit irgendwelchen Erledigungen zu tun oder dem Drang nach Überpünktlichkeit. Um Neylas Ernüchterung jedoch nicht zu untermauern, wich ich kurzerhand auf das Offensichtliche aus. »Flüssigkeiten und Technik harmonieren nicht so gut miteinander.«
Und mein Laptop war mir heilig. Neyla zögerte kurz, ehe sie sowohl die Flasche als auch das Glas auf die Arbeitsfläche stellte. Letzteres platzierte sie zwischen uns.
Ich erkannte die Frage hinter dieser Geste, das Angebot, das sie mir damit unterbreitete. In letzter Zeit hatte ich meine Schwester so oft abgewiesen, dass ich ihren vorsichtigen Annäherungsversuch verstand. Ein kleiner Funken des schlechten Gewissens meldete sich in mir, dem ich gedanklich sofort den Sauerstoff entzog und ihn auslöschte, damit er sich nicht zu etwas Größerem entwickeln konnte.
Wortlos griff ich nach dem Glas und entdeckte ein Lächeln auf Neylas Lippen, das sie nicht vor mir zu verbergen schaffte. Auch dann nicht, als sie sich von mir abwandte und die Flasche aufschraubte. Meine Schwester wusste, dass ich die künstliche Süße verabscheute, die sie dafür umso mehr liebte. Dankbar für ihre Rücksicht hielt ich den bissigen Kommentar zurück, der im selben Moment von der bitteren Note weggespült wurde. Ich erwischte mich dabei, wie ich den Kaffee etwas länger im Mund behielt, bevor ich Neyla das Glas zurückreichte – weil sie ebenso wusste, dass ich nie mehr als einen Schluck Kaffee zu mir nahm.
Ein Klecks Sirup durchtränkte die hellbraune Flüssigkeit, ehe meine Schwester selbst am Kaffee nippte. Währenddessen breitete sich wieder diese Stille aus, die mich eben noch in eine warme Decke gehüllt hatte. Jetzt aber empfand ich dabei nichts als erdrückende Enge.
»Ich habe nächste Woche meinen Check-up«, erinnerte mich Neyla. »Vielleicht habe ich mich deswegen die halbe Nacht umher gewälzt.«
Das hatte ich nicht vergessen. Wie könnte ich auch, wenn dieser Termin nicht nur meine Schwester, sondern die ganze Familie betraf. Die Anspannung, die seit Wochen in diesem Haus herrschte, war kaum auszuhalten, weshalb ich mich meistens am Strand aufgehalten hatte, manchmal auch an den Docks.
Neyla war mit einem Herzfehler geboren worden. Auch ich hatte bei meiner Geburt ein Loch im Herzen gehabt, das aber klein genug gewesen war, um sich selbst zu schließen. Meine Schwester hatte nicht so viel Glück. Nach nur zwei Monaten hatte sie operiert werden müssen.
Eigentlich war das ein Routineeingriff, in Neylas Fall hatte es aber Komplikationen gegeben, die verantwortlich dafür waren, dass sie ihr Leben lang unter ärztlicher Aufsicht stehen würde. Vor neun Jahren hatte sie sich einer weiteren Operation unterziehen müssen. Die Ärzte sprachen von einem Wunder, dass sie damals überhaupt überlebt hatte, dass sie aufrecht neben mir sitzen konnte und dass wir unseren dreiundzwanzigsten Geburtstag hatten feiern können.
Und obwohl es Neyla schlechter getroffen hatte als mich, wirkte sie ausgeglichen. Auch jetzt, trotz der dunklen Schatten auf ihren Wangen.
»Woran arbeitest du gerade?« Sie wandte sich mir zu, wieder leuchtete diese Hoffnung in ihren Augen auf. Diese Sehnsucht nach etwas, das unbestreitbar nicht mehr bestand. Diese Verbindung hatte ich eigenhändig gekappt.
Hin- und hergerissen zwischen der Wahrheit und einer Lüge, entschied ich mich erneut für den Mittelweg – Desinteresse. Gegen irgendeine Art der Interaktion, gegen jede weitere Annäherung. Demonstrativ sah ich zur Uhr an der Wand und stand auf. Beißend schrappte der Hocker über die Fliesen, während ich mich vorlehnte, um mir einen Apfel aus der Obstschale zu angeln.
Neyla nahm die Abweisung mit einem zarten Nicken zur Kenntnis, als hätte sie damit bereits gerechnet. Ich konnte mir nicht erklären, wieso meine Entscheidung erneut an meinem Gewissen kratzte. Sonst konnte ich gut darüber hinwegsehen. Jetzt jedoch spürte ich Neylas Betroffenheit viel zu deutlich, weshalb ich mich meiner Schwester schließlich doch zuwandte. Sie starrte in ihren Milchkaffee und umklammerte das Glas so fest, als wäre es ein Rettungsanker. Unschlüssig legte ich die Hand auf die Arbeitsfläche und tippte mit dem kleinen Finger, um sie aus ihrer Gedankenkette zu befreien. »Kannst du Mom sagen, dass ihr heute nicht mit dem Abendessen auf mich warten müsst?«
»Klar«, gab Neyla einsilbig zurück, ihre Enttäuschung war kaum zu überhören.
Ich bückte mich nach meinem Rucksack und warf ihn mir über die Schulter. Weil Neyla nicht mehr reagierte, hielt ich ein weiteres Mal inne und senkte leicht den Kopf, bis ich mich mit ihr auf Augenhöhe befand. Sachte berührte ich ihre Schulter, doch selbst das brachte sie nicht dazu, mich anzusehen. »Du bist stärker, als du denkst. Vergiss das nicht.«
Ich wartete noch etwas, ehe ich mich gänzlich abwandte. Im Flur schnappte ich mir mein Skateboard und umfasste die Klinke der Haustür.
»Ever, warte.«
Meine Brust verkrampfte sich bei diesem Spitznamen. So wurde ich seit Jahren nicht mehr genannt. Ihn ausgerechnet jetzt zu hören, aus Neylas Mund, führte mir nur noch deutlicher vor Augen, wie sehr wir uns tatsächlich voneinander entfernt hatten. Deshalb schloss ich sie. Ein schwacher Versuch, mich von einem Zustand abzuschirmen, der sich ganz leicht ändern ließe – wenn ich mich nicht widersetzen und Neyla nicht weiterhin auf Abstand halten würde.
Ich brachte kein Wort über die Lippen. Verbot mir jegliche Reaktion, während ich auf ihre wartete. Auch ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass Neyla mir hinterhergekommen war und dicht hinter mir stehen blieb. Ihre Schritte verklangen, ihr Duft hüllte mich ein. Dennoch verharrte ich so lange in der dunklen Stille, dass ich dachte, mir ihre Stimme nur eingebildet zu haben. Doch dann hörte ich sie, so leise, dass ich es beinahe überhört hätte. Laut genug, um den Dolch zu spüren, der sich mir dank der zwei Silben zwischen die Rippen bohrte. »Danke.« Etwas Schweres drückte in meiner Kehle, das meiner Stimme ihre gewohnte Stärke nahm, wodurch sie vielmehr einem heiseren Kratzen glich. »Wofür?«
Statt einer Antwort spürte ich eine Berührung an meinem Handgelenk. Ein zartes Zupfen an einem Band, das weiterhin zwischen uns existieren würde. Ob ich wollte oder nicht. Kurz war ich versucht, ihr mit meinen Fingerspitzen entgegenzukommen. Neyla mitzuteilen, dass ich immer da sein würde, auch wenn ich nicht hierbleiben wollte. Aber ich tat nichts dergleichen. Nicht, als mir ihre Berührung entglitt. Nicht, als das Zupfen verebbte. Erst verzögert wagte ich einen Blick über die Schulter, doch von meiner Schwester war nichts mehr zu sehen. Sie war gegangen.
Ich wandte mich in die entgegengesetzte Richtung und tat es ihr nach. Mit meinem Skateboard unterm Arm verließ ich das Haus, lief über die Veranda und die drei Stufen hinunter, ehe ich das Board losließ und es scheppernd auf den Boden fiel. Mit Moms liebevollem Tadel im Ohr, ich solle erst auf dem Gehweg fahren, stieg ich auf. Kaum dass ich Schwung holte, spürte ich das Vibrieren unter den Sohlen und den warmen Wind im Gesicht. Zumindest eine Sache, die sich nicht änderte, während sich alles verändert hatte. Einfamilienhäuser zogen an mir vorbei, und auch wenn ich verbissen an meinem Handeln festhielt, musste ich an die vergangenen Minuten denken. Daran, wie meine Schwester mich angesehen hatte. Wie sie mit mir zu sprechen versucht und wie ich sie abgewiesen hatte. Wieder.
Vor Jahren hatte ich eine Entscheidung getroffen, um meine Schwester zu schützen. Etwas, das Neyla nie von mir verlangt hatte und um das sie mich nie gebeten hätte.
Ich hatte es trotzdem getan, weil sie nun mal meine Schwester war. Mit dieser Entscheidung hatte ich jedoch an einem Rad gedreht, das uns als Ganzes voneinander trennte – und das ließ ich sie spüren. Ich wusste, dass ich sie mit meinem Verhalten verletzte. Dass es nicht fair war, sie so zu behandeln, und ich ihr stattdessen die Chance geben sollte, selbst über das zu urteilen, was ich getan hatte. Aber mir war es lieber, dass wir uns auseinanderlebten, als dass sie den wahren Grund kannte, den Auslöser für diesen Entschluss.
Im nächsten Jahr würde ich sowieso fort sein.
Erneut stieß ich den Fuß auf den Asphalt und erhöhte mein Tempo. Im Vorbeirauschen hörte ich das Schlagen von Türen, das Anlassen von Motoren. Ich entdeckte die vielen Surfboards auf den Autodächern und den Ladeflächen.
Das allein reichte, um zu wissen, wohin die Einheimischen von Blackcoast Bay wollten – Richtung Meer.
Und ich verstand es.
Weil es mir genauso ging.
Seit ich denken konnte, bildete der Strand mit seiner kohlschwarzen Küste das Herzstück der Stadt. Auch jetzt noch, obwohl sich die extreme Hitze des kalifornischen Sommers verabschiedet hatte. Für Anfang September war es dennoch angenehm warm, weil es sich nachts nur kaum merklich abkühlte.
Der Gegenwind strich über meine Beine und zerrte an meiner Kleidung. Salzige Luft schlug mir entgegen, die verriet, dass sich der Ozean ganz in der Nähe befand. An der nächsten Kreuzung bog ich zur Promenade ab, die an den Anlegestellen begann und zu dem Strandabschnitt führte, an dem ich mich am liebsten aufhielt.
Onyxschwarze Felsformationen ragten in die Höhe und zeichneten einen dunklen Kontrast zum türkisfarbenen Wasser, das sich heute aufgebracht zeigte. Die perfekten Gegebenheiten, um zu surfen. Ich entdeckte ein paar Leute, die sich ihre Neoprenanzüge überstreiften und ihre Boards vorbereiteten. Hinter ihnen brach der Himmel entzwei; die Dämmerung verwandelte den Horizont in ein buntes Farbenmeer, das sich auf der Wasseroberfläche spiegelte.
Der Anblick war unglaublich. Obwohl ich an der Küste Kaliforniens aufgewachsen war, raubte er mir immer wieder den Atem. Jedes Mal und immer anders. Als sähe ich es täglich zum ersten Mal.
Einige Sekunden lang erlaubte ich mir den friedvollen Einklang, den ich dabei empfand.
»Vorsicht!«
Im einen Moment registrierte ich eine Bewegung – im nächsten presste mir ein Widerstand jeglichen Sauerstoff aus der Lunge.
Kapitel 2
Everleigh
Ich versuchte noch, mein Gesicht zu schützen. Das Schlimmste zu verhindern und mich abzufangen, bevor ich auf den Boden knallte. Vergebens. Schmerz erschütterte meinen Körper, gefolgt von einer Taubheit, die mich von innen heraus lähmte. Alles passierte so schnell, dass es sich nur um Sekunden handeln konnte. Aber auch die winzigste Zeitspanne fühlte sich manchmal wie ein ganzes Leben an.
Unfähig, mich zu bewegen, blieb mir nichts anderes übrig, als meine flache Atmung unter Kontrolle zu bringen. Ich musste mich beruhigen. An irgendetwas anderes denken als an den Druck auf meiner Brust, der diesen Drang nach Sauerstoff erschwerte.
»Oh, fuck.« Eine Stimme vibrierte an meinem Ohr, begleitet von einem Ächzen. Ich brauchte einen Moment, um die Informationen zu verarbeiten. Dann fuhr ich so schnell hoch, dass ich es sofort bereute. Ein unangenehmer Stich schoss mir durch den Kopf und meine Muskeln schrien auf. »Geht es dir gut?«
Beides rückte in den Hintergrund, als ich in ein fremdes Gesicht starrte. Ein schönes Gesicht, das mir so nah war, dass ich jedes Detail wahrnehmen konnte.
Sonnengeküsste Haut, ein Grübchen am Kinn und Bartstoppeln, die seinen Kiefer betonten. Honigfarbenes, gewelltes Haar, das ihm bis zur Schulter reichen musste und in dem sich Sand verfangen hatte. Kastanienbraune Augen, die wie eine warme Entschuldigung über meine Haut glitten, sodass ich erschauderte. Gott. Der Typ sah aus wie Heath Ledger. Nur mit markanteren Zügen.
»Ich wusste nicht, dass ich so leicht zu übersehen bin.« Ein schmerzverzerrter Laut entwich seiner Kehle, der in einem rauen Lachen endete. »Du hast mich einfach umgefahren.«
»Scheiße. Tut mir leid«, stieß ich aus und entdeckte mein Skateboard, das rücklings im Sand lag. Die Rollen waren noch immer in Bewegung. »Ich habe nicht aufgepasst.«
»Ist mir gar nicht aufgefallen«, scherzte der Typ. »Kannst du aufstehen?«
Ich wollte ihm gerade sagen, dass ich höchstens ein paar blaue Flecken davontragen würde und keinen Knochenbruch, als er sich unter mir bewegte – und das machte mir bewusst, dass ich auf ihm lag.
»Sorry.« Ich stützte mich zu seinen Seiten hoch, um ihn von meinem Körpergewicht zu entlasten. Doch obwohl ich von ihm herunterrutschte und mich auf meine Fersen setzte, entfernte er sich nicht. Der Typ richtete sich mühelos auf, als hätte ihm dieser Sturz rein gar nichts ausgemacht.
Sand rieselte bei dieser Bewegung auf sein marineblaues Shirt, das an seinen Armen spannte. »Habe schon Schlimmeres erlebt.«
»Klar, Mr. Army«, murmelte ich abwesend, weil mir sein Muskelspiel nicht entging, und befreite mein Oberteil von den kleinen Körnern.
»Ehrlich. Mach dir keinen Kopf.« Wahrscheinlich hatte er die Situation und meine ungewohnte Befangenheit mildern wollen, doch der Unterton, mit dem er die Worte aussprach, bewirkte das Gegenteil. Diese sanfte Gleichgültigkeit gab mir das Gefühl, als hätte ich einen toten Nerv getroffen.
Ich sah auf. Großer Fehler. Denn ich hatte recht. Sein blondes Haar reichte ihm bis zur Schulter und umrahmte sein Gesicht in leichten Wellen. Das Rauschen des Ozeans vervollständigte das Bild eines typischen Surfers, wie sie sich täglich an diesem Strand aufhielten – und die ich demonstrativ mied.
»So gehst du also mit Leuten um, die dir den Weg versperren.« Verschwunden war der trübsinnige Schatten, stattdessen erhellte ein amüsiertes Grinsen sein Gesicht, das mich kurzzeitig ablenkte. Normalerweise ignorierte ich Menschen, die mir im Weg standen, aber in diesem Kontext führte das leider zum selben Ergebnis: Ich hatte ihn über den Haufen gefahren. Einige Sekunden verharrten wir so voreinander, ein Zögern, das Einladung und Frage zugleich repräsentierte. »Ich bin Coven.«
Na toll, sogar sein Name klang heiß. »Schön für dich, Coven.« Meinem Tonfall zum Trotz konnte ich den Blick nicht von ihm abwenden.
Er lachte leise, als störte er sich gar nicht an meiner verschleierten Abweisung. »Memo an mich selbst: Aufpassen, dass ich nicht aus unbekannten Gründen auf deiner Blacklist lande.«
Ich konnte regelrecht fühlen, wie mir die Gesichtszüge entgleisten. Denn jetzt wurde ich mir des fehlenden Gewichts auf meinem Rücken bewusst.
Mein Laptop.
Erschrocken sah ich mich um und entdeckte meinen Rucksack, nicht weit von meinem Skateboard. So schnell ich konnte, stand ich auf. Auch wenn es sich nur um ein paar Schritte handelte, stolperte ich mehr über die unebene Oberfläche, als dass ich lief, ehe ich mich erneut auf die Knie fallen ließ. Ich ignorierte das dort entstehende Stechen und strich den Sand von meiner Tasche, bevor ich sie öffnete und mein Notebook herausholte. Schnell prüfte ich es auf äußere Schäden und klappte es auf. Neben mir nahm ich einige Worte wahr, verstehen tat ich sie jedoch nicht. Der Bildschirm leuchtete auf, woraufhin ich ihn mit einer Kombination aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen entsperrte. Wahllos öffnete ich einige Fenster, doch meine Anspannung blieb. So lange, bis ich sicher sein konnte, dass er funktionierte. Es war nichts passiert.
Meine Programme waren intakt. Und damit auch all das, was ich mir in den letzten Monaten, wenn nicht sogar in den vergangenen Jahren, erarbeitet hatte. Natürlich besaß ich mehrere Sicherungen davon, aber allein der Gedanke, irgendwann von ihnen Gebrauch machen zu müssen, brachte mich ins Schwitzen. Eine neue Ausrüstung kostete mehrere tausend Dollar – und die brauchte ich wirklich für etwas anderes.
Mit einem leisen Seufzen lehnte ich mich zurück und rieb mir über die Stirn. Erst nach mehreren Atemzügen, in denen ich mein Notebook erneut auf äußeren Schaden prüfte, verstaute ich mein wichtigstes Gut wieder im Rucksack.
»Hey.« Beim Klang der Stimme zuckte ich zusammen. In meiner Panik hatte ich den Typen völlig ausgeblendet, der jetzt neben mir auftauchte und mich mit ehrlichem Interesse musterte. »Funktioniert alles?«
»Ja«, antwortete ich knapp und nickte.
»Na komm, ich helfe dir.« Coven streckte mir seine Hand hin, die ich aber nur anstarren konnte. Er schien mein Zögern falsch zu interpretieren, denn er fügte vergnügt hinzu: »Oder habe ich mich noch nicht als würdig genug erwiesen?«
Das entlockte mir ein leises Schnauben, wodurch sich meine Mundwinkel unbewusst hoben. Es war kein Lächeln, aber … es war da. Schließlich ergriff ich seine Hand und ließ mich von ihm auf die Beine ziehen.
»Danke«, sagte ich leise. Hoffte, dass er aus diesen beiden Silben heraushören konnte, dass ich damit mehr einschloss als das Aufhelfen. Ich nahm ungern Hilfe an. Mich auch noch dafür zu bedanken, widersprach meiner Natur. Dass ich es trotzdem tat, überraschte mich.
»Stets zu Diensten«, erwiderte Coven. Seine Finger verharrten weiterhin an meinen, was mich dazu bewegte, den Kopf zu heben. Ihn anzusehen, obwohl ich ihn nicht ansehen wollte.
Sein Grinsen tauchte wieder auf, eine leise Erwartung schwang darin mit.
Ich wollte nicht, dass das so blieb.
»Was schulde ich dir?«, fragte ich kühl.
»Wie bitte?« Die Brauen des Typen schossen in die Höhe. »Wieso denkst du, dass du mir etwas schuldest?«
»Ich habe dich umgefahren und als Polster genutzt.« Eine Anklage wegen Körperverletzung stand nicht auf meiner Agenda. »Du hättest dir sonst etwas dabei brechen können, weil du mich abgefangen hast.«
Ehe ich mich versah, klopfte der Typ seine Brust ab, seine Rippen, seine Hüfte. Ein Finger musste sich in seinem Shirt verhakt haben, denn bei der nächsten Handbewegung starrte ich auf einen Streifen gebräunter Haut an seinem Bauch.
»Alles dran.« Die unteren Bauchmuskeln des Typen zeichneten ein V. Gott, verdammt. »Du schuldest mir nichts.«
»So etwas kann gegen mich verwendet werden«, erklärte ich dann mürrisch. Coven wirkte belustigt und irritiert zugleich, weshalb ich weiter ausholte. »Irgendwann kommen solche Leute wieder auf dich zu und fordern einen Gefallen für etwas ein, an das du dich gar nicht mehr erinnern kannst. Ist dir das etwa noch nie passiert?«
»Schon, aber –«
»Sag mir, was du willst«, forderte ich nachdrücklich.
»Verrate mir deinen Namen.«
»Ein Name ist keine Gefälligkeit.«
Aber Coven schien es wirklich wissen zu wollen. »Er ist ein Anfang.«
»Ein Anfang wovon?« Ich seufzte leise, weil er auf diese Frage nicht einging. Schließlich gab ich nach. »Everleigh.«
Erneut hob sich sein Mundwinkel. Und erneut konnte ich nicht anders, als darauf zu starren.
»Everleigh«, wiederholte der Typ, als wolle er die Silben kosten. Sie auf seiner Zunge schmecken und probieren, ob ihm mein Name gefiel. Eine Weile betrachtete er mich schweigend. Nicht auf die unangenehme Art, mit der Männer nach einem weiblichen Körper gierten, sondern … mit aufrichtiger Beachtung. Seine Mimik veränderte sich, bevor er zu einer betont lässigen Erklärung ausholte: »Ich brauche deinen Namen, um mir deine Handynummer einzuspeichern. Oder um ihn später zu erwähnen, wenn ich meinem Kumpel erzähle, dass ich eine Frau gerettet habe und sie sich mit einem Kuss bedankt hat.«
»Wie bitte?« Ich hatte mich gerade verhört. Oder?
Doch Coven zwinkerte nur.
Nein, ich hatte ihn genau verstanden. Mein Name schien wirklich nur der Anfang gewesen zu sein, der die eigentliche Forderung einleitete. Meine Handynummer. Oder einen Kuss.
So viel zum Thema Du-schuldest-mir-nichts.
Auffordernd hielt ich ihm die Hand hin. Ohne mich aus den Augen zu lassen, holte er sein Smartphone hervor und reichte es mir. Ich ertappte mich dabei, wie ich ihm diese Selbstsicherheit vom Gesicht wischen und sie zeitgleich genau dort festhalten wollte, weil es mir zu meinem Leidwesen gefiel. Vielleicht ein bisschen zu sehr.
Ich tippte auf das Display.
Gesperrt.
»Soll ich den Code selbst knacken?«, fragte ich und hätte die Worte am liebsten sofort aus seinem Gedächtnis gestrichen. Jede Andeutung in diese Richtung war gewagt, auch Fremden gegenüber.
»Ich glaube nicht, dass du das schaffst«, entgegnete Coven.
Ich wollte ihm gerade eine Erwiderung an den Kopf werfen, als er näher an mich herantrat und sich über den Bildschirm beugte, wodurch sich das Handy entsperrte.
Jetzt musste ich ein Lachen unterdrücken. »Du entsperrst dein Handy kopfüber?«
»Da kommt niemand drauf. Wenn es mir mal geklaut werden sollte und jemand in meiner Vergangenheit wühlen will, scheitert es schon an den simpelsten Dingen.«
»Hast du so viel zu verbergen?«
Coven sah mich an, ein schelmisches Funkeln blitzte in seinen Augen auf, was mich neugierig machte. Aus diesem Winkel und aus dieser Nähe erkannte ich die goldenen Sprenkel, die den warmen Braunton seiner Iris umgaben. »Wer hat das nicht?«
Ich wusste nicht, was den Schalter in mir umlegte. Ob es die beunruhigende Intensität war, mit der er mich bedachte. Oder ob es doch an seiner Wortwahl lag, die mich an das erinnerte, was ich immer an höchste Stelle setzte: meine Anonymität. Sie stand vor allem anderen – und sie brachte mich dazu, meinen leichtsinnigen Entschluss, ihm meine Nummer zu geben, fallen zu lassen.
Ehe ich das noch einmal überdenken konnte, stellte ich mich auf die Zehenspitzen und schob die Hand in sein Haar. Ich zog seinen Mund an meinen und schloss die Distanz, die uns voneinander trennte. Für den Bruchteil einer Sekunde spürte ich die Überraschung, die ihn erfasste und sofort wieder verschwand, als hätte er auf genau diese Entscheidung gehofft. Seine Haltung veränderte sich so schnell, dass ich es vielleicht gar nicht wahrgenommen hätte, wäre ich ihm nicht so nahe. Coven umfasste meine Taille, griff mit der anderen Hand in meinen Nacken. Er hielt mich bei sich. Nahm mir so jede Möglichkeit, meine Entscheidung zu revidieren und ihm zu entfliehen. Dann erwiderte er meinen Kuss mit einer Entschlossenheit, die mich bis ins Mark erschütterte. Hatte ich eben noch gedacht, die Oberhand zu haben, verflüchtigte sich diese Überzeugung in dem Moment, als Coven meine Lippen teilte. Jetzt küsste er mich. Nicht sanft oder unsicher, sondern grob und besitzergreifend.
Oh, Scheiße.
Ich erschauderte unter seiner Berührung. Unter der Art, wie er etwas einforderte, das ich ihm zuvor bereitwillig angeboten hatte, und unter dem Gefühl, das seine Bestimmtheit in mir auslöste. Er musste meine Empfänglichkeit dafür spüren, denn all das verleitete ihn dazu, mich noch näher an sich zu ziehen. Selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich nicht die Kraft gefunden, von ihm abzurücken. Wie von selbst gruben sich meine Finger in sein Haar, wickelten sich um die weichen Strähnen und entlockten ihm ein leises Stöhnen.
Ich glaubte nicht an große Gefühle nach einem einzigen Kuss, geschweige denn nach der ersten Begegnung. Aber ich glaubte an unverkennbare Anziehung, der man nicht entgehen konnte.
Und dieser Typ schien das Gleiche zu denken, denn er spielte seine Präsenz mir gegenüber vollkommen aus. Coven küsste mich mit einem Hunger, der jedem hätte gelten können, und doch gab er mir das Gefühl, dass nur ich allein ihn stillen konnte.
Er verlangsamte den Kuss und verlieh ihm zeitgleich eine Tiefe, die mich meines Gleichgewichts beraubte. Scheiße, bekam ich gerade wirklich weiche Knie?
Nach einer viel zu kurzen Zeit, in der mein Körper genoss und mein Verstand dagegen rebellierte, löste Coven sich von mir.
Gleichzeitig verstärkte sich der Druck seiner Finger um meine Taille, eine unerträgliche Sanftheit, die es mir schwer machte, der Vernunft den Vortritt zu lassen.
Sein Atem strich zitternd über meine Haut. Ob vor Überraschung oder Erregung, konnte ich nicht sagen. Das Schlimmste daran war, dass es mir genauso ging. Jetzt bereute ich es fast, mich für den Kuss entschieden zu haben. Nicht, weil es mich kümmerte, einen Fremden zu küssen, sondern weil ich es noch einmal tun wollte. Wieder und wieder. Was war nur in mich gefahren?
»Ich dachte wirklich, du würdest dich für die Handynummer entscheiden«, raunte Coven. Allein diese Klangfarbe hätte einen Eigennamen verdient. Denn auch wenn er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, konnte ich die Begierde hören, die er zu verbergen versuchte.
»Falsch gedacht«, flüsterte ich und musste mich um die Festigkeit meiner Stimme bemühen, weil er mitten ins Schwarze getroffen hatte. Und weil ich ihm immer noch so nah war, dass ich das Knistern in der Luft um uns herum und an meinen Lippen spüren konnte. Ich musste Abstand zwischen uns bringen. So schnell wie möglich. »Für meine Handynummer braucht es mehr als einen Rettungsversuch.«
Damit drückte ich ihm sein Smartphone gegen die Brust und mich von ihm weg. Covens Blick glitt über mein Gesicht, von meinen Augen hinunter zu meinem Mund und zurück.
Distanz, Everleigh. Jetzt.
Weil er keinerlei Anstalten machte, mich loszulassen, verpasste ich Coven einen leichten Stoß, sodass er mich freigeben musste. Dabei ließ ich das Telefon fallen. Seine Hand schnellte nach oben und fing es reflexartig auf. Er selbst schien jedoch Mühe zu haben, zu verarbeiten, was gerade passiert war. »Du gibst mir deine Nummer nicht?«
Um mir etwas Zeit zu verschaffen, bückte ich mich nach meinem Rucksack und schob ihn mir einseitig über die Schulter. »Du hast ›oder‹ gesagt, nicht ›und‹.« Noch nie fiel es mir so schwer, mich von jemandem abzuwenden, wie in diesem Moment. Ich zog mein Skateboard aus dem Sand und klopfte dagegen, um auch hier die kleinen Körner zu entfernen. Dann betrat ich den gepflasterten Weg.
Ich wollte das Board gerade über den Boden schieben und losfahren, als mein Name durch die Luft schallte.
»Everleigh.« Coven hatte sich kein Stück vom Fleck bewegt, aber anscheinend hatte er sich wieder gefangen. Selbst über die Entfernung hinweg erkannte ich die unbeirrbare Herausforderung in seinen Augen. »Ich werde dich finden.«
»Träum weiter.« Trotz der Härte in meiner Stimme musste ich lächeln.
Ich meinte, ein »Das werde ich« von seinen Lippen lesen zu können, ehe ich das Board anschob und aufstieg. Die Brise kühlte meine erhitzten Wangen, während ich den Fuß auf den Asphalt stieß und mein Tempo erhöhte.
Erst als ich den Pfad erreichte, der zwischen den Felsen verborgen lag, stieg ich ab und zog meine Sneaker aus. Mit meinen Schuhen in der Hand und dem Skateboard unterm Arm lief ich den schmalen Weg hinunter. Mein Ziel tat sich gewaltig vor mir auf und ragte erhaben in die Höhe.
Das Holzschiff, das zur Eröffnung der ortsansässigen Werft als Symbol neben der Klippe platziert worde war, hatte seit Jahren keine Instandhaltungsmaßnahmen mehr gesehen. Aber es hielt auch niemand für nötig, es vom Strand zu entfernen.
Mit einem flüchtigen Blick über die Schulter vergewisserte ich mich, dass mich niemand beobachtete, obwohl ich hier noch nie jemanden angetroffen hatte. Dann tastete ich an dem Holz entlang, bis ich meine Finger unter eine Diele schieben konnte. Ich ruckelte kräftig daran und löste sie aus der Verankerung. Durch das Loch in der Flanke verschaffte ich mir Zutritt zum Bauch des Schiffes. Vor einigen Monaten hatte ich entdeckt, dass das Holz an dieser Stelle so beschädigt war, dass ich es problemlos hatte aushängen können.
Seitdem nutzte ich dieses Wrack als Rückzugsort. Eigentlich passend, wenn man bedachte, dass ich mich seit drei Jahren nicht mehr ins Meer wagte. Die Dielen knarrten unter meinem Gewicht, doch ich störte mich nicht daran. Im Gegenteil. Ich mochte dieses Geräusch. In gewisser Weise erzählte es eine Geschichte, der ich gern zuhörte.
Ich setzte mich in den Rumpf des Schiffes. Geschützt vor fremden Blicken hatte ich hier nicht nur meine Ruhe. Von diesem Platz aus konnte ich durch eine abgeschlagene Diele auch unentwegt auf den Ozean sehen. Von früh bis spät das Rauschen hören und die Gewalt der Wellen spüren, wenn sie gegen die Felsen brandeten.
Ich hatte den Pazifik direkt vor mir. Ein Anblick, an dem ich alles liebte – und den ich gleichzeitig nicht noch mehr hätte hassen können. Wie jedes Mal übermannte mich die Sehnsucht auch jetzt so stark, dass ich den Schmerz zwischen meinen Rippen fühlte.
Mein Puls beschleunigte sich. So schnell, dass meine Atmung flacher wurde und ich mich abwenden musste. Ich schloss die Augen. Versuchte, mich auf meinen Herzschlag zu konzentrieren, den ich viel zu deutlich in meiner Brust wahrnehmen konnte. Entscheidende Sekunden hatten sich darin verewigt, wie die Narbe auf meiner Haut. Eine Erinnerung an einen Moment, den ich nicht würde rückgängig machen können, egal wie sehr ich es mir wünschte. Ich hatte versucht, ihr die Macht über mich zu entziehen. Hatte versucht, wieder aufs Board zu steigen – und es bis heute nicht geschafft.
Langsam lehnte ich den Kopf zurück. Erst nachdem sich mein Puls beruhigt hatte, wagte ich es, die Augen zu öffnen. Aber ich traute mich kein weiteres Mal, auf das offene Meer zu schauen.
Dass ich es bei mir wusste, musste reichen.
Ich bückte mich nach meinem Rucksack, auf dem sich ein paar letzte Sandkörner hartnäckig hielten. Kurz erwischte ich mich dabei, wie sich mein Mundwinkel hob. Wie ich das warme Gefühl willkommen hieß, das mich durchströmte, als ich an den Typen dachte. Coven.
Ich wollte, sollte, durfte nicht an ihn denken. Nicht an seinen Kuss, der sich auf meine Lippen gebrannt hatte. Nicht an seine Berührung, die meine Haut versengt hatte, und auch nicht an diesen Blick, der den Schutzschild um mein Herz in Asche verwandeln könnte. Dennoch ließ ich es zu, um diese unerbittliche Furcht, die ich seit drei Jahren in mir trug, für ein paar Sekunden zu überdecken.
Mit einem lauten Ratschen des Reißverschlusses beendete ich den schwachen Moment, sein Gesicht löste sich auf. Zurück blieb mein Laptop, den ich aus der Tasche zog und auf meinem Schoß bettete. Anschließend angelte ich nach meinem Handy und öffnete einen Hotspot, durch den ich mein Notebook mit dem Internet verband. Ich durfte mich nicht ablenken lassen. In keiner Weise. Deshalb klickte ich auf den Browser, in dem das beendete Schachspiel noch geöffnet war. Auch die Anfrage von vorhin stand noch unbeantwortet auf dem Bildschirm. Trotzdem hielt nicht das meine Aufmerksamkeit, denn sie wanderte zu dem kleinen Brief-Symbol, das seine Farbe zwischen Weiß und Rot wechselte. Eine Nachricht?
Ich bewegte den Cursor auf das Symbol und klickte. Kurz darauf öffnete sich das Postfach. Ein Name stach mir ins Auge – Caissa.
Ich kannte diesen Accountnamen, hatte aber bisher noch nicht gegen sie gespielt. Caissa galt als die ungeschlagene Anführerin dieses Portals. Seit ich im Sommer mit dem Online-Schachspielen angefangen hatte, hatte sie kaum ein Spiel verloren. Ein paarmal hatte ich es geschafft, sie zu überholen, aber nie von Dauer. Caissa langfristig vom Thron zu stoßen, war nahezu unmöglich.
Kurzerhand öffnete ich ihre Nachricht. Ich wusste nicht, was ich erwartete. Ein einfaches Hallo oder eine andere Höflichkeitsfloskel sicher nicht, aber das hier … Damit hatte ich nun gar nicht gerechnet.
Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest auserkoren, es mit der Göttin des Schachs aufnehmen zu dürfen.
Mehr stand dort nicht. Irritiert starrte ich auf ihre Worte und fragte mich, was sie damit meinte. War das ihre Art, mich herauszufordern? Dann hätte sie mir auch einfach eine Anfrage schicken können.
Meine Aufmerksamkeit glitt zu der Summe, die ich mir bisher erspielt hatte. Knapp viertausend Dollar. Eigentlich spielte ich nur gegen Rangniedrigere, um die größtmögliche Chance zu haben, meinen Einsatz zu summieren. Nur dafür loggte ich mich täglich auf diesem Portal im Darknet ein und nicht, um einen Platz auf irgendeiner virtuellen Rangliste zu erlangen.
Als wäre Caissa das Warten leid, erschien eine zweite Nachricht. Dieses Mal mit einem Link.
Ich musste ein Schnauben unterdrücken. Glaubte sie wirklich, dass ich naiv auf irgendeinen Link klickte, der mir von einer Wildfremden zugesandt wurde?
Ohne ihr zu antworten, schloss ich das Nachrichtenfenster.
Ganz sicher nicht.
Kapitel 3
Coven
Wind peitschte mir ins Gesicht und zerrte an meinem Körper. Die Arme zu den Seiten ausgestreckt, versuchte ich, die Balance zu halten. Ein ohrenbetäubendes Rauschen sprengte meinen Hörsinn, der Geschmack des Meeres dominierte meine Zunge.
Das Gefühl von Freiheit beherrschte mich.
Konzentriert navigierte ich das Board die Welle entlang. Unter meinen Sohlen spürte ich den Druck, mit dem mich das Wasser Richtung Ufer trug. Fort aus dem Ozean und hin zum Land, nur damit ich auf die nächste Böe warten konnte, die das Meer in Bewegung versetzte. Ich verlagerte mein Gewicht und riss das Board hoch, um mich gegen den Widerstand zu behaupten. Der gewaltigen Kraft zu entkommen, die mich zu überwältigen drohte. Wieder. Und wieder.
Das Meer als einen Gegner anzusehen, hatte ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Vielmehr sah ich darin einen Freund, der einen ständig herausforderte. Ein Freund, der einen, egal wie viel Zeit auch verstrich, mit offenen Armen empfing. Wie aufs Stichwort türmte sich die Welle auf und verschluckte mich in einem Tunnel, in dem nur mein Fokus existierte. Für diesen einen Moment sperrte die Macht des Meeres all das aus, was mich damals von hier vertrieben und mich jetzt an diesen Ort zurückgeführt hatte. Nach Blackcoast Bay, an die schwarze Küste Kaliforniens. Eine Heimat, die keine mehr war.
Weil ich sie verloren hatte.
Doch irgendwann führte jedes offene Ende unwiederbringlich zum Anfang zurück. Nach mehr als zehn Jahren in diese Stadt zurückzuziehen, fühlte sich trotzdem so an, als wäre ich nie weg gewesen. Als hätte sich nichts verändert, obwohl sich alles verändert hatte.
Abwesend näherte ich mich der salzigen Wasserwand, wollte mit der Fingerspitze durch sie hindurchfahren und die Kraft hinter den Massen spüren. Doch das konnte ich auch, ohne sie zu berühren. Ein Vibrieren unter meinen Füßen warnte mich vor. Die Welle lief aus, ich befand mich mittendrin. Deshalb duckte ich mich tiefer, schaffte so ein höheres Tempo und fand aus ihr heraus, bevor sie mich mit sich reißen konnte. Ich beendete einen Ritt lieber gewollt.
Kurzerhand stieß ich mich ab und sprang vom Board. Wasser schlug über mir zusammen, drückte mich in die Tiefe, die mich in einer eisernen Umarmung empfing. Ruhe breitete sich in mir aus, während die unsichtbare Kraft an meinem Körper zerrte.
Zwei Sekunden lang genoss ich das Gefühl der Schwerelosigkeit. Hörte meinem Herzschlag zu, der sich dem Takt des Ozeans anpasste. Dann holte ich Schwung und tauchte mit zwei kräftigen Schwimmzügen auf, ehe ich die Oberfläche durchbrach. Sauerstoff füllte meine Lunge. Doch noch während ich Luft holte, sah ich mich um. Die nächste Welle dieses Sets schob sich unbarmherzig auf mich zu. Im sich auflösenden Schatten der Nacht wirkte sie wie eine Wand, die mich gnadenlos unter sich begraben würde. Ich kraulte dem Board entgegen, das mit einem Leash an meinem Fuß befestigt war, und hievte mich hoch.
Ein kurzer Blick über die Schulter genügte, um zu wissen, dass ich mich beeilen musste. Ich paddelte los. Die Welle erfasste mich. Ich paddelte schneller – und stand auf. Das Gefühl, sich von einer Welle tragen zu lassen, war unbeschreiblich. Dennoch kam das Jetzt nicht an die Erinnerung heran, die ich mit diesem Spot verband.
Ich hatte die Veränderung dieses Küstenabschnitts sofort bemerkt, sie gesehen. Zehn Jahre konnten nicht spurlos an einem Ort vorbeigehen, der das Meer mit dem Land verband – die Brandung hatte ihn verändert. Während der Ozean die rechte Seite des Strands weggerissen hatte, hatte er auf der linken Seite einen ganzen Abschnitt angespült. Eine lange, aufgewühlte Sandbank umgab das alte Schiffswrack.
Eine letzte Welle vor dem untergehenden Schiff.
Obwohl es brachlag, symbolisierte es die Bay. Ein Überbleibsel der hinter den Felsformationen liegenden Werft, die vor Kurzem bankrottgegangen war. Was für eine Ironie, wenn man bedachte, dass sie dieser Stadt zum Aufschwung verholfen hatte. Während ich dieses Symbol betrachtete, flutete ein Bild mein Gedächtnis.
Sophia und ich. Vor diesem Schiff sitzend, weil Piraten sie schon immer fasziniert hatten. Ich hatte ihr zugehört, weil sie mich fasziniert hatte. Obwohl das ebenfalls Jahre zurücklag, hatte sich an diesem Empfinden nichts geändert. Ich nahm es nur anders wahr. Was früher unerträglichen Schmerz bedeutet hatte, glich jetzt nur noch einem stetig dumpfen Pochen.
Eine gebrochene Welle bahnte sich ihren Weg zum Wrack, und obwohl sie es nicht erreichte, spülte sie das Bild meines Unterbewusstseins fort. Zurück blieb nichts als eine Erinnerung, die ich in meinem Herzen trug.
Plötzlich riss mich etwas von den Füßen. So schnell, dass ich nicht reagieren konnte. Ich verlor den Halt, fiel vom Board und tauchte ins Wasser, das wütend über mir zusammenschlug.
Das passierte, wenn man nicht aufpasste und das Warnzeichen des Ozeans überhörte. Leichtsinn hatte Konsequenzen. Ich durchbrach die Oberfläche und schob mir das Haar aus dem Gesicht. Meine Atmung ging schwer, mein Herz pumpte das Blut durch meine Adern. Doch meine Aufmerksamkeit … Die wanderte gen Himmel. Zum Horizont, der sich rötlich zu färben begann.
Es wurde Zeit.
Mit dem Board unterm Arm stieg ich aus dem Wasser. Meine Zehen versanken im nassen Sand, ein Widerstand, der nachließ, je weiter ich über den Strand lief. Die Brise an diesem Morgen war schon so warm, dass sie meine Haut trocknete. Nur das Salz, das ich an meinen Lippen schmecken konnte, blieb an mir haften.
Ich stellte das Board auf die Leihfläche zurück, von der ich es mir vorhin genommen hatte. Früher hatte ich davon nie Gebrauch machen müssen, im Moment hatte ich keine andere Wahl. Der einzige Zeitraum, der mir in den kommenden Wochen zum Surfen bleiben würde, belief sich auf den Schutz der Dunkelheit, wenn alle anderen schliefen. Sich dafür ein Board zu kaufen, wäre pure Verschwendung.
Wie aufs Stichwort vernahm ich in der Ferne einen Motor. Kurz darauf erkannte ich einige Gestalten, die sich dem Strand näherten, begleitet von einem Stimmengewirr, das in Jubel umschlug, als sie über den Sand rannten.
Ich verstand diese Begeisterung. Damals hatte ich dasselbe empfunden. Obwohl ich den jungen Menschen noch eine Weile hätte zusehen können, stieg ich in meine Sneaker und streifte mir mein Shirt über, das ich vorhin achtlos auf den Stein hatte fallen lassen.
Dann joggte ich los.
Ich lief die Promenade entlang, vorbei an der Stelle, an der mich vor knapp vierundzwanzig Stunden jemand umgefahren hatte. Schon erwischte ich mich dabei, wie ich auf das energische Rollen ihres Skateboards lauschte. Wie ich auf den Aufprall wartete, der ausblieb. Wie ich zum Sand sah, wo sich Schmerz mit Überraschung vermischt hatte, weil sich alles an diesem Sturz richtig angefühlt hatte.
Selten hatte es jemand geschafft, mich umzuhauen. Die Frau mit den himmelblauen Augen hatte es gleich in doppelter Hinsicht getan.
Everleigh.
Ich schmeckte ihren Namen auf der Zunge. Sie hatte genauso gerochen – nach Salz und Meer, vermischt mit Lavendel. Nach einer frischen Brise an einem herrlichen Sommertag. Mit jedem Schritt ließ ich den Strand hinter mir. Während die aufsteigende Sonne die Dämmerung vertrieb, erwachte Blackcoast Bay aus dem Schlaf. Je näher ich dem Kern der Stadt kam, desto voller wurde es auf den Straßen, vor den kleinen Lädchen der Hauptstraße und in den Cafés.
Ich brauchte ungefähr zehn Minuten, bis ich meinen Wohnkomplex sehen konnte. Noch während ich mich auslief, entdeckte ich eine hochgewachsene Gestalt, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem schwarzen SUV lehnte.
Ronan hatte ein Bein angewinkelt und fixierte mich mit verschlossener Miene, in der ich deutete, dass er dort schon länger stand und auf mich wartete.
»Hätte ich mir denken können«, sagte er statt einer Begrüßung. Das abfällige Schnauben dichtete ich gedanklich dazu.
»Hey.« Ich fuhr mir durch das Haar, das ich wegen des Meersalzes kaum bändigen konnte. Die letzten Jahre hatte ich diese Frisur gern getragen. Jetzt war ich mir nicht mehr sicher, ob ich sie noch länger tragen sollte. »Hast du geklingelt?«
»Kein Licht in der Wohnung und du nicht in Sicht.«
Da kannte mich jemand besser, als mir lieb war. »Gib mir zehn Minuten.«
»Wir haben Zeit.« Ronan gehörte zu den Menschen, die konsequent eine halbe Stunde vor der eigentlich verabredeten Uhrzeit auftauchten. Er rieb einem seine Überpünktlichkeit aber nie unter die Nase. Im Gegenteil. Ronan blieb gelassen und beschwerte sich nicht, wenn er auf andere warten musste.
»Hey, Ronny.« Wenn sein Ausdruck vorher schon düster gewesen war, wandelte er sich nun zu einem schwarzen Loch. »Du wärst der perfekte Familienvater. Das ist dir klar, oder?«
Die Art, wie Ronan die Mundwinkel verzog, brachte mich zum Grinsen. »Sei still und pass auf, dass ich dich nicht gleich überfahre.«
Das schafft nur eine Person. »Bis gleich.« »Und bitte«, hielt Ronan mich auf und musterte mich von Kopf bis Fuß, so beherrscht, wie ich ihn kannte, »zieh dir etwas Anständiges an.«
»Alles klar, Dad.« Mit seinen vierunddreißig Jahren war er nur zwei Jahre älter als ich. Trotzdem – oder gerade deswegen – zog ich ihn mit dieser Tatsache auf, die zu ihm gehörte wie er zu mir. Seit Jahren wich Ronan mir nicht von der Seite, obwohl er, wie ich vermutete, manchmal nichts lieber tun würde als das. Aber er hatte sich für dieses Los entschieden. Dasselbe Los, das ich gezogen hatte.
»Ich melde gleich einen Unfall.« Unter Ronans Brummen mischte sich das Aufschnappen eines Feuerzeugs, mit dem er sich eine Zigarette anzündete, während ich mich zur Tür wandte. Zwei Stufen auf einmal nehmend, lief ich hoch in meine Wohnung. Eine kleine Einzimmerwohnung mit angrenzender Küche und einem Bad, das gerade groß genug war, um sich einmal um die eigene Achse drehen zu können. Aber es reichte. Je weniger ich besaß, desto mehr konnte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich trat mir die Sneaker von den Füßen und zog mir im Gehen das Shirt über den Kopf.
Binnen weniger Minuten wusch ich mir den Sand aus den Haaren, das Salz von der Haut und die Unbeschwertheit aus dem Herzen.
Mit feuchtem, aber zusammengebundenem Haar und in frischen Klamotten stand ich in der Mitte des Raums und krempelte die Ärmel meines Hemdes hoch. Schon jetzt fühlte ich mich darin nicht wohl. Das hier war nicht ich. Trotzdem griff ich nach meiner Ledertasche und verließ die Wohnung, ohne mich ein letztes Mal im Spiegel anzusehen.
Ronan erwartete mich wie ein Personenschützer vor der Tür, die Zigarette – vielleicht sogar bereits die zweite – klemmte zwischen seinen Lippen. Als er mich entdeckte, nahm er einen letzten Zug, ehe er den Glimmstängel zu Boden warf und ihn austrat.
»Vorsicht, sonst erwischen dich die Cops.« Beinahe dachte ich, Ronans Züge mit diesem Kommentar tatsächlich erweicht zu haben. Fehlanzeige. Er blieb so ausdruckslos wie immer. Deswegen breitete ich die Arme aus und präsentierte ihm meine Jeans-Hemd-Kombi. »Anständig genug?«
»Du machst den Schnöseln aus meiner Studienzeit ziemlich Konkurrenz.« Damit stiefelte Ronan zurück zu seinem Auto und stieg ein. Ich folgte ihm und war froh, dass die Scheiben getönt waren und niemand ins Wageninnere sehen konnte.
Ohne ein weiteres Wort startete Ronan den Motor. Statt die Fahrt mit Small Talk zu überbrücken, verfielen wir in einvernehmliches Schweigen. Still dankte ich Ronan, dass er nichts sagte. Denn je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr wuchs meine Anspannung.
Dafür bestand keinerlei Grund, das wusste ich. Manchmal half jedoch noch nicht einmal das, um die Nervosität im Zaum zu halten. Schließlich hatte ich von Anfang an gewusst, worauf ich mich einließ, wenn ich diesem Deal zustimmte. Die letzten Monate hatte ich mich so intensiv hierauf vorbereitet, dass praktisch nichts anderes mehr für mich existierte.
Ich bekam nicht mit, dass der Wagen hielt. Erst als ich das Gebäude durch das Fenster sehen konnte, wurde ich mir des fehlenden Motorengeräusches bewusst.
»Hey, Leonard.«
Langsam drehte ich den Kopf, um Ronan finster anzusehen. Es sollte mich wundern, dass er es wirklich wagte, mich so anzusprechen. Tat es aber nicht. Die unerwartete Sorge, die sich auf seinen Zügen zeigte, überraschte mich dafür umso mehr. Ronan offenbarte seine Gedanken nie, geschweige denn seine Gefühle. Dass er es jetzt tat, traf mich wie ein Hieb. Einige Sekunden sahen wir einander schweigend an, und das machte mir die Ernsthaftigkeit bewusst.
»Wenn irgendetwas sein sollte«, Ronan wies auf sein Telefon, das in der Mittelkonsole lag, »zögere nicht, mich anzurufen. Ich bin erreichbar. Jederzeit.« Das letzte Wort fügte er leiser, aber nicht weniger eindringlich hinzu.
Ich nickte bedächtig. »Danke.«
Seine Aufmerksamkeit verlagerte sich auf die Geschehnisse hinter mir auf dem Gehweg, woraufhin ich seinem Blick folgte. Der Campus der Blackcoast Bay University füllte sich langsam, der Tag hatte gerade erst begonnen. Dennoch erkannte ich bereits jetzt einige Freshmen, die sich erst einmal zurechtfinden mussten. Ich erinnerte mich an die Zeiten zurück, in denen ich die Einführungswoche getrost ausgelassen hatte, so wie es alle Studierenden der höheren Semester taten. Jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als diese Woche anzutreten und sie hinter mich zu bringen.
»Bist du so weit?«
Ich erlaubte mir, einen Moment über diese Frage nachzudenken. Aber die Antwort kannte ich bereits. Seit ein paar Wochen konnte ich guten Gewissens sagen: »Ja. Ich bin so weit.«
Kapitel 4
Neyla
Schwarz und weiß.
Jedes Mal, wenn ich auf dem Campus auf der Bank vor dem überdimensional großen Schachbrett saß, fragte ich mich, wieso gerade diese beiden Farben in diesem Spiel existierten. Wenn man es genau nahm, handelte es sich dabei noch nicht einmal wirklich um Farben, sondern um Nicht-Farben. Zwei Extreme, die durch unzählige Graustufen miteinander verbunden waren.
Die menschengroßen Figuren ragten majestätisch auf dem Feld auf. Seit ich an der Blackcoast Bay University Gesundheitswissenschaften studierte, hatte ich noch nie jemanden dieses Spielfeld nutzen sehen. Zu keinem Zeitpunkt. Die Figuren blieben unbewegt in der Startaufstellung, wartend, dass sich endlich jemand dazu durchrang, den ersten Zug zu wagen.
Ich senkte den Blick auf mein Handy, als es vibrierte. Eine App-Benachrichtigung. Bevor ich die Worte allerdings entziffern konnte, erklang eine dunkle Stimme ganz in meiner Nähe. »Da ist ja mein Lieblingszwilling!«
Und sie kam geradewegs auf mich zu.
Schnell drückte ich das Display an meinen Bauch. Keine Sekunde zu spät.
Ein Ruck fuhr durch meinen Körper, als Tiziano sich neben mich auf die Bank fallen ließ und einen Arm um meine Schultern legte. Bevor ich jedoch die Möglichkeit hatte, mich ihm zuzuwenden, flüsterte er in einem warmen Timbre an meinem Ohr: »Aber verrate es nicht deiner Schwester.«
Ich musste lachen. »Du sagst ihr ständig dasselbe.«
»Hm.« Tiziano drückte mich fester an sich, indem er meinen Kopf umfasste. »Stimmt. Aber bei dir meine ich es auch so.«
»Spinner.« Ich verpasste ihm einen spielerischen Klaps, der ihm keinesfalls wehtun konnte. Dennoch quittierte Tiziano ihn mit einem so lauten Jaulen, dass er damit die Aufmerksamkeit vorbeilaufender Studierender auf sich zog. So schnell er sich eben noch zu mir gesetzt hatte, so schnell riss er sich von mir los, nur um sich die Hände theatralisch vor die Brust zu schlagen und den Kopf in den Nacken zu werfen.
»Ich schütte dir mein Herz aus und du hast nichts Besseres zu tun, als darauf herumzutrampeln wie auf einem Häufchen Sand!«
»Ein Häufchen Sand«, wiederholte ich und musste mein Schmunzeln unterdrücken, während ich unbewusst etwas tiefer rutschte. »Das tritt sich auch irgendwann fest.«
»Aber der Weg dahin schmerzt!« Manchmal nahm Tiziano sein Studium in Theater und Schauspiel so ernst, dass er die anderen um sich herum völlig ausblendete – oder sie in seine Show einbezog, wie zum Beispiel jetzt. Während er es liebte, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, fühlte ich mich nicht wohl dabei, auch nur in die Nähe des Scheinwerferlichts zu kommen und das Interesse anderer auf mir zu wissen. Dafür war die Aufmerksamkeit, die ich dank meines nicht ganz so starken Herzens bereits erhielt, zu groß.
Tiziano schien meine Anspannung zu bemerken, denn er lehnte sich zurück und musterte mich von der Seite. »Was geht ab, Twinny? Erzähl mir den neuesten Tratsch.«
»Du weißt ganz genau, dass ich so etwas nicht mache.« Und vor allen Dingen nicht mochte. Schließlich wusste man nie, was man anderen damit antat, wenn man etwas erzählte, das man nur vom Hörensagen kannte.
»War einen Versuch wert.« Tiziano stupste mir auffordernd gegen die Wange, als versuchte er so, sein eigenes Lächeln auf meine Lippen zu duplizieren. Mit seinem schwarz gelockten Haar und dem strahlenden Lächeln, das zwei Grübchen auf seine Wangen zeichnete, personifizierte Tiziano den Inbegriff von italienischer Attraktivität. Dessen war er sich durchaus bewusst, denn er scheute nicht davor zurück, dieses Wissen einzusetzen. Leider hatte ich mich einmal zu oft von seinem offenen Charme treffen lassen, wodurch die Mauer, die ich aufgrund meiner Vorgeschichte so sorgsam um mein Herz errichtet hatte, langsam, aber stetig unter seinen immerwährenden Angriffen bröckelte. Ich wusste nicht, was er damit bezwecken wollte. Ich wusste nur, dass es mir nicht guttat, obwohl er mir guttat.
Machte das überhaupt Sinn?
Als könne er mir meinen Zwiespalt vom Gesicht ablesen, schnellten seine Brauen erwartungsvoll nach oben, ein Funkeln durchbrach seine wolkengrauen Augen.
Ich wandte mich ab.
Tiziano und ich waren Freunde, seit wir zusammen im Sandkasten gespielt hatten. Genau wie ich hatte er ein Jahr in der Highschool wiederholt. Während mir eine Operation samt Nachbehandlung keine andere Wahl gelassen hatte, als eine Ehrenrunde zu drehen, ließ mich der Gedanke nicht los, dass Tiziano sich freiwillig dazu entschieden hatte. Immerhin hätte er einfach nur lernen müssen, um seine Klausuren zu bestehen.
Eine leichte Berührung an meinem Kinn zwang mich dazu, meinem besten Freund wieder in die Augen zu sehen.
»Sag mir, was du denkst, Stellina«, forderte er mich auf, nun leiser als zuvor. Jedes Mal, wenn er mich mit diesem Spitznamen ansprach, bröckelte die Fassade ein Stück mehr. Mein Herz pumpte aufgeregt, als stemmte es sich von der geschützten Seite ebenso gegen die Mauer, mit der ich so vehement andere Einflüsse auszusperren versuchte. Oder Tizianos. Doch der erste Stein fiel, als seine Augen für einen Sekundenbruchteil an meinen Lippen hängenblieben. Ein zweiter, als ich die Unsicherheit erkannte, die über sein Gesicht huschte. »Habe ich etwas verpasst?«, ertönte eine zögernde, aber nicht verwundert klingende Stimme, die mir einen Schock durch die Adern jagte.
Ich zuckte zurück, Tizianos Hand schwebte weiter in der Luft. Schnell sah ich hoch. Everleigh stand vor mir und durchbohrte mich mit ihrem Blick. Als wäre ich ein offenes Buch, das sie schon tausendmal gelesen hatte und es leid geworden war.
Ich öffnete den Mund, doch die Enge in meinem Hals hinderte mich daran, auch nur eine Silbe klar auszusprechen. Nicht jetzt. Nicht, nachdem –
»Was geht ab, Sonnenschein?« Tiziano bettete seinen Knöchel auf sein Knie und saß mit provokanter Lässigkeit neben mir. Entweder hatte er sich schneller wieder gefangen als ich oder ihm hatte es schlichtweg nichts ausgemacht. Diese … Nähe.
»Nenn mich noch einmal Sonnenschein und du wirst die nächsten zwei Tage keinen mehr sehen.«