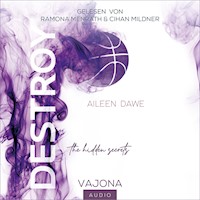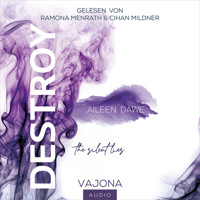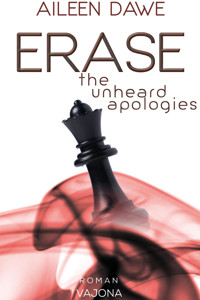9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJONA Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Kurz vor seiner Verhaftung hatte Papá dafür gesorgt, dass ich starb.« Hunt or be hunted. Lovia Benson weiß, wie es sich anfühlt, auf der Flucht zu sein. Obwohl sie seit Jahren mit einer neuen Identität lebt, hält sie an ihrer Vergangenheit fest und setzt alles daran, den letzten Auftrag ihres Vaters zu erfüllen: herauszufinden, wer ihn ins Gefängnis gebracht hat. Lovias einziger Hinweis führt sie nach Silverlake Cliff. Dort treibt eine Streetgang ihr Unwesen – zu der Penley Montgomery gehört, der so versucht, sich vom Namen seiner Eltern zu lösen. Doch als er auf Lovia trifft und ihr näherkommt, gerät sie in die Schusslinie der Gang. Nun weiß sie nicht mehr, ob sie die Jägerin ist, oder doch die Gejagte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aileen Dawe
FEAR the unseen memories
FEAR THE UNSEEN MEMORIES
© 2025 VAJONA Verlag GmbH
Lektorat: Michelle Markau
Korrektorat: Michelle Abt
Umschlaggestaltung: VAJONA Verlag GmbH
Satz: VAJONA Verlag GmbH,
unter Verwendung von Canva
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
ISBN: 978-3-9871836-9-0
Für all diejenigen, die vor etwas oder jemandem weglaufen.
Bleibt stehen. Dreht euch um.
Denn nur wer seinen Ängsten ins Gesicht sieht,
kann sie bezwingen.
Ein beißender Geruch lag in der Luft. Einer, der in eine Stadt wie diese gehörte, aber nicht an diesen Ort. Nicht in diesem Ausmaß. Nicht in dieses Haus.
Es roch nach Benzin.
Der penetrante Geruch drang so intensiv durch die Maske, dass ich versucht war, durch den Mund zu atmen. Aber selbst das wäre zu laut. Eine Ablenkung, die ich nicht zulassen durfte.
Ich genoss die Stille. Ich brauchte die Stille, weil sie mich in Sicherheit wiegte. Noch nicht einmal die Dunkelheit der Nacht bot mir den Schutz, den ich in der Lautlosigkeit fand. Ich wollte keine Musik hören. Keine Stimmen und kein Leben. Nur meine Schritte, mit denen ich eine Fährte zog und sie sofort mit der Flüssigkeit überdeckte. Mit Bedacht neigte ich den Kanister und lief langsam rückwärts. Jeder Handgriff saß, doch mein gnadenloser Herzschlag strafte dieser Präzision Lügen. Das, was ich Gewissen nannte, pochte in einem unregelmäßigen Rhythmus gegen meine Rippen. Obwohl ich dieses Szenario wiederholt durchgespielt hatte, lief nichts wie geplant. Alles war durcheinander.
Ich war durcheinander.
Aber damit musste ich leben. Ebenso mit der Konsequenz, die diese Entscheidung mit sich brachte.
In einem lautlosen Fluss kroch sie auf mich zu. Erinnerte mich daran, was ich bereit war, zu tun, und sickerte langsam in das Holz. Zäh, bedrohlich und nicht zu übersehen. Doch selbst diese Spur blieb nicht von Dauer.
Manchmal gewinnt man die Kontrolle nur dann zurück, wenn man sie abgibt. An etwas, das man nicht kontrollieren kann.
Langsam holte ich das Feuerzeug aus meiner Tasche. Es schimmerte silbern im Licht des Mondes, der mich, umgeben von unzähligen Sternen, verhöhnte. Ein schmaler Grat zwischen Treue und Abtrünnigkeit. Selbst durch das Leder, das meine Hände schützte, fühlte ich das kühle Metall; eine letzte Mahnung, diesen Entschluss zu überdenken. Ein unnötiges Hinauszögern einer Tatsache, die ich nicht ändern konnte oder wollte. Das Feuerzeug schnappte auf. Ich starrte auf die kleine Flamme, gebändigt und gefährlich zugleich.
Für meine Zukunft war das vielleicht ein Fehler, doch für diesen Moment die einzig richtige Entscheidung.
Deshalb warf ich das Zippo von mir. Metall rutschte über Stein, das Geräusch verlief in erdrückender Stille. Dann ertönte ein Zischen, das wie eine Warnung durch die Luft schallte. Ein einziger Kuss der Flamme reichte – und sie steckte die Flüssigkeit in Brand. Wie gleißender Nebel tanzte sie über den Asphalt, bahnte sich hungrig einen Weg bis zur Treppe, hoch auf die Veranda. Eine Spur, die ich gelegt hatte und die niemand zurückverfolgen könnte. Flammen leckten über das Holz, das sich knackend zu wehren versuchte.
Es hatte keine Chance. Feuer gab niemandem eine Chance. Es löschte aus.
Ich war niemand, der Spuren hinterließ.
Ich war jemand, der sie vernichtete. Ein ständiges Zerwürfnis zwischen Verewigen und Vergessen, weil etwas mit Feuer zu beseitigen, der eine Widerspruch war, der mein Leben bestimmte.
Doch von jetzt an würde ich mich nicht mehr verstecken.
Ich werde dich jagen.
Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Lovia
Geschwungene Linien, die in scharfen Kanten endeten, nur um in eine nächste Rundung überzugehen. Ein typisches Graffiti, das sich einmal quer über das Glas zog, hinter dem sich eine Stadtkarte von Silverlake Cliff befand. Die Stimmen der vielen Menschen dröhnten so wild durcheinander, dass sie sich zu einem wirren Summen vermischten. Ein Wunder, dass mir noch niemand auf die Füße getreten war, so wie ich mitten auf dem Bahnsteig auf meiner Tasche hockte. Immer wieder verdeckten vorbeilaufende Menschen meine Sicht, weshalb ich mehrere Anläufe gebraucht hatte, um den Schriftzug zu entziffern.Bonded. Gebunden.
Fragte sich nur, an was. Oder an wen.
Langsam drehte ich den Lolli zwischen meinen Lippen, der den Geschmack von fruchtiger Kirsche auf meiner Zunge hinterließ. Dabei wanderte meine Aufmerksamkeit zu einem Typen, der keine paar Meter von mir an einer Säule lehnte. Anscheinend gefiel ihm die Vorstellung, die ich ihm bot. Oder das Bild, das er sich von mir gemacht hatte, wie auch immer das aussah. Dass er sich eins gemacht hatte, war sonnenklar, sonst würde sein Augenmerk nicht ständig auf meinen Mund fallen und dort eine Sekunde länger verweilen als nötig. Ich machte mir keine Illusion, dass er mit seinem Starren unschuldige Absichten hegte.
Demonstrativ ließ ich den Lolli zwischen meinen Lippen verschwinden, ohne den Typen aus den Augen zu lassen. Jedem anderen wäre die Regung in seinem Gesicht vermutlich nicht aufgefallen, mir blieb die Bedeutung dahinter jedoch nicht verborgen. Weil ich ihn genauso beobachtete wie er mich.
Selbst zwischen all den Leuten stach sein feuerrotes Haar hervor, seine Haut bildete einen hellen Kontrast zu seiner dunklen Kleidung. Die scharfgeschnittenen Züge verliehen seinem Blick zusätzliche Intensität. Mit seinem Auftreten ließ er einem eigentlich keine Wahl, als ihn anzuschauen. Dieser Typ sah gut aus – und das wusste er. Er trug diese Arroganz mit einer Lässigkeit, die ihn auf gewisse Weise schon wieder anziehend machte.
Ich wandte den Blick ab und drehte den weißen Stiel, um den Geschmack auf meiner Zunge aufzufrischen. Mich in Geduld zu üben, passte eigentlich nicht zu mir, aber manchmal blieb auch mir nichts anderes übrig.
Schon bevor ich in Illinois aufgebrochen war, hatte ich gewusst, dass ich mehrere Tage unterwegs sein würde. Ich war nach Georgia geflogen, von dort mit einem Mietwagen nach South Carolina gefahren, um meinen Flug nach New York City zu erreichen. Eine Großstadt, von der ich nie mehr gesehen hatte als die Skyline, die von meinem Abteil im Zug aus immer kleiner geworden war. Bis ich ihr ganz den Rücken zugekehrt hatte.
Jetzt saß ich am Bahnhof von Silverlake Cliff, einer Vorstadt von Boston, Massachusetts. Ein Ort, dem ich nie eine große Bedeutung zugeschrieben hatte und der jetzt mein einziger Hinweis war. Von Illinois hätte ich direkt nach Boston fliegen können, statt einen so umständlichen Umweg auf mich zu nehmen, den niemand freiwillig in Kauf nehmen würde.
Niemand, außer mir. Eine notwendige Maßnahme, um Spuren zu verwischen und neue zu schaffen, so wie Papá es immer getan hatte.
Papá.
Jeder Gedanke an ihn erhöhte die Last auf meinen Schultern. Einen zitternden Atemzug lang ließ ich den Schmerz zu. Zwang mich im selbigen, die Augen nicht zu schließen, damit das Netz, das ich um mich gesponnen hatte, nicht zerriss, als wäre es nichts weiter als ein Stück Seidenpapier. Mehrere schmerzhafte Herzschläge vergingen, bis ich die Trauer eingezäunt und die Tür geschlossen hatte, hinter der ich sie wegsperrte.
Gerade in dieser Stadt musste ich aufpassen, mich nicht zu verraten.
Eine weibliche, etwas verzerrte Stimme drang durch die Lautsprecheranlage und verkündete, dass der Zug in Richtung Philadelphia gleich einfahren würde. Dankbar stand ich auf und musste die Schwerfälligkeit abschütteln, die das lange Sitzen auf einem nicht gerade bequemen Untergrund verursacht hatte. Erst dann griff ich nach meiner Tasche und warf sie mir locker über die Schulter. Darin befand sich alles, was ich besaß. Nicht viel, aber es reichte, um zu überleben.
Der einzige Zweck, den mein Leben hatte. Ein Kampf ums Überleben.
»Anscheinend haben wir das gleiche Ziel«, ertönte eine männliche Stimme hinter mir. Kurz darauf trat die dazugehörige Person in mein Sichtfeld. Ich brauchte ihn nicht anzusehen, um zu wissen, dass es sich um den Typen handelte, dessen Blick an mir haftete wie Klebstoff. Der Klang seiner Stimme passte zu seinem Erscheinungsbild. Er strotzte vor Selbstbewusstsein und einer Härte, die sich in seiner Haltung widerspiegelte.
»Hm«, machte ich nur und nahm den Lolli aus dem Mund, um besser reden und ihn einschätzen zu können. Wie zu erwarten, lenkte ihn das erneut ab. »Manche würden behaupten, es wäre Schicksal.«
Das entlockte ihm ein leises Lachen. »Ich glaube nicht an Schicksal.«
Ich auch nicht.
Aber das sagte ich nicht. Bisher hatte jeder, dem ich verraten hatte, woran ich wirklich glaubte, mich nur belächelt – dass jede Entscheidung, die man traf, auf reiner Manipulation basierte. Nichts entstand aus freiem Willen, auch wenn ich mit dieser Überzeugung allein lebte.
Hinter dem Typen tauchten die mächtigen Umrisse des Steuerwagens auf, der sich wie eine Wand auf uns zuschob. Ihn schien das jedoch nicht zu interessieren, die Süßigkeit in meiner Hand dafür umso mehr. »Sind diese Teile nicht für Kinder gedacht?«
»Sehe ich etwa aus wie ein Kind?« Natürlich wusste ich, dass man eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten sollte. Ich tat es trotzdem und bekam genau das, was ich mir erhoffte – ein vielversprechendes Lächeln, das mir Rede und Antwort stand.
Bevor der Typ etwas erwidern konnte, kreischten die Bremsen des Zuges und verschluckten jeden Versuch, irgendein schamloses Kompliment zwischen uns zu werfen. Die wenigen Worte, die wir miteinander gewechselt hatten, reichten bereits aus. Ich wusste alles, was ich wissen musste.
Die Bahn kam zum Stehen, direkt vor mir eine Doppeltür. Dahinter erkannte ich mehrere Augenpaare, einige davon entspannt, andere wiederum wirkten selbst durch die verglaste Barriere gehetzt.
Die Tür schwang auf, die ersten Passagiere strömten auf den Bahnsteig. Ich machte einen Schritt zur Seite, um den Fahrgästen Platz zu machen. Zwischen mehreren Gestalten erhaschte ich immer wieder einen Blick auf den Typen, der mich unentwegt beobachtete.
Alles an ihm strahlte ein Selbstbewusstsein aus, von dem sich jeder Zweite im Umkreis von mehreren Metern etwas hätte abschneiden können. Aufgrund seines unverhohlenen Interesses hoffte ich, dass er ohne Umschweife einsteigen würde. Was ich nicht erwartet hatte, war die ausladende Handbewegung, mit der er mir den Vortritt ließ.
Immerhin schien er ein Idiot mit Anstand zu sein.
Ich hob einen Mundwinkel. »Ich stehe nicht auf Gentleman-Manier.«
»Nicht?« Der Typ machte einen Schritt auf mich zu, sodass mich ein Hauch seines Aftershaves erreichte. Sogar sein Geruch passte zu ihm.
»Süßigkeiten sind verlockend.« Ich betrachtete den Lolli in meiner Hand. Der Schimmer wirkte selbst auf mich anziehend, obwohl ich den Geschmack bereits kannte. »Aber nur, solange man sie nicht haben kann.«
Der Typ verstand den Wink mit dem Zaunpfahl. Obwohl ich ihn nicht direkt ansah, konnte ich die unverfrorene Boshaftigkeit ausmachen, die von ihm Besitz ergriff. Fast hätte ich ihn darauf angesprochen, aber eine weitere Ansage hielt mich davon ab: »Gleis Fünf, Silverlake Cliff nach Philadelphia, bitte einsteigen. Vorsicht an den Türen.«
»Na dann.« Der Typ stieg ein. Die Energie, die er versprühte, strotzte vor Erwartung, als er einen vielsagenden Blick über die Schulter warf.
»Bitte halten Sie Ihre Tickets bereit!«, ertönte es aus dem Innenbereich.
Ich zog mein Handy aus der Lederjacke, die ich in einem Secondhand-Laden hatte mitgehen lassen. Das Display meines Smartphones erhellte sich und trotzdem blieb es bis auf die Anzeige der Uhrzeit schwarz. Die meisten nutzten den Hintergrund für eine Erinnerung. Für ein Foto, das zeigte, was oder wen man liebte.
Mein Sperrbildschirm war schwarz. Es gab nichts, an das ich mich erinnern wollte oder durfte. Meine Vergangenheit glich einem großen schwarzen Loch, das all das Schöne gefressen hatte. Mehr als Verlust und Schmerz ließ es nicht übrig.
Keine Farbe der Welt könnte das besser beschreiben als Schwarz.
»Hey, du.« Obwohl ich mit niemandem reiste, wusste ich, dass ich gemeint war. Ich sah auf und begegnete dem Blick des aufdringlichen Typen, der am oberen Treppenabsatz wartete.
»Weißt du, worauf ich auch nicht stehe?« Mit einem entschuldigenden Lächeln steckte ich mein Handy weg. »Penetranz.«
Ein Piepen ertönte.
Ich trat zurück.
»Grüß Philadelphia von mir«, sagte ich etwas lauter, damit er mich hörte. Eine Sekunde verging. Zwei, bis sich die Erkenntnis auf seinem Gesicht ausbreitete.
»Moment, was –« Der Typ machte einen Schritt vor, doch die Tür schloss sich direkt vor seiner Nase. Er knallte fast gegen das Glas, als er den Kopf herumriss und vermutlich nach einem Schaffner Ausschau hielt, der ihm aus dieser Misere helfen würde.
Wie wild fuchtelte der Typ mit seinem Arm. Wahrscheinlich betätigte er den Knopf, ein letzter Versuch, aus diesem Zug zu steigen. Vergeblich, denn er setzte sich sanft in Bewegung.
Mit eiserner Genugtuung schob ich mir den Lolli zurück in den Mund und ließ den Fremden nicht aus den Augen. Ich würde mein letztes Geld darauf verwetten, dass er noch nicht einmal eine Fahrkarte besaß. Diese naive Nachlässigkeit stellte sich ein, sobald man sich zu sehr in Sicherheit wiegte.
Menschen zu lesen, war einfach. Manchmal sogar schon zu einfach. Es wäre gelogen, zu behaupten, der Typ hätte keine Ausstrahlung, aber die reichte nun mal nicht, um in dieser Welt zu bestehen.
Langsam wandte ich mich ab und lief in die entgegengesetzte Richtung, in die der Zug fuhr. Vor einer halben Stunde war ich in Silverlake Cliff eingetroffen, mein Zielort und kein weiterer Zwischenstopp, wie ich den Typen hatte glauben lassen. Ich hatte ihn schon bemerkt, als ich das U-Bahn-Netz in der Haupthalle studiert hatte. Er hatte mit seinen Freunden zusammengestanden, die er dann sogar stehen gelassen hatte, um sich mir zu nähern. Er hatte mich ins Visier genommen, als sei ich sein Preis – und meine Vergangenheit bewies, dass ich nirgends sicher sein konnte, solange ich nicht dafür sorgte. Also hatte ich das nächstbeste Gleis angesteuert, auf dem ein Fernzug fuhr, und er war mir mit einer Beharrlichkeit gefolgt, der ich nicht traute; ihn nach Philadelphia zu schicken und ihn auf diese Weise loszuwerden, schien mir nur fair.
Ungesehen tauchte ich in den Strom von Menschen ein, bis ich die Treppe erreichte, die von den Gleisen weg und zurück in die große Halle führte. Auch hier scharrten sich die Menschen wie Ameisen vor ihrem Bau. Suchend glitt mein Blick über Dutzende Köpfe hinweg, bis ich ein Schild entdeckte, das mir den Weg Richtung U-Bahn wies. Ich biss den restlichen Lolli entzwei und warf den Stiel in den Mülleimer, ehe ich die Stufen in das Untergeschoss nahm.
Kaum dass die Gleise in Sichtweite kamen, entdeckte ich die dort wartende Bahn, weshalb ich mich beeilte. Schon hörte ich das grausige Piepen. In letzter Sekunde stieg ich ein, bevor die Türen mit einem dumpfen Knall zufielen. Im Gegensatz zu der Bahn an der Erdoberfläche setzte sich diese ruppig in Bewegung. Also ließ ich mich auf den nächstgelegenen Sitz fallen und stellte meine Tasche zwischen meine Beine. Nur eine Handvoll weitere Passagiere befanden sich in diesem Wagen, jeder schien mit sich selbst beschäftigt zu sein. Das kam mir gerade recht.
Mit einem leisen Seufzen schob ich die Hand in meine Hosentasche und lehnte den Kopf zurück. Auch das Wackeln der Bahn, die durch den Tunnel und über die Gleise raste, konnte mich nicht beruhigen. Ein kräftezehrendes Begleitsymptom der Ungewissheit, weil ich nicht sagen konnte, ob mich nicht doch jemand verfolgte.
Diese innere Unruhe würde wohl nie ganz vergehen.
Meine Fingerspitzen streiften das kühle Metall, doch das reichte bereits aus, um mein aufgewühltes Inneres zu besänftigen. Erst strich ich flüchtig über die Einkerbungen, dann bewusst, bis ich die Form ganz umschloss. Langsam zog ich sie heraus und bettete die Hände in meinen Schoß. Das künstliche Licht flackerte über die silbrige Oberfläche, auf der sich einige Kratzer in die filigrane Verarbeitung gegraben hatten. Spuren, die auf Zustand und Alter hinwiesen, dem metallenen Schmetterling aber nichts von seiner Schönheit nahmen. In all den Jahren hatte ich nie etwas Bedeutungsvolleres besessen als das. Der Abschied von einer Zeit, in der ich alles hatte und an die nur noch dieses Exemplar erinnerte.
Einzig der kühle Luftzug verriet mir, dass wir bereits die nächste Haltestelle erreicht hatten. Eine willkommene Abwechslung zu der stickigen Luft in diesem Waggon. Ich genoss die unsichtbare Hand, den sanften Kuss auf meiner Wange und das zarte Streichen durch mein Haar.
Manchmal sehnte ich mich danach. Nach irgendeiner Art dieses Gefühls, das ich zusammen mit Papás Tod verloren hatte. Ein Stück Geborgenheit, das ich suchte und nirgends fand. Niemand könnte dieses Band ersetzen, das zwischen meinem Vater und mir existiert hatte, bevor er mir auf grausame Art genommen worden war.
Das erste Piepen ertönte. Ein Blick auf die Anzeigetafel verriet, dass ich noch einige Haltestellen vor mir hatte. Das Piepen ertönte erneut.
Plötzlich riss mir jemand den Schmetterling aus der Hand und rannte los.
Lovia
»Hey!« Sofort packte ich meine Tasche und stürzte Richtung Ausgang. Der Typ mit der Baseballcap hechtete aus der Tür, ich lief hinterher. Schon schlug er einen Haken und rannte direkt auf die Rolltreppe zu. Mierda. Wenn er die erreichte, würde ich ihn nie wiedersehen, das letzte Andenken an meinen Vater ebenso wenig. Im Affekt ließ ich meine Tasche fallen und spannte meine Muskeln an, um Tempo zu gewinnen. Zu meiner Überraschung lief der Dieb an der Treppe vorbei, hin zum gegenüberliegenden Steig.
Ich musste ihn irgendwie aufhalten, bevor er die dort stehende Bahn erreichen konnte. Sie könnte jeden Moment losfahren, niemand stand davor. Ein glänzend roter Apfel stach mir ins Auge. Im Vorbeirennen riss ich ihn jemandem aus der Hand, hörte kurz darauf ein Fluchen. Ich visierte den Dieb an, sprang und holte aus. Mit aller Kraft schleuderte ich den Apfel von mir, der wie ein roter Blitz durch die Luft schoss.
Er traf den Cap-Typen direkt in der gebeugten Kniekehle, wodurch er ins Straucheln geriet. Jetzt stolperte er mehr, als dass er lief, und knallte mit der Schulter gegen die Mauer. Er fiel. Wertvolle Sekunden, in denen ich zu ihm aufschloss, sein Handgelenk packte und ihm den Schmetterling entwendete.
Mein Brustkorb hob und senkte sich schwer, während ich die vor mir kauernde Gestalt betrachtete. Auf allen vieren, den Blick stur auf seine flach auf den Boden gelegten Hände gerichtet. Jetzt wirkte er gar nicht mehr so tough wie wenige Sekunden zuvor, sondern … reumütig, fast schon verzweifelt. Irgendetwas an dieser Haltung kratzte an einem Teil von mir, den ich genauso zu verdrängen versuchte wie alles andere.
»Steh auf«, forderte ich. Doch der Typ schüttelte keuchend den Kopf und verbarg sein Gesicht. Ob er wirklich zu Atem kommen musste oder auf den passenden Zeitpunkt wartete, um zu flüchten, mich dabei vielleicht sogar zu verletzen, blieb fraglich. Aufmerksam glitt mein Blick über die Stellen, an denen er eine Waffe tragen könnte. Aufgrund der lockeren Kleidung war das allerdings nicht möglich. Ich hatte keine Ahnung, ob es hier so etwas wie Security gab, mit der er sich gleich herumschlagen müsste, wenn er nicht schleunigst verschwand. Und wahrscheinlich würde mich jeder hier als närrisch bezeichnen, aber … ich hatte den Schmetterling zurück. Mehr wollte ich nicht. Deshalb machte ich einen Schritt auf den Cap-Typen zu und reichte ihm die Hand. »Komm.«
Er zuckte zurück, fasste sich an seine Mütze, vermutlich um sie sich weiter ins Gesicht zu ziehen, damit ich ihn nicht verpfeifen konnte. Doch dann starrte er so fassungslos auf meine angebotene Hand, dass er das anscheinend vergaß.
Jetzt erkannte ich auch den Grund. Die großen, meerblauen Augen spiegelten Angst, die weichen Züge verrieten mir das junge Alter. Ein Teenager. Vor mir hockte jedoch kein Typ, wie ich angenommen hatte, sondern ein Mädchen.
Ich bewegte mich nicht. Bot ihr weiterhin meine Hand an, die sie zögerlich ergriff. Sie ließ sich von mir auf die Beine ziehen, wich meinem Blick aber konsequent aus. Demonstrativ hielt ich das Metallstück hoch. »Was hast du dir hiervon erhofft?«
Sie antwortete nicht, lief aber auch nicht weg, weshalb ich sie einzuschätzen versuchte. An ihren Fingerknöcheln entdeckte ich Schürfwunden, keine frischen Wunden, weshalb ich den Sturz als Ursache ausschloss. Ihre Kleidung wirkte abgewetzt und viel zu groß für ihre schmale Statur. Trotzdem ging ein frischer Duft von ihr aus, als hätte sie sich gerade erst gewaschen. Zumindest schien sie ein Dach über dem Kopf zu haben.
»Sieh mich an«, verlangte ich. Ob es an meinem Tonfall lag oder daran, dass sie keine Gefahr in mir witterte, wusste ich nicht – doch dieses Mal kam sie meiner Aufforderung nach. Obwohl Cap und Kapuze ihr Gesicht für Außenstehende weiterhin verdeckten, konnte ich es deutlich sehen. Einen Moment lang studierte ich ihre Augen, die überraschend klar waren. Ihre Haut hatte einen gesunden Farbton, obwohl ihre Wangenknochen hervorstachen, als hätte sie eine längere Zeit zu wenig gegessen. Sie stand mir ängstlich gegenüber, ich registrierte jedoch kein unkontrolliertes Zittern. Das reichte mir, um irgendeine Art von Drogenkonsum auszuschließen. »Das nächste Mal, wenn ich dich beim Klauen erwische, lasse ich dich verhaften.« Auch wenn ich nicht vorhatte, sie auszuliefern, schien meine Drohung Wirkung zu zeigen.
Der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Du rufst nicht die Cops?«
»Nein.« Meine erste Begegnung mit dem Police Department wollte ich noch etwas hinauszögern. »Verrätst du mir deinen Namen?«
»Jamie«, antwortete sie leise.
»Okay, Jamie.« Ich fischte ein paar Dollarscheine aus meiner Jeans und reichte sie ihr. »Hier. Das ist mehr Geld, als dieses Stück wert ist.«
»Was?«, brachte sie erstickt hervor und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht annehmen.«
»Aber klauen konntest du?«
Stille.
»Ich will, dass du es nimmst und es für das nutzt, für das du dich eben strafbar gemacht hast.« Nachdrücklich hielt ich es ihr hin. Aber sie zögerte.
Und das verriet mehr über ihren Charakter, als ihr bewusst sein würde.
Behutsam griff ich nach ihrem Handgelenk und drehte es, sodass ich ihr das Geld in die Hand legen konnte. Ich schloss ihre Finger um die Scheine, damit sie durch den aufkommenden Luftzug nicht mitgerissen wurden. »Und jetzt verschwinde.«
Unglauben dominierte ihre jugendlichen Züge, ehe er von Reue abgelöst wurde. »Danke«, flüsterte sie und wollte sich abwenden, hielt dann aber noch einmal inne. »Wie heißt du?«
Jetzt zögerte ich einen Moment. »Lovia.«
Jamie neigte leicht den Kopf. »Danke, Lovia.« Mit diesem Namen angesprochen zu werden, würde sich wahrscheinlich nie richtig anfühlen. Aber … irgendwann würde ich mich daran gewöhnen müssen.
Das Mädchen joggte los. Kurz sah ich ihr nach, ehe ich mich abwandte und vorsichtig über den Schmetterling strich. Ich brauchte die Gewissheit, dass ich ihn zurückhatte. Auch wenn ich es vermutlich in ein paar Stunden bereuen würde, Jamie das Geld gegeben zu haben, was ich für meine Unterkunft gebraucht hätte, war es mir das wert.
Die Erinnerung an Papá war es wert.
»Dir möchte ich nachts nicht begegnen«, ertönte eine dunkle Baritonstimme hinter mir.
Ich fuhr herum und entdeckte einen groß gewachsenen Typen, der mit räuberischer Ruhe auf mich zukam. Er war ungefähr einen Kopf größer als ich, der Kragen seines schwarzen Mantels aufgestellt. Silbrige Kettenglieder schimmerten an seinem Hals. Schwarzes Oberteil, schwarze Jeans, schwarze Springerstiefel.
Wie die Nacht. Wie ein Schatten.
Der Typ lief mittig des Steigs, eine Tasche über der Schulter, und spielte seine Präsenz mir gegenüber voll aus. Smaragdgrüne Augen hielten mich gefangen, die einen starken Kontrast zu seinem dunkelbraunen Haar bildeten. Konzentriert zusammengezogene Brauen, ein Zeichen seiner Wachsamkeit, der leicht gehobene Mundwinkel eines der Belustigung.
Meine Arme ruhten an meinen Seiten, das Gewicht des Schmetterlings schwer und vertraut. Er schmiegte sich perfekt in meine Handfläche, als sei er genau dafür gemacht. »Dann würde ich mich an deiner Stelle aus dem Staub machen. Es ist gleich acht.« Und wir hatten Mai. Doch er ignorierte meine verschleierte Warnung, auf Abstand zu bleiben, und näherte sich mir mit ungerührter Lässigkeit.
Ich drückte auf den Schmetterlingskopf, die Klinge schoss aus der Vorrichtung. Beinahe im selben Moment blieb der Typ stehen, seine Aufmerksamkeit verlagerte sich auf das Messer, das ich gerade zum Vorschein gebracht hatte. Kein Wurfmesser, aber eines, womit ich mich verteidigen konnte, sollte es nötig sein.
Tausende Emotionen tanzten über sein Gesicht, verborgen unter einer eisernen, für ihn gemeißelten Maske, die keinen Zentimeter verrutschte. Noch nicht einmal dann, als sich ein leises Lachen aus seiner Kehle löste. »Vorsicht, Butterfly. An deiner Stelle würde ich mich nicht bewegen.«
Meine Erwiderung verflüchtigte sich auf meiner Zunge, als er den Kopf kaum merklich nach links neigte.
»In dieser Ecke befindet sich eine Kamera. Wenn du auch nur einen falschen Schritt machst, oder ich«, er verstummte für einen Moment, in dem sich ein gefährliches Lächeln auf seinen Mund schlich, »dann fängt sie das ein, was du mit dir trägst.«
Mit einer stummen Herausforderung zog er sich die Tasche von der Schulter und schmiss sie mir vor die Füße. Nach kurzem Betrachten stellte ich fest, dass es sich um meine handelte. Mierda, wie hatte ich nur so nachlässig sein und sie fallen lassen können?
Für Papá.
»Du schuldest mir ein Essen«, fügte der Typ hinzu.
Ich hatte mich wohl verhört. »Ich bin nicht am Daten interessiert.«
»Kein Date«, korrigierte er mich und wies auf den ziemlich lädierten Apfel auf dem Boden. »Eher eine Schuld. Deinetwegen hat mein Snack in der Kniekehle eines Typen gesteckt.«
Noch ein Punkt für Jamie und ihr Händchen für eine hervorragende Täuschung.
»Du wirst es überleben.« Mit den Fingerspitzen schob ich das Schmetterlingsgehäuse in meinen Ärmel, sodass ich die Klinge hinter meiner Handfläche verstecken konnte.
»Wo hast du gelernt, so zu werfen?«
»Handball«, nannte ich die offizielle Version. Inoffiziell basierte dieses Können auf jahrelangem Training im Messerwurf. Wachsam bückte ich mich nach meiner Tasche und schulterte sie.
»Du bist nicht von hier«, vermutete der Typ, womit er vollkommen richtiglag.
»Ich wüsste nicht, was dich das angeht.«
Wieder dieses leise Lachen. Dieses Mal zeigte er jedoch Zähne und sah zur Seite, wodurch sich ein Grübchen auf seiner Wange offenbarte. Davon abgelenkt, reagierte ich zu langsam, als er einen Schritt auf mich zumachte und mir auf einmal so nah war, dass mich eine Woge seines Dufts erreichte. Eine zurückhaltende Zitrusnote mit einem Hauch Bergamotte.
»Du bist nicht von hier«, wiederholte er mit unerschütterlicher Überzeugung und hob seine Hand, kurz davor, über meinen Kiefer zu streichen. Ich wollte sie wegschlagen, doch er packte mein Handgelenk und drehte es so, dass die Messerspitze aufblitzte. »Sonst wüsstest du, dass allein das Mitführen von Switchblades in diesem Staat verboten ist.«
Ich antwortete nicht.
Und er grinste. Jetzt musste ich auf seinen linken Eckzahn starren, der im Gegensatz zu seinen lächerlich perfekten Zähnen schief stand, als hätte er sich dagegen wehren wollen, der vorgegebenen DNA zu folgen.
»Lass mich los«, sagte ich leise. »Sonst zeige ich der Kamera, wie Notwehr aussieht.«
»Hört sich verlockend an.« Er beschlagnahmte meine Hand weiter, doch dieses Mal drehte er sie so, dass das Messer von der Kamera abgeschirmt wurde, und hauchte mir einen zarten Kuss auf den Handrücken. »Aber du kannst mir ein anderes Mal zeigen, was diese hübschen Finger mit dieser unscheinbaren Klinge anstellen können.«
Idiota presumido. »Du willst eine Kostprobe?«
»Vielleicht.«
Ich entriss mich seiner Berührung, spürte den Nachhall dessen in einem Prickeln, das ich am liebsten von meiner Haut gewischt hätte. Genauso wie dieses Grinsen aus seinem Gesicht.
»Vorsicht«, warnte ich und überwand die letzte Distanz zwischen uns, ohne unseren Blickkontakt zu unterbrechen. Ein tiefer Atemzug hätte ausgereicht, um seinen Oberkörper mit meiner Brust zu streifen. Ich konnte nicht sagen, ob er überhaupt bemerkte, dass er sich mir entgegen neigte, dass er den Kopf senkte, um … um verflucht noch mal was zu tun?
Bevor ich es herausfinden konnte, packte ich den Stoff seines Hemdes, spürte die Muskeln, die sich darunter anspannten und mich kurz aus dem Konzept brachten. Schnell veränderte ich den Winkel und konnte den Ruck spüren, der durch seinen Körper fuhr. Das Gefühl der Genugtuung durchströmte mich, denn jetzt lag seine Aufmerksamkeit auf der Messerspitze, die sich gegen seinen Bauch drückte.
»An deiner Stelle würde ich mich nicht bewegen«, wiederholte ich seinen Wortlaut. »Wenn du auch nur einen falschen Schritt machst, oder ich …« Unschuldig hob ich die Schultern und lächelte.
Zu meinem Erstaunen entdeckte ich keine Furcht in diesen grünen Augen. Darin loderte … Begehren. Ein so tiefes, dunkles Begehren, dass es mir eine Gänsehaut bescherte.
»Du bist gut«, raunte er und ich konnte den Unterton nicht ignorieren, der in seiner Stimme mitschwang. Bewundernd, herausfordernd und verlangend.
»Ich weiß«, gab ich in einem genauso heiseren Ton zurück. Der Typ lehnte sich weiter vor, ich verharrte still. Spürte, wie sich die Klinge fester gegen seinen Bauch drückte, gegen diese Muskeln, die sich allein durch diese flüchtige Berührung in meine Fingerspitzen gebrannt hatten. Der Typ näherte sich mir mit sinnlicher Trägheit, bis sein Gesicht so nah vor meinem schwebte, dass wir denselben Sauerstoff atmeten.
Für einen kurzen Moment verrutschte die Maske. Nicht die des Typen, sondern meine. Ein Produkt dieses Miteinander-Spielens, das die Luft zwischen uns elektrisch auflud, und das ich nicht ignorieren konnte, sosehr ich es auch wollte.
Erst ein Dröhnen erinnerte mich wieder an das, weshalb ich hier war. Ich konnte keine Ablenkung gebrauchen. Deshalb ließ ich von dem Typen ab und bückte mich kurzerhand nach dem Apfel, der vergessen auf dem Steig lag. Er hatte wirklich ein paar Dellen abbekommen, aber man konnte ihn noch essen. Erneut drehte ich mich zu dem Typen um, doch der hatte sich kein Stück von der Stelle bewegt. In seinem Profil erkannte ich ein leises Lächeln, das in seinem Mundwinkel ruhte.
Provozierend warf ich den Apfel in die Luft. »Ich gehe davon aus, dass du den nicht mehr isst.« Ohne seine Antwort abzuwarten, wandte ich mich ab und machte mich auf den Rückweg zu meinem Gleis, an dem gerade die nächste Bahn einfuhr.
»Hey, Butterfly.«
Ich blieb stehen, nur um mich betont langsam zu dem Fremden umzudrehen.
Selbst über die Distanz nahm ich sein ehrliches Interesse wahr, als er fragte: »Wieso hast du den Möchtegernräuber laufen lassen?«
»Weil hinter jeder Entscheidung oft mehr Verzweiflung steckt, als es den Anschein hat.« Damit biss ich in den lädierten Apfel.
Meine erste Mahlzeit an diesem Tag.
»Danke.« Ich nahm den Schlüssel entgegen und steckte die Kreditkarte zurück in meine Geldbörse.
Die Dame lächelte mich über den Empfangstresen des Motels an. »Gern, Miss Hayes.« Beim Erklingen dieses Nachnamens verharrte ich einen Moment, weil er sich so falsch anhörte. Obwohl ich auch nicht mit dem Namen Lovia Benson geboren wurde, fühlte er sich vertrauter an als der auf meinem gefälschten Ausweis. Ich hasste es, davon Gebrauch machen zu müssen, aber ich musste, wenn ich nicht auf der Straße schlafen wollte. Nur die Fälschung passte zu dem Namen auf der Kreditkarte. »Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.«
»Ihnen auch, Mrs. Thompson«, murmelte ich, als ich das handbeschriebene Schild auf dem Tresen entdeckte.
Sie strich sich eine ergraute Strähne hinter das Ohr und widmete sich ihrem PC, der mindestens genauso alt zu sein schien wie die Frau selbst. Während ich den kleinen Raum verließ, versuchte ich, mein Gewissen auszublenden. Mrs. Thompson hatte mich mit solch einer Herzlichkeit empfangen, dass sich ein bereits lange vergessenes Gefühl in mir regte. Mir blieb allerdings nicht viel Zeit, bis sie herausfinden würde, dass die Karte, die ich ihr vorgelegt hatte, nicht gedeckt war und ich dieses Zimmer nicht bezahlen konnte.
Schnellen Schrittes verließ ich das Gebäude, um eine Treppe hochzusteigen und auf einer schmalen, überdachten Veranda nach der Nummer Vierzehn zu suchen. Meine Unterkunft für die nächste Nacht. Wenn ich Glück hatte, für die nächsten Nächte.
Bereits an der zweiten Tür wurde ich fündig und öffnete sie. Stickige Luft schlug mir entgegen, als ich das Zimmer betrat und mich umsah. Mit einem Bett und einer Kommode fiel die Einrichtung eher spärlich aus, aber ich kannte es nicht anders.
Langsam schloss ich die Tür, drehte den Knauf und schob den Riegel vor. Fürs Erste musste ich darauf vertrauen, dass ich es geschafft hatte. Dass mich niemand in dieser Stadt fand. Im gleichen Atemzug wusste ich, dass auch dieses metallene Vorhängeschloss niemanden davon abhalten würde, die Tür mit Gewalt aufzubrechen, sollte er es darauf anlegen.
Leise seufzend ließ ich die Tasche von meiner Schulter gleiten und mich auf das durchgelegene Bett fallen. Ich schob die Hand in meinen Nacken und übte kurz Druck auf den Punkt neben der Halsbeuge aus. Ein schwacher Versuch, etwas von meiner Anspannung zu lösen, die ich als ständige Begleitung akzeptierte. Dann öffnete ich meine Tasche und kippte den kompletten Inhalt auf die Matratze. Ich scherte mich nicht um die paar Tops, meine beiden Jeans und meine Unterwäsche, sondern widmete mich der Tasche selbst und griff hinein. Dieses Mal hob ich den Bodeneinsatz an, unter dem ein brauner Umschlag klebte.
Vorsichtig zog ich ihn heraus und öffnete ihn. Mittlerweile waren die Dokumente an den Ecken abgestoßen, das Papier etwas vergilbt. Da es sich hierbei jedoch nicht um die Originale handelte, war der Zustand der Papiere zweitrangig. Wichtig waren die Daten. Daten, die mir vor Augen führten, wofür ich das Leben, wie ich es führte, in Kauf nahm.
Papás Akte wog schwer in meiner Hand, aber das hielt mich nicht davon ab, darüberzustreichen. Auch wenn er diese Papiere nie berührt hatte, erzählten sie eine Geschichte. Seine. Und irgendwie auch meine. Behutsam legte ich die Akte ab und kippte den Umschlag. Ein schwarzer USB-Stick rutschte heraus und landete ebenso auf dem weißen Laken. Ich griff danach und drehte ihn zwischen den Fingern. Ohne Laptop würde ich mir nicht ansehen können, was darauf war, aber ihn bei mir zu wissen, hielt mich aufrecht. Dieser Stick enthielt alles, was ich brauchte, und nichts, was mir wirklich half.
Kurz vor seiner Verhaftung hatte Papá dafür gesorgt, dass ich starb. Als hätte er geahnt, dass ich bald untertauchen müsste, um ein Leben zu haben. Für die Öffentlichkeit kam die Tochter des mehrfach verurteilten Mörders Javier Moreno Rodriguez bei einem verheerenden Brand um.
Niemand durfte wissen, dass sie lebte. Dass ich lebte.
Sonst wäre Papás Opfer umsonst gewesen.
Mit meiner neuen Identität hatte Papá mir das ermöglicht, was er sich immer für mich gewünscht hatte: Ein richtiges Leben, ohne Weglaufen und der ständigen Angst, gefunden zu werden. Wenn man als zehnjähriges Mädchen jedoch nicht über seine wahre Herkunft, seine tiefsten Wünsche und die vielen Fragen reden konnte, die der entrissene Elternteil hinterlassen hatte, wurde man zu einem Problem, das von einer Pflegefamilie in die nächste geschoben wurde. Bis ich irgendwann freiwillig weggelaufen war und nur hoffen konnte, dass Papá das nie erfahren hatte. Vielleicht hätte er gewollt, dass ich studierte, dass ich etwas lernte, um anderen zu helfen. Oder um mir selbst zu helfen. Ohne Geld eine unüberwindbare Hürde, doch selbst das hatte mich nicht davon abgehalten, an meinem Wunsch festzuhalten.
Ich wollte für Gerechtigkeit sorgen. Dass es sich dabei um Gerechtigkeit für meinen Vater handelte, hatte ich ihm nie sagen können.
Und das würde ich auch nicht mehr.
Vor sechs Monaten war Papá in Texas hingerichtet worden. Einer der wenigen Staaten, in denen die Todesstrafe mit der Giftspritze noch rechtskräftig war, und der Staat, in dem er vor fünfzehn Jahren verurteilt worden war.
Ich hatte mich noch nicht einmal verabschieden können. Hatte nicht bei ihm sein dürfen, weil mich offiziell nichts mehr mit ihm verband. Doch egal, welcher Name auf meinem Ausweis stand, welcher Lebenslauf sich dahinter verbarg – nichts würde mich dazu bringen, Papá zu vergessen. Ihn zu verleugnen. Daran konnte kein Stück Plastik etwas ändern.
Zum tausendsten Mal schlug ich die Akte auf, blätterte durch die Unterlagen, die Auflistung seiner Taten, die Namen seiner zwölf Opfer. Doch egal, wie oft ich das tat – nichts davon konnte ich mit dem Mann in Einklang bringen, der mich aufgezogen und geliebt hatte.
Trotzdem sprach alles gegen ihn. Die Beweislast war zu hoch.
Ich holte den Schmetterling aus meiner Hosentasche und betätigte den Knopf. Die Klinge glänzte im letzten Licht des Tages und bildete einen Kontrast zu dem ermatteten Silber des Gehäuses.
Butterfly.
Mein Gedächtnis holte die Erinnerung an den Klang hervor. An die dunkle Baritonstimme, den darin mitschwingenden Unterton, mit dem dieser Typ es geschafft hatte, diesen Spitznamen liebevoll und verachtend zugleich klingen zu lassen. Obwohl nichts an mir an einen Schmetterling erinnerte, nichts an die Zartheit, die diese Wesen implizierten, hielt ich daran fest. So, wie ich das Messer hielt.
Cuídate, mi mariposa. Pass auf dich auf, mein Schmetterling.
Abwesend drückte ich die Spitze gegen meine Fingerkuppe, um die Erinnerung an die Trauer, die Papás Gesicht gezeichnet hatte, zu verdrängen. Ein scharfer Stich schoss meinen Arm hinauf, ein Blutstropfen quoll aus der Haut.
»Lo prometo, papá«, flüsterte ich.
Ich verspreche es.
Penley
Ich hasste es. Hasste es, lächeln zu müssen. Hasste es, hier zu sein. Ich hasste die Gespräche, die Falschheit, das geheuchelte Interesse, nur weil der Name Montgomery als Gastgeber dieser Gala auf der Einladungskarte stand.
Mit einer Laune, die so finster war, dass Schwarz dagegen freundlich wirkte, beugte ich mich über den Tresen und nickte dem Barkeeper zu. Selbst er vermittelte den Eindruck, dass er es satthatte, unzählige Gläser mit Champagner zu füllen und jeden Gast anlächeln zu müssen, der Blickkontakt mit ihm aufnahm. Aber er hatte sich diesen Job ausgesucht.
Ich hatte das nicht. Allein auf dieser Gala anwesend zu sein, fühlte sich an wie ein beschissener Job. Ich könnte den größten Scheiß von mir geben und würde dafür trotzdem in den Himmel gelobt werden. Vor gerade einmal fünf Minuten hatte ich Mr. Cartwright, einer der einflussreichsten Gönner von Moms Kunst, aus Langeweile erzählt, dass ich darüber nachdachte, mir ein Alpaka anzuschaffen und es in meiner Wohnung zu halten. Ein zugegeben verzweifelter Versuch, mich dezent aus diesem Gespräch zurückzuziehen. Doch Mr. Cartwright hatte eifrig genickt und mir bereits die ersten Vorschläge vor die Füße geworfen, wie man meine Terrasse entsprechend ausrichten und umbauen könnte. Schließlich besaß er eines der erfolgreichsten Architekturunternehmen des Bundesstaates und arbeitete aus diesem Grund eng mit Mom zusammen.
Montgomery. Ein Name, der Türen öffnete und Möglichkeiten bot, von denen ich mir keine selbst erarbeitet hatte, weil ich es ›nicht brauchte‹.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich das alles hasste?
Ein Glas wurde in mein Sichtfeld geschoben, die goldbraune Flüssigkeit darin das einzige Mittel, mit dem ich diesen Abend irgendwie überstehen würde. Ohne Umschweife kippte ich den Bourbon hinunter, die Flüssigkeit brannte sich meine Kehle hinab.
»Hier steckst du, Kumpel.« Jemand klopfte mir hart auf die Schulter.
Ich verschluckte mich fast.
Das breite Grinsen verriet, dass er genau auf diesen Zeitpunkt gewartet hatte. Fynn setzte sich neben mich auf den Hocker und nickte dem Barkeeper zu, bevor er den Arm lässig auf das polierte Mahagoni legte. »Mr. Cartwright hat sich deinen Dad zur Seite genommen. Willst du dir wirklich ein Alpaka zulegen?«
Fuck. My. Life.
»Du hast zwar genügend Platz, aber so ein Tier in der Wohnung zu halten, ist nicht ganz … artgerecht«, fuhr Fynn unbeirrt fort. »Ich meine … die Terrasse? Ernsthaft?«
»Willst du lieber auf der Terrasse schlafen, damit ich dem Tier das weiche Bett im Gästezimmer anbieten kann, in dem du während deiner Besuche nächtigst?«
Mit hochgezogenen Brauen nahm Fynn den Drink vom Barkeeper entgegen und setzte das Glas an die Lippen. »Wenn du mich fragst, ist die Terrasse ein hervorragender Ort für ein Alpaka.« Seine Worte verloren sich in einem Gemurmel, weil er an der Flüssigkeit nippte.
»Wusste ich’s doch.« Wehmütig starrte ich in das leere Glas, ehe ich mein Smartphone aus der Jeans zog und es daneben legte. Abgesehen von Fynn war es meine einzige Rettung, um dieser beschissenen Gala und dem noch beschisseneren Abend zu entkommen. Zumindest für eine Weile. Wenn man allerdings auf etwas wartete, zog sich die zu überbrückende Zeit so lang wie ein durchgekauter Kaugummi.
»Hey, Babe«, schnurrte eine honigsüße Stimme, ehe sich ein schlanker Frauenarm um Fynns Schultern drapierte. Ihr glattes, hellblondes Haar bildete ein Pendant zu Fynns dunkelblondem Durcheinander auf dem Kopf, das er Frisur nannte. Auf mich machte es allerdings den Eindruck, als hätte er genau gar nichts damit gemacht, außer es zu waschen.
»Marissa.« Fynns Drink war vergessen, als er seine Hände an die schmale Taille der Blondine legte und sie an sich zog.
»Flüchtest du etwa vor mir?«, fragte sie unschuldig. So wie sie ihn dabei allerdings anlächelte, würde er heute sicher nicht bei mir übernachten.
»Natürlich nicht«, wehrte Fynn ab. »Penley tat mir nur etwas leid, so allein, wie er hier saß.«
»Doch nicht etwa Penley Montgomery?« Wow. Die gespielte Überraschung war kaum zu überhören und versetzte ihr Interesse an Fynn sogleich einen bitteren Beigeschmack. Sie hatte längst gewusst, auf wen sie sich heute einlassen wollte.
Ich wandte mich ab und versuchte, erneut die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu gewinnen.
»Genau der.« Obwohl er sich nichts anmerken ließ, wirkte Fynns Höflichkeit gezwungen, als er seiner Begleitung entschuldigend über den Arm strich. »Kannst du uns einen Moment allein lassen? Ich muss noch etwas mit Penn klären.«
»Klar. Aber lass mich nicht wieder so lange warten, ich habe noch etwas vor.« Der zweideutige Kontext und das wortlose Versprechen, das dahintersteckte, entgingen mir nicht. Blondie griff nach ihrer Tasche, drückte sie sich an ihre Brust und wandte sich mit einem Zwinkern an mich. »Wir sehen uns später.«
Ganz sicher nicht. Fynn hatte mir schwören müssen, keinen Damenbesuch in meine Wohnung zu bringen.
Während er ihr hinterher glotzte wie ein Löwe seiner Beute, musste ich mich mit aller Macht davon abhalten, die Augen zu verdrehen.
Viel zu überschwänglich wandte Fynn sich zu mir. »Du kannst es nicht lassen, oder?«
Ich rieb mir über die Stirn. »Was habe ich dieses Mal gemacht?«
»Du bist Penley Montgomery.«
»Und du bist Fynn Montgomery.«
»Schon, aber du bist nun mal Penley Montgomery!«
Meine Hand landete mit einem Klatschen auf dem Holz. »Und du bist Fynn Montgomery, du Vollidiot. Also, was willst du von mir?«
Wieder stahl sich dieses elendige Grinsen auf Fynns Lippen. »Du zählst zur fucking High Society dieser Stadt und dir ist es einfach scheißegal.« Exakt. »Bei dir sieht sogar jeder darüber hinweg, dass dein Arsch auf einer Gala in Jeans und Stiefeln steckt.«
Vielleicht doch ein Vorteil, der Sohn der Gastgeber zu sein.
Der Barkeeper suchte sich diesen Moment aus, um uns die Getränke hinzuschieben. Seine hochgezogene Braue machte deutlich, dass er dieser Aussage haltlos zustimmte.
Fynn betrachtete mich offensiv, eine blonde Locke fiel ihm dabei in die Stirn. Unter dichten Wimpern sah er zu mir auf. »Wenn du nicht mein kleiner Neffe wärst, würde ich dich glatt mit zu mir nach Hause nehmen.«
Ich schnaubte. »Du meinst wohl in mein Zuhause.« Schließlich pennte er in meinem Gästezimmer.
»Ach, komm schon, Alter. Sei nicht so grantig. Hast du nicht genug gegessen?«
Ehrlich gesagt, hatte ich gar nichts gegessen. Dank dieser schwarzhaarigen Schönheit mit den stahlgrauen Augen, deren wilde Entschlossenheit genauso eisern darin gestanden hatte wie das Stück Metall, für das sie sich wie Jeanne, die Kamikazediebin, eingesetzt hatte. Ich hatte sogar eine Stichwunde in Kauf genommen, um auszutesten, wie hoch die Flammen in ihren Augen schlagen würden.
Meine fehlende Antwort schien genug, denn Fynn winkte schon jemanden heran. Ein grauhaariger Mann kam dieser Aufforderung in akkurater Haltung nach, woraufhin Fynn über die Schulter zu mir deutete. »Wir brauchen noch etwas zu essen für unseren Grumpy-Penn.«
Bei meinem neuen Titel lächelte ich verkniffen, der Kellner allerdings behielt seine Professionalität mit makelloser Präzision bei und ließ uns allein.
Niemandem sonst erlaubte ich es, mich so zu nennen. Oder mir generell irgendeinen Spitznamen zu verpassen, weil ich darüber selbst entscheiden wollte. Vom Verwandtschaftsgrad her war Fynn mein Onkel, aber das ließ er anderen gegenüber nur in seltenen Fällen heraushängen. Uns trennten acht Jahre und obwohl ich keine Geschwister hatte, war ich mit dem Gefühl aufgewachsen, einen Bruder zu haben. Dad hatte Fynn so oft zu uns geholt, dass er uns teilweise wie Geschwister großgezogen hatte.
Mein Handy vibrierte auf dem Tresen. Ein schneller Blick auf das Display reichte, damit ich danach griff und es zurück in meine Jeans schob. Schnell leerte ich auch den zweiten Drink und stand auf.
»Hey, ich habe dir gerade was zu essen geordert«, kam es von der Seite. »Wohin willst du?«
»Weg.«
»Wie weg?« Fynn schnaubte. »Erst stiehlst du mir die Show und dann lässt du mich in dieser Gesellschaft hängen?«
»Du sitzt hier allein.«
»Eben.«
Mein Blick schoss über seine Locken hinweg und fand sofort die Blondine, die uns seit ihrem Weggang anscheinend keine Minute aus den Augen gelassen hatte. »Ich bin mir sicher, nicht mehr lange.«
Dreißig Minuten später hatte ich mein Hemd gegen einen schwarzen Hoodie eingetauscht und den Mantel gegen einen dünnen Windbreaker, in dem ich mich um einiges wohler fühlte. Während ich die U-Bahn-Station ansteuerte, schob ich die Hände in die Jackentaschen und genoss das Gefühl, das dieser Ort in mir hervorrief. Auch wenn die Luft hier unten zu wünschen übrig ließ, konnte ich zum ersten Mal seit Stunden wieder atmen. Einige Passanten liefen an mir vorbei, aber niemanden kümmerte es, wer ich war oder wohin ich wollte. Eine willkommene Abwechslung zu der Gala, bei der ich keinen Schritt hatte gehen können, ohne von jemandem am Arm zurückgehalten zu werden und mit ihm Small Talk führen zu müssen.
Ich schlenderte zum Steig A und blieb mit etwas Abstand zu den Gleisen stehen, um auf die Bahn zu warten. Es dauerte nicht lange, bis ein Windzug meine Haare erfasste. Ich lauschte auf das vertraute Rauschen der U-Bahn, die Ansagen überhörte ich mittlerweile gekonnt, weil ich mich dabei lieber auf meine Intuition verließ. Ein paar Sekunden später tauchte der Lichtschein im Tunnel auf, die Bahn kam mit einem kreischenden Bremsen zum Stehen. Um diese Uhrzeit saßen nur wenige Menschen auf den Sitzen. Die einen trugen Kopfhörer, andere wiederum schliefen oder starrten ins Leere. Ein guter Grund, wieso ich öffentliche Verkehrsmittel gern nutzte, denn niemand interessierte sich hier für sein Umfeld. Schon gar nicht für jemanden wie mich, der zustieg und den Gang zielstrebig durchquerte, um in den nächsten Waggon zu gelangen. Im Gehen zog ich mir den Windbreaker aus und rollte ihn so zusammen, dass er in die große Tasche meines Hoodies passte.
Die Türen piepten. Gerade rechtzeitig passierte ich eine und schob mir die Kapuze über den Kopf.
Für die Überwachungskameras war Penley Montgomery eben in diese Bahn gestiegen, bereit, diese Haltestelle zu verlassen. Niemanden interessierte, dass ich wieder ausstieg. In der gleichen Station. Auf demselben Steig. Mit gesenktem Kopf, unsichtbar und doch für alle zu sehen, denn jetzt befand ich mich in einem toten Winkel.
Während sich hinter mir die Tür schloss, nahm ich mein Smartphone zur Hand und checkte die Uhrzeit. Kurz nach halb eins. Cosima würde mir mit Sicherheit den Arsch aufreißen, weil sie auf mich warten mussten. Dass sie warteten, stellte ich nicht infrage. Seelenruhig schob ich das Smartphone zurück in meine Jeans, während die Bahn mit einem ätzenden Quietschen anfuhr.
Fünf Minuten. Dann würde die nächste einfahren.
Ich wartete, bis auch die Rücklichter ins Nirgendwo verschwunden waren. Ein letztes Mal sah ich mich um, ehe ich auf den kleinen Vorsprung stieg und der Bahn in die nachtschwarze Finsternis folgte. Ich hatte Ewigkeiten gebraucht, bis ich mich überwinden konnte, die ersten paar Meter ohne jegliche Lichtquelle zu gehen. Aber jedes bisschen Aufmerksamkeit wäre zu viel. Deswegen hielt ich mich nah an der Tunnelwand, bis auch das letzte Licht in meinem Rücken erlosch und die Notausgangsbeleuchtung das einzige war, das mir den Weg wies. Trotzdem hielt ich weit davor an einer Tür, an der eine verrostete Kette hing. Schon schallte das vertraute Quietschen der Bremsen durch den Tunnel. Pünktlich.
Ich drückte die Tür auf. Feuchte Luft schlug mir entgegen, als ich die Schwärze aussperrte und auch diesen Gang durchquerte, der durch alte Neonleuchten erhellt wurde. Kaum dass ich um die Ecke bog, flog etwas Dunkles aus einer offen stehenden Tür. Keine Sekunde später stolperte Jaron nach hinten und duckte sich lachend unter einer – wie ich feststellte – daherfliegenden Sturmhaube.
Er hob die Mütze auf und wurde auf mich aufmerksam, weshalb er mir die Hand hinhielt und mich an sich zog. »Da bist du ja.«
Während ich ihm auf die Schulter klopfte, spähte ich in den Raum, aus dem mich bereits ein Stimmengewirr empfing. Schnell überflog ich die Anzahl an Personen und schätzte sie auf ungefähr zwanzig, was einem guten Mittelmaß für diesen Abend entsprach. »Fehlt noch jemand?«
»Shane. Keine Ahnung, wo der steckt, aber Cosima bekommt langsam schlechte Laune.«
Ich musste mir das Grinsen verkneifen, während ich den Raum, dicht gefolgt von Jaron, betrat. Er schüttelte gerade die Mütze aus, als ich Cosimas weiß gefärbtes, hüftlanges Haar entdeckte. Selbst in ihrem Profil meinte ich, die zusammengezogenen Brauen ausmachen zu können, deren Ernsthaftigkeit auf ihre Stimmung schließen ließ. Anscheinend lag Jaron richtig mit seiner Vermutung, denn er hob unbeholfen die Schultern, als wolle er mir mitteilen: Ich hab’s dir gesagt.
Cosima redete mit Leah, die ihren Rucksack für den Abend prüfte. Etwas abseits von ihnen stand Heather und verfolgte die Unterhaltung still. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie sei nur ihrer jüngeren Schwester Leah zuliebe Teil dieser Gang geworden, um auf sie achtzugeben. Es war offensichtlich, dass sie sich zwischen all den Writern – die Bezeichnung für einen Sprayer, der Namen oder Worte als Basis für sein Graffiti nutzte – nicht so wohlfühlte wie Cosima, die sich mir in diesem Augenblick zuwandte.
»Sieh an, wer zu uns gefunden hat«, ergriff sie das Wort, woraufhin die Gespräche im Raum verstummten. Auffordernd reckte sie das Kinn. Obwohl sie mir gerade einmal bis zur Brust reichte, gab sie jedem, der ihr gegenüberstand, das Gefühl, ihn mit einer beneidenswerten Leichtigkeit schlagen zu können. Dass sie es tatsächlich konnte, hatte ich bereits mehr als einmal miterleben müssen. »Ich hatte schon fast den Eindruck, du würdest heute bei den reichen Ärschen bleiben und uns hängenlassen.«
»Würde ich nie.« Und das stimmte.
Ein stolzes Lächeln breitete sich auf ihren Lippen aus, als hätte sie auf diese Antwort spekuliert. Eigentlich sollte sie mittlerweile wissen, dass ich diese Leute niemals hängenlassen würde. Manchmal konnte sie es jedoch einfach nicht lassen, mich darauf hinzuweisen, dass ich ein anderes Leben führte als die meisten in dieser Crew. Ich verübelte es ihr nicht. Schließlich hielt ich genauso wenig von den Klassen, in die wir anhand unseres Vermögens unterteilt wurden.
Cosima griff nach hinten und zog einen Rucksack zu sich heran, den sie mir auffordernd hinhielt. Meinen Rucksack, den ich gestern hatte zurücklassen müssen. Ich nahm ihn ihr ab und warf einen Blick hinein, ehe ich meine Jacke darin verstaute.
»Wir sind vollzählig«, rief Cosima und zog damit erneut die Aufmerksamkeit aller sich hier aufhaltenden Personen auf sich, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Verschiedene Generationen waren vertreten, von Teenagern bis Erwachsene in den späten Vierzigern, die aber alle dieselbe Leidenschaft teilten: Sprayen. »Wir teilen uns auf. Unser heutiges Ziel ist das Rathaus. Wie ihr dorthin kommt, bleibt euch überlassen. Die Polizei klebt uns sowieso an den Fersen, weshalb die einzige Regel lautet: Lasst euch nicht erwischen.« Ein Grölen ging durch die Runde. »Wer hat Lust, für ein bisschen Ablenkung zu sorgen und die Cops an der Nase herumzuführen?«
Anfeuerungsrufe wie die einer Footballmannschaft kurz vor Antritt eines Spiels schallten durch den Raum. Ich blendete sie aus. Sobald unser Leader Soren nicht in der Stadt weilte oder sich aus einer Session heraushielt, ergriff Cosima das Wort. In Sorens Abwesenheit hatte sie sich einmal an die Spitze gestellt und war dort einfach … geblieben.
»Jetzt lasst uns ein bisschen Spaß haben!« Leah klatschte in die Hände, einige taten es ihr nach. Schon herrschte Aufbruchstimmung. In einem unausgesprochenen Einverständnis verließen wir dieses Versteck. Allerdings teilten wir uns schon hier auf: Einige nahmen den Weg, den ich gekommen war – um die Security, die sich an der Haltestelle aufhielt, in Schach zu halten. Andere nahmen den Weg über die Treppe und der Rest – Jaron, Leah, Heather, Cosima und ich – schlich sich durch die Gänge der Unterführung.
Jaron, der neben mir herlief und seinen Rucksack lässig über einer Schulter trug, stieß mir leicht gegen den Arm. »Wie war die Gala?«
»Nicht so glamourös, wie sie sich anhört«, antwortete ich knapp.
»Irgendeine neue Bekanntschaft?«
»Keine, die mich interessiert.« Zumindest nicht auf der Gala. Das entlockte Jaron ein Grinsen. Er zählte zu den wenigen Personen, mit denen ich mich auch über etwas anderes unterhalten konnte als die Gang. Auch wenn er nicht viel über sich und sein Privatleben redete, wusste ich, dass er es nicht leicht hatte. Seitdem er sich seiner Familie gegenüber geoutet hatte, verbrachte er immer mehr Zeit mit der Gang. Den Drang, sich im Kreis der Menschen zu bewegen, die einen nicht dafür verurteilen, wen oder was man liebte, konnte ich nachvollziehen. »Wollen wir wirklich ohne Shane losziehen?«
Jaron hob die Schultern. »Schon komisch, dass niemand weiß, wo er steckt. Vorhin meinte er noch, dass er sich um das nötige Werkzeug kümmern will, dann war er verschwunden.«
»Das passt gar nicht zu ihm«, murmelte ich. Normalerweise ließ Shane sich keine Session entgehen, schon gar nicht solche wichtigen Aktionen.
»Seit wann interessierst du dich für Shane?«, klinkte Cosima sich in unser Gespräch ein, ohne über die Schulter zu sehen.
»Ohne ihn wird es schwer, überhaupt an die Fassade zu kommen.« Auch wenn ich den Typen nicht sonderlich mochte, war er ein entscheidender Faktor für viele Aktionen: Er sorgte für die passende Ausrüstung, um auf ein Gelände zu kommen.
»Sicher, dass es nur das ist?« Jetzt spähte Cosima doch über die Schulter. »Oder hast du etwa Angst, dass er dir mit seinen Verbindungen den Platz auf dem Thron streitig macht?«
»Ich sitze auf keinem Thron.« Ich stand daneben. Dad als ehemaliger NBA-Spieler zählte zu den erfolgreichsten Sportlern des Landes, und Mom hatte mit ihren Kunstwerken bereits unzählige Galerien gefüllt.
Von mir wurde der gleiche Erfolg erwartet.
Und das störte mich mehr, als ich zugeben wollte. Ich war nicht ansatzweise so sportbegeistert wie Dad oder so ein begnadeter Künstler wie meine Mom. Ein Los, das niemanden kümmerte, weil es zum selben Ergebnis führte: der direkte Vergleich. Aus dem Schatten eines solchen Erfolgs herauszutreten und sich einen eigenständigen Namen zu machen, würde mir niemals zuteilwerden. Ich liebte meine Eltern. Dafür, dass sie mir Türen offen hielten und Möglichkeiten boten – aber das vereinfachte die Sache kaum, denn es war egal, was ich machte oder wie sehr ich mich anstrengte. Solange ich den Namen Montgomery trug, würde ich immer in ihrem Schatten stehen.
»Komm schon, Nox!«
Deshalb hatte ich mir einen anderen zugelegt. Nachts, wenn ich durch die Straßen streifte, war ich nicht mehr Penley Montgomery, sondern der Writer Nox.
Und das erfüllte mich mehr als alles Geld, das auf meinem Konto ruhte.
Ich folgte den anderen durch die Gänge, bis wir eine Treppe erreichten, die uns aus dem Untergrund führte. Ab hier verlief unsere Kommunikation mehr oder weniger über Handzeichen. Dieser Eingang befand sich direkt an einer befahrenen Straße, weshalb er ungern genutzt wurde. Manchmal blieb uns allerdings keine andere Wahl. Heather öffnete vorsichtig die Tür und wagte sich als Erste hindurch. Es glich einem Wunder, dass wir den Cops hier noch nie in die Arme gelaufen waren. Dass sie irgendwann auf uns warten würden, stand bereits fest. Um den Zeitpunkt jedoch noch ein wenig hinauszuzögern, nahm ich manchmal auch gern den Umweg durch den U-Bahn-Tunnel.
Nacheinander traten wir durch die Tür. Obwohl ich mich so schnell wie möglich aus der Schusslinie manövrieren sollte, lief ich den Gehweg in einem gemächlichen Tempo entlang. Jede zu hektische Bewegung würde genau das Gegenteil von dem bewirken, was ich beabsichtigte. Obwohl wir nur noch zu fünft waren, scherten wir auseinander, bewegten uns dennoch wie die Einheit, die wir waren. Jaron und ich fielen zurück, Cosima wechselte die Straßenseite und ging dort auf ihr Handy starrend weiter, während Heather und Leah bereits ganz aus meinem Sichtfeld verschwunden waren.
Ich kannte nicht alle Mitglieder der Streetgang mit richtigem Namen, oft stellte man sich mit einem Pseudonym vor. Aber diejenigen, die ich kannte, waren mir wichtig. Cosima, Jaron und Leah waren mir wichtig. In gewisser Weise sogar Heather, obwohl ich mit ihr kaum ein Wort wechselte.
Wenn wir loszogen, dann oft in genau dieser Konstellation, weil wir alle im selben Alter waren.
Unsere Schritte wurden hier und da vom Rascheln der Kleidung oder dem Klappern der Dosen in den Rucksäcken begleitet, die sich unter die Geräusche der städtischen Nacht mischten. Schweigend näherten wir uns dem Zentrum und dem Gebäude, zu dem wir wollten. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto konzentrierter wurden wir.
Ich erkannte Cosimas weißes Haar aus dem Augenwinkel, das wie ein Stern am nachtschwarzen Himmel aufblitzte. Sie scannte die Umgebung von der anderen Straßenseite. Wie eine Raubkatze pirschte sie sich an der Mauer entlang bis an die Ecke, um die sie vorsichtig spähte. Den Blick fest auf das gerichtet, was sie sehen konnte, streckte sie den Arm nach hinten und gab uns ein Zeichen. Jaron lief los.
Ich zog meine Maske hoch und verbarg damit nicht nur mein Gesicht, sondern distanzierte mich für die nächsten Stunden auch von meinem Namen. Das hier entsprach einem der wenigen Momente, in denen ich mich wirklich wie ich selbst fühlte. In denen ich mich gesehen fühlte, ohne von anderen erkannt zu werden.
Ein Pfiff ertönte. Beinahe im selben Moment setzte ich mich in Bewegung und lief auf die gegenüberliegende Straßenseite zur Mauer, an der Jaron mich bereits heranwinkte.
»Schnell«, wies er mich an, woraufhin ich an den Rand griff und mich mit einem kräftigen Ruck hochzog. Die Fläche war breit genug, sodass ich ohne Probleme darauf stehen konnte. Dennoch blieb ich auf den Knien und streckte einen Arm nach Cosima aus, die in diesem Moment bei Jaron ankam.
Ich half ihr auf die Mauer. Während sie auf der anderen Seite verschwand, ertönte erneut ein Pfiff. Automatisch nahm ich eine Habachtstellung ein. Obwohl sich ein Streifenwagen in der Nähe befinden musste, wartete ich darauf, dass Jaron mich ansah. Kaum dass er das tat, hob ich den Daumen.
Jaron erwiderte die Geste. »Bis später.«
»Lass dich nicht erwischen.«
»Nicht heute.« Unter seiner Maske konnte ich ein Grinsen ausmachen, ehe er in die Richtung lief, aus der wir zuvor gekommen waren. Jaron gehörte heute zu dem Trupp, der anderweitig für Aufruhr sorgen würde, um uns so lange wie möglich den Rücken freizuhalten.
Erst als ich ihn nicht mehr sehen konnte, kletterte ich auf der anderen Seite der Mauer hinunter und bahnte mir einen Weg durch das Dickicht, das uns auf das Gelände führte. Es dauerte nicht lange, bis ich Cosimas weißes Haar entdeckte, die entgegen jeder Vernunft darauf verzichtete, ihre Haare unter einer Sturmhaube zu verbergen. Stillschweigend liefen wir nebeneinanderher, bis wir an einem Gitter ankamen, das uns den Weg versperrte. Ich versuchte, die Höhe des Tors einzuschätzen.
»Vielleicht müssen wir uns doch einen anderen Weg suchen«, murmelte Cosima, die vergebens mit dem Schloss hantierte.
»Dann los.« Doch bevor wir losgehen konnten, vernahm ich ein Rascheln. Schritte. Sofort streckte ich den Arm zur Seite, um Cosima darauf aufmerksam zu machen. Zu spät. Eine Gestalt tauchte so schnell vor uns auf, dass wir nicht mehr hätten weglaufen können.
»Was ist?«, ertönte eine männliche Stimme. Jetzt erkannte ich das rote Haar, das genauso herausstach wie Cosimas. »Kommt ihr ohne mich etwa nicht weiter?«
»Verdammt noch mal, Shane!« Sie boxte ihm gegen die Schulter. »Du kannst uns doch nicht so einen Schrecken einjagen. Wo hast du gesteckt?«
»Im Zug«, brummte er und öffnete seinen Rucksack, aus dem er ein Gerät zog.
»Warum?«, hakte Cosima nach. »Du warst doch vorhin noch bei Jaron und mir, bis du einer Frau nachgelaufen bist wie ein junger Hund. Kam sie nicht von hier?«
Shanes Blick wurde so finster, dass er der Dunkelheit um uns herum starke Konkurrenz machte.
»Sag schon«, drängte Cosima. »Oder waren deine Anmachversuche so schlecht, dass sie dich gleich aus der Stadt geschickt hat?«
Eine bedeutungsschwere Pause entstand, in der Shane nichts erwiderte und damit alles beantwortete.
»Stimmt das etwa?« Cosima brach in schallendes Gelächter aus. Auch ich musste grinsen. »Scheiße, das ist zu gut!«
»Ich würde jetzt wirklich gern dieses Tor zerschneiden.« Shane deutete auf die Flex in seiner Hand.
»Geräuschkulisse kommt.« Cosimas Smartphone leuchtete auf und zeigte ihr amüsiertes Grinsen. Kurz darauf ertönten von der Straße mehrere Explosionen, die von Böllern stammten – und gezielt von uns wegführen würden. Shane zögerte nicht, sondern setzte die Flex an. Das Metall kreischte, Funken sprühten, bis der Zugang groß genug war, damit wir hindurchpassten. In einvernehmlichem Schweigen schlichen wir uns an die Fassade, über die Cosima andächtig strich. »So unschuldig und rein«, murmelte sie und sah auffordernd zu mir. »Wir haben vielleicht zehn Minuten, bis die checken, dass wir hier sind.«
»Genug Zeit, um die Welt ein bisschen bunter zu machen.« Ich stellte meinen Rucksack ab und zog mein Equipment heraus. Mit routinierten Handgriffen setzte ich den breiten Sprühkopf, den Cap, auf die Dose und schüttelte sie, ehe ich sie freisprühte.