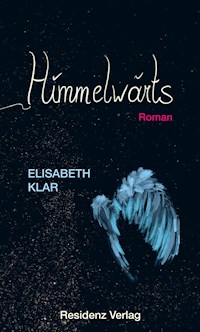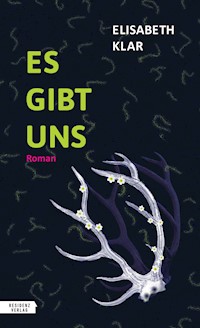
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Anemos, einer postapokalyptischen verstrahlten Stadt, hat sich eine prekär ausbalancierte Gemeinschaft aus Mischwesen und Mutant*innen gebildet – für das gemeinsame Überleben braucht es die Leuchtqualle Oberon, die die Wasserversorgung der Stadt sicherstellt, aber auch die geweihbewehrte Titania, die für die wilden Feste der Stadt sorgt. Doch eines Jahres endet das Fest Walpurgis mit Oberons Tod im Liebesspiel – und das kleine Schleimtierchen Müxerl muss Oberons Aufgaben übernehmen. Denn: Was du kaputt machst, musst du richten, so verlangt es das Gesetz von Anemos. Was, so fragt Elisabeth Klar, kommt nach dem Anthropozän? Und welche Gesetze kann sich eine Gesellschaft geben, um unter widrigen Umständen nicht nur zu überleben, sondern auch leben zu wollen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Klar
Es gibt uns
Roman
Residenz Verlag
Wir danken für die Unterstützung
© 2023 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Kathrin Klöckl
Lektorat: Jessica Beer
ISBN Print 978 3 7017 1769 9
ISBN eBook 978 3 7017 4701 6
Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren.
Pina Bausch
Inhalt
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil IV
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zitierte und referenzierte Gedichte
Quellen und Inspirationen
I
1
Es ist Frühjahr, das Licht kehrt zurück und langsam werden die Tage länger, doch noch wickeln sich die Bewohnerinnen von Anemos in Hüllen um Hüllen und finden sich ein auf dem Vorplatz des Schlosses, weil das Theaterstück wieder aufgeführt werden soll.
Sie tummeln sich, weil sie es nun endlich wieder wagen, eng aneinander zu stehen und gemeinsame Luft zu atmen, und der Chor mischt sich bereits auf dem Vorplatz unter das Publikum. Heute werden sich die Tore des Schlosses öffnen, nicht nur für wenige wie sonst, sondern für die ganz vielen, für die gesamte Stadt, die an diesem einen Tag im Jahr für diese eine Theatervorstellung über die Schwelle der Industrieanlage treten darf, in die Höfe zwischen hohen Gebäuden, rauchenden Schloten. In ein Meer aus Lichtern, weil jede Außentreppe von unzähligen Neonröhren beleuchtet ist.
Anemos findet zusammen für die Geschichte von Titania, Oberon und dem Müxerl, und auf kaltem Beton in beißender Luft wird eine andere, wärmere Jahreszeit beschworen und dieses andere, das größte Fest. Die Theatervorstellung kehrt jedes Jahr wieder, immer und immer wieder drängt sich die Menge auf dem Vorplatz, Chor und Zuschauerinnen mischen sich, und jedes Jahr wieder beginnt es mit demselben Satz:
»Walpurgis kehrt wieder, immer und immer wieder«, erzählt der Chor, »und das ist es wohl, was es so wertvoll macht.«
Die Menge wird still, sobald der Chor spricht. Das Flüstern verstummt, noch raschelt es allerdings ein wenig, noch haben nicht alle einen guten Platz gefunden. Manche reiben sich die Arme, steigen von einem Fuß auf den anderen. Auf vielen Plätzen der Stadt brennen heute hohe Feuer, in die die Bewohnerinnen von Anemos das werfen, was sie sich ersehnen – manche schreiben es auf Zettel, manche bringen kleine Objekte mit, die etwas beschwören sollen: Samen für Früchte, Knochen für Fleisch, Windeln für Kinder. Denn heute ist Imbolk – das Fest, das den Frühling ankündigt, obwohl noch Winter herrscht. Imbolk, das den Beginn des neuen Jahres markiert, und heute werden Vorsätze gefasst, Entscheidungen werden getroffen. Walpurgis und damit der Sommer sind noch Monate entfernt, noch kann man sich auf die Rückkehr der Sonne freuen – allzu bald werden die meisten sie wieder wegwünschen, sie verfluchen, und viele an ihr zugrunde gehen.
»Wir, die wir in Anemos leben, betrauern, was geht, und wir begrüßen, was kommt«, singt der Chor, »aber wir haben gelernt, nur zu feiern, was wieder und wieder geht, was wieder und wieder kommt, alles andere tut zu weh und nicht alles lässt sich ertragen. Wir tragen genug – denn zu vieles in dieser Stadt steht still und ist zugleich beständig im Wandel. Hitze und Kälte, Dürre und Feuchtigkeit. Und vieles geht und kommt nicht wieder, und manches kommt und frisst anderes auf. Wir halten uns in den Armen, drehen uns im Kreis, und wieder ist die Welt um uns eine andere geworden. Trotzdem müssen wir weiter und weiter erzählen, was bleibt uns auch übrig?
Es bleibt uns die Zunahme und Abnahme des Lichts. Es bleibt uns der ewige Wandel der Sonnenstunden, der nie stehen bleibt, der gleich geblieben ist in seiner Unbeständigkeit.
Das ist das Maß unserer Zeit, zugleich das Maß unseres Lebenswillens – der Abstand zwischen den Jahresfesten. Ein Fest noch, sagen wir, wenn die Feuer unsere Felder auffressen, ein Fest noch, wenn wir über Wochen hinweg nicht aus unseren Höhlen kriechen können. Dieses Fest auslassen, sagen wir, wenn die nächste Seuche wütet, und wir feiern umso lauter, sobald es wieder geht. Dicht gedrängt stehen wir hier, weil wir uns wieder drängen können, weil wir Schulter an Schulter stehen können, und es treibt uns, treibt uns ins Theater.«
Ein Raunen geht durch die Menge. Niemand spricht mehr sehr gerne vom vergangenen Jahr. Das nächste Samhain, das wissen alle, wird gewaltig werden, viel wird zu verabschieden sein beim nächsten Tag der Toten. Doch als der Chor die Fragen stellt, die jedes Jahr gestellt werden, hat das Publikum die Antwort bereit, wie immer.
»Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene?«, fragt der Chor.
Die Menge antwortet: »Ins Theater!«
»Du hast zerrissene Stiefel?«
Und wieder tönt es: »Ins Theater!«
»Du hast nichts zum Tauschen und doch Hunger?«
»Ins Theater!«
»Du legst Vorräte an und versteckst sie gut?«
»Theater!«
»Du lebst in dieser Stadt, weil du sonst nirgends leben kannst?«
»Theater!«
»Dein Körper ergibt sich den Tumoren?«
»Theater!«
»Du stehst vor dem Freitod?«
»Theater!«
»Du hasst und verachtest die anderen und kannst sie dennoch nicht missen?«
»Theater!«
»Man borgt dir nirgends mehr, lässt dich nirgends mehr ein?«
»Theater!«
Immer lauter wird die Menge, bis sie schreit, sich das Zögern aus dem Leibe schreit, bis sie sicher ist, dass das die Antwort auf alles ist: »Theater!«
»Es treibt uns, treibt uns auf den Vorplatz«, spricht der Chor, »jetzt, da die Tage länger werden, müssen wir spielen, müssen wir sprechen, müssen wir Pläne fassen. Und wir, der Chor, sind unter euch, wir gehören zu euch, denn jedes Jahr werden wir unter euch ausgewählt. Wir stehen dort, wo ihr steht, sind von euch kaum zu unterscheiden. Und gemeinsam warten wir, dass sich die Tore zum Schloss öffnen, dass wir eintreten, dass wir in den Höfen eine Bühne finden und uns endlich vergessen dürfen in einer weiteren Geschichte.«
2
Anemos heißt die Stadt, die die Industrieanlage umgibt. Sie heißt so nach der Blume, die an jeder Ecke blüht und zu einer ganz anderen Gattung gehört als jene, die Titania in ihren Treibhäusern hochzieht. Die Wiesen an den Ufern des Flusses, der die Stadt durchschneidet, sind übersäht von Anemonen, von kleinen weißen Blüten, die sich dicht an dicht im Wind wiegen. Zumindest in jenen Zeiten, in denen es noch regnet.
Titanias Knospen locken Fremde in die Stadt, die Anemonen hingegen stellen sicher, dass es mehr als genug Wohnraum gibt und fast genug Essen und dass das trinkbare Wasser meistens für alle reicht. Sie sorgen dafür, dass weite Teile der Stadt schon vor langer, langer Zeit verlassen worden sind, überwachsen und still, obwohl hier weniger Dürre herrscht als anderswo, obwohl selbst in der schlimmsten Sommerhitze ein leichter Wind geht, obwohl hier jede immer noch einen Unterschlupf gefunden hat, in einem Keller, in einer verlassenen Wohnung, unter einem Steg.
Geschichten ändern sich, müssen sich beständig ändern, weil Fluten kommen und dann Brände, neue Krankheiten und alte, weil Stürme das Land heimsuchen und dann wieder die Temperatur so weit fällt, dass der Boden friert, und doch sind die Geschichten über die Anemonen sehr alt und immer die gleichen geblieben.
Kleine, weiße, herzförmige Blüten, die die gelben Staubblätter umgeben. Windröschen heißen sie auch, weil jeder zu starke Windstoß ihre Blütenblätter abreißen und überall verteilen mag. Sie wurden vor sehr langer Zeit zur Warnung erschaffen und wachsen immer noch dort, wo vieles kurzlebig ist, nicht nur sie selbst. Wo sie wachsen, ist der Boden giftig, das Wasser auch, und alles strahlt. Tumore entfalten sich in Körpern wie noch mehr Blüten.
Die Geschichten über diese Körper hingegen ändern sich sehr wohl. Es gibt Körper, die den Windröschen keinen fruchtbaren Boden bieten. Es gibt jene Körper, die trotz der Tumore weiter atmen und sich bewegen können. Alles andere, das sich in dieser Stadt niederlässt, stellt sich auf einen frühen Tod ein.
Nie aber ist Anemos so belebt wie zu Walpurgis, dem Fest, für das aus allen Himmelsrichtungen angereist wird. Für manche dieser Gäste ist die Nachbarschaft zu den weißen Blumen nichts Ungewöhnliches – sie wachsen vielerorts und unzählige Siedlungen und Städte könnten Anemos genannt werden. Warum nur die eine Stadt diesen Namen trägt, ist zwischen den Geschichten durchgerutscht und verloren gegangen – vielleicht ist es ein Ausdruck der Liebe für diesen Ort gewesen, die sich trotz des allgegenwärtigen Todes erhalten hat.
Manche Gäste kommen von weiter Ferne, weil Anemos an vielen Orten bekannt ist, weil an wenigen anderen Orten die Jahresfeste so wild gefeiert werden wie hier. Weil Tanz und Spiel und Vergnügen dabei über alle Grenzen hinweg fast so hoch gehandelt werden wie die anderen Güter der Stadt, Wärme und Energie.
Und diese Gäste von Ferne sehen vielleicht zum ersten Mal die Wiesen weiß von Blüten. Schön ist es hier, sagen sie dann, schön und gefährlich. Sie nehmen die Gefahr auf sich, für einen Tag oder zwei, haben ihren eigenen Proviant mit, essen von keinen Tellern und trinken aus keinen Bechern, waschen sich nicht mit Anemos’ Wasser und legen sich nicht auf Anemos’ Erde. Sie gehören nicht hierher und ihre Zeit hier ist begrenzt. Doch selbst sie tauschen, sofern sie wohlhabend genug sind, ihren Besitz gegen Titanias schwere Knospen, legen sich diese Knospen auf den Bauch und denken an Hitze und Schweiß, an Lust und Rausch.
3
Die Menge bewegt sich unter Schieben und Rufen, macht Platz vor den Toren des Schlosses – denn alle wissen, dass es nun nicht mehr lange dauert, bis Titania auftreten wird.
»Jetzt ist die Zeit nach Jul«, erzählt der Chor, »nach der Wintersonnenwende. Es ist die Zeit nach den Raunächten zwischen den Jahren, die nach Geschichten verlangen, die Tage sind noch kurz und die Welt finster. Es trieb die wilde Jagd der Schwestern durch unsere Stadt, grau und schattenhaft dieses wütige Heer, und sind die Unholden auch weitergezogen, so treibt es immer noch Stürme und manchmal, wenn wir Glück haben, glänzenden Schnee. Wir haben uns verkrochen, erst langsam wagen wir uns wieder hervor. Noch verbrennt der Frost unsere nackten Sohlen, noch schlafen viele von uns in ihren Bauten oder unter dem Eis. Wer sich nicht unter eigenem oder fremdem Fell, unter genug Schichten Stoff verstecken kann, muss frieren. Die Imbolk-Feuer lodern, doch die Wechselwarmen unter uns wollen sich noch kaum bewegen. Und doch werden wir heute von Walpurgis sprechen, vom Fest der kommenden Hitze, und mit ihm von allem, was Walpurgis bedeutet: vom Tanz!
Noch einmal sich aneinander reiben, noch einmal einander packen im Spiel, noch einmal da sein, wirklich da. Noch einmal triumphieren.
Ja sagen, wenn man Ja sagen will, Nein sagen, wenn man Nein sagen will, auch das, denn das Ja und das Nein bedingen einander, können ohne einander nicht bestehen, umarmen einander im Tanz, müssen beide willkommen geheißen werden, sonst sind wir verloren.«
»Sonst sind wir verloren!«, ruft die Menge.
»Verloren, verloren, wie wir es zu lange waren«, klagt der Chor, »die Angst vor dieser alten Zeit ist zu nah. Getanzt wird zu Walpurgis auf den Straßen und im Schloss, um die Klärbecken, auf Wiesen und Beton, zwischen Tomatenstauden, und die Meisterin des Tanzes ist Titania.«
»Titania, Titania!«
Hier schiebt sich nun endlich das Tor des Schlosses zur Seite, und Titania, von der Menge herbeigerufen, tritt hinaus auf den Vorplatz, auf die freie Fläche, die das Publikum ihr gelassen hat.
Titania mit ihren schweren Hufen und ihrem ausladenden, mit bunten Bändern geschmückten Geweih – so groß ist sie, dass sie die meisten der Zuschauerinnen überragt. Sie trägt einen langen Rock und an ihrem Gürtel den Schlüssel zum Treibhaus und die Schere, die zuschnappen und Knospen von ihren Stängeln trennen kann, auf dass sich diese Knospen später öffnen und auf Haut legen.
Auf ihrem Rücken krallt sich eine riesenhafte Spinne fest, in Titanias Fleisch verbissen. Zwei Spinnenbeine ruhen auf Titanias Schultern, zwei andere betasten ihre Hüften.
»Titania, Meisterin des Tanzes!«
Wie manch andere Figuren des Stückes ist auch Titania keine Darstellerin, spielt sich stattdessen selbst, Jahr für Jahr. Sie wird das Publikum durch beinahe das gesamte Stück begleiten, so wie sie die Stadt durch das gesamte Jahr führt, Fest nach Fest anleitet. Umso hungriger ist die Menge nach ihr.
Sie verbeugt sich tief vor allen, sagt: »Ich bin Titania, sie.«
Und viele aus dem Publikum rufen ihr den eigenen Namen zu, die eigenen Pronomen, ob sie, er, es oder xier, nin, per, hän: »Titania, Titania«, rufen sie, »wenn du schon nicht mit mir spielen magst, so merk dir nur meinen Namen, ach, nur ein Viertelstündchen lang!«
»Lade uns ein!«
Und Titania öffnet die Hand, weist zum Tor.
»Ich, Titania, weiß, wer durch welche Türen des Schlosses treten darf, weiß, wer von welchen Tellern, Schüsseln oder Trögen essen darf; weiß, wer mit wem spielen darf und wer mit wem tanzen. Ich bin die Meisterin des Tanzes, ich besitze den Schlüssel zu den Treibhäusern, und ja, für heute, für diese Nacht und zu diesem Theaterstück lade ich euch ein!«
Die Menge bricht aus in Jubeln und Applaus, in ohrenbetäubendes Getöse.
Titania wartet nicht auf das Verebben des Klatschens, der Jubelschreie, dreht sich stattdessen um, geht voran in das Schloss.
Und die Theaterbesucherinnen folgen ihr, zugleich gierig und vorsichtig, halten gerade noch Abstand, »Titania, Titania!«, rufen sie, »schau mich nur einmal an, ach, nur ein kleines Weilchen!«
Und sie zögern, bevor sie das Gelände der Industrieanlage betreten, die meisten von ihnen kennen es nicht gut. Es ist weitläufig, das Schloss, manche Anlagen erlaubt, manche nicht. Höfe mit metallenen Wasserbecken und bepflanzten Außenbereichen, die so früh im Jahr noch kahl sind, in denen zu Walpurgis aber Buschwerk, die allgegenwärtigen Tomatenpflanzen und kleine Wäldchen Schutz vor Blicken bieten werden. Von einer Halle wissen die Bewohnerinnen von Anemos, dass sie gefliest ist, dort gibt es Haken und in die Wand geschraubte Ringe, an denen Seile und Ketten befestigt werden können. Über diese Halle erzählt man sich wilde und zugleich so zärtliche Geschichten, vom Fliegen und Abtauchen, vom Loslassen, vom Gehaltenwerden.
Und dann erreicht die Gesellschaft den Hof mit den Klärbecken. Die Bühne wurde neben einem der Becken errichtet, spiegelt sich im Wasser. Ein Vorbau reicht wie ein Steg in das Becken hinein. Auf der Bühne selbst versperrt ein Tor – nicht unähnlich dem Eingangstor des Schlosses – den Blick auf den hinteren Teil. Und um diese Bühne scharen sich alle. Die Zuschauerinnen strecken die Hälse auch zum Becken hin, aber sie sehen das Müxerl nicht, oder besser gesagt, sie sehen nur seine bunten, glimmenden Bakterien, die im Wasser tanzen. Noch hält das Schleimtierchen sich versteckt, oder vielleicht ist es auch noch zu sehr mit seiner Arbeit be schäftigt.
»Müxerl!«, ruft eine Stimme, und eine andere nimmt den Ruf auf, »Müxerl, zeig dich!«
»Müxerl, wir wollen dich sehen!«
»Noch ist es dafür nicht die Zeit«, entgegnet Titania, steigt ohne Eile auf die Bühne, geht bis zum Rand des Stegs, blickt hinunter ins Wasser. Die Farben tanzen auf ihrem Geweih, unruhig, immerzu in Bewegung. »Seid ihr denn nicht zufrieden mit Müxerls Lichterspiel? Geduldet euch.«
»Das Lichterspiel mag uns wohl gefallen«, ruft es rundherum, »aber das Müxerl, das Müxerl!«
»Keine Sorge, es wird auftreten. Zuerst aber erzähle ich euch von Oberon.
Ihr ruft nach dem Müxerl, wie es heute und jetzt ist, aber die Geschichte, die wir auf dieser Bühne erzählen werden, beginnt nicht heute. Nein, sie hat vor vielen Jahren begonnen, als wir vom Müxerl noch kaum etwas wussten. Das große Quallentier Oberon hingegen war stadtbekannt und wohnte statt dem Müxerl hier, in genau diesem Becken. Viele solcher Becken gibt es in diesem Schloss, und manche sind von Algen bevölkert und manche von Pilzen, in diesem aber saß damals noch xier.«
»Oberon, xier«, wiederholt die Menge.
Titania nickt.
»Wir nennen xien ein Quallentier, dabei wissen wir dieses Tier nicht einzuordnen, nicht vor und nicht nach seinem Tod, können ihm immer noch nicht mit Begriffen beikommen, so wie wir vielem nicht mit Begriffen beikommen können. Und doch war Oberon wichtig, denn xier hat über viele Jahre das Wasser gereinigt, das wir getrunken haben.«
»Hat das Gift abgebaut«, ergänzt der Chor.
»Hat Leben ermöglicht«, sagt Titania. »Und ich sorgte damals noch für Oberons Wohl. Ich habe Oberon hierhergebracht vor langer Zeit und kümmerte mich nun um xien, setzte mich an den Rand xieses Beckens, und wir sprachen leise miteinander. Das war mein Privileg, das war meine Pflicht. So leise sprachen wir, dass es von den Wänden der umliegenden Gebäude nicht hallen konnte, und ich bot Oberon meine Dienste an, xier lehnte freundlich ab, fast entschuldigte xier sich dafür, dabei hatte ich genug Spielpartnerinnen.
So ging es nun schon seit Jahren, es ist lange her, dass Oberon die Tentakel aus dem Becken gereckt und mir entgegengestreckt hat zur Betastung. Und ich fragte nicht nach, machte nur jedes Mal mein Angebot, allein schon aus alter Freundschaft. Denn ich wusste doch, dass Oberon andere gefunden hatte, die xiem Gesellschaft leisteten, mit xiem spielten. Ich stellte oft genug die Passierscheine aus, sah manche Namen nur einmal auf ihnen, sah manche Namen immer wieder. Auch das Müxerl war unter diesen Namen, immer öfter. Und es war besser so, dass Oberon nicht ganz alleine war, das sagte ich mir, und dasselbe sagte auch das Schuppentier. Wie sollte ich es xiem also übel nehmen? Ich tat es nicht. Froh war ich, dass Oberon immer noch zu dem kam, was xier brauchte, auch wenn ich selbst es xiem nicht mehr geben konnte. Und manchmal hielt ich nur Oberons Greifarm, während wir redeten, weil wir einander vermissten, auch wenn die Zeit unserer Spiele vorüber war.
Dann strich ich über die Haut, und wie verletzlich Oberons Tentakel doch an der Luft waren, nicht für diese Schwere gemacht. Gallerte, die sich auf meinem Schoß gerade noch so in Form hielt, wenn nur niemand zu fest drückte.
Ich fragte nicht nach, warum xier ablehnte, immer und immer wieder. Ich hatte kein Recht, den Grund zu erfahren, weil es nie einen Grund für ein Nein braucht, ein Nein muss sich genügen.«
Der Chor stimmt zu, singt: »Oberons Nein war zu feiern, wie Oberons Ja einmal gefeiert worden war.«
4
»Doch genug davon«, sagt Titania dann, ihr Ton auf einmal fast scharf, »auf Oberon werden wir schon noch zurückkommen. Doch es geht heute auch um Walpurgis, nicht wahr, denn unsere Geschichte hat zu einem Walpurgis begonnen. Ihr wollt also mehr über meine Knospen hören?«
»Ja! Deine Knospen!«
Sie nickt und schreitet langsam wieder in die Mitte der Bühne.
»Noch ist es kalt, bald wird es zu heiß werden. Noch erzählen wir nur von Walpurgis, spielen es nach auf den Brettern des Theaters, bald werden wir es wieder leben. Zu keinem anderen Fest habe ich so viel zu tun. Ich stehe früh auf, um in den großen Treibhäusern meine jährliche und wichtigste Ernte einzubringen.«
»Zeig sie uns, zeig sie uns!«, ruft die Menge. »Öffne die Türen!«
Titania schüttelt den Kopf.
»Nicht dieses und nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes. Nicht zu Imbolk und auch nicht zu Walpurgis selbst. Nicht euch und auch nicht anderen Gästen. Das Schloss mag euch heute einlassen, doch die Treibhäuser bleiben allen außer mir verschlossen, das wisst ihr nur zu gut.
Stellt euch stattdessen einen weitläufigen Hof vor, von Stacheldrahtzäunen umgrenzt, darin die Glashäuser. Die Scheiben milchig, man erkennt kaum mehr als Schatten dahinter. Wenn ich jedoch eintrete, trete ich in feuchte Luft, bin umgeben von großen Pflanzen mit langen Stielen, Blättern, die sich in die schmalen Wege zwischen den Beeten drängen. Ganz anders als alles, was sonst in Anemos wächst: ausladender, bunter, saftiger.
An anderen Tagen würde ich die Pflanzen kontrollieren, die Feuchtigkeit der Erde, über die Blätter streichen, hier und dort etwas wegschneiden, neue Triebe suchen. Auch heute streichle ich Blütenblätter groß wie Badewannen, staube sie ab, wiege manche Früchte in den Händen, klopfe an ihnen, sind sie schon reif?