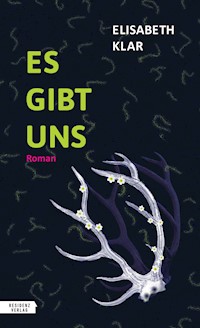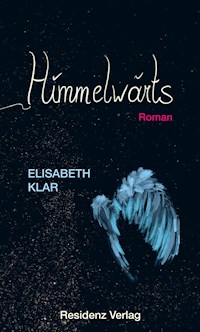Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bilderreicher Roman, der uns ein großes Gefühl unserer Zeit hautnah spüren lässt: die Angst Wer ein Jahr in der Antarktis verbringt und die Polarnacht in einer Forschungsstation erträgt, muss Ausdauer und Entschlossenheit haben. So eine scheint Erika zu sein: Die renommierte Bioakustikerin lauscht den Walen, geht auf lange Tauchgänge, sucht beim Aikido die Herausforderung. Kaum jemand weiß, dass sie das alles tut, um eine lähmende Angst zu bekämpfen, die Angst vor einer Welt, die sie zu überwältigen droht. Und dann taucht die Musikwissenschaftlerin Judith, eine junge Frau voller Widersprüche, in Erikas Freundeskreis auf. Als die beiden sich annähern, ahnt Erika: Judith hat sich von jener Macht, gegen die Erika ankämpft, überschwemmen lassen. Vielleicht ist sie verrückt geworden, vielleicht hat sie aber auch einen Gegenzauber gefunden und sich gerettet …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Klar
Wasser atmen
Roman
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch ein Stipendium des Bundesministeriums für Kunst und Kultur unterstützt.
Der Verlag dankt für die Unterstützung
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2017 Residenz Verlag GmbHSalzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comunter Verwendung eines Fotos von Sandra VollmarLektorat: Jessica Beer
ISBN e-Book 978 3 7017 4553 1
ISBN Printausgabe 978 3 7017 1679 1
Gewidmet Sebastian Gärtner,der neunzehn Tage langein Wachtelei in seiner Hand ausgebrütet hat
Inhalt
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Hinweis
I
1.
Zwischen dem Interview mit der Studentin und dem Aikido-Training bleibt nicht mehr viel Zeit. Es reicht, um das Wasser für die Instantnudeln aufzustellen. Es reicht, um die Trainingskleidung in den Rucksack zu stopfen, Erikas Brust brennt. Und was, wenn du heute nicht gehst? Du musst am Montag die Lehrveranstaltung halten, du kannst es dir nicht leisten, dann verletzt zu sein. Erika zieht ihre Waffentasche zwischen den Regalen hervor, wirft sie zum Rucksack auf das Sofa, nimmt die schmutzigen Kuchenteller und bringt sie in die Küche. Natürlich werde ich gehen. Was, wenn Juri heute Koshinage macht? Dann wird er eben Koshinage machen. Das heißt dann, auf der Hüfte des anderen zu hängen, kopfüber und ausgesetzt, nach dem Kragen des Partners zu greifen, und da fällt sie schon, kopfüber dem Boden entgegen, kann nicht anders, als die Augen zuzupressen, nur das Kinn zur Brust! Wenn sie einen Fehler macht, flach auf den Rücken fällt, und alles vibriert, denkt sie: liegen und atmen. Sie will das nicht. Wieso sollte sie sich wieder darauf einlassen. Sie sieht es nicht ein.
Du hast später noch genug Zeit, Angst zu haben, Erika. Die Tassen in die Küche bringen, das Wasser für die Instantnudeln kocht schon fast.
Als sie das Haus verlässt, mit dem Rucksack und der Waffentasche über der Schulter, bleibt sie kurz stehen, weil sie weit oben den Specht hört. Er klopft wieder auf das Metallrohr, wahrscheinlich einen Sendemast, weithin hörbar über die Gassen hinweg. Dieser Baum verhilft dir zu keinen Würmern, Specht, aber zu einem großen Revier. Hört mich, all das hier gehört mir, mir, mir. Er übertönt die Singvögel im Park nebenan mit Leichtigkeit. Was hat sie eigentlich in dem Interview gesagt? Auch etwas über Raum. Sie kann sich kaum mehr erinnern. Sie hätte die Studentin auf ihren Metallrohr-Specht hinweisen können. Ihr Specht, der nicht ihr gehört.
Als sie in der Umkleide ankommt, hört sie am Geräusch des Aufschlagens aus dem Turnsaal, dass noch Matten hergeräumt werden. Wenn es schlägt, weiß sie immer, ob sie zu spät ist oder nicht, denn das Schlagen der Matten auf den Boden und das Schnappen der Menschen auf die Matten, wenn sie von anderen geworfen werden, ist leicht zu unterscheiden. Nur Stille ist verdächtig und lässt Erika auf die Uhr blicken. Es könnte noch niemand im Turnsaal sein. Es könnten alle bereits in einer Reihe knien, langsam ein- und ausatmen, die Hände im Schoß, den Alltag loszulassen versuchen, sich freimachen für den Kampf: Hier musst du zur Gänze anwesend sein.
Sie bindet den Hosenrock, schlüpft in die Sandalen, nimmt ihre Waffentasche. Sie tritt in den Turnsaal, verbeugt sich, es werden gerade die letzten zwei Matten aufgelegt. Waffentasche hinlegen und öffnen, Holzschwert, Stab und Holzdolch bereitlegen, zu den Matten gehen und sich umdrehen, aus den Sandalen auf die Matten schlüpfen, sich umdrehen, verbeugen, sich hinsetzen in die Reihe. Viele sind sie heute nicht. Cécil, Christian und ein paar Anfänger. Und da ist schon Juri, tritt auf die Matte, setzt sich vor sie in die Mitte, legt die Hände in den Schoß, die anderen tun es ihm gleich.
Den Alltag loslassen, sie denkt an das Interview, ja, auch Wale können an Taucherkrankheit sterben. Das hätte sie so nicht formulieren sollen, so vereinfacht könnte es die Studentin auch in einer Zeitschrift lesen, und vielleicht schreibt sie das dann so in ihre Arbeit und dann! Ein- und ausatmen, aus damit, sie hat nicht mehr viel Zeit. Sie weiß nie, wie lange Juri sie sitzen lassen wird, bevor er aufsteht, bevor er die erste Technik vorzeigt. Sie muss das Interview loslassen, sie muss bald ganz anwesend sein. Bist du nicht aufmerksam, reagierst du langsam oder falsch, und wenn der andere deine Gelenkshebel versperrt, tust du dir weh. Da nickt Juri schon Cécil zu, steht auf und streckt Cécil die Hand entgegen, der wiederum auf Juri zukommt und dessen Hand greift. Aihanmi Katatedori: Die linke Hand greift die linke Hand. Erster Angriff.
Nach dem Aikido-Training wollen alle noch etwas trinken und Erika geht mit. Jetzt ist ihre Brust frei, und wie immer weiß sie nicht mehr, was die Brust vor dem Training so eng gemacht hat. Sie hat es ja doch wieder überlebt. Juri hat zwar wieder einmal eine Technik mit ihr vorgezeigt, hat sie geworfen, aber auch das ist nicht weiter schlimm gewesen. Sie hat sich wieder einmal nicht das Genick gebrochen, nicht die Schulter ausgekugelt, nicht das Kreuzband gerissen, sie kommt ja doch jedes Mal heil davon. Was ihr die Brust eng macht, weiß sie immer, ist nur um die Ecke, immer ganz nah. Was macht es schon. Sie ist trotzdem zum Training gegangen, ist das nicht das Einzige, was zählt? Wiederholung, trotzdem Ja sagen. Annehmen, was der andere dir gibt, die Zukunft vergessen. Jedes Mal wieder. Und jetzt ist ihr Körper rechtschaffen müde, und sie gehen durch die nächtlichen Gassen zum nächsten Wirt.
Wie so oft sind sie die einzigen Gäste, stapeln Rucksäcke und Waffensäcke in eine Ecke, zerren die Stühle aus ihrer Umklammerung mit anderen Stühlen. Der Gastraum ist halbdunkel, Juri wendet sich gleich an einen der Anfänger, dessen Namen Erika sich noch nicht gemerkt hat, beugt sich weit über den Tisch, verwickelt ihn in ein Gespräch über den kommenden Lehrgang.
»Die Musikstudentin war übrigens heute da«, meint Erika zu Cécil neben ihr, der ihr, gemeinsam mit Karo, die besagte Studentin schließlich aufgehalst hat.
»Ah, Judith Lackner«, sagt er. »Und?«
»Was soll schon gewesen sein. Etwas konfus in ihren Fragen war sie. Ich habe das Thema ihrer Diplomarbeit nicht so richtig verstanden.«
Was bringt man in der Musikwissenschaft den Studierenden über wissenschaftliches Arbeiten eigentlich bei? Erika ist sich nicht sicher, es ist ein geisteswissenschaftliches Studium, so richtig forschen werden die dort wohl nicht. Dann denkt sie, sei nicht dumm, was würde Karo sagen, wenn du solche Gedanken aussprichst? Naturwissenschaftliche Borniertheit, würde sie sagen. So eng darf man Forschung nicht sehen.
»Sie sucht noch«, sagt Cécil, als wäre das Suchen nach einem Thema mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Diplomarbeit vollkommen legitim.
»Sie sollte auch mal was finden«, sagt Erika. »Sie sollte das hinter sich bringen, ihren Titel abholen und sich für die Dissertation dann ernsthaft etwas überlegen. Sie verzettelt sich.«
»Weil wir, wir würden uns nie verzetteln, schon gar nicht bei der Diplomarbeit, würde uns nie einfallen.«
Kein Grund, sarkastisch zu werden, Cécil. Er grinst sie an, mit dem Grinsen sagt er: Du bist überheblich, Erika. Als wärst du nie Judith Lackner gewesen.
»Judith hat mir jedenfalls gefallen. Ich habe ihre Fragen gemocht, und wenn man nur ein bisschen nachhakt, kriegt man so einiges mit. Wenn ich ehrlich sein muss, sie hat mich ein bisschen an dich erinnert«, meint Cécil.
Wenn ich ehrlich sein muss. Erika fragt sich, wann sie Cécil gezwungen hat, ehrlich zu sein, und ob sie seine Aussage nun als Kompliment oder Kritik auffassen soll.
»Ich weiß, dass ich zu viele Interessen habe«, sagt sie.
»Ich sagte doch, Judith Lackner hat mir gefallen«, sagt Cécil. »Und du machst deine Forschung sicher systematischer als sie.«
»Schön, dass du mich für systematischer als Judith Lackner hältst.«
»Das meinte ich doch nicht so.«
»Wie hast du es dann gemeint?«
»Schwer zu sagen«, sagt Cécil und zuckt mit den Schultern. »Als ich sie gesehen habe, habe ich einfach sofort an dich gedacht. Noch so ein stilles Wasser. Und weißt du, sie wollte sich in ein bestimmtes Café nicht setzen, die Wände haben ihr dort zu sehr gehallt.«
»Und?«
Cécil lacht.
»Ich weiß nicht. Auf so was würdest sonst nur du kommen.«
»Ich weiß nicht, Cécil.«
Erika weiß nicht, nein. Hallende Cafés sind nicht nur bei Akustikern unbeliebt. Die Idee, sie zu vermeiden, könnten eine ganze Menge Menschen haben. Sie mag es ohnehin nicht, wie er ihre Überempfindlichkeit manchmal betont. Welches Bild von ihr will er hier zeichnen? Erika Wawracek mit den besonders sensiblen Ohren? Sie hat bei allen Hörtests vollkommen durchschnittlich abgeschnitten.
Später geht Erika heim, horcht auf ihre Schritte und überlegt, ob sie nicht doch die Kritik annehmen sollte, die in Cécils Kommentar versteckt gewesen sein könnte. Weil sie immer Gefahr läuft, sich zu zerfasern, zwischen den Forschungsreisen, dem Aikido, zwischen Kongressen und Wochenenden, an denen sie nur ins Schwimmbad will, von einer Seite zur anderen tauchen, jenen Wochenenden, an denen sie die Pressluftflaschen an den Rücken schnallt und noch tiefer geht, jenen Wochenenden, an denen sie in der Uni vor dem Computer sitzt und Daten eingibt, rechnet, sich nicht einmal gerne von dort wegbewegt, um sich ein Glas Wasser zu holen. Sie weiß das und auch, dass man ihr jederzeit vorwerfen könnte, vermutlich mit Recht, sich immer zu wenig auf eine Sache zu konzentrieren.
Gut, an alldem ist Cécil ebenso schuld. Mitschuld, korrigiert Erika sich, legt zu Hause ihren Mantel ab, sie hätte nicht darauf einsteigen müssen. Sie zieht sich aus, in der Dusche denkt sie, sie steigt auf Cécils Vorschläge recht häufig ein. Das fällt ihr auf. Vielleicht sollte sie ihr Urteilsvermögen gründlicher hinterfragen. Sie dreht das Wasser auf. Sie schließt die Augen, weil sie das wenige Bier trotzdem spürt. Sogar hier ein Leichtgewicht.
Du machst wohl nichts, Erika, ohne es dir dreimal zu überlegen.
Cécil hat gesagt, geh dort hin, und sie hat ihn damals kaum gekannt, und ist dennoch hingegangen. Sie hat es sich vorher dreimal überlegt.
Cécil ist neben ihr in der Statistik-Vorlesung gesessen, drahtig und lang, und neben ihm ist der dünne, lange Sack gestanden. Deswegen hat sie ihn angesprochen.
»Nur Holz«, antwortete er auf ihre Frage.
»Nur Holz?«
»Bokken, Jo und Tanto. Habe ich aber nur aus Werbegründen dabei.«
»Was?«
»Du weißt schon, Aufmerksamkeit erregen, Fragen provozieren.«
Er lachte, gab zu, dass er die Waffen für das Training später brauchte, und erzählte ihr von dieser japanischen Kampfkunstart Aikido, bei der man niemandem wehtun will und in der es vor allem um Hebel geht. Und dann beugte er sich vor und wollte wissen, wer sie denn eigentlich sei.
Ein paar Wochen später war sie in dem niedrigen Trainingsraum gekniet. Matten bedeckten beinahe den gesamten Boden, die Matten selbst waren rau von unzähligen winzigen, aber genau quadratischen Hügelchen – Rutschschutz. Und schon allein aus diesem Grund hatte sie sich hierher gesetzt, wegen dieser von Matten vollständig bedeckten Fläche in all den Videos über Kampfsportvorführungen. All die Leute in Weiß, die durch die Luft springen und fallen, als wären sie Fächer, die man schwenkt. Das Geräusch, wenn sie auf die Matte aufprallen, ist immer ein Schnappen: hell. Es war so weit weg von ihr, dieses Geworfenwerden, Aufschlagen, sofort Aufstehen. Sie saß dort, im selben Raum, aber das hatte gar nichts mit jemandem wie ihr zu tun, davon war sie vollkommen überzeugt. Der Lehrer machte da vorne etwas mit Cécil, und Cécil flog, schlug auf die Matte, stand wieder auf, aber mit ihr zu tun hatte das nichts.
Der Lehrer sagte ein Wort, das Erika nicht verstand, und meinte, dass sie das jetzt doch alle ausprobieren sollten. Sie verbeugte sich, wie es die anderen taten, stand auf, verbeugte sich vor dem Mann, der zu ihr getreten war, etwas wollte er also von ihr: mit ihr trainieren.
Außerdem sagte er, er heiße Christian.
»Willst du angreifen oder lieber angegriffen werden?«, fragte Christian.
Was für eine Frage.
Die anderen um sie herum bewegten sich schon, drehten sich umeinander, ein Tanz? Es sah ein wenig so aus, dann traf einer auf dem Boden auf. Also doch nicht. Aber müssten die nicht alle zusammenstoßen, auf ihr Genick fallen, sich die Füße verdrehen, mit den Zehen in den Mattenspalten hängen bleiben? Sie hörte das Schaben, wenn steife Kleidung über steife Kleidung strich, hin und wieder ein Schlagen auf den Mattenboden, Cécils Lachen. Manche ganz in Weiß gekleidet, manche in blauen Hosenröcken, die sich auffalteten im Flug, das waren die Fortgeschrittenen, das hatte sie schon verstanden. Sie selbst noch in T-Shirt und Trainingshose griff Christians Jacke, wie er es ihr zeigte. Wie viel weicher der Stoff ihrer eigenen Kleidung war! Wenn er sie anfasste, dachte er sich dann: Diese Neue gibt mir noch nicht einmal über ihre Kleidung Widerstand? Die anderen, meinte sie plötzlich, trugen ihre Trainingskleidung wie eine Rüstung, die sie nicht hatte.
Später lernte sie, dass all diese Kleidungsstücke Namen hatten, Gi, Hakama, all die Holzwaffen, Jo, Bokken, Tanto, all die Techniken, Shihonage, Koshinage, Ikkyo. Du trittst ein in einen Raum, legst deine Straßenkleidung ab, du legst fremde Namen an und akzeptierst damit bereits neue Regeln: wann sich verbeugen, wann still sein und zusehen, wann selbst ausprobieren. Juri kommt vorbei und schiebt deine Hand an den Platz, an den sie eigentlich gehört.
Sie hat trotzdem ein Jahr gewartet, bis sie sich Trainingskleidung gekauft hat, um sicherzugehen: Sie wird bleiben.
2.
Wie kann ein so winziger Mensch so riesig sein, fragt Judith sich, als sie das Stiegenhaus hinuntergeht, und denkt: fast, als liefe ich vor ihr weg. Unsinn, aber Erika Wawracek ist nur wenig älter als sie und hat schon viel zu viel geschafft? Wie soll Judith das nachholen? Der Kalender anderer Menschen hat Raum für alles, für Kampfsport, Tauchen, Wissenschaft: Ja, ich habe mich dann schon auf Meeressäuger spezialisiert, aber begonnen hat es mit Vögeln. Von Vögeln zu Walen, wie kann sie einfach so springen, aber sie springt dennoch, schnell, über diese glitschigen Steine: akademische Glaubwürdigkeit.
Judith stolpert, fällt fast.
Sie tritt auf die Straße, die Tür schlägt ihr in den Rücken, jammern bringt nichts, nimm dir stattdessen ein Vorbild. Dr. Wawracek läuft schnell und ohne sich umzusehen, ein ständiges Rennen, Dr. Wawracek springt, rennt an der Spitze.
Rennt an der Spitze wohin? Aber Judith verwechselt mal wieder alles, Dr. Wawracek ist nicht Teil des Problems, sondern dessen, was einmal eine Lösung hätte sein können, bevor es zu spät war: Erika Wawracek steht wie ein Baum an der Klippe und blickt hinunter, sagt, ab hier geht es abwärts. Zumindest weist sie hin auf das Problem der Übersäuerung der Ozeane. Säure, die an den Wänden der Korallen kratzt, sie entfärbt und tötet, die Mikroorganismen langsam zersetzt.
Ein Schlagen auf Metall, Judith bleibt stehen. Links von ihr das Rauschen, Holpern von Autos, aber über ihr schlägt jemand auf hohles Metall. Sie dreht sich herum, sieht nichts, aber sie ist sich sicher. Ein regelmäßiges Schlagen, es hallt.
Zu Hause, als Judith ihren Computer aufdreht und ihre Notizen zur Diplomarbeit durchgeht, erkennt sie, sie hat die Hälfte der Fragen nicht gestellt, aber dafür die falschen. Hätte sie den Fragebogen nicht außerdem mit ihrer Betreuerin absprechen sollen? Sie schlägt ihr Buch mit den Interviewnotizen auf, sieht, wie ihre runde, raumgreifende Schrift in den Zeilen abrutscht, Schnörkel macht, die niemand braucht. Dazwischen, wie Einschnitte, Dr. Wawraceks kleine, zusammengedrückte Schrift, wenn sie für Judith einen Artikel oder eine Website notiert hat. Dr. Wawraceks Schrift drückt sich fast durch das Papier, und Judiths? Sie ist sich auf einmal nicht mehr sicher, was besser ist. Ist auch nicht wichtig – sie hält sich mit Kleinigkeiten auf. Dabei verrinnt die Zeit. Schau in deinen Kalender, deine Abgabetermine drücken schon überall auf dich ein.
Dr. Wawraceks Wohnung ist klein und Dr. Wawracek darin noch kleiner, in ihrem Arbeitszimmer stehen Kisten auf dem Boden, eine offene Kiste mit herausbrechenden Wänden geht über vor Kabelsalat. Alle anderen Kisten sind aus Holz, sie halten sich an ihre Begrenzungen, nur diese eine aus dickem, gefalteten Karton, der an den Ecken durch Plastiknieten zusammengehalten wird. Aber eine der Nieten hat sich gelöst, und so ist die Kistenwand herausgebrochen, die Kartonfaltung öffnet sich, kann endlich ihrer Spannung nachgeben. Trotzdem steht die Kiste da mitten in Dr. Wawraceks Arbeitszimmer, nicht weggeworfen. Dr. Wawracek braucht diese Kabel wohl ständig, um dieses an jenes anzuschließen, braucht dies und das, hat sich nicht die Mühe gemacht, für den Besuch aufzuräumen, ihre Pappkiste zu ersetzen. In den Bücherregalen liegen die Bücher übereinandergestapelt in mehreren Reihen, zwischen zwei Regale ist eine längliche Stofftasche geklemmt. Eine Wohnung in Benutzung, eine Wohnung gefüllt mit Gegenständen, die dazu dienen, etwas zu tun. Auf der Straße vor Dr. Wawraceks Haus hallt es metallisch, Schlag auf Schlag, woher?
Judith dreht ihren Sessel, blickt in ihr eigenes Zimmer. Wenn sie jemanden hierher einladen würde – was würde er dann über sie erfahren? Sie kann es nicht sagen. Da hinten, das Regal, in dem sie früher ihre Schallplatten abgestellt hat, ist jetzt leer. Der Staub hatte die Platten bedeckt, bedeckt jetzt noch Wände und Boden. Die Platten ist sie losgeworden, ihren Staub nicht? Über den Plattenspieler hat sie ein Tuch gebreitet, dabei würde sie ihn gerne einmal wieder verwenden, wie er dort steht, fest auf seinen Gummifüßen, sie findet: unerschütterlich. Aber was auflegen? Kaum etwas ist mehr ungefährlich. Retroromantik, würde Karo zu dem Plattenspieler sagen, wir können nicht einfach in die Siebziger zurückkehren, bloß weil wir es uns wünschen. Nein, das geht nicht, es geht nur immer vorwärts. Schneller, schneller, um die Erste zu sein. An die Wände hat sie weiße Plakate gehängt, für Notizen. Zu weiß, stattdessen sollten hier Tücher hängen, aber besser Plakate als Postkarten. Die Postkarten mussten weg, sie hat diese ständige Lüge nicht mehr ausgehalten. Reinen Tisch machen. Im Grunde müsste sie neu ausmalen. Sie sieht die Plakate an, sieht ihre eigene Schrift überall, wie sich die Os überall nach vorne drängen. Sie sollte sich eine andere Schrift angewöhnen. Diese hier hält sie bloß zurück.
Das Wasser gluckst wieder in den Wänden – dort drüben, wo die Wand so warm ist. Bald nachdem Judith eingezogen ist, hat sie das gemerkt, diese eine Stelle, hinter der das Wasser gluckst. Ton auf Ton hinunter. Aber da würde niemand hingreifen, man kommt doch nur zum Kaffee, man tastet deshalb nicht gleich alles ab. Auch wenn es in der Wohnung zu oft gluckst, man ist zu höflich, um nachzufragen: Ist etwas nicht in Ordnung? In der Küche sieht man, dass sie den Boden zu selten aufwischt. Die Türstöcke, die unten abblättern: Die Zeit wohnt die Wohnung für dich ab. Zu wenige Teller in den Kästen: Hier kommt zu selten jemand zu Besuch. Der Kühlschrank ist zu leer: Man sieht, dass sie die Supermärkte meidet, man sieht das sofort. Dass das Zimmer zu leer ist, hört man schon am ersten Schritt – früher hat sie die Wahrheit noch gepolstert, heute fallen ihre eigenen Worte und die Worte der Stimme wieder und wieder auf sie zurück. Und überall sind viel zu wenige Bücher, Bücherregale fehlen an jedem Fleck. Sie hat sich dabei immer für jemanden gehalten, der liest. Was sagt das schon. Es reicht nicht, sich für jemanden zu halten, man muss dieses Versprechen auch wahrmachen gegenüber sich selbst.
Sie blickt den Klarinettenkoffer an, der zwischen Kleiderkasten und Wand gedrängt steht, ganz wie Dr. Wawraceks dünne, längliche Tasche zwischen Bücherregal und Bücherregal geklemmt war, die Tasche, von der Judith nicht weiß, was sich darin verbirgt. Eine Ähnlichkeit. Aber wenn man Judith zu ihrer Tasche fragen würde, was müsste sie sagen?
Ich spiele die Klarinette nicht mehr.
Es ist peinlich, sie hier noch stehen zu haben, was sollen die Leute denken? Sie sollte sie loswerden.
Wieso, es ist eine Erinnerung. Früher hat Judith gern gespielt. Über die Donau, zur Musikschule. Über die Donau, zurück. Das Ruckeln der U-Bahn. Die leeren Konzertsäle, bevor die Leute kommen. Sessel werden verschoben. Selbst die schweren Vorhänge vor den Fenstern hört man, wenn sie über das Parkett schleifen, aber jeder Ton ist satt, jeder Gedanke klar, alles genau umrissen. Die Kanten sind da, aber nicht scharf genug, um sich zu schneiden.
Und ist das denn ein Grund? Außerdem ist es vorbei. Sie wäre schon ganz aus der Übung. Sie hat sich für jemanden gehalten, der Klarinette spielt, aber dann hat sie es eben doch nicht mehr getan. Manches ist eben nur eine Phase, und die Klarinette provoziert Fragen.
Wenn die Klarinette wenigstens nicht so laut wäre, sich hier nicht so aufschaukeln würde, denkt Judith, und steht auf.
3.
»Und?«, fragte Cécil.
Cécil Fournet, der Student, den Erika in der Statistik- Vorlesung kennengelernt hatte, hatte nach diesem ersten Aikido-Training mit ihr in das Caféhaus gegenüber gehen wollen, dessen vergilbte, bestickte Vorhänge den Blick auf die Straße verdeckten. Die Tischtücher hatten kleine Brandlöcher, außer ihnen war da nur ein alter Mann mit einem halb leeren Glas Bier, die Haube lag neben ihm auf dem Tisch, der Gehstock lehnte daran. In der Ecke stand ein Spielautomat, Erika hätte sich allein hier nicht hineingesetzt, warum nicht? Was hinderte sie daran?
»Was sagst du dazu?«
Als hätte ihr Urteil Gewicht, dachte sie, rührte im Milchschaum, der sich schnell auflöste, der Kaffee würde bitter sein und schal, wieso ließ sie sich von einem Spielautomaten abhalten, sich allein in ein Café zu setzen? Lächerlich. Dabei, erinnerte sie sich, hatte sie dieses Café schon öfter von außen beobachtet, war nach anderen Uni-Sportkursen daran vorbeigegangen, hatte sich gefragt, wie es drin wohl aussehen würde. Cécil hatte die Türen ohne Zögern aufgestoßen, es ärgerte sie, dass das alles so war, wie es war. Als der Aikido- Lehrer ihnen erklärt hatte, wie man vorwärtsrollt, war sie dagesessen, die Hand so auf den Boden gestützt, wie man es ihr sagte, über diesen Arm sollte sie nun rollen, rund machen sollte sie ihn, er musste ihr Gewicht nehmen. Sie hatte sich vorgebeugt, sich gesagt: Los, jetzt, vorwärts! Sie hatte sich nicht vom Boden abgestoßen. Sie hatte sich wieder zurückgelehnt.
Es ging nicht. Es konnte nicht gehen.
»Ich glaube, ich kann noch nicht viel dazu sagen.«
»Aber was ist dein erster Eindruck?«, sagte Cécil. »Das würde mich wirklich interessieren, gerade bei dir.«
Gerade bei ihr. Es würde ihn wahnsinnig interessieren, ihn, der durch die Luft flog wie ein Fächer, der sich aufklappte, wieder zusammenklappte, mit einem Schnappen, sofort wieder stand. Manchmal hatte es ausgesehen wie ein Tanz, aber ein Tanz war es nicht gewesen. Gerade bei ihr. Er kannte sie nicht, das ergab keinen Sinn. Er hatte sie nicht einmal zum Vorwärtsrollen überreden können. Oder wollte er zuerst einmal Komplimente machen, der Kleinen den Eindruck geben, dass sie wichtig war, ernst genommen wurde, dann schauen, was geht? Erika nahm einen Schluck Kaffee, der besser war als erwartet, sie mochte es nicht, immer wieder so zu denken, sie hatte gelernt, es trotzdem zu tun. Es war so, und sie ärgerte sich darüber. Ob sich da etwas ändern würde, nach ein paar Jahren rollen und hebeln und geworfen werden? Ob sie Cécil dann ansehen und stattdessen denken würde: Hier und dort kann ich dich zum Stolpern bringen?
Aber was auf seine Frage antworten? Sie dachte an das Geräusch der Fallenden auf den Matten, an den festen Stoff der Jacke unter ihren Fingern. Und dann hatte Christian ihren Arm genommen und etwas damit gemacht, sie wusste nicht was, und plötzlich war nur noch eine Richtung gut gewesen, und dann war schon der Boden dagewesen. Sie hatte nicht gewusst, wohin, aber dann hatte es ohnehin nur noch einen Weg gegeben.
»Gut«, sagte sie und kam sich dumm dabei vor, »der erste Eindruck war gut. Es ist spannend, dass man so viel Kontrolle über den anderen hat …«
Wenn man die Technik konnte.
»Das Rollen, das bringe ich nicht zusammen. Da bin ich echt unfähig.«
Cécil lachte: »Glaub mir, du hast genug Zeit, um das Rollen zu lernen.«
Auch das hatte Juri gesagt. Er hatte gesagt, wenn man Aikido macht, macht man das nicht für ein paar Jahre. Man macht es für ein paar Jahrzehnte.
Und dieser Gedanke war fast erleichternd, sie wusste nicht wieso.
»Stimmt«, sagte sie, »ich kann es wieder versuchen.«
»Viele, viele Male.«
Und Erika lehnte sich zurück in den Stuhl. Still war dieses Café, schlecht besucht. Der Kaffee dunkel und kräftig. Vielleicht würde sie öfter hierherkommen, und sei es nur aus Trotz.
Sie wollte sich nicht mehr hindern lassen. Sie sah es einfach nicht mehr ein.
»Danke«, fügte Cécil dann hinzu, und Erika fragte sich, wofür.
4.
Am Wochenende bereitet Erika ihre nächste Lehrveranstaltung vor, Evolution versus kulturelles Lernen bei Buckelwalen, sucht wieder Cécils E-Mail hervor, noch einer seiner Vorschläge. »Hallo Erika, lass mal das Tippen und schau dir das an. Ich habe Köhler schon gut von dir reden hören. Und die Acoustic Release-Sache, das ist ja nun echt nicht das erste Mal, dass du das machst. Ich glaube, du müsstest ihn nur anschreiben. Du kennst ihn doch eh.«
Ja, Erika kennt Köhler, jeder kennt Köhler, wenn nicht als Leiter des Johann-Werner-Instituts, dann von den Konferenzen, bei denen er immer über dasselbe Thema spricht, die Eisbewegungen in der Antarktis. Wenigstens ein interessantes Thema, nur kennt sie sich zu wenig damit aus.
Sie hört stattdessen den Schiffen und Ölbohrstationen zu, die jedes Jahr zahlreicher und damit lauter werden und die Rufe und Gesänge der Wale immer mehr verstecken, verdrängen. Sich nicht hören, heißt, sich nicht finden. Sich nicht finden, heißt, zugrunde gehen als Spezies. Aber all das ist wohlbekannt.
Sie liest den Absatz zum Acoustic Release System noch einmal durch und sieht bald, Cécil hat recht, gerade mit dieser Variante hat sie tatsächlich Erfahrung. Die Mikrofone in schwere Gerüste sperren, sie hinunter bis zum Meeresboden senken, sie dort zurücklassen. Und dann kommt man wieder, Monate später, und ruft: Bist du da? Und wenn man Glück hat, hört das Acoustic Release System den Ruf, schickt einen Ruf zurück, löst den Schwimmer aus seiner Verankerung, der dann auftaucht zwischen den Wellen: Ich bin da und genau hier musst du ziehen, um mich vor dem Meer zu retten.
Sie denkt an das Projekt an der irischen Küste, die Gerüste, die sie in Zementkübeln versenkt haben, und dann im Meer. Leon, der sich davor an den Gerüsten hochzieht, der Bootsführer, der sagt, passen Sie auf, Sie werden auf Deck noch verweht. Sie ist nicht verweht worden.
Trotzdem, was soll sie dort unten? Und ein ganzes Jahr.
Du weißt, was das für eine Gelegenheit ist. Ja, Erika weiß es. Die Wale kommen dorthin, um Krill oder Robben zu verschlingen, und werden dabei aufgenommen.
Ein ganzes Jahr: mehrere Monate ohne Tageslicht.
Brauchst du Licht?
Du willst doch nur, dass ich die nächste Aikido-Prüfung verschieben muss, genau wie du, schreibt sie zurück.
Cécil schlägt etwas vor, Cécil nimmt sie mit zum Training, zum Tauchen, in die Antarktis, wenn es sein muss, als müsste sie überall sein, wo er auch ist. Glücksbringer, Schlüsselanhänger? Sie steigt auf Cécils Vorschläge häufig ein, sie ist auch damals Woche für Woche wieder ins Dojo gegangen, hat sich von Cécil die Vorwärtsrolle erklären lassen, in dem Café mit dem Spielautomaten und den spärlichen Besuchern sprachen sie jetzt statt über Kampfsport über Korallenriffe. Sie lernte langsam, aber doch: Er wollte, wenn etwas, dann zumindest keinen Sex von ihr, keine Beziehung. Hätten wir das auch geklärt, kein weiterer Thomas auf ihrer Lebensliste, und dann war es vielleicht auch in Ordnung, dass er sie von hinten umarmte, wenn sie es nicht erwartete, dass er ständig nach ihrer Meinung bohrte, über Studien, Lehrveranstaltungsleiterinnen, den neuesten Kinofilm, außerdem hatte er diese Sozialanthropologin kennengelernt, Karoline Bates, »die musst du unbedingt treffen, die wäscht dir den Kopf, so schnell kannst du gar nicht schauen«. Nach dem Training blieb er noch länger, um mit ihr das Fallen zu üben, gegen das sie sich wehrte. Versuch es einfach wieder. Vielleicht klappt es diesmal. Vielleicht.
Lass mal das Tippen und schau dir diese Judith Lackner an.
Da sieht sie auch schon ein neues Mail von Judith Lackner, Erika hat es bereits erwartet.
»Sehr geehrte Frau Professor Erika Wawracek, es tut mir leid, Ihre wertvolle Zeit noch einmal in Anspruch nehmen zu müssen, und ich weiß, dass nur meine eigene Nachlässigkeit schuld daran ist, wie immer. Aber wären Sie möglicherweise trotzdem bereit, einem weiteren Interviewtermin zuzustimmen? Ich würde – wenn es Sie nicht stört, ausnahmsweise die Rollen umzudrehen, aber ich verspreche Ihnen, Sie müssen die Aufnahme nachher nicht hören – gerne das Interview diesmal aufnehmen. Wie könnten Sie andererseits vollkommen fremde Tiere abhören und dann nicht einwilligen, in einer kontrollierten Situation aufgezeichnet zu werden? Entschuldigen Sie meine Frechheit, ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Judith Lackner.«
Erikas Finger hängen über der Tastatur, legen sich dann darauf, während sie das Mail ein zweites Mal liest. Sehr geehrte Frau Professor. Immer diese übertrieben höflichen Ansprachen. Und: Ich weiß, dass nur meine eigene Nachlässigkeit schuld daran ist, wie immer. Wie immer. Was macht das hier?
Und wieso glaubt Judith Lackner, hier etwas versprechen zu müssen? Wie könnten Sie andererseits vollkommen fremde Tiere abhören und dann nicht einwilligen, in einer kontrollierten Situation aufgezeichnet zu werden? Abhören, als wären die Bioakustiker nur ein weiterer Geheimdienst.
Entschuldigen Sie meine Frechheit.
Erika entschuldigt alles, überlegt, wie sie antworten soll. Cécil würde vielleicht nachfragen, aber es gibt Gründe, warum Erika nicht nachhakt, wie er es tut. Steht es ihr denn zu? Man sollte den Menschen ihren Raum lassen, sie treten dann oft genug von selbst heraus.
Erika sieht auf die Uhr, wenn sie schwimmen will, bevor das Bad schließt, sollte sie jetzt gehen.
Das Wasser lässt sie ein. Es lässt Erika ein und umgibt sie mit scharfem Chlor, ihre Haut wird später rot sein und jucken. Sie schwimmt zuerst ihre Längen, hin und her, das Wasser vor ihr teilen, Wellen zu den anderen Schwimmern schicken. Hier kann sie nirgendwohin fallen, sie hat den Schwimmbadboden verlassen, seine Fliesen, über die das Chlorwasser sich Rinnsale bahnt.
Früher ist sie öfter hierhergekommen, aber seitdem das Aikido ihr Abende abverlangt, sind nur noch manche Wochenenden übrig geblieben, Sonntage, wenn der Nacken von der Computerarbeit schmerzt und ihr die Wohnung ohne Kopfhörer zu leer wird. Oder wenn sie, wie heute, von einer Aufgabe zur anderen springt, als könnten die ihr nichts anhaben, wenn Erika sie nur möglichst kurz berührt.
Cécil hat seinen Kommentar vermutlich doch als Kritik gemeint. Zerteilst du dich nicht, fragt selbst Leon manchmal, mit all dem, was du tust?
Aber Erika weiß nicht einmal, wie sie es sonst tun soll.
Ihr Leben will eingeteilt sein in Beete, von denen jedes genau abgegrenzt ist, zu ihrem Schutz. Hier ist die Zeit, in der ich arbeite, hier ist die Zeit, in der ich Cécil und Christian auf der Matte werfe, hier ist die Zeit, in der ich mit Karo diskutiere, hier ist die Zeit, in der ich mich einsam fühlen darf. Da jeder Moment genau abgegrenzt ist, weiß Erika, er wird ein Ende haben. Dann kommt wieder eine Forschungsreise, und sie muss in fremden Zimmern schlafen, in fremden Sportvereinen trainieren, mit Bootsführern reden. Mit ihrem Assistenten Leon, der sie im Schlauchboot mit dem Smartphone fotografiert, sie mit der Boje im Arm, er hat es ins Internet hinausgeschickt, bevor sie noch etwas sagen konnte. Einspruch erheben konnte. Aber auch das abgegrenzt, dann wieder Wien.
Die Wände dieses Hallenbades sind hoch, das Becken von Stiegen umgeben, die zu den Umkleidekabinen in den oberen Stockwerken führen. Weit über ihr die Glasdecke, wozu braucht es eine so große Halle für das bisschen Beckentiefe? Es scheint unangemessen: Wenn man vom obersten Stockwerk, und es trennt einen dort nur ein Geländer von der Leere, hinab ins Wasser springen würde, es würde einen zerreißen.
Umso mehr hallt es hier, mehr noch als in den Hallenbädern ihrer Kindheit, und schon damals hat sie das gewundert, wie von überall die Stimmen und Geräusche umhergeworfen werden, sie springen von den Wänden ab, kommen zurück, eben hat man sie noch weggestoßen.
Heute weiß sie, Hall ist eine Frage des Materials, weich oder hart, dämpfend oder reflektierend, und besonders laut wird es, wenn der Schall ungebremst im Zickzack durch den Raum springen kann, mit anderen Schallwellen interferiert, Hochschaukelung der Geräusche: Dafür ist es hier vergleichsweise angenehm.
Ganz anders jedenfalls als draußen, wo das Wellenbecken ist und der Strudel, dort verklingt jedes Geräusch ganz schnell, die Schreie der Kinder, das Platschen, wenn sie in die Pools springen. Jeder Laut ist nur ganz kurz und abgehackt, da und gleich wieder fort.
Trotzdem kommt sie immer wieder hierher zurück, nach jeder Reise in dieselbe Wohnung, an die sie sich jedes Mal von Neuem gewöhnen muss, in dasselbe Schwimmbad, das ihr längst vertraut ist. Jedes Mal zieht sie zurück in das Revier des Spechtes. Wie sollte sie es anders machen? Wiederholung ist notwendig, findet sie, und sie weiß nicht, wie sie anders weiterkommen oder auch am selben Fleck bleiben soll als durch die Wiederkehr.
Am Rand des Sportbeckens hält sie sich fest, lässt das Wasser an ihr ziehen, dabei ist es ohnehin fast unbewegt. Hier in den Bädern, ob draußen oder drinnen, ist das Wasser gebleicht, hier ist das Wasser gezähmt. Die Stadt zähmt alles, aber Wasser lässt sich nicht zähmen, auch wenn du es in Becken gießt, auch wenn du es der Maschine überlässt, die Wellen zu schlagen. Im Meer schlagen dich die Wellen gegen die Felsen, einmal, zweimal, damit du auch wirklich zerbrichst.
Sie atmet tief ein. Sie atmet tief aus. Die Lunge mit Luft füllen, ein wenig warten, die Luft zurückschicken in das Hallenbad. Neben ihr schlittern Kinder über die Fliesen, ihr Lachen kehrt wieder, entwischt nirgendwohin. Eine junge Frau steigt dort vorne über die Leiter ins Becken, als könnte sie jederzeit ausrutschen auf den Stufen.
Dann sieht sie, die junge Frau ist Judith Lackner.
Manchmal ärgert es Erika, wie klein Wien ist. Eine Großstadt sollte dich mit Anonymität umhüllen, aber überall kannst du deinen Kollegen begegnen, oder Musikstudentinnen mit irritierenden Formulierungen und Diplomarbeiten im Gepäck. Cécil würde hingehen, sie ansprechen, er würde sich, wäre er hier, an Erika wenden: Wovor hast du Angst? Warum immer Mauern um dich bauen? Und Erika kann sich erinnern, wie das mit ihrer Diplomarbeit war. Du stehst vor dem Ende des Studiums und glaubst, du wirst es nicht darüber hinweg schaffen. Der andere nimmt deine Hand, dreht sie Richtung Boden, und du weißt, du musst springen, und glaubst, du wirst niemals springen können.
Sie will trotzdem nicht erkannt werden. Sie wollte ohnehin die Länge zurücktauchen.
Einatmen, Luft einsperren, und mit den Händen nach vorne taucht sie ein, streckt die Beine nach oben, um schneller den Grund zu erreichen, am Grund ist weniger Widerstand. Und er kommt ihr auch ganz schnell entgegen, schon muss sie sich wieder ein wenig nach oben strecken, sich mit dem Fliesenboden in eine Linie bringen: Du bist mein größter Verbündeter.
Ist es hier still, ganz plötzlich? Das glaubst du zuerst, doch so ist es nicht. Du hörst auch hier, was um dich herum geschieht, nur ist jeder Laut ganz dicht bei dir.
Den ersten Schwimmzug machen, groß. Dann lässt sie sich gleiten, das Gesicht dem Boden zugewandt. Nur ganz knapp über den Fliesen, hier gleitet sie am leichtesten, sie ziehen unter ihr vorbei. Hier wird sie nicht rutschen. Sie hört die Bewegungen der Schwimmer über ihr, das dumpfe Grollen, weil jemand gesprungen ist. Über ihr schwimmt wohl auch Judith Lackner. Weit weg, jetzt.
Wir Säuger, denkt sie, sind doch unwahrscheinlich gut geeignet für das Wasser. Nehmen all die Luft mühelos in die Tiefe, die die Fische erst herausfiltern müssen, können rufen, so weit rufen. In dieser Welt siehst du nicht weit, hörst umso besser. Nachrichten von einer Küste zur anderen schicken, es kommt eine Antwort.
Bist du da?
Ich bin da.
Du bist da und baust Mauern um dich, Erika.
Der zweite Schwimmzug, lass mich, Cécil. Ein helles Klirren, als würde Metall auf die Fliesen fallen. Was könnte das sein? Den Kopf nicht heben, so würde sie langsamer, so würde sie mehr Luft verbrauchen. Sich gleiten lassen, bis der nächste Schwimmzug notwendig ist. Sich nicht mehr bewegen, als notwendig ist. Den Fliesen zusehen, wie sie eine nach der anderen unter ihr verschwinden.
Cécil, nicht jeder kann sein wie du.
Und dann kommt es, das Drängen. Sie hat schon darauf gewartet und begrüßt es, weil sie es kennt: Das Gefühl entfaltet sich tief in ihrem Bauch, macht ihn enger, kriecht dann aufwärts, als drängte es sich ihren Hals hinauf. Auftauchen, auftauchen. Tauche auf!
Sie macht einen weiteren Schwimmzug.
Mit der Bewegung meldet sich auch das Drängen stärker. Jede Bewegung frisst Luft, frisst sie weg, so viel ist gar nicht mehr da. Bald wird es wehtun, weiß sie. Sie will auftauchen. Sie will hier bleiben.
Jedes Mal, wenn sie einen Schwimmzug macht, wird sie schneller, gleitet sie schneller über die Fliesen, dann verlangsamt sich ihr Vorwärtsfließen – wann den nächsten machen?
Ein Schwimmzug.
Wieso nicht bleiben? Es ist, wenn auch nicht still, doch ruhig hier, sie schwebt, sie fließt.
Ein Schwimmzug.
Du wirst ertrinken! Die Fliesen ziehen unter ihr vorbei, als wäre nichts geschehen.
Ein Schwimmzug.
Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Sie fühlt dem Brennen nach Luft in ihr nach, es drückt, während sie zusieht, wie die Fliesen weiter und weiter unter ihr durchrutschen, ein steter Messer ihres Fortkommens, und doch weiß sie nicht, wie weit sie nun gekommen ist. Sie könnte noch ganz am Anfang sein. Sie könnte schon fast an der Wand sein. Sie kann es nicht abschätzen. Da blickt sie auf: ein Fehler. Sie sieht die Wasseroberfläche, hinauf, hinauf! Beherrsch dich!
Aber sie strampelt, es tut weh, du ertrinkst!, nur noch ein wenig, sie zerbricht den Spiegel über sich, atmet tief ein, sieht sich um. Die Geräusche des Hallenbads sind zurückgekehrt, von überallher, die schreienden Kinder, das Wasser, das über den Beckenrand tritt und in die Abflüsse fällt, die Schlapfen auf dem Boden. Sie hat nicht einmal die Hälfte des Sportbeckens hinter sich gebracht.
Sie breitet die Arme weit aus, teilt das Wasser vor ihr, das sich beinahe fortschieben lässt, dann doch zurückrinnt zwischen ihren Fingern, schwimmt zum anderen Ende des Beckens. Atmet, spürt, wie das Brennen in ihr verklingt. Spürt nach dem Wasser zwischen ihren Fingern – hier an seiner Außengrenze noch fassbarer als unten. Langsamer atmen. Sie muss wieder ruhig werden, sie muss sich wieder ganz entspannen, bevor sie zurücktauchen kann. Ausatmen, Einatmen.
Der Bademeister kreist um das Becken, zieht seine Schlapfen hinter sich her. Erika sieht: Judith Lackner schwimmt konzentriert ihre Längen, blickt nicht auf und erkennt Erika nicht. Aber die Musikstudentin breitet ihre Arme für die Schwimmzüge auch nicht ganz aus, als dürfte sie sich diesen Raum nicht nehmen. Dabei sind die Kreise, die ihre Wellen ziehen, im Vergleich zu Erikas ohnehin so klein. Unsinn, jede Welle, auch noch so laut, wäre hier von Wänden eingesperrt, man kann nicht in denselben Maßstäben rechnen.
Erika ist an der Kante angekommen, an die sie sich nun wieder lehnt, das andere Ende des Beckens ist weit. Ist sie schon bereit, oder soll sie noch warten? Soll sie riskieren, dass die andere ihr doch zu nahe kommt?
Karo hatte Erika von Judith erzählt, von dem ersten musikwissenschaftlichen Proseminar, in dem Karo gesessen ist, noch unsicher, ob sie das nun wirklich auch noch fertigstudieren soll. Und Judith Lackner sei vorne gestanden und habe im vollen Ernst darüber referiert, warum die Musik von Nine Inch Nails eine beruhigende Wirkung auf Zuhörer habe.
Die These ist doch wahnwitzig, hatte Karo gemeint. Nicht einmal Trent Reznors eigene Aussagen haben ihr da den Rücken gestärkt, und da Nine Inch Nails im Grunde ohnehin nur aus Trent Reznor besteht, hat das schon ein gewisses Gewicht. Katharsis hin oder her, Reznor hat in Interviews gesagt, seine Musik sei geschaffen, um zu schmerzen. Und dann steht dieses blasse Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und einem karierten Rock da vorne und argumentiert, warum der Rhythmus in diesem oder jenem Lied Gefühle von Sicherheit vermittle. Hast du jetzt also Zeit, ihr ein bisschen was über Bioakustik zu erzählen oder nicht?
Ist es das, was Cécil an ihr gefunden hat, ist das die Parallele zu Erika – aber was für eine Parallele sollte das überhaupt sein? Erika hat den Gegensatz nicht gesehen, wie Karo es tut, zwischen den Zöpfen und Trent Reznor. Sie hat gefragt: Und war ihre Argumentation gut?
Schwierig, hat Karo gesagt. Aber allein die Idee, es zu versuchen.
Sie sucht noch, hat Cécil gesagt. Cécil sagt, sieh dir Judith Lackner an, Karo sagt, sieh dir Judith Lackner an, alle kommen sie mit Judith Lackner, und Judith Lackner kommt mit: Entschuldigen Sie meine Frechheit.
Und Erika sieht sich Judith an, aus einiger Entfernung, die sie einhalten möchte, denn es gibt einen guten Abstand, und er wird ohnehin oft genug unterschritten.
Erika zerteilt sich vielleicht, weiß sich aber nicht anders zu helfen. Das Leben getrennt in Beete, alle wollen etwas von ihr, sie will selbst zu viel, aber alles hat Grenzen, alles kehrt wieder. Alles wird wieder versucht. Auch der Grund des Beckens kehrt wieder. Sie lässt den Beckenrand los.
Vielleicht dieses Mal. Dieses Mal wird sie weiter kommen.
5.
Manche Wege führen nur in Sackgassen. Wenn Judith beispielsweise »Bioacoustics« auf Youtube eingibt – dann findet sie vor allem Videos über Schlaganfallpatienten, die von ihrem Erfolg mit Geräuschbehandlungen sprechen, oder aber eine Kompilation von Walgesang. Das hätte sie sich denken können, so macht man das auch nicht.
Die Tabs in Judiths Webbrowser vervielfältigen sich schnell, allein die Website eines amerikanischen Bioakustik- Vereins nimmt die Hälfte ein, Judith ist auf Diplomarbeiten gestoßen, überfliegt die Titel, lädt sie herunter, so viel Text, wann soll sie das lesen? Die Tabs vervielfältigen sich, aber der Browser nimmt immer noch mehr auf, er kann sie alle halten. Anders als Dr. Wawraceks Kiste, die in der Mitte des Raumes gestanden ist. Die Plastikniete, die die Kartonwände zusammenhält, hat sich gelöst, die Wand hat sich geöffnet: überquellend vor all dem, was Dr. Wawracek verwenden kann und soll.
Wo soll Judith aber beginnen? Sie stößt auf den »Good Practice Guide For Underwater Noise Measurement«, beginnt zu lesen. Eine halbe Stunde später überlegt sie: Brauche ich diesen Artikel überhaupt? Würde es ihr helfen, zu verstehen, worin der Alltag dieser Forscher genau besteht? Sie kann es sich nicht vorstellen. Die Kopfhörer aufsetzen und was genau hören? Wozu auch, darum geht es nicht. Was genau Dr. Wawracek oder Cécil Fournet mit ihren Bojen und Kisten machen, das kann Judith ganz gleichgültig sein. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, das Wesentliche ist ihr schon zu viel. Andere Menschen haben so viel Raum in ihrem Kalender. Aber die Zeit ist kein Raum, sie schreitet bloß voran, von Moment zu Moment, das ist es, was nicht verhindert werden kann. Das Wesentliche muss in ein paar Stunden gezwängt werden, dann muss sie heim, den Käufer empfangen, der ihr die Klarinette abnehmen wird.
Sie sitzt mit Karo in der Bibliothek der Musikwissenschaft, hier in der Auslage, vor den Wänden aus Glas, die hinausgehen auf den Innenhof des Campus, in dem die Studenten von Hörsaalzentrum zu Hörsaalzentrum wandern, auf Bänken und Wiesen liegen und ihre Joghurts auslöffeln. Jederzeit können sie Judith hier beim Lesen zusehen, oder sehen, wie sie über ihren Büchern einschläft: Das merkt man sich. Und wenn sie hierherkommt und erst zu spät bemerkt, sie hat einen Fleck auf ihrem Pullover, Nachlässigkeit, das wird jeder sehen: Das merkt man sich auch.
Jeder hört sie ohnehin, wenn sie durch den Raum geht, zwischen den Bücherregalen herumirrt, alle wissen, dass sie sich wieder einmal die Haare nicht gewaschen hat. Ihre Sohlen kleben auf dem Boden. Einmal versucht sie, den Sessel so unter dem Tisch hervorzuziehen, wie ihn die anderen hervorziehen, aber wie soll das gelingen, wenn sie sich nicht einmal die Haare gewaschen hat?
Die Schritte des Studenten, der aufgestanden ist, kommen näher und entfernen sich wieder, er sucht etwas, kann er es nicht finden? Irgendwann wird er sich wieder hinsetzen und mit dem Stuhl zum Tisch rücken, und dann muss sie wieder erschrecken. Wann? Denk eben an etwas anderes, du bist zum Arbeiten hier. Du bist für die Tabs in deinem Webbrowser da, die sich entfalten wie ein Fächer. Du bist für dein Notizbuch da, für die in das Papier gedrückte Schrift.
Sie beugt sich über ihre Notizen, Dr. Wawraceks Worte zwischen den eigenen. Die Os der eigenen Hand durchgestrichen, besser so, bis sie eine andere Schrift besitzt. Es dauert, sich umzugewöhnen. Dr. Wawraceks r geht über in das n, die Buchstaben sind manchmal kaum voneinander zu unterscheiden. Nachlässig, Dr. Wawracek ist mit dem Inhalt beschäftigt, nicht mit der Form. Fast ungeübt, weil sie inzwischen die Tastatur wohl wesentlich öfter verwendet als den Stift. Das muss Judith erreichen, aber dazu müsste sie auch ein bisschen etwas tun. Die letzten Tage hat sie abgeschrieben, Dr. Wawraceks wenige Worte, untereinander auf ein Blatt Papier, aber sie lernt langsam, sie hat immer schon langsam gelernt. Wer sich früh eine erwachsene Schrift angewöhnt, hat es leicht, wer damit wartet, muss sich plagen. Der Sessel kreischt, verstummt, kreischt, der Student hat sich wieder hingesetzt.
Es gab da dieses Online-Archiv mit Unterwassergeräuschen, erinnert Judith sich jetzt. Judith lädt herunter: Stiller Ozean. Judith lädt herunter: Rossrobbe. Keine repräsentativen Beispiele. Das hilft ihr höchstens für die Einleitung oder die Konklusio: So habe ich die Laute erfahren. Ohne Kontext und Konzept nutzlos. Die Kopfhörer ins Ohr stecken, eine Rossrobbe in ein MP3-File gepresst, sie klickt die Datei an, es beginnt leise. Synthesizer-Musik der Achtziger, denkt Judith. Karo sagt neben ihr: »Also was der Krause zum Lärm in Restaurants schreibt, ist schon kräftig konservative Scheiße«, die Synthesizer-Robbe wird davon übertönt.
Karo schlägt das Great Animal Orchestra zu, in dem sie geblättert hat. »Hätte ich gewusst, dass Bernie Krause einer von denen ist, hätte ich dich wegen dem nicht zu Cécil und Erika geschickt.«
Karo trifft sich mittwochs mit Judith hier, damit Judith sich zumindest einmal pro Woche darum kümmert, was andere Menschen zu ihrem Thema zu sagen haben, einmal pro Woche gibt Karo Judith diese Chance: es endlich richtig zu machen. Judith könnte an diesem Ort viel öfter sitzen, sie findet ja doch immer wieder heraus, dass sie etwas übersehen hat. Judith ist aber faul, es wäre Zeit, dass Judith endlich systematischer liest. Judith sollte sich einen Plan machen, Judith liest stattdessen, was ihr in die Hände fällt. Karo hat Judiths Literaturverzeichnis durchgesehen und gemeint: »Nach welchem System hast du die Sekundärliteratur eigentlich ausgesucht?«
Dein Auswahlkriterium ist, dass du nicht für die Artikel bezahlen musst. Es reicht nicht, vom Stillen Ozean zur Rossrobbe zu springen, das kannst du besser, du willst nur nicht. Ich versuche dir hier zu helfen. Wenn ich sage, Krause ist konservativer Mist, dann hör mir zu.
Judith wehrt sich: »Ich kann ihn irgendwie verstehen«, sagt sie. Irgendwie, was soll das denn heißen, was ist denn das überhaupt für ein Wort? Sie spinnt Wissenschaft aus Gefühlen und wundert sich, dass man sie zerlegen kann.
»Lärm ist Lärm, weil wir ihn dazu machen«, sagt Karo.
Karo hat eine kleine spitze Nase und bereits die Titel, die Judith sich erst verdienen muss, Sozialanthropologie, Verhaltensbiologie, jetzt steckt sie sich zwischendurch noch die Musikwissenschaft in die Tasche, ist ja nicht so ein Aufwand, sagt sie, sie hat später als Judith begonnen und wird früher fertig werden. Sie schreibt über die kulturgeschichtlichen Hintergründe der Unterscheidung zwischen Lärm und Musik, weiß also, wovon sie spricht. An jede Aussage könnte sie drei Fußnoten hängen.
Bringen wird mir das trotzdem nichts, sagt sie, mit zusätzlichen Titeln werden die Verträge nur umso befristeter.
Und was hat Judith dem entgegenzusetzen? Nicht einmal Sozialanthropologie oder ein Grundverständnis für ihren Forschungsgegenstand, aus reinem Zufall hat sie damals zu Bernie Krause gefunden, und was weiter? Sie mag ihn, sie kann ihn irgendwie verstehen. Das ist nun wirklich kein Argument. Als hätte sie nichts dazugelernt.
Aus Zufall – sie ist an ihm hängen geblieben. Sie glaubt, sie findet sich in ihm. Sie findet ihn nicht in den Worten, die sie über ihn schreibt. Er erzählt von einem nordamerikanischen Wasserfall und einem Stamm von Ureinwohnern, der in seiner Nähe siedelt. Aber warte nur, Moment folgt auf Moment, und das Militär schließt die Stahltore eines Staudammes, das Tosen des Wasserfalls verklingt. Dr. Wawracek nickt zu dieser Geschichte und spricht vom Anthropozän, dem Zeitalter, in dem Umweltveränderungen zuallererst auf den Menschen zurückzuführen sind. Heute prägen wir die Welt, sagt sie, es ist unser Zeitalter, was immer das auch für uns bedeuten mag. Sie sagt: Lärm verursacht Stress, Stress verursacht Stressreaktionen. Wale tauchen zu schnell auf, paaren sich nicht, brechen ihre Suche nach Futter ab, gehen anders mit ihren Kälbern um. Was sich nicht anpassen kann, wird vergehen. Wer sich nicht findet, wird sich nicht vermehren. Flexibel muss man sein heutzutage, lebenslanges Lernen, immer bereit zur Flucht. Judith hingegen sitzt in der Bibliothek mit Karo, weiß nicht, warum Karo mit ihr in der Bibliothek sitzt, und kann Karo nichts entgegensetzen, ihrer Stimme, die laut ist und Bernie Krause vom Tisch wischt, denn Lärm ist ein kulturelles Phänomen, und worin man Ordnung findet, kann nicht Bernie Krause bestimmen.
»Ja«, sagt Judith, und es stimmt ja, »aber der Lärm macht unsere Körper auch dann krank, wenn wir uns an ihn gewöhnen. Den anhaltenden Stresslevel kann man mit Geräten messen. Schiffslärm und Tiefseebohrungen senken die Überlebensrate von Jungtieren, verletzen im schlimmsten Fall die Hörorgane, weißt du doch nur zu genau.«
»Ah, jetzt holst du Erika aus dem Ärmel«, sagt Karo, und faltet sich ein, zieht ihre Arme zu sich zurück.
Es tut mir leid, will Judith sagen. Du hast mir deine offene Flanke gezeigt, ich hätte nicht zustechen dürfen.
»Aber Dr. Wawracek hat dir auch recht gegeben«, sagt sie deshalb, streckt ihre Arme zu Karo aus, »sie hat gesagt, dass sich nicht nur einfach die Geräusche verändern, sondern auch die Art und Weise, wie wir sie hören.«
»Seitdem wir glauben, dass der Frühling stummer wird«, sagt Judith, »die Vögel weniger, horchen wir mehr darauf.«
Karo nickt. Und: »Kannst du dich erinnern, wie das mit den Geigerzählern nach Fukushima war?«
6.
Judith hat damals erst viel zu spät von der Kernschmelze erfahren, erst Tage später nämlich, trotz Internet, trotz aller Medien. Dafür hat sie in gewisser Hinsicht selbst Sorge getragen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie schon weggesehen von den Schlagzeilen der Gratiszeitungen in den U-Bahnen, hat nicht einmal mehr die Nachrichten im Radio gehört. Das hätte sie nicht tun sollen, jeder erwartet von dir, ein Grundwissen über die Weltpolitik zu besitzen, wie eine täglich zu erneuernde Pflichtübung. Aber es hört ja nie auf. Manchmal braucht man eine Pause, aber man kann tun, was man will, die Dinge hören einfach nicht auf zu geschehen.
Deshalb ist diesmal ein Großereignis an Judith vorbeigerollt, und eine Welle, die Menschen unter sich begraben hat, hat Judith nicht einmal berührt. Das Wasser, das die Kraftwerke und Notstromgeneratoren geflutet hat, hat Judith nicht benetzt. Als sie davon erfuhr, waren die Explosionen in den Reaktorblöcken schon passiert, war das kontaminierte Wasser schon ausgetreten, hatte es radioaktiven Schutt schon auf die Höfe des Fabrikgeländes geregnet, die Reaktoren wurden mit Wasserwerfern gekühlt.
Erst im Nachhinein wurde ihr Kopf in diese Flut eingetaucht, von Karo, die sagte: »Dabei war das noch gar nicht das große Japan-Erdbeben, auf das alle schon so lange warten.«
Auf was wir alles warten – Judith sollte nicht überrascht sein: Ein Moment folgt auf den anderen, auch wenn sie sich von den Schlagzeilen abwendet. Sie denkt an den Tsunami in Thailand, als die Touristen hinausgelaufen sind ins leere Meer, um Muscheln zu sammeln. Das Wasser hatte sich zurückgezogen, um Kraft zu sammeln für den Schlag, der Strand wurde plötzlich lang, die bunten Muscheln lagen alle frei. Das Meer kam dann zurück wie eine Wand.
Auch in Fukushima ist das Meer wie eine Wand gekommen, und als es sich wieder zurückgezogen hatte, war die Kette an Reaktionen schon in Gang. Ursache und Wirkung.
Nein, sie wehrt sich nicht mehr. Sie weiß, sie hat einen Fehler begangen, es wird auf die Liste geschrieben. Karo hat sich damals gedacht: Diese Studentin, die ich meine Freundin nenne, weiß noch nicht einmal, dass in Fukushima die Menschen aus den Häusern gespült worden sind.
»Ein Anzeiger von Gefahr«, sagt Karo jetzt. »So lesen wir es. All diese Internetvideos von Leuten, die in Tokyo mit dem Geigerzähler durch ihr Haus gehen.«
Judith nickt, sie hat diese Videos schließlich lange vor Karo gefunden, hat sich nicht mehr gewehrt. Ruhige Videos, hausgemacht, man sieht bloß eine Hand, die das Messgerät hält, und so geht es durch den Garten. Es kracht nicht laut, nicht ununterbrochen, stattdessen abgehackt, so oft ist es gar nicht. Man könnte es leicht überhören. Nur der Bildschirm sagt dir, dass der Level an Strahlung bereits gefährlich ist. Schalte den Zähler ab, es ist wieder still.
Karo hebt beim Reden wieder einmal ihre Arme und senkt sie, breitet sie aus, öffnet ihren Mund weit. Vielleicht, weil sie vorhin von Dr. Wawraceks Urteil zum Verstummen gebracht worden ist, macht sie sich jetzt umso dringender Luft. Schaut sie Judith an? Ist sie wütend? Judith könnte es nicht sagen. Judith sollte es sagen können. Man muss wissen, wem man sich anvertrauen darf und wem nicht. Judith weiß noch nicht einmal, warum Karo sich mit ihr angefreundet hat, damals.
Sie ist auf diese Freundschaft gestoßen wie aus Zufall, wie auf Bernie Krause, weil Karo sie angesprochen hat nach ihrem Referat in einem der Proseminare, gesagt hat: »Widerspricht dir da nicht Trent Reznor selbst?« Sie wollte mehr von Judith wissen über Nine Inch Nails, mehr und immer mehr, ist ihr die Stiegen hinunter gefolgt und hat noch an der Tür weitergeredet: »Aber endlich mal nicht so ein harmloser Scheiß, endlich wühlt jemand mal den Schlamm auf und macht das Wasser ein bisschen trübe«, und Judith hat sofort an die Forelle von Schubert denken müssen, dann weiter an andere Schubert-Lieder, an die schöne Müllerin, die Winterreise, und da waren die Melodien auch schon alle bei ihr, eng, zu nah, zu unausweichlich, denn anders als Trent Reznor fischt Schubert mit Widerhaken.
Zwischen den Liedern aber Karo, die über Notensysteme sprach, und Takt, und dass man das nicht einfach als gegeben nehmen durfte, all das sei historisch gewachsen und die wissenschaftliche Analyse der Wirkung von Musik auf die Psyche in den allermeisten Fällen bloß eine Rechtfertigung des eigenen Geschmacks.
»Insofern echt geil«, sagte Karo. »Da vorne stehen und sagen, die Musik von Nine Inch Nails entspannt, und das ohne Studien in der Hinterhand. Das muss man sich erst mal trauen, auf diesem Vorgartenzwerg-Institut.«
Judith brauchte lange an diesem Tag, um sich Schuberts Widerhaken aus dem Fleisch zu reißen, nicht mehr ständig die Winterreise und die schöne Müllerin abspulen zu müssen, aber Karo setzte sich bei der nächsten Einheit der Lehrveranstaltung direkt neben sie und wollte wissen, wie Judith mit der Proseminararbeit inzwischen weitergekommen war.
Etwas musste Karo also wohl an Judith interessieren, aber was, kann Judith sich nicht vorstellen, nicht wenn Karo ihre Arbeiten Korrektur liest und darüber schimpft, dass Judith schon wieder nur Zitate aneinanderreiht, »Du musst auch einmal einen Gedanken zu Ende gehen«, sagt Karo dann, »zu einem logischen Schluss kommen, Schritt für Schritt.«
Judith trifft sich mit Karo seit Jahren. Judith weiß nicht, warum Karo sich mit ihr trifft, aber sie weiß: Wer immer Angst hat, abgelehnt zu werden, kann niemals ehrlich sein. Wer sich weit aus dem Fenster beugt, kann fallen. Folgendes muss Judith im Umgang mit anderen immer beachten: natürlich wirken, niemals Schwächen zeigen, dich in niemandes Schuld begeben. Sagt die Stimme, die recht hat und es gut mit ihr meint. Judith steht aber bereits in Karos Schuld, weil Karo all ihre Arbeiten Korrektur gelesen und im Heuhaufen ihres Lebens gekramt hat, bis zwei Namen zum Vorschein kamen: Erika Wawracek und Cécil Fournet. »Das sind Meeresbiologen und Erika ist Bioakustikerin. Wenn du zu Bernie Krause und dem Tierorchester schreiben willst, geh zu denen.«
Jetzt redet sie über das Kernkraftwerk in Japan, krallt ihre Finger dabei in den Tisch, wie sie es oft macht, und warum hat Judith immer noch nicht verstanden, weil sie eine schlechte Freundin ist, unaufmerksam.
»Und weißt du, was die Arbeiter gemacht haben, als sie schon Neutronen-Strahlung in den Kraftwerken gemessen haben, also gewusst haben, die Kernschmelze ist im Gang, jetzt ist alles zu spät, jetzt sollten sie echt weg? Sie sind zu ihren Autos gelaufen, mit denen sie noch hätten fliehen können, haben die Autobatterien ausgebaut und versucht, das Kühlsystem mit Autobatterien wieder zum Laufen zu kriegen! Mit Autobatterien, Judith! Das Kühlsystem eines riesigen Kernkraftwerks mit verdammten Autobatterien!«
Karo lacht laut auf.
»Es gibt rund um Wien dutzende Kernkraftwerke, und stell dir mal vor, was dann passiert«, sagt Karo. »Wir haben im Grunde den Arsch längst offen, allesamt.«
Judith will es sich nicht vorstellen. Judith hat in der Schule »Die Wolke« lesen müssen und weiß, was passieren wird, wenn Temelin beschließt, zu schmelzen. Sie weiß um die Regenwolken, die das schlechte Wasser bringen, sie weiß um die von all den Flüchtlingen überfüllten Straßen, die ausfallenden Haare, und weiß doch, dass das Buch alt ist, und ein Kinderbuch. Man kann Kindern nicht die ganze Wahrheit sagen.
Fukushima ist verlassen worden – wird man Wien ebenso verlassen, den Augarten mit seinen Flaktürmen, diesen Campus? Jetzt ist alles da, und draußen löffeln die Studenten Joghurt, tragen ihre Umhängetaschen über die Wiese. So viele Jahrhunderte lasten auf dieser Stadt. Wir laufen weiter, Schritt für Schritt, zu unseren logischen Schlüssen, mit Jahrhunderten und Schlagzeilen auf den Schultern.
Karo redet sich ihre Wut vom Leib, ihr ist es egal, wer sie hört, wenn es nur nicht Dr. Wawracek ist, es könnte der Studienprogrammleiter hinter der Ecke stehen. Judith sollte Karo sagen, dass das nicht der richtige Ort für ihre Schimpftiraden ist. Ihr kennt euch seit Jahren, Judith, du solltest inzwischen mit ihr umgehen können, mit ihren Eigenheiten, oder aber dich wehren oder aber Abstand nehmen: Mit dir will ich nicht mehr gesehen werden. Nach alldem, was du für mich getan hast, sind wir geschiedene Leute.
Sie blickt aus den Fenstern zu den Bäumen im Innenhof des Campus, die im Wind rauschen, unter einem von ihnen liegen im Herbst dann Nüsse. Noyer – Nussbaum. Lärmbaum. Und laut ist es doch immer.
Wie klein die Welt früher gewesen ist, denkt sie dabei, für die meisten hat sie sich auf ein paar Dörfer und vielleicht auf zwei entfernte Hauptstädte beschränkt. Und was woanders passierte, davon hat nie jemand erfahren. Niemand hat von dir erwartet, dich darum zu kümmern. Irgendwo in Südamerika gab es dann ein Erdbeben und einen Vulkanausbruch, und in Europa war es, als wäre es nie geschehen. Es kommt die Wolke aber auch, wenn du es dir nicht vorstellen kannst.
7.
Judith stellt den Klarinettenkoffer ins Vorzimmer, öffnet die Tür einen Spalt. Sie hört den Käufer das Stiegenhaus hinaufsteigen, seine Schritte klingen hohl. Soll sie sich hinsetzen, bis er kommt? Nein, sie muss sehen, wer es ist, im Notfall die Tür wieder zuschlagen.
Glaubt sie denn, dass das hilft?