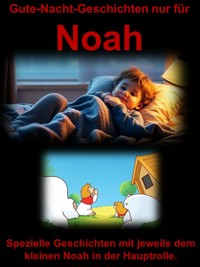8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Friedhofsgärtner
- Sprache: Deutsch
Der Melatenfriedhof in Köln, ein Ort der Ruhe und des Gedenkens, dient Friedhofsgärtner Konrad Leisegang seit vielen Jahren als Arbeitsplatz und Zufluchtsort gleichermaßen. Als er ein altes Grab abräumen will, stößt er jedoch auf etwas, das die Friedhofsruhe jäh durchbricht: eine zweite Leiche unter der ersten. Zeitgleich ereignet sich auf einem Flug von Bogotá nach Deutschland ein vermeintlich natürlicher Todesfall. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht, die direkt an den Friedhof angrenzt. Kurz darauf wird der Wachmann des Instituts ermordet aufgefunden. Zufall? Konrad muss, unterstützt von dem aufgeweckten Schüler Martin, tief in die Geheimisse seines grünen Paradieses eintauchen, um die beiden Fälle zu lösen. Gemeinsam decken sie ein Netz aus düsteren Geheimnissen und Verbrechen auf, das Konrad selbst in allergrößte Gefahr bringt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Der Melatenfriedhof in Köln, ein Ort der Ruhe und des Gedenkens, dient Friedhofsgärtner Konrad Leisegang seit vielen Jahren als Arbeitsplatz und Zufluchtsort gleichermaßen. Als er ein altes Grab abräumen will, stößt er jedoch auf etwas, das die Friedhofsruhe jäh durchbricht: eine zweite Leiche unter der ersten. Zeitgleich ereignet sich auf einem Flug von Bogotá nach Deutschland ein vermeintlich natürlicher Todesfall. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht, die direkt an den Friedhof angrenzt. Kurz darauf wird der Wachmann des Instituts ermordet. Zufall? Konrad muss, unterstützt von dem aufgeweckten Schüler Martin, tief in die Geheimnisse seines grünen Paradieses eintauchen, um die beiden Fälle zu lösen. Und gerät dabei selbst in größte Gefahr …
Der Autor
Thomas Krüger, geboren 1962 in Ostwestfalen, arbeitete zunächst als Journalist für Tageszeitungen und Magazine. Heute ist er Hörbuch- und Kinderbuchverleger, Autor von Kinderbüchern (»Jo Raketen-Po«) und zahllosen Sonetten – u. a. an Donald Duck. Thomas Krüger lebt mit seiner Familie in Bergisch Gladbach bei Köln.
THOMAS KRÜGER
ES RAPPELT IN DER KISTE
Der Friedhofsgärtner ermittelt
KRIMINALROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 11/2024
Copyright © by Thomas Krüger
Copyright © 2024 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Michelle Stöger
Umschlaggestaltung: © zero-media.net unter Verwendung von iStockphoto (Valeriia Dorofeieva, LeeYenz, Natalia Misintseva); FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30674-8V002
www.heyne.de
Für Simone, Niklas und Verena
DEN LEICHEN EIN HEILIGER ORT
Es war Mittwoch, der 29. August. Gegen 18 Uhr herrschte in Köln Feierabendverkehr. Der Tag war noch immer warm und sonnig. Der Himmel: ein tiefes Leuchten, spätsommerlich blau, mit ein paar Kondensstreifen. Sie ließen an Stricheleien auf dem Reißbrett eines einfallslosen Stadtplaners denken. Ansonsten war hoch über Köln alles in Ordnung.
Unten eher nicht. Die breite Aachener Straße glich einem überfüllten Parkplatz. Hitze flirrte. Es stank nach Sprit, nach Teer. Die schnurrenden E-Mobile im Stau milderten das Abgaswabern über den Fahrzeugen kaum. Heute war es besonders schlimm: An einer Baustelle, wo die Fahrbahn erneuert wurde, war ein qualmender Asphaltfertiger im Einsatz, und irgendwo stadtauswärts hatte es geknallt. Blaulicht quälte sich durch zähes Blech. Ein Martinshorn nervte.
Die junge Frau verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Melaten. Sie trug Sonnenbrille, wirkte gestresst. Sie ging zum Ende des Bahnsteigs bis an die Fußgängerampel, guckte nach rechts, wartete nicht auf Grün sondern zickzackte zwischen den stehenden Autos hindurch.
Sie war eine elegante Erscheinung, schlank, etwa Mitte dreißig, ganz in Schwarz. Ein Wesen von sizilianischem Stolz. Mit zielstrebigen Schritten hielt sie auf den alten Haupteingang des Melaten-Friedhofs zu, dessen Begrenzung – teils schmiedeeiserner Lanzenzaun, teils mannshohe Steinmauer – über Hunderte von Metern der schnurgeraden Straße folgte. Die Frau hatte dunkles, mittellanges Haar, gescheitelt. Es umgriff die Kinnpartie wie ein strenger Pagenschnitt. Sie trug ein eng anliegendes knielanges Kleid – wie gesagt: schwarz. In der Linken hielt sie einen schwarzen Geigenkasten.
Sie musste etwas erledigen.
In Gedanken sah sie Martin in einem Grab. Sie lächelte. Ein kurzes, waffenscheinpflichtiges Lächeln. Eigentlich war ihr nicht nach Lächeln. Ihr fehlte die Zeit. Sie konnte nicht lange nach ihm suchen. Und lange fackeln durfte sie ebenfalls nicht.
Sie näherte sich dem Portal des alten Haupteingangs: Der wuchtige Durchgang erinnerte an den Umriss eines ägyptischen Tempels. Oberhalb des Sturzes, in der Giebelfläche sozusagen, war ein Spruch in vergoldeten Großbuchstaben zu lesen, jedes U ein V:
FVNERIBVSAGRIPPINENSIVMSACERLOCVSDen Toten Kölns ein heiliger Ort
Als die Frau durch das Portal unter dem Spruch hindurchschritt, wechselte sie von einer hektischen Welt in eine ruhige. Es dauerte nicht lange und das Raunen des Verkehrs, der Motoren, wurde vom dichten Grün verschluckt.
Nun ja, hier und dort heulte ein Friedhofsfahrzeug, keuchte ein Pritschenwagen beladen mit Bagger und Motorsägen zu einer aufzulassenden Grabstelle oder einer alten Platane, von der Äste abzubrechen drohten. Lärm war auf dem Friedhof allerdings die Ausnahme. Hier waren die Bewegungen leiser, feiner. Hummeln und Bienen flogen, Amseln, Stare, Elstern, Rotkehlchen, Meisen, Tauben, Zaunkönige, Gimpel und Zilpzalpe und nachts Käuze und diverse Fledermäuse. Am Boden wuselten Eichhörnchen, Mäuse, Wildkaninchen, dann und wann Marder, sogar Füchse – und zum Herbst hin immer wieder Igel. Auf Melaten lebten sie in Frieden – auf der Aachener Straßen hinterließen sie Matschflecke. Der Friedhof war eine Welt voller Schlupfwinkel, und die Menschen – sogar die, die hier nicht lagen, sondern als Besucher umherwandelten – ließen den Tieren und Insekten des Friedhofs ihre Ruhe.
Die Luft duftete von Wild- und Wiesenkräutern. Alles roch irgendwie nach Grün. Die Bäume, Büsche, Sträucher hielten nicht nur den Verkehrslärm, sondern auch Stress und Abgase fern. Der Friedhof gönnte dem Erfinder des Verbrennungsmotors, Nikolaus August Otto, der hier seit über 130 Jahren lag, Ruhe vor den Geistern, die er gerufen hatte.
Auf dem Friedhof benahmen sich sogar die Radfahrer.
Meistens jedenfalls.
Die Frau in Schwarz folgte dem Hauptweg, schritt auf ein breites Rondell mit angegrüntem, sandsteinernem Hochkreuz in der Mitte zu, wo am Wegrand das Ehrengrab der Kölschen Funken lag: eine prächtige Anlage, gestaltet mit rotem Granit. In einem Seitenweg links des Rondells trug die bronzene Statue eines verstorbenen Karnevalisten sommers wie winters eine rote Clownsnase.
In Köln hatte der Tod Humor.
Davon wollte die Frau in Schwarz nichts wissen. Sie verließ das Rondell auf ihrem von Leichen gesäumten Weg, näherte sich einem Kriegerdenkmal. Oben, auf dem Säulenbaldachin des turmhohen Dings, hockte ein die Schwingen ausbreitender, drohender Bronzeadler.
Der guckte allerdings weniger düster als die Frau.
Während sie sich auf die Ostseite des Friedhofs zubewegte, fanden, keine hundert Meter entfernt, Abräumarbeiten statt: nah dem Grab von Edith Mendelssohn Bartholdy – gestorben 1969. Einst hatte sie im WDR die Sendung Der Lebensabend moderiert. Nun lag sie hier.
Gleich neben ihr, vor einem stark verwitterten Sandsteinblock mit kaum noch leserlichen Buchstaben, stießen die Finger des Friedhofsgärtners Konrad Leisegang auf Knochen. In über zwei Metern Tiefe.
»Hast recht gehabt«, sagte er. »Fantastisch.«
Weil Konrad über einige Erfahrung mit Menschenknochen verfügte, wusste er sofort, dass er einen Schädel gefunden hatte. Sein Herz hüpfte. Er war ein schlaksiger Typ, fast zwei Meter groß, und hatte trotz seiner 38 Lebensjahre noch immer das melancholische Gesicht eines Hamlet-Darstellers: ernste große Augen und verstrubbeltes Haar, das wunderbar zum grüblerisch-verträumten Charakter Konrads passte. Man hätte ihn für einen an die Forschung verlorenen Akademiker halten können, wäre da nicht der grüne Arbeitsoverall der Friedhofsgärtner gewesen.
Da sich Konrad in der engen Ausschachtung kaum bücken konnte, war er in die Hocke gegangen. Seine Finger schlüpften in die Augenhöhlen des Schädels wie in die Löcher einer Bowlingkugel. Jetzt musste er vorsichtig lockern und ziehen:
»Ich hab ihn.«
»Hier ist auch was!« Eine zweite Stimme.
»Nicht so laut. Wir sind auf dem Friedhof.«
Konrads Stimme klang, wenn er leise sprach, immer leicht gedämpft, wie von einer dünnen Schicht Erde bedeckt.
Statt auf den Vorwurf einzugehen, rief die zweite Stimme: »Ich stell mir grad vor, hier um uns rum hätten früher Zuschauer gestanden, um dem Scharfrichter zuzugucken.«
»Dem was? Pssst!«
»Dem Scharfrichter. Der alte Richtplatz von Köln. Der lag hier irgendwo.«
»Und was bedeutet das für uns?«
»Dann könnte es ja sein, dass die Knochen hier von Leuten stammen, die vielleicht gerädert wurden.«
»Aha.«
»Gerädert und geköpft. Vielleicht waren das Hexen!«
»Nein«, widersprach Konrad. »Außerdem …«
»Stimmt. Hexen sind hier meist verbrannt worden. Erwürgt, dann verbrannt.«
»Außerdem waren das keine Hexen, sondern Frauen, die man zu Hexen erklärt und dann umgebracht hat«, sagte Konrad – so leise, als spräche er zu sich selbst. Das offene Grab, das es abzuräumen galt, lag nicht weit entfernt vom neuen Haupteingang des Friedhofs. Neben jenem Bereich, den ein Steinblock mit besinnlichen Worten als Ruhegarten auswies. Konrad hatte mit dem Bagger sehr tief gegraben. Tiefer als geplant, denn er und sein Kollege gingen einem Verdacht nach. Einem, der ganz und gar nichts mit Hexen zu tun hatte.
In diesem Grab war ein Kölner Fabrikant bestattet worden, der um 1900 herum zu Geld und Einfluss gekommen, aber mit seinem Tod in Vergessenheit geraten war. Über hundert Jahre lang hatte das Grab Zeit gehabt, zu verfallen. Ein eher unscheinbares Grab, abseits der Angebergräber der Kölner Geldsäcke. Kaum hatte Konrad hier am Montag begonnen, in die Tiefe zu graben, war er auf ein Metallkästchen gestoßen. Und nun …
Er besah den Fund. Es war der erstaunlich gut erhaltene Schädel einer Frau. Zumindest vermutete Konrad das. Das Loch auf der Rückseite deutete auf Mord hin. Erschlagen. Von hinten. Mit was auch immer. Konrad beugte sich halb über den Schädel, drehte sich vom Weg weg. Er wusste, dass es nie gut kam, wenn Leute plötzlich Knochen, insbesondere Totenköpfe, sahen. Nicht mal hier, auf dem Friedhof. Sein Gesprächspartner hatte da weniger Probleme:
»Ein Femur!«, rief er.
»Pssst. Bitte.«
»Guck doch! Ist ein ziemlich kurzer. Hier!«
Femur – Oberschenkelknochen. Das lateinische Wort wirkte fremd im Ton der aufgeregten Stimme. Eine ältere Dame, die sich aus südlicher Richtung näherte, schrie plötzlich auf, was auf dem Friedhof selten geschah, denn der Friedhof war der Ort der Zeit nach dem Tod und nicht der des Moments unmittelbar davor. Die Dame war elegant gekleidet, weißhaarig – der Volksmund nannte es melatenblond. Vielleicht kam sie von einem Kaffeekränzchen mit befreundeten Witwen auf einen Abstecher zum Ruheplatz des Gatten. Sie schnappte keuchend nach Luft, war alt genug, um nun auch den letzten Atemzug beziehungsweise Schritt noch zu tun. Sie stolperte, stützte sich, Halt suchend, auf einem der Grabsteine rechts des Weges ab. Da erblickte sie in dem gähnenden Erdloch links von sich – sie konnte ein Stück weit hineinsehen – nicht nur den erschrockenen Konrad mit Schädel in der Hand, sondern auch eine Faust, die einen stattlichen Knochen hielt und hochfuhr, als würde diese Faust eine Keule schwingen und zuschlagen wollen. In dem Moment ging die Fantasie mit der alten Dame durch:
»Ein Kind! Da … da ist …«, japste sie verwirrt, »… ein Kind … im Grab!«
Eine weitere Person eilte, wie tänzelnd, von den Toiletten nahe der Trauerhalle herbei. Sie fing die hyperventilierende Dame auf, die nun auch noch vom Halt am Grabstein abzurutschen und in das Loch mit dem Keulenschwinger hineinzuplumpsen drohte. Den Namen der Retterin kannte Konrad, und er war froh über ihr Auftauchen: Oma Gitti, das Herz einer Gruppe von Obdachlosen, die regelmäßig am anderen Ende des Friedhofs übernachteten. Meist fand man sie dort in der Nähe des Rechtsmedizinischen Instituts, im Schatten der Mauer zum Jüdischen Friedhof Ehrenfeld, der ebenfalls an Melaten grenzte. Oma Gitti trug ein sehr buntes Sammelsurium von Altkleidern, was der gut situierten älteren Dame sicher aufgefallen wäre, hätte sie in diesem Moment über jenen kritischen Blick verfügt, für den sie sonst durchaus berüchtigt war:
»Ein … ein Kind!«
»Kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich mal hin und beruhigen Sie sich. Das ist ein Engelchen. Das wohnt hier«, sagte Oma Gitti in ihrem typischen Singsang. Sie zog die Verwirrte behutsam vom Grabloch fort, lotste sie zu einer Bank an den Urnenreihen des Ruhegartens.
»Ich habe mich ja so erschrocken«, stammelte die alte Dame, versuchte, das Bild des Knochenschwingers aus dem Kopf zu bekommen, während Oma Gitti sie behutsam mit sich lotste und ihr dabei die Hand tätschelte. Als die Dame auf der Bank saß, holte Oma Gitti ihr etwas zu trinken. Ein Wasserglas fand sie zwar nicht, aber da lagen ein paar kleinere, in den Boden steckbare Grabvasen auf einem Fenstersims der Trauerhalle. Eine davon sah recht sauber aus und gefiel Oma Gitti wegen der bunten Blümchenaufkleber. Das Wasser entnahm sie einer Gießkanne. Die entdeckte sie neben dem Grabkerzen-Automaten an der Trauerhalle, wo der Hauptweg des Friedhofs begann. Er wurde Millionenallee genannt, weil an seinem Rand die prachtvollsten Grabanlagen Melatens lagen: Oberbürgermeister, Regierungsmitglieder, Kaufleute, Bankiers. Möglicherweise auch das Grab, dem die Dame ihren Besuch hatte abstatten wollen. Oma Gitti verscheuchte einen durstigen Dackel von der Gießkanne und befüllte anschließend die Vase. Das Wasser von den Toiletten schien ihr ungeeignet, und der Wasserhahn am Friedhofseingang ließ sich partout nicht aufdrehen. Was Oma Gitti aber nicht wunderte, denn es passte ja zu einem Friedhof, dass dort alle möglichen Dinge verrosteten, außer Betrieb, defekt waren.
Ein bisschen defekt war auch Oma Gitti.
Während die alte Dame gedankenverloren einen Schluck Gießkannenwasser nahm, hatte Konrad seinen Schreck überwunden. Er wollte sich mit klopfendem Herzen aus dem Loch stemmen und sich nach dem Befinden der Dame erkundigen. Er ahnte, dass sie sich später beschweren würde. Arno Schorn, der Chef der Friedhofsgärtner von Melaten, hatte viel Verständnis für Konrads Schrullen, dennoch gab es immer mal wieder einen Rüffel – und wenn nicht von Schorn selbst, dann von Konrads Kollegen, die in der Mehrheit nicht so viel Verständnis für ihn hatten wie Schorn.
Er wollte sich gerade aus der Grube hochwuppen, als plötzlich ein Schatten auf ihn fiel – lang und schwarz.
Ein Schatten und das vordere Ende eines Geigenkastens.
»Ich habe es geahnt«, sagte eine kalte Stimme, und während Konrads Herz gefror, wurde Martin, die Person neben ihm, jäh daran erinnert, dass er nicht nur zu laut, sondern auch vergesslich gewesen war: »Mist!«
BITTE SCHNALLEN SIE SICH AN
Als um 18 Uhr in Köln die Kirchenglocken läuteten, sprang die Zeitanzeige in der Schalterhalle des Flughafens von Bogotá auf zwölf Uhr mittags. Kurz darauf wurde der Flug nach Frankfurt am Main ausgerufen und am Gate ging ein Aufatmen durch die Wartenden. Endlich. Die Maschine hatte fast sechzehn Stunden Verspätung. Ein Streik, aber nun war ein Ende in Sicht. Nun konnte man zwölf Stunden lang die Augen schließen und schlafen. Morgen früh, Ortszeit sechs Uhr, würde man in Deutschland landen.
Als das Boarding begonnen hatte, eilte ein Geschäftsmann, ein untersetzter älterer Herr mit schwarzem Lederkoffer zum Check-in. Er hatte schon am Tag zuvor sein Gepäck aufgegeben. Doch als klar war, dass der Flug um mehr als zwölf Stunden verschoben wurde, hatte er noch einmal sein Fünfsternehotel bezogen.
Geld genug hatte er.
Und er brauchte Ruhe.
So wirkte er, als er die Halle betrat, ganz und gar nicht entspannt. Und jetzt, wo die Zeit drängte – der Service hatte ihn zu spät informiert –, musste er noch eine längere Kontrolle über sich ergehen lassen.
Es gab wohl Sicherheitsprobleme. Die Welt war voll davon und Südamerika ganz besonders. Nach der Kontrolle des Handgepäcks und einem Moment der Irritation fand der Mann den entsprechenden Schalter, legte seine Papiere dort noch einmal vor. Hinter der Glasscheibe saß ein Mann mit dunkelblauer Schussweste, ein Militärpolizist. Er besah die Dokumente, blickte auf, sah dem etwas atemlosen und im Gesicht teigig blassgrauen Herren erneut in die Augen:
»Sie fliegen nach Deutschland, Herr … Hoffmann?«
Er sprach mit erstaunlich wenig Akzent.
»Ja«, räusperte sich der Herr. Er hatte damit gerechnet, auf Englisch angesprochen zu werden: »Frankfurt. Dann weiter nach Köln.«
»Köln«, sagte der Offizier, »war dort für ein Jahr. Militärischer Austausch. Konrad-Adenauer-Kaserne. Wie sagt man …?« Er sprach die Worte langsam, weil er sie eins nach dem anderen aus den Ablagen seiner Erinnerungen zog: »Be-trunken mit Kölsch heißt er-trunken.«
Er betonte die Anfangssilben, lachte. Hoffmann lachte ein bisschen mit.
»Der ist gut«, sagte er, wenig überzeugend.
Der Militärpolizist hielt die Ausweispapiere vor sich in der Luft.
»Sie leben schon lange in Kolumbien? Ein R-Visum?«
»Ja«, sagte Hoffmann mit einer gewissen Zurückhaltung. Ein R-Visum erhielt man, wenn man sich für einen unbegrenzten Aufenthalt in Kolumbien qualifiziert hatte. Ein solches Visum zu bekommen, war an strenge Bedingungen geknüpft.
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin … ich war Chemiker.«
»Chemiker?«
Der Blick des Militärpolizisten wurde argwöhnisch. Hoffmann bemerkte seinen Fehler. Wieso war er nicht bei den Absprachen geblieben? Verheiratet mit einer Kolumbianerin. Punkt. Verlor er die Nerven? Chemiker waren die Stützen der kolumbianischen Kokskartelle. In jedem Chemiker steckte Potenzial für Jahrzehnte politischen Chaos’.
»Was genau?«
Hoffmanns Herz schlug schneller:
»Lebensmittelchemie. In der Forschung. Zuckeraustauschstoffe. Ein heikles Feld. Viele dieser Ersatzstoffe … entweder sie bringen nur die Verdauung durcheinander oder gleich den ganzen Stoffwechsel. Sacharin, Cyclamat, Aspartam, Steviosid … Thaumatin. Ganz gleich, sie …«
»Thaumatin, verstehe. Hauptsache, Sie haben das Problem gelöst«, würgte der Militärpolizist ihn ab. Machte der Mann Witze? Wer über Witze aus dem Mund eines Militärs lachte, stand schnell an der Wand.
»Ich? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Forschung ist ein Kampf mit vielen Niederlagen. Ich … habe mich bemüht.«
Der Militärpolizist lächelte, gab die Dokumente zurück:
»Le deseo un buen viaje y una buena vida en Colombia«, sagte er.
Hoffmann schluckte:
»Muchas … gracias. Ellos … son muy amigables.«
Er stotterte. Sprach mit starkem Akzent. Sein Herz raste. Der Militärpolizist zeigte keine Regung. Hoffmann nahm die Papiere entgegen, wandte sich ab, schob Personalausweis und Reisepass umständlich zurück ins Jackett und ging schleunigst weiter. Diese verdammte Übelkeit hatte sich schon am vergangenen Abend angekündigt. Sie schnürte ihm die Luft ab. Er stellte den Lederkoffer ab, öffnete den obersten Knopf des Hemdkragens, griff den Koffer, ging weiter. Er schwankte, blieb nochmals stehen, schwitzte stärker. Im Gewimmel des Flughafens fiel das nicht auf. Nur ein Kind, das die Welt des Terminals mit großen Augen und in der Nase bohrend erkundete, glotzte Hoffmann an. Als es seiner Mutter sagen wollte, was an Hoffmann so interessant war, schimpfte sie nur, zog dem Kind den Finger aus der Nase und widmete sich wieder den Verlockungen des Duty-free.
Hoffmann erreichte das Gate. Nur noch wenige Passagiere warteten darauf, dass ihre Bordkarten eingelesen wurden und dass ihnen die freundliche Dame am Durchgang den Weg in den Flieger freigab. Ein Gefühl von Beklemmung trieb ihn auf den Tunnel zu, der zum Flieger führte, zurück nach Hause. Zwölf Stunden Flug. Es war ein Horror, den er überstehen musste.
Fixiert auf den langen Flug, bemerkte er nicht, dass zu den wenigen noch Wartenden zwei Männer gehörten, die am Gate gesessen und den Zugang zum Wartebereich beobachtet hatten. Als Hoffmann erschien, wechselten sie einen Blick, erhoben sich. Auch sie trugen dunkle Aktenkoffer und dunkle Anzüge. Und das war nicht das Einzige, was sie zu dunklen Gestalten machte. Der eine war schlank, hochgewachsen, hatte in seinem Blick etwas, das auf ein Gehirn hinter den Augen schließen ließ. Der andere war eher klein, gedrungen. Sein Gesicht war gezeichnet von den Narben eines intensiven Lebens. In der kolumbianischen Unterwelt nannte man sie Los Manos – die Hände. Grammatisch korrekt wäre Las Manos gewesen, aber Pablo und Pedro empfanden sich ganz und gar als Männer, da störten weibliche Artikel nur. Es gab dann und wann Klugscheißer, die sie auf die falsche Grammatik hinwiesen.
Solche Klugscheißer hatten keine besonders hohe Lebenserwartung.
Der hochgewachsene mit dem Gehirn hieß Pablo. Pablo Baresco. Genannt: Zwei-Finger-Pablo. Aus Gründen. Der Gedrungene mit dem Blick einer Baustelle hieß Pedro. Pedro Brasi. Acht-Finger-Pedro. Ebenfalls aus Gründen.
Die beiden bestiegen nach Hoffmann den Flieger.
Als Hoffmann am Ende der Fluggastbrücke durch die Einstiegstür des Airbus trat, fiel dem Bordpersonal bereits auf, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Eine Stewardess in dunkelblauer Uniform hob in aller Freundlichkeit dezent ihre feine Nase. Getrunken hatte der Mann nicht. Aber dennoch, das blassgrau verschwitzte Gesicht, der fast panische Blick: Man hatte Hoffmann von nun an auf dem Schirm.
Der Flieger war gut gefüllt, doch in der Businessclass waren nur knapp die Hälfte der Plätze besetzt. Das Bordpersonal sorgte diskret dafür, dass die Dame, die neben Hoffmann hätte sitzen sollen, durch einen Flugbegleiter mit weniger feiner Nase ausgetauscht wurde. Ein Problem mit der Elektronik an ihrem Platz, erklärte man der Dame: Beleuchtung, Fernsehmonitor. Funktionierten nicht richtig. Und es gab während des Flugs so viele gute Filme. Sie bekam noch einen Piccolo Champagner extra und war ohnehin erfreut, den Flug nicht neben diesem nervösen Dickerchen verbringen zu müssen.
Hoffmann nahm den Austausch gar nicht wahr. Er atmete schwer, als er den Lederkoffer in der Ablage über dem Sitzbereich deponieren wollte. Nach zwei vergeblichen Versuchen, den Koffer hochzuhieven, stellte er ihn auf den Boden, unterhalb des Fensters.
»Darf ich Ihnen behilflich sein?«
Der Flugbegleiter. Hoffmann erschrak.
»Danke, nein, ich …«
Sein Atem ging rasselnd.
»Solche sperrigen Gegenstände müssen gesichert sein«, sagte der junge Mann. »Sie könnten sich bei Turbulenzen verselbstständigen.«
Er schob die Hand vor, sah Hoffmann freundlich, aber fest in die Augen. Hoffmann nickte. Der Mann nahm den Koffer, verstaute ihn. Währenddessen lief vor ihm auf dem Monitor der vor Starts übliche Film mit Sicherheitschecks inklusive dem obligatorischen:
»Bitte schnallen Sie sich an …«
Hoffmann befolgte die Anweisung. Aber auch mit dem Sicherheitsgurt hatte er Schwierigkeiten.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«
Wieder der Flugbegleiter. Er half mit dem Gurt. Dann sagte er:
»Sie sehen, wenn ich das sagen darf, ein wenig blass aus.«
Blass war untertrieben. Hoffmann war mittlerweile leichengrau.
»Vielleicht … eine Reisetablette? Etwas zur Magenberuhigung.«
Das Schwindelgefühl wurde stärker.
»Ich habe heute Morgen beim Frühstück wohl etwas gegessen, was ich nicht gut vertragen habe. Und dann … das lange Warten.«
Der junge Mann lächelte verständnisvoll. Doch Hoffmann hatte gelogen. Er hatte seit Stunden nichts gegessen.
»Machen Sie es sich bequem. Ich besorge Ihnen etwas.«
Der Mann hatte sein Hilfsangebot kaum formuliert, da brachte eine Kollegin bereits die Tablette. Mit einem Glas Wasser. Hoffmann nahm die Tablette mit einem Schluck Wasser, von dem er zittrig einiges verschüttete.
Schon wurde eine Serviette mit Kranich-Symbol darauf gereicht.
Pablo und Pedro hatten ebenfalls in der Businessclass Platz genommen. Pablo schräg hinter Hoffmann, Pedro auf gleicher Höhe, an der linken Bordwand. Pablo betrachtete sein Smartphone, was weder mit dem Checken von Geschäftsmails noch mit Zeitvertreib zu tun hatte. Auch Pedro betrachtete sein Smartphone. Bei ihm war es Zeitvertreib. Er spielte Tetris und verlor. Nach dem Auftrag wollte er dem Erfinder dieses Spiels einen Besuch abstatten.
Als sich die Maschine aufs Rollfeld bewegte und sich der Reihe der startbereiten Flieger anschloss, hatte Hoffmann das Gefühl, die Übelkeit würde nachlassen. Die Tablette wirkte. Er hätte jetzt gern geschlafen, aber er musste wach bleiben. Mindestens einen halben Tag lang musste er noch durchhalten …
Reiß dich zusammen, dachte er und starrte aus dem Fenster, begann zur Ablenkung Dinge zu zählen: Militärfahrzeuge am Rand der Startbahn, die Maschinen vor ihnen, die Hallen und die flachen bunten Häuser, die teils zum Flughafen, teils zu den Wohngebieten im Nordwesten Bogotás gehörten. Beim Beschleunigen zählte er die unterschiedlich dunklen Asphaltflicken auf der Rollbahn, die Randbeschilderungen auf den Grasflächen daneben – bis ihn die Geschwindigkeit mit einem neuen Schwung Schwindelgefühle überschüttete und er die Augen schließen musste.
Das Flugzeug hob ab. Hoffmann hielt die Luft an. Es kam ihm vor, als müsste er sie bis zum Übergang in den Reiseflug anhalten, was etwa eine Viertelstunde dauerte. Als dann die Anspannung abfiel, konnte er sich gegen das Einschlafen nicht mehr wehren. Er bemerkte es so wenig wie die Tatsache, dass man ihn weiterhin beobachtete.
Als er erwachte, hatte er Schmerzen. Ein Tonnengewicht lastete auf ihm. Das Aufwachen war sein Versuch, dieses Gewicht zu heben. Er stöhnte vor Anstrengung. Seine Gedanken standen in Flammen: Wie lange hatte er geschlafen? Wo befand er sich? War das eine Schlaftablette gewesen? Erinnerungen an die Momente vor dem Start. Der Kopf pochte. Der gesamte Körper schien langsam zu erstarren. Er musste sich bewegen, dieses Gewicht heben. Die Maschine schnitt durch ein von tief leuchtender Helligkeit gesäumtes Wolkenfeld. Ein abendliches Bild. Er musste stundenlang weggetreten gewesen sein. Große heiligweiße Wolkengebilde waren da aufgewachsen, majestätisch und zugleich zart glimmend, golden, wie mit Honig bestrichen. Und dann … Hoffmann versuchte aufzustehen. Er war noch immer angeschnallt. Der Gurt … Jemand kam auf ihn zu, sprach ihn an. Hoffmann konnte ihn nicht verstehen. Das strahlende, warme Licht, es wechselte, schimmerte plötzlich tiefgrün. Hoffmann tauchte ganz ein in diese Farbe, und dann trat in diesem geheimnisvollen Grün wie in einem überirdischen Garten ein Engel auf ihn zu, und er führte jemanden an der Hand. Einen Mann in schäbiger Kleidung. Einen Menschen ohne Geld und Habe. Jemanden, der den Beistand eines Engels auch im Leben brauchte.
Doch dieser Mann war tot.
Der Engel hatte ihn zum Leben erweckt.
Der Mann sah Hoffmann an, und Hoffmann erkannte ihn, und sein Herz blieb stehen. Er wollte etwas sagen. Da hob der Engel die Hand, und Hoffmann schwieg, und der Engel lächelte und sagte mit einer Stimme, für die Engel aus Filmen berühmt sind:
»Alles ist gut. Du bist kein Mörder. Dir ist vergeben.«
Und dann umarmte der tote, lebende Mann Hoffmann, und das Glück, das Hoffmann fühlte, hob alles auf, was er im Leben je Schlimmes erlebt hatte.
Der Flugbegleiter schüttelte ihn, rief:
»Schnell! Schnell! Ein Notfall!«
Das Bordpersonal, für Notfälle geschult, ging eilig, aber routiniert ans Werk: Kontrolle der Vitalfunktionen, Herzstillstand. Defibrillator. Die Szene wurde vom Rest der Businessclass abgeschirmt. Die Dame, die neben Hoffmann hatte sitzen sollen, hatte während des Flugs noch einen zweiten Piccolo getrunken, war nun noch ein Stück entrückter und doppelt froh, den Platz gewechselt zu haben. Auch Pablo und Pedro saßen nicht mehr auf ihren vorigen Plätzen, sondern mehrere Reihen von Hoffmann entfernt auf benachbarten Sitzen, sprachen miteinander. Das heißt: Pablo sprach, Pedro hörte zu und nickte.
Die Reanimationsmaßnahmen hatten keinen Erfolg. Als die Maschine um kurz nach fünf Uhr morgens – sie hatten Tempo machen können – in Frankfurt landete, war Hoffmann seit zwei Stunden tot. An Bord wussten nur wenige von dem Vorfall. Der flugbegleitende junge Mann, der sich um Hoffmann gekümmert hatte, hatte den Lederkoffer in der Dramatik des Geschehens vergessen. Aber das Ding war ohnehin verschwunden, nachdem Fluggäste und Besatzung den Flieger verlassen hatten.
IM GEWITTER DER ROSE
Konrads Herz fand nur langsam zurück in den Rhythmus der Friedhofsruhe. Das hatte vor allem mit Amalia Schmitz zu tun, der ersten Violinistin des WDR Sinfonieorchesters, die um 20 Uhr in der Oper sein musste: eine Aufführung von Shakespeares Sommernachtstraum mit der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Amalia hatte ihrem Sohn Martin am Morgen eingeschärft, ab spätestens 17 Uhr zu Haus zu sein und sich schon mal umzuziehen, denn auch Martin gehörte zum Ensemble des Stücks. Natürlich war er auch um 18 Uhr noch nicht erschienen und Amalia hatte ihn auf seinem Smartphone nicht erreichen können. Martin stellte das Ding nicht nur morgens vor der Schule ab, sondern wann immer es stören könnte.
Martin ging ins nahe Apostelgymnasium, in die siebte Klasse. Seit Wochen, genauer seit Ende der Ferien, blieb er nach der Schule auf dem Friedhof hängen – was auf der Liste beliebter Freizeitaktivitäten für Zehnjährige nicht besonders weit oben stand. Er hatte zwei Klassen übersprungen, machte niemals Hausaufgaben, brachte dennoch reihenweise Einsen heim und wurde von seinen zwei bis drei Jahre älteren, teils mehrere Köpfe größeren Mitschülern gemobbt oder gemieden.
Gemobbt insbesondere von Rochus Gröben, dreizehn, im Wiederholungsjahr in der Siebten und Sohn des schwerreichen Fabrikanten Richard Gröben junior. Rochus konnte mit seinem Taschengeld Kursschwankungen an den internationalen Börsen auslösen. Kurz nachdem Martin der Klasse vorgestellt worden war, hatte Rochus ihm im Beisein aller Mitschüler als Einstandsgeschenk einen Kindersarg überreicht. Das heißt, er hatte den Sarg von zwei seiner willigen Helfer, Enno und Marius, überreichen lassen. Rochus hatte fast die gesamte Klasse im Griff.
»Kannst jetzt in Ruhe sterben, Schmitz«, hatte er gesagt. »Hier braucht dich keiner.«
Selbstverständlich war Martin dieser Aufforderung nicht gefolgt. Er ging oft sehr eigenwillig mit Empfehlungen, Anordnungen, Hinweisen um. So hatte der Sarg sein Interesse an Friedhöfen geweckt, und schon am Tag darauf hatte er Rochus gebeten, das Ding gegen ein etwas größeres Modell umzutauschen, denn es liege sich doch sehr eng darin – die Lacher, die der Spruch auslöste, hatte Rochus Gröben als Kriegserklärung aufgefasst. Seitdem hatte Martin manches Widerliche erlebt und war vorsichtiger geworden.
Was nun den Sommernachtstraum betraf: Martin war zum Mitmachen verdonnert worden, denn seine Eigenwilligkeiten stauten sich auch bei Amalia manchmal auf, und dann gab es diese mütterlichen … Entladungen. Martin sollte zusammen mit weiteren Kindern von Musikern und Darstellern eine der vielen Elfen und Waldgeisterchen spielen, die kostümiert über die Bühne hopsten, um der Komödie Farbe zu verleihen.
Die Krönung seines Kostüms war eine quietschbunte Blümchen-Badekappe, die seiner Oma gehört hatte. Schon der Gedanke an den Auftritt damit war ihm so zuwider, dass er Amalias Anweisungen einfach verdrängt, dann komplett vergessen hatte und viel zu lange bei Konrad geblieben war.
Als Amalia ihren Sohn am Grab zur Rede gestellt hatte, hatte er auch noch die Frechheit besessen, auf das Grab von Edith nebenan zu verweisen und zu behaupten, er habe da wohl die Mendelssohn Bartholdys verwechselt. Nur deshalb sei er hier.
Amalia hatte Martin resolut aus dem Grab gezogen und fortgeschleift. Wie ein schwarzer Engel Richtung Hölle.
Von Amalias Donnerwetter hatte Konrad einiges abbekommen. Er hatte im Gewitter der Worte kaum etwas sagen können. Viel zu perplex war er gewesen, denn zum einen war es seine erste Begegnung mit Amalia Schmitz und zum anderen hatte ihn ihre Erscheinung getroffen wie ein Blitz.
Nun leuchteten seine Wangen in einem Rosa ähnlich dem der hübschen Fleißigen Lieschen (Impatiens walleriana) schräg gegenüber, am Fuß des Grabkreuzes von Justizrat Johann-Joseph Gade († 1834). Und als Minuten später jemand laut rief, blühte Konrads Kopf noch einmal auf.
»Du bist das. Hab schon gedacht, da wachsen Tomaten, die ich besser pflücken sollte.«
Arno Schorn. Der oberste Gartenmeister von Melaten.
Konrads schuldbewusster Blick milderte seinen Ärger:
»Was haste wieder anjestellt, Jung?«, brummte er. Ein kugeliger Sechzigjähriger mit gepflegtem Zwirbelbart:
»Du sollst keine älteren Damen erschrecken. Die kommen noch früh jenuch zu uns. Ich habs mal ausjebügelt.«
»Tut mir leid, Chef«, sagte Konrad.
»Haste den Knirps wieder mitbuddeln lassen?«
Ein leichter Vorwurf in der Stimme.
»Gucken Sie mal, was Martin gefunden hat.«
Konrad hob den Schädel. Drehte ihn. Arno Schorn sah genauer hin.
»Loch im Kopp?«, brummte er. »Hammse den ollen Fabrikanten etwa erschlagen?«
»Der ist von ner zweiten Leiche. Lag tiefer. Darunter. Eine Frau.«
»Unter dem Fabrikanten? Du glaubstes nich …« Schorn zog die mächtigen Augenbrauen hoch. Seine Bartspitzen zitterten: »Der Knirps hat die gefunden?«
»Martin hat geahnt, dass wir noch tiefer graben müssen.«
»Na, aus dem wird noch was.«
»Der is schon was.«
Schorn nickte.
»Sei ma vorsichtich mit dem Jungen. Du weißt ja, Kinder ham hier in den Gräbern nix zu suchen. Falls das in die Zeitung kommt.«
»Klar, Chef«, sagte Konrad. »Martin weiß das auch.«
»Na, ich bin jespannt.«
Schorn zog ab, Richtung Feierabend, blieb dann aber noch einmal stehen:
»Im Notfall behaupteste, er is ’n Schülerpraktikant. Un jetz mach Schluss für heute.«
Schorn wusste, dass der Schädel nicht wieder unter die Erde kam. Das Loch im Kopf würde Konrad keine Ruhe lassen:
»Schließ die Funde weg«, sagte er noch, »oder gib se gleich drüben ab.«
Er wies quer über das Gelände. Mit drüben meinte er das Institut für Rechtsmedizin, das an der anderen Seite des Friedhofs am Melatengürtel lag. Wo Tote, deren Todesursache fraglich war, untersucht wurden.
Man kannte Konrad dort. Der Schädel war nicht sein erster Knochenfund mit möglichen Mordspuren.
Mit einem letzten Gruß zog Arno Schorn davon, zum Betriebshof. Anschließend ging es wahrscheinlich ins Kölschgrab, die Stammkneipe der Friedhofsgärtner in der nahen Dürener Straße.
Es war jetzt fast 19 Uhr. In einer Stunde schloss der Friedhof. Konrad arbeitete gern spät. Oft über den Feierabend hinaus. Der Friedhof war der Ort der Abendstunden. Vor allem im Sommer, wenn die Sonne schien und das Licht sich goldgelb färbte. Dann hatte Konrad das Gefühl, dass der Himmel die Erde berührte und die Gräber anfingen, Geschichten zu erzählen.
»Noch im Dienst, Kollege?«
Nicht die Stimme eines Grabes, sondern eines älteren Herren, den Konrad gut kannte: Heribert Rehbein war 64, Kölner Kommissar im letzten Arbeitsjahr. Ein bedächtiger Ermittler, mit dem Konrad schon manches Gespräch geführt hatte. Heribert, kaum eins fünfundsechzig groß und ein Kopf mit hoher Denkerstirn, besuchte auf Melaten seine Mutter Käthe. Mehrmals die Woche. Und sommers wie winters trug der Kommissar Trenchcoat und Hut. Käthe Rehbein war vierzig Jahre lang Sekretärin diverser Kölner Polizeipräsidenten gewesen, hatte bei einigen das Regiment geführt und das Amt vor Schaden bewahrt. Deshalb schmückten nicht allein die Blumen ihres Sohnes das Grab, sondern alle paar Wochen auch ein Strauß der obersten Kriminalbehörde. Und an Käthes Geburtstagen sogar eine Schale mit Trauerschleife:
Unvergessen
Konrad und Rehbein unterhielten sich kurz. Konrad zeigte dem Kommissar den Schädel und den Oberschenkelknochen. Und Heribert Rehbein gab Konrad denselben Rat, den ihm schon Arno Schorn gegeben hatte:
»Brings rüber zu den Forensikern. Wenn die was finden, sehen wir weiter.«
Das wollte Konrad gleich am nächsten Morgen tun. Heribert Rehbein ging heim. Konrad sicherte das Grabloch, hier gab es noch Arbeit genug in den kommenden Tagen. Dann legte er die Knochen zurück in den Jutebeutel und nahm ihn mit zu seinem Spind im Gebäude des Betriebshofs.
Auf dem Weg dorthin begegnete ihm Marlies von Törne, mit ihrer Gruppe von Qigong-Senioren aus dem nahen Stift Sankt Ursula. Die Ü-80-Jährigen befanden sich auf dem Rückweg von ihrer Übungsstunde, die sie regelmäßig auf einer Wiese unweit des Rechtsmedizinischen Instituts abhielten. Sie grüßten, wippten locker dahin. Bis auf Gisbert Schwaderlapp. Der humpelte. Gerd von Hoppenstedt frotzelte, Gisbert habe sich mal wieder »bis so ’n Stück« – er machte mit Daumen und Zeigefinger eine Fünf-Zentimeter-Geste – »ans Jenseits rangeturnt«.
Lachend zogen sie weiter, und als Konrad den Betriebshof fast erreicht hatte, kam ihm noch der Paul entgegen. Ein recht kleiner älterer Mann mit leichtem Bierbauch und strubblig graublondem Haar. Links trug er einen Ohrring: ein in die Jahre gekommener Punker.
Der Paul war der Paul, so wie Oma Gitti Oma Gitti war, Joschi Joschi, Bernadette Bernadette und der Köbes der Köbes: jene Gruppe von Obdachlosen, die an der Westseite des Friedhofs, nah der Fröbelstraße, ihr Nachtasyl hatten und von Gärtnermeister Schorn geduldet wurden. Die Stadtverwaltung allerdings sah das nicht gern. Immer mal wieder gab es Beschwerden von besorgten Bürgern, und neulich war in den Abendstunden Polizei aufgetaucht, um das Nachtlager zu räumen. Arno Schorn hatte daraufhin etwas taktisch Kluges getan. Er hatte mit Geschäftsleuten aus der nahen Dürener Straße gesprochen. Die kannte er persönlich. Mehrere Ladeninhaber organisierten eine Tafel, um Lebensmittel an Bedürftige abzugeben.
Die Tafel war Teil der Bürgerinitiative Lindenthal:Lebenswert – LiLeBü. Paul hatte sich, auf Vermittlung von Schorn, mit dem Juwelier Cornelius Walterscheid, Ose Schumann von Oses Tee-Oase und Alice Stüssgens vom lokalen Supermarkt getroffen. Paul, Bernadette, Oma Gitti, Joshi und der Köbes würden Unterstützung von der Tafel bekommen und beim Verteilen der Lebensmittel helfen. Sie durften nun darauf hoffen, von den Behörden in Ruhe gelassen zu werden, denn die Geschäftsleute aus der Dürener Straße hatten Einfluss in der Stadt. Besonders Ose Schumann setzte sich sehr dafür ein, dass die Gruppe auf dem Friedhof bleiben durfte.
Doch nicht allein die Behörden waren den Fröbelingern, wie Schorn sie nannte, ein Problem. Als Konrad den Paul grüßte, wirkte der aufgewühlt.
»Der Joschi ist verschwunden«, sagte er, als Konrad nachfragte.
»Der Joschi? Der ist doch immer mal ’n paar Tage weg.«
»Ja, aber diesmal. Ich weiß nich. Seit ner Woche schon.«
»Na, komm«, sagte Konrad. »Der taucht wieder auf.«
Paul wirkte nicht überzeugt.
»Gab wieder Stress. Schmierereien an der Friedhofstür. Die wollen sie jetzt uns in die Schuhe schieben.«
»Schmierereien?«
»An der Tür vom Jüdischen Friedhof. Joshi hatte da nachts was gehört und is gucken. Da sindse weg. Aber ’n paar Farbdosen warn noch da. Un Hakenkreuze hattense aufgeschmiert.«
»Die Polizei glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr das wart?«
»Is doch immer einfach, zu glauben, wir warn das. Verhört hammse den Joschi ja schon. Und kannste glauben: nich mit Samthandschuhn.«
Konrad guckte betreten. Der alte Jüdische Friedhof von Ehrenfeld war ein kleiner historischer Friedhof am Rand von Melaten. Er lag, von einer Mauer eingefasst und stahltürgesichert, neben dem Rechtsmedizinischen Institut. Das Gelände war nicht öffentlich zugänglich und die abgeschlossene Tür war häufiger beschmiert.
»Wir warn das nich«, beteuerte Paul und holte Konrad aus seinen Gedanken.
»Das musst du mir nicht sagen«, sagte Konrad.
»Aber wenn die Faschos denken, dass Joschi sie erkannt hat …«
Konrads Herzschlag beschleunigte sich:
»Hat er der Polizei denn gesagt, wer das war?«
»Na klar hat er das. Aber erkannt hat er keinen. Die warn vermummt. Und geglaubt hammse ihm sowieso nich, die Polizei.«
»Seid ihr denn bedroht worden, seitdem?«
»Immer mal wieder. Von allen möglichen Leuten. Kennste doch.«
»Ja.«
»Aber jetzt nich speziell von … Faschos«, ergänzte Paul. »Nich in den letzten Tagen.«
Konrad nickte:
»Pass mal auf«, sagte er, »der taucht bald wieder auf, der Joschi. Wenn da jetzt was gewesen wär … ich meine, ich spreche doch immer mal mit dem Rehbein. Der hat auch nichts gesagt. Also, was angedeutet oder so.«
»Ach, der Rehbein. Der is doch auch Polizei«, sagte Paul.
»Der taucht wieder auf«, wiederholte Konrad. »Der Joschi … Das ist doch sein Leben hier.«
»Ja«, sagte Paul. »Aber verstecken tut der sich nich. Der war immer der Mutigste von uns allen. Der kneift nich.«
Sie verabschiedeten sich. Nachdenklich zog Konrad weiter, zu den Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden auf dem Betriebshof, wo sich seine Sachen befanden. Am Spind betrachtete er den Jutebeutel. Nach kurzer Überlegung stopfte er Schädel und Oberschenkelknochen in seinen Rucksack und nahm die Funde kurzerhand mit.
Bevor er nach Haus ging, standen noch ein paar Einkäufe an. Zunächst in Oses Tee-Oase in der Dürener Straße. Ose Schumann, 69, zierlich und drahtig wie eine Yoga-Lehrerin, wollte ihren Teeladen schon zumachen. Sie war gerade dabei, das im Kopfteil der bunten Ladentür baumelnde Schild von GEÖFFNET auf GESCHLOSSEN zu drehen – bei Ose hießen die Worte allerdings PASARÁN! und ¡NOPASARÁN! Ein Scherz, der auf Oses wild bewegte rote Vergangenheit anspielte. In ihrer Studienzeit in einer WG in Sülz war sie Ose Luxemburg genannt worden. Als Ose nun Konrad erblickte, wusste sie sofort, was er wollte. Für treue Kunden öffnete sie den Laden gern noch einmal.
Und weil er nicht nur ein treuer, sondern auch ein netter Kunde war, kaufte Konrad neben seinem Tee gleich auch ein bebildertes Buch, das in einem Stapel auf dem Verkaufstresen lag. Ose nahm das oberste Buch in die Hände:
»Das ist ’n Mängelexemplar«, sagte sie und zwinkerte. »Kriegste zum Sonderpreis.«
Zehn Euro war absolut Fair Trade.
Ose hatte das Buch herausgegeben. Zu ihren vielfältigen Interessen gehörte Architektur, insbesondere die Baugeschichte Kölns. Und dieses prächtige Buch befasste sich mit der Bau- und Denkmalgeschichte des Melaten-Friedhofs.
»Ich arbeite schon am nächsten. Der Friedhof ist eine ganz besondere Unterwelt.«
»Glaub ich gern«, sagte Konrad und dachte an den Schädel.
Mit zweihundert Gramm Superior Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe First Flush plus dem sperrigen Bildband im Gepäck schlurfte er weiter zum Supermarkt. Alice Stüssgens hatte bis 21 Uhr auf und die Dame an der Kasse kannte Konrad. Das war sein Glück, denn als Konrad den Rucksack öffnete, um ein Paket Schwarzbrot, einen Kanten Käse und ein bisschen Suppengemüse einzupacken, guckte nicht nur eine leicht gestauchte Ecke des Buches, sondern auch der Oberschenkelhals heraus. In der Schlange hinter Konrad schnappte ein Kunde nach Luft. Die schlagfertige Kassiererin grinste und rief durch den halben Laden:
»Konrad, du sollst deinen Hund nicht so verwöhnen!«
Konrad schnürte den Rucksack fix wieder zu, zahlte und eilte nach Haus. Weit war der Weg nicht. Seine Wohnung lag direkt an der Ostseite des Friedhofs, an der Piusstraße. Geräumige hundert Quadratmeter im obersten Geschoss eines der dortigen Mehrfamilienhäuser.
Zwei Häuser nebenan, ebenfalls im obersten Stock, wohnte Martin. Mit seiner Mutter. Die Konrad ja nun kannte.
Er kochte, aß zu Abend. Um 21 Uhr guckte er, Suppe löffelnd, Nachrichten. Dann sah er nach draußen.
Es dämmerte. Aus dem großen Wohnzimmerfenster, über den Balkon hinaus, fiel der Blick auf die Grabfluren jenseits der Friedhofsmauer. Nachts leuchteten dort rötliche Lichter. Insbesondere im Herbst. An den Trauertagen war der nächtliche Friedhof ein Feld voller Sterne. Und auch heute Abend glomm er wie ein Nachthimmel.
Konrad dachte nach.
Er machte sich Tee, trank den ersten Schluck und wandte sich dem Rucksack zu, legte eine alte Zeitung auf den Wohnzimmertisch. Er zog Oses Bildband über den Friedhof aus dem Rucksack, blätterte ein wenig, und nahm sich vor, in den nächsten Tagen darin zu lesen. Der Schädel war wichtiger. Er legte das Buch beiseite, nahm den Schädel und stellte ihn auf den Tisch. Er betrachtete das fast kreisrunde Loch im Hinterhaupt. Eine Frau, die möglicherweise ermordet worden war. Erschlagen. Rücklings. Eine Unbekannte. Eine, die von der Zeit beseitigt worden war. Die man hatte entsorgen wollen.
Wie sollte er nun vorgehen?
Konrad ging zu einem Schreibtisch in der rechten Fensterecke des Wohnzimmers, zog die Schublade auf, holte ein Schulheft heraus und ein verbeultes Metallkästchen, nahm beides mit sich und legte die Sachen ebenfalls auf den Wohnzimmertisch.
Er setzte sich, trank einen weiteren Schluck Tee, schlug das Heft auf. Es enthielt Notizen, die er sich beim Sichten der Unterlagen zu den alten Gräbern gemacht hatte. Unterlagen aus der Friedhofsverwaltung, soweit sie noch in der Verwaltung bei Arno Schorn aufbewahrt wurden.
Den Anfang der Notizen machte ein Name:
Theodor Schlagowski.
Ein Mann, der auf Melaten begraben lag. Schon lange.
Geboren: 18. Januar 1871
Gestorben: 28. Oktober 1918
Vor über hundert Jahren also.
Die weiteren Notizen handelten davon, dass man sich seitens der Friedhofsverwaltung offenbar eine Zeit lang bemüht hatte, Personen zu kontaktieren, die eine Verlängerung der Belegungsdauer hätten beantragen können. Irgendwann war das eingestellt worden. Man hatte niemanden gefunden und sich dann nicht weiter um die Angelegenheit gekümmert.
Theodor Schlagowskis Grab war für Jahrzehnte aus dem Blickwinkel geraten. Niemand hatte sich für den Toten interessiert. Ein kleines Niemandsland auf einem Friedhof voller Totenreiche.
Dann hatte Arno Schorn entschieden, das Grab aufzulassen und Konrad mit den Arbeiten beauftragt. Konrad befasste sich gern mit der Vergangenheit interessanter Gräber. Und kaum hatte er in der Tiefe wie erwartet die ersten Restknochen Schlagowskis gefunden, war er auf dieses flache, verbeulte Metallkästchen gestoßen. Messing oder so. Verschmutzt, aber nach ein bisschen Polieren hatte es golden geglänzt. Eine Gummierung zur Abdichtung war zerfressen und im Inneren hatte dieser Umschlag gelegen, Ölpapier oder Wachspapier. Wasserdicht also. Hätte es zumindest sein sollen, doch im Laufe der Zeit war wohl Feuchtigkeit eingedrungen. Feuchtigkeit und Bodenleben. Das Papier, das Dokument in diesem Umschlag, war halb zerstört, von Mikroben zersetzt. Die Schrift, wo nicht weggefressen, nur noch zum Teil erkennbar. Eine Art Anklage. Eine Beschuldigung. Konrad öffnete das Kästchen und nahm das Papier heraus. Er hatte es schon Dutzende Male gelesen. Die Worte, die noch lesbar waren:
Der hier … Theodor Schlag… große Schuld auf … Mörder … Erschlagen hast … Do… in deinem Haus bei …. reine Seele. Missbraucht hast … erschlagen am 2 … des J… 191… Kammer … Spuren schon finden. Ihre Leich … hast … toten Körper beiseit … Blut …. Waffe, ein stäh… Blutgeld bezahlt allen, die … geschworen, jedem das …. verraten möcht. Schlagowski … Mörder! Zwanzig Jahre jung …. Vergangen …. zwei Leben … Hölle schmoren … Wahrheit … Licht kommen …. deine Tat finden … tiefer … nicht ausgewa… Musste mit ihm in die Kiste … tiefer, und ihr werdet … Gepeinigten … Kopf mit … Wunde. zerspaltenen Schädel. Die Wahrheit ist ein eisern Ding. Sie vergeht nicht. Sie wird ans Licht … Schlagowski, du wirst …. nicht davon … jüngsten Gericht!
Notizen in krakeliger, sehr alter Handschrift. Konrad hatte die Sätze, die Satzfetzen, die Überreste dieser Mitteilung mühsam entziffert. Die Botschaft an sich blieb kryptisch. Er rätselte seit Tagen an den Worten herum, hatte Nachforschungen angestellt über diesen Theodor Schlagowski. Der war eine Kölner Größe im alten Kaiserreich gewesen. Nach seinem Tod aber schien der Mann in Vergessenheit geraten zu sein. Keine Verwandten, keine Nachfahren.
Konrad goss Tee nach, trank.
Der Tee öffnete Türen in seinem verwinkelten Gehirn.
Später, als es endgültig dunkel geworden war, packte er den Schädel zurück in den Jutebeutel, legte den Fetzen Papier zurück in die Messingbox, setzte sich noch eine halbe Stunde auf den Balkon und versuchte, an etwas anderes zu denken, stellte sich vor, was wohl gerade in der Oper geschah. Das belebte ihn, heiterte ihn fast auf. An Martin mit seiner Blümchen-Badekappe dachte er dabei nicht. Martin hatte ihm natürlich nichts von diesem Kostüm erzählt. Aber der Sommernachtstraum versetzte Konrad irgendwie in Aufregung.
Er besaß einen alten CD-Player und eine gar nicht mal kleine Sammlung klassischer Aufnahmen. Gerät und CDs hatten zum Bestand der Wohnung gehört, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Ein Mann, der an der Universität gearbeitet hatte, am Institut für Ur- und Frühgeschichte. Ein verschlossener Alkoholiker, der Konrad so fremd geblieben war wie ein archäologisches Relikt.
Von Felix Mendelssohn Bartholdy besaß Konrad nur die Italienische Sinfonie. Herbert von Karajan, 1973.
Konrad nahm sich vor, gleich in den nächsten Tagen nach einer guten Aufnahme des Sommernachtstraums zu suchen. Er konnte Martin ja mal fragen, seine Mutter wusste doch bestimmt, welche Aufnahmen da zu empfehlen waren.
Über all dies nachdenkend, hörte er im Geist Violinen. Die Luft war angenehm. Die nahe Aachener Straße schnurrte wie ein Kater aus Metall, begleitete die Melodien in Konrads Kopf. Ein Nachtfalter bumperte liebestrunken gegen das Fenster nebenan. Auf dem Balkon dort blühte eine duftende Staude Gelber Nachtkerzen und verführte die Brummer.
Gegen 23 Uhr 30 legte sich Konrad schlafen. Um sechs Uhr morgens ging sein Wecker. Da war die Maschine aus Bogotá bereits in Frankfurt gelandet.
DER THEODOR, DER THEODOR, ALLEIN AUF SEINER GRABESFLUR
»Sind Sie ein Angehöriger?«
Die junge Dame am Informationsschalter der Airline wich dem Blick des Mannes aus, als sie ihre Gegenfrage stellte.
»Nein, ich bin ein guter Freund«, antwortete der Mann. »Ich wollte Herrn Hoffmann abholen. Und nun hieß es, die Fluggäste seien bereits alle ausgestiegen. Er befand sich doch an Bord?«
Sie sah nach unten, zögerte. Dann hob sie den Kopf. Ihr Blick flackerte.
»Ich bin nicht befugt, Ihnen über die Passagierliste Auskunft zu geben.«
Die Dame war nicht gut darin, Nein zu sagen.
Der Mann wirkte angespannt. Er war jung, dunkelhaarig. Mit seiner hohen vorgewölbten Stirn und den stechenden Augen wirkte er durchsetzungsfähig wie ein aufstrebender Jungmanager. Doch seine Lippen vollführten nervöse Bewegungen:
»Hören Sie, es ist wichtig. Ich hole Herrn Hoffmann nicht nur ab. Er braucht seine Medikamente. Die hat er vergessen. Wenn er die nicht nimmt … Sie verstehen?«
Die Dame wurde noch unsicherer, seufzte:
»Medikamente? Also … Warten Sie einen Moment.«
Sie griff zum Hörer eines neben ihr angebrachten, von außen nicht sichtbaren Telefons. Solche Geräte, das wusste der junge Mann, machten Ärger. Die Dame dachte anders darüber. Ihr gab das Ding Sicherheit. Sie führte ein kurzes Gespräch, nickte mehrmals, legte auf:
»Gleich kommt jemand, der Ihnen vielleicht helfen kann«, erklärte sie erleichtert.
Der Mann nickte automatisch. Aber der Boden unter seinen Füßen wurde heiß. Die Frage war ein Fehler gewesen. Er räusperte sich und wandte sich halb vom Schalter ab:
»Ich warte dort drüben.«
Er wies ins Ungefähre des Wartebereichs und machte sich so schnell davon, dass die Dame Halt! rufen wollte. Aber ihre natürliche Schüchternheit verbot es ihr.
Nach nur wenigen Minuten hatte der Mann das Terminal des Frankfurter Flughafens verlassen, befand sich im Parkhaus, bei seinem Wagen, überlegte. Sein Kopf pochte. Immer wieder sah er sich um. Plötzlich hatte ihn in der großen Flughafenhalle das Gefühl überkommen, dass ihn die Augen Hunderter Überwachungskameras anstarrten – was gar nicht so falsch war. Fehler über Fehler. Es hatte alles so einfach sein sollen, und nun? Was sollte er jetzt tun? Nicht einmal eine Smartphoneverbindung hatten sie. Die ganze Sache war dämlich, kopflos, laienhaft organisiert worden. Der Mann hätte doch allein nach Köln reisen können, mit der Bahn. Weshalb hatte er ihn in Frankfurt abholen müssen? So ein Mist!
Nun musste er die Sache ausbaden.
Er versuchte, sich zu beruhigen. Es gab nur drei Erklärungen für das, was passiert war: Entweder der Mann hatte sich abgesetzt. Das schien ihm aber unwahrscheinlich. Nicht nach dem, was er von ihm wusste. Nein, dieser Hoffmann war nicht der Typ, der einen hinterging.
War er von der Polizei festgenommen worden?
Seltsamerweise bereitete ihm diese Erklärung die geringsten Sorgen. Am schlimmsten war Möglichkeit Nummer drei:
Hoffmann war hochgenommen worden. Aber nicht von der Polizei.
Der Mann ging noch einmal zurück in die Abflughalle, mied allerdings den Schalter. Er konnte ihn aus der Distanz im Blick behalten. Die Dame saß nicht mehr an ihrem Platz. Die Halle schien groß genug, um ein Segelflugzeug hindurchfliegen zu lassen. Vielleicht hatte er diesen Hoffmann einfach nur verpasst? Sie kannten sich nicht, aber sie hätten sich erkannt. Er hatte Fotos von dem Mann gesehen, und diesem Hoffmann war gesagt worden, wer ihn abholen würde.
Doch Hoffmann war dort nirgends. Und draußen, vor den Fenstern der Halle, stand das Flugzeug nach wie vor an seinem Platz an der Fluggastbrücke. Ein Flugzeug von vielen dieser Überseemaschinen, die Frankfurt täglich zu Hunderten ansteuerten. Der Mann folgte einem Gefühl. Es lotste ihn auf die Besucherterrasse. Von dort aus hatte er einen guten Blick auf die Maschine und das Drumherum. Ein großer Vogel. Daneben wirkte alles recht klein …
Vorn am Flieger, halb verdeckt von Bug und rechter Tragfläche, stand ein signalrot-weißer Transporter mit gelb-rot gestreiftem Heck – wie ein Küken unter den Fittichen der Mutter.
Ein Rettungswagen?
Der Mann dachte an eine vierte Möglichkeit, die das Verschwinden Hoffmanns erklären konnte. Sie war die natürliche Folge von Möglichkeit drei:
Sie hatten Hoffmann außer Gefecht gesetzt. Vergiftet vielleicht? Oder betäubt, um ihn zu entführen und anderswo zu verhören? Im Gehirn des Mannes ging es rund. Wenn das, was er da zusammenfantasierte, tatsächlich geschehen war, dann musste er herausfinden, wohin sie Hoffmann brachten.
Er holte sein Smartphone hervor und rief jemanden an. Das Gespräch dauerte fast fünfzehn Minuten. Er hatte große Schwierigkeiten, seinen Gesprächspartner zu beruhigen. Der Typ am anderen Ende der Leitung war der Panik nahe.
Er selbst ging jetzt mit kühlem Kopf vor.
In der folgenden Stunde gelang es ihm, ein wenig Licht in die Angelegenheit zu bringen. In der Notfallambulanz des Flughafens fand er jemanden, der ihm Auskunft gab. Seine schlimmste Befürchtung bestätigte sich. Hoffmann war tot.
Was geschah nun mit der Leiche?
Weil sich der Mann mit ganzer Kraft auf den Fall Hoffmann konzentrierte, bemerkte er nicht, dass sich zwei der Fluggäste – Zwei-Finger-Pablo und Acht-Finger-Pedro – an seine Fersen geheftet hatten. Ohne aufzufallen, was dem Gehirn Pablos und der Durchschlagskraft Pedros zu verdanken war. Man sollte sich allerdings keine falschen Vorstellungen von den Kräfteverhältnissen innerhalb des Duos machen. Acht-Finger-Pedro, der Gedrungene, Wuchtige, war eine Kampf- und Mordmaschine. Man nannte ihn Acht-Finger-Pedro, weil er mal zwei Verräter mit je einer Hand unter Wasser gedrückt hatte. Dabei hatte er zwei Finger verloren. Es war nicht klar, ob sie ihm von den Opfern oder von den mit Crystal-Meth aufgeputschten Piranhas im Mordbecken abgebissen worden waren. Pedro hatte nicht mal gezuckt. Das tat er nur, wenn Pablo Baresco, der Schlanke, Nachdenkliche, ihm Anweisungen gab. Pablo musste nur mit zwei Fingern schnipsen, dann gehorchte auch Pedro.
Um kurz nach sieben Uhr machte sich ein Leichentransport auf den Weg nach Köln. Zwei Fahrzeuge folgten ihm. Die Todesumstände des Mannes, der auf dem Flug von Bogotá nach Frankfurt gestorben war, waren in einem Maße rätselhaft und warfen so viele Fragen auf, dass eine gerichtsmedizinische Untersuchung anberaumt worden war. In Köln.
Der Leichenwagen fuhr mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Er geriet nur kurz vor Köln in einen Stau, im dort üblichen Baustellensalat. Das Fahrzeug ließ sich gut verfolgen, denn es fuhr nie schneller als 120 km/h. Im Leichenwagen wusste der lebendige Teil der Fahrzeugbesatzung nichts von den Verfolgern. Der Mann im Wagen dahinter, der den Toten als lebendigen Menschen vom Frankfurter Flughafen hatte abholen wollen, wusste nichts von Fahrzeug drei, hinter ihm. Nur in Fahrzeug drei wussten Pablo und Pedro von allen anderen. Hätte der Nerd Martin sich Gedanken über den kleinen Konvoi gemacht, hätte er sich vielleicht zu der Hypothese verstiegen, dass das Wissen der drei Parteien voneinander, mathematisch betrachtet, eine Funktion der Wagenreihenfolge darstellte.
Aber Martin war jetzt auf dem Schulweg und dachte daran, dass sein Schultag mal wieder eine Funktion der Launen Rochus Gröbens sein würde. Nach dem Sommernachts-Albtraum ein weiteres Desaster.
Konrad machte sich am Donnerstagmorgen nach einem wunderbar melodischen Schlaf auf den Weg zur Arbeit. Doch zunächst kehrte er bei der Rechtsmedizin ein. Um kurz nach acht erschien er mit einem Jutebeutel am Empfang und fragte nach Josepha Roth und Benedikt Weiss. Konrad kannte die beiden Forensiker, die oft zusammenarbeiteten. Intern nannte man sie das Team Roth-Weiß. Die beiden spielten unter Forensikern in einer Liga, von der man beim ebenfalls in Rot-Weiß antretenden 1. FC Köln nur träumen konnte.
»Na, Konrad, was haste diesmal?«, begrüßte ihn die Dame am Empfang. Konrad gewährte ihr einen Blick in den Jutebeutel:
»Vom Friedhof?«
»Klar.«
»Und wenn der einfach nur gestorben is?«
»Der ist ne die«, sagte Konrad.
»Ne Frau?« Die Dame beäugte den Schädel skeptisch. »Was verrät dir das? Die Frisur?«
Sie grinste.
»Haste geforscht?«
»N bisschen«, sagte Konrad. »Brauch aber noch mehr Informationen. Vielleicht kommt ihr hier weiter.«
»Bestimmt«, sagte die Frau, fühlte sich selbst gemeint und beäugte das Loch im Schädel.
»Wenn die bei den Reichen lag, dann hat die vielleicht nur einen Golfball an den Kopf bekommen. Die können 200 Kilometer schnell werden.«
Die Dame wohnte nobel, bei Marienburg, golfplatznah. Auf ihrem Zierrasen wuchsen nicht nur Boviste.
»Die lag bei den Reichen, die Leiche, aber ich glaube nicht, dass die reich war«, sagte Konrad vieldeutig.
Die Dame runzelte die Stirn und erinnerte sich daran, dass ein Morgenschwätzchen eine gewisse Zeitspanne nicht überschreiten sollte:
»Benedikt ist noch nicht da«, sagte sie daher. »Der hat einen Außentermin. Aber Josepha ist da. Dann ruf ich sie mal.«
»Danke«, sagte Konrad. Und wartete.
Als Josepha Roth nach zehn Minuten erschien, war sie sehr in Eile:
»Drei schwere Verkehrsunfälle, und bei jedem machen die Versicherungen Druck. Ein Airbag, der angeblich zu spät ausgelöst hat. Ein Mann, der angeblich angeschnallt war, obwohl die Polizei das verneint. Eine Frau, die angeblich verbotene Medikamente eingenommen hat. Dann ein Multimillionär, dessen Todesursache eigentlich ziemlich klar ist, wären da nicht die geldgierigen Erben, die sich gegenseitig des Mordes beschuldigen. Hässliche Sachen. Und alles heute. Und zu allem Überfluss dreht in Mühlheim auch noch einer durch, hört Stimmen und setzt sich mit Gitarre und Cowboyhut im Keller an ein Lagerfeuer. Sieben neue Leichen. Alle heute abzufrühstücken. Das gibt bestimmt noch ne Nachtschicht. Was haste denn, Konrad?«
Die Frage war rhetorisch. Der Schädel stand nach dem einführenden Gespräch auf dem erdbraunen Holz des Empfangstresens. Daneben lag nun auch der Oberschenkelknochen. Josepha wies auf das bräunliche Hinterhaupt.
»Wegen des Lochs hier?«
Sie drehte den Schädel, betrachtete ihn genauer.
»Sieht tatsächlich nicht danach aus, als sei das entstanden, weil der Sarg eingebrochen ist. Harter, gerundeter Hammerkopf mit flacher Schlagseite, würde ich sagen. Das Loch ist aber … recht klein. Ziemlich schmaler Hammer.«
»Eine … Kugel?«
»Nein, dafür dann doch zu groß. Eine solche Kugel hätte vom Schädel nichts übrig gelassen … Andererseits … Eine Schleuder vielleicht.«
»Golfball«, murmelte die Dame vom Empfang, und dann lauter: »Konrad behauptet, das ist ne Frau.«
»Kann schon sein«, sagte Josepha. »Der Femur hier, das Collum Ossis Femoris.«
»Collum was?«
»Der Oberschenkelhals. Er ist etwas nach vorn gedreht. Typisch Frau. Und hier, am Schädel, die Augenwulst: kaum ausgebildet. Frauen erinnern weniger an Neandertaler als Männer. Kinn sehr spitz. Ziemlich vollständig, die Dame.«
»Also doch«, sagte Konrad.
»Na ja warte mal noch ein bisschen. Hab ich Zeit?«
Josepha Roth sah Konrad herausfordernd an.
»Klar«, sagte Konrad, betrachtete den Schädel. »Ich glaub, Zeit spielt jetzt nicht mehr so die Rolle.«
»Bei mir schon«. Josepha Roth seufzte. Nur der Schädel schien zu grinsen.