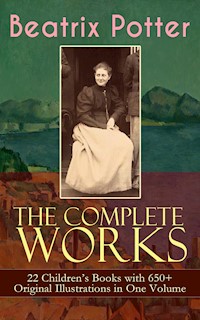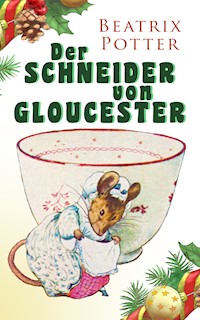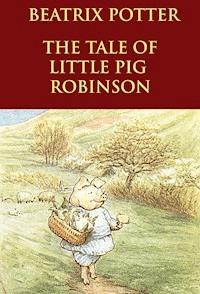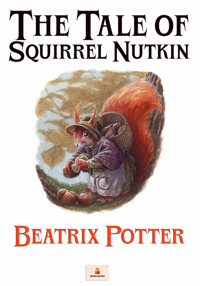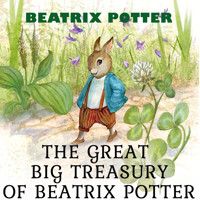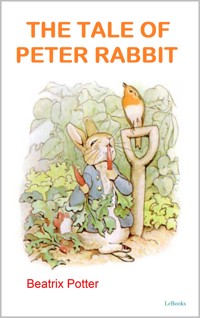Es war einmal zur Weihnachtszeit: Die schönsten Weihnachtsgeschichten, Märchen & Sagen E-Book
Beatrix Potter
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer Weihnachten feiern möchte, muss unter dem Baum unbedingt ein Exemplar von unserer Sammlung der bekanntesten und schönsten Weihnachtsgeschichten haben, die zur feierlichen Atmosphäre beitragen: Der Schneider von Gloucester (Beatrix Potter) Nußknacker und Mausekönig (E.T.A Hoffman) Charles Dickens: Der Weihnachtsabend Das Heimchen am Herde Der Kampf des Lebens Die Silvester-Glocken Der Behexte und der Pakt mit dem Geiste Die Geschichte des Schuljungen Doktor Marigold Mrs. Lirripers Fremdenpension Die Geschichte des armen Verwandten Sherlock Holmes: Der blaue Karfunkel (Arthur Conan Doyle) Eine Erzählung für Kinder (Leo Tolstoi) Selma Lagerlöf: Christuslegenden Die Heilige Nacht Ein Weihnachtsgast Die Mausefalle Das Geschenk der Weisen (O.Henry) Bergkristall (Adalbert Stifter) Da stand das Kind am Wege (Theodor Storm) Marthe und ihre Uhr (Theodor Storm) Das Sternenkind (Oscar Wilde) Der selbstsüchtige Riese (Oscar Wilde) Weihnacht (Karl Kraus) Pariser Weihnachten (Kurt Tucholsky) Die heilige Weihnachtszeit (Peter Rosegger) Als ich Christtagsfreude holen ging Erste Weihnachten in der Waldheimat Weihnacht in Winkelsteg Hans Christian Andersen: Die Schneekönigin Das Kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen Der Tannenbaum Der standhafte Zinnsoldat Der kleine Lord (Frances Hodgson Burnett) Der Schneemann (Manfred Kyber) Der kleine Tannenbaum (Manfred Kyber) Das Geheimnis der Mischung (Ludwig Ganghofer) Das Weihnachtsland (Heinrich Seidel) Ein Weihnachtsmärchen Eine Weihnachtsgeschichte Am See und im Schnee Brüder Grimm: Sternthaler Frau Holle Sneewittchen Die Wichtelmänner Lüttjemann und Püttjerinchen (Hermann Löns) Puck Kraihenfoot Der allererste Weihnachtsbaum Die kleine Tänzerin aus der Sperlingsgasse (Wilhelm Raabe ) Das Elixir (Georg Ebers) Die Nüsse Die graue Locke Christkindl-Ahnung im Advent (Ludwig Thoma) Luise Büchner: Die Frau Holle Knecht Nikolaus Die Geschichte vom Christkind und vom Nikolaus Die Geschichte vom Christkind-Vogel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Es war einmal zur Weihnachtszeit: Die schönsten Weihnachtsgeschichten, Märchen & Sagen
Über 100 Titel in einem Buch: Das Geschenk der Weisen, Die Heilige Nacht, Der Schneider von Gloucester, Der Tannenbaum, Der Schneemann, Der Weihnachtsabend, Knecht Nikolaus und viel mehr
Inhaltsverzeichnis
Der Schneider von Gloucester
Zur Zeit der Schwerter und Perücken; als die Herren noch Mantelröcke mit geblümten Zipfeln und Rüschen und goldverzierte Westen trugen – da lebte ein Schneider in Gloucester.
Er saß in einem Schaufenster eines kleinen Geschäfts in der Westgate Straße, im Schneidersitz auf einem Tisch – von morgens bis abends.
Solang es draußen hell war, nähte und schnipste er, schnitt Stoffe und Schnüre und Dinge mit komischen Namen, die zu jener Zeit sehr teuer waren.
Aber obwohl er die feinste Seide für seine Nachbarn nähte, war er selbst sehr arm – ein kleiner alter Mann mit Brille, mit verkniffenem Gesicht, krummen Fingern und abgenutzten, zusammengeflickten Klamotten.
Er schnitt seine Mäntel sehr sorgfältig um nichts zu verschwenden, gemäß seiner bestickten Klamotten waren es nur kleine Schnipsel, die übrig blieben – „Die Schnipsel sind zu klein um sie für etwas zu gebrauchen – außer vielleicht für Müsewesten,” sagte der Schneider.
Eines kalten Tages in der Weihnachtszeit machte sich der Schneider an einem Mantel – einen Mantel mit kirschfarbener Seide, bestickt mit Stiefmütterchen und Rosen und einer cremefarbenen Seidenweste – edel verarbeitet für den Bürgermeister von Gloucester.
Der Schneider arbeitete und arbeitete und sprach dabei zu sich selbst. Er maß die Seide, drehte sie hin und her und trimmte sie mit seiner Schere in die richtige Form bis der Tisch mit kirschfarbenen Schnipseln übersäht war.
„Die ganzen Schnipsel, zu klein um damit etwas anzufangen. Gerade groß genug für Mäuse!” sagte der Schneider von Gloucester.
Als die Schneeflocken langsam anfingen sich vor die Fensterscheiben zu legen und das Licht daran hinderten hinein zu kommen, hatte der Schneider seine Arbeit für den Tag erledigt. All die Seiden- und Satinausschnitte lagen ausgebreitet auf dem Tisch.
Zwölf Stücke für den Mantel und vier Stücke für die Weste und auch die Manschetten und Knöpfe lagen ordentlich aufgereiht dort. Für das Mantelfutter gab es feinsten gelben Taft und für die Knopflöcher der Weste gab es kirschfarbenen Garn. Alles war bereit am nächsten Morgen zusammengenäht zu werden, alles fertig ausgemessen und nur darauf wartend vernäht zu werden.
Als es schon dunkel war, trat der Schneider aus seinem Geschäft, denn die Nacht verbrachte er dort nicht. Er schloss das Fenster und verschloss die Tür und nahm den Schlüssel mit sich. Niemand war in der Nacht im Geschäft außer ein paar kleiner brauner Mäuse – denn die kamen auch ohne Schlüssel rein und raus!
Hinter all den hölzernen Wandverkleidungen der alten Häuser in Gloucester lagen Treppenaufgänge und Geheimtüren der Mäuse. Und die Mäuse laufen durch diese kleinen Gänge von Haus zu Haus – durch die ganze Stadt – und das ohne auch nur einmal auf die Straße treten zu müssen.
Der Schneider kam aus seinem Geschäft und schlurfte durch den Schnee nach Hause. Er lebte gleich um die Ecke seines Geschäfts und obwohl es kein großes Haus war, konnte der Schneider nur die Küche mieten. Für mehr reichte sein Geld nicht aus.
Er lebte dort alleine mit seinem Kater Simpkin.
Während der Schneider bei der Arbeit war, hatte Simpkin das ganze Haus für sich alleine. Auch er war ganz angetan von den Mäusen, wenn auch er anderes im Kopf hatte als ihnen Satin für Mäntel zu überlassen.
„Miau?“ sagte der Kater als der Schneider die Tür öffnete, „miau?”
Der Schneider antwortete: „Simpkin, wir werden schon zu Geld kommen aber nun bin ich erschöpft. Nimm diesen Groschen (unser letztes Geld) und besorge uns Brot, Milch und Wurst. Ach, und Simpkin, besorg´ mir bitte auch noch etwas kirschfarbene Seide. Aber verlier ja nichts, Simpkin, sonst bin ich verloren, den ICH HABE KEINEN GARN MEHR.“
Dann sagte Simpkin wieder „Miau?” und nahm den Groschen, bevor er in die Nacht hinaus ging.
Der Schneider war sehr müde und fing auch noch an krank zu werden. Er setzte sich an den Kamin und redete zu sich selbst über den bezaubernden Mantel.
„Ich werde schon zu Geld kommen – und sei es ein schräger Schnitt – der Bürgermeister von Gloucester wird am Morgen des Weihnachtstages heiraten und hat einen Mantel und eine bestickte Weste bestellt – gefüttert mit gelben Taft – aber es reicht nicht aus; gerade noch genügend Schnipsel für die Mäuse –”
Doch plötzlich wurde der Schneider von Geräuschen unterbrochen. Von der anderen Seite der Küche machte es —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Was mag das sein?” sagte der Schneider von Gloucester und sprang von seinem Stuhl auf. Die Anrichte war voll von Geschirr und Tontöpfen, Porzellan sowie Teetassen und Becher.
Der Schneider ging hinüber und stand ganz still neben der Anrichte, aufmerksam lauschend und durch seine Brille starrend. Und da war es wieder, von unter einer umgedrehten Teetasse kam das witzige Geräusch—
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Sehr merkwürdig,” sagte der Schneider und drehte die Teetasse um.
Zum Vorschein kam eine kleine Mäusedame, die sich sogleich vor dem Schneider verbeugte. Dann machte sie einen Sprung von der Anrichte und verschwand hinter der hölzernen Wandverkleidung.
Der Schneider nahm wieder vor dem Feuer Platz, seine kalten Hände daran wärmend und murmelte in sich hinein: „Die Weste wurde aus pfirsichfarbenen Satin gemacht – mit Rahmenstickerei und Rosenknospen in ungezwirnter Seide! War es schlau von mir Simpkin meinen letzten Groschen anzuvertrauen? Einundzwanzig Knopflöcher von kirschfarbenen Garn!“
Aber plötzlich kamen wieder ein Geräusch von der Anrichte —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Das ist mehr als ungewöhnlich!” sagte der Schneider von Gloucester und drehte noch eine Teetasse um, die falschherum stand.
Zum Vorschein kam ein kleiner Mäusemann und machte eine Verbeugung vor dem Schneider!
Und dann kamen die kleinen Klopfgeräusche aus jedem Winkel der Anrichte, mal im Takt klopfend und mal als ob sie miteinander sprechen würden —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
Und von unter den Teetassen und von unter den Schüsseln und Schalen kamen noch mehr kleine Mäuse hervor, die eine nach der anderen die Anrichte hinuntersprangen und hinter der Wandverkleidung verschwanden.
Der Schneider setzte sich ganz nah an das Feuer und sagte klagend: „Einundzwanzig Knopflöcher von kirschfarbenen Garn! Fertig zu sein am Samstagmittag und heute ist schon Donnerstagabend. War es richtig die Mäuse einfach laufen zu lassen, Simpkin hatte sie ja anscheinend gefangen? Ach, ich bin am Ende, ich habe keinen Garn mehr!“
Die kleinen Mäuse kamen wieder hervor und lauschten dem Schneider. Ihnen fiel das Muster des bezaubernden Mantels auf. Sie flüsterten sich gegenseitig zu, was das für ein schönes Taft-Futter sei.
Und dann, ganz plötzlich, rannten alle gemeinsam die Gänge hinter der Wandverkleidung entlang, piepsend und sich gegenseitig rufend, während sie von Haus zu Haus liefen. Und als Simpkin mit der Milch zurückkam, war keine einzige Maus mehr in der Küche des Schneiders!
Simpkin öffnete die Tür und trat mit einem grimmigen „G-r-r-miau!” hinein, wie eine verärgerte Katze, die keinen Schnee mag und doch mit Schnee bedeckt ist. Er legte den Brotlaib und die Wurst auf die Anrichte und schnüffelte.
„Simpkin,” sagte der Schneider, „wo ist mein Garn?”
Aber Simpkin stellte nur die Milch ab und schaute misstrauisch auf die Teetassen. Zum Abendbrot wünschte er sich eine kleine fette Maus!
„Simpkin,“ sagte der Schneider, „wo ist mein GARN?“
Simpkin verstecke heimlich ein kleines Päckchen in der Teekanne und fauchte den Schneider an. Wenn er sprechen könnte, hätte er wohl gesagt: „Wo ist meine MAUS?“
„Ach, ich bin geliefert!” sagte der Schneider von Gloucester und ging traurig ins Bett.
Die ganze Nacht lang jagte Simpkin durch die Küche, schaute in die Schränke, unter die Holzverkleidung und in die Teekanne, in der er den Garn versteckt hatte – aber er fand keine Maus!
Und als der Schneider im Schlaf murmelte und redete, sagte Simpkin „Miau-ger-r-w-s-s-ch!” und machte ganz merkwürdige Geräusche, so wie Katzen das nun mal nachts machen.
Da der Schneider sehr krank war und sogar Fieber hatte, schlief er sehr unruhig. Trotz alledem murmelte er in seinem Schlaf: „Kein Garn! Kein Garn!“
Den ganzen nächsten Tag lag er krank im Bett und so auch am nächsten und übernächsten Tag. Was sollte jetzt aus dem kirschfarbenen Mantel werden? Im Geschäft des Schneiders in der Westgate Straße lagen die ausgeschnittenen Teile aus Seide und Satin auf dem Tisch mit ihren einundzwanzig Knopflöchern. Aber wer sollte schon kommen und sie zusammennähen, wenn die Fenster verriegelt und die Türe feste verschlossen war?
Aber das ist kein Hindernis für die kleinen braunen Mäuse, die laufen rein und raus in jedes Haus in Gloucester – und das ohne irgendeinen Schlüssel.
Auf den Straßen des Marktes tummelten sich indes die Menschen, die ihre Truthähne und Gänse für ihr Weihnachtsessen schleppten. Für Simpkin und den armen alten Schneider jedoch, würde es kein Weihnachtsessen geben.
Der Schneider lag für drei Tage und Nächte krank in seinem Bett bis es bereits spät am Weihnachtsabend war. Der Mond kletterte über die Dächer der Stadt und blickte von oben hinab. In den Fenstern brannte kein Licht mehr und in den Häusern hörte man keinen Mucks. Die Einwohner des schneebedeckten Gloucesters schliefen tief und fest.
Simpkin sehnte sich immernoch nach seinen Mäusen und er miaute während er neben dem Bett des Schneiders stand.
Aber wie es schon in den alten Büchern steht, können Tiere in der Weihnachtsnacht sprechen (obwohl nur wenige Leute das wissen und sie hören können).
Als die Kirchenuhr Mitternacht schlug, ertönte eine Antwort - so als ob die Glocken ein Echo schlugen – Simpkin hörte es und ging hinaus in den Schnee.
Aus allen Ecken der Stadt ertönten tausende fröhliche Stimmen, die Weihnachtslieder sangen, darunter viele bekannte Lieder, aber auch einige unbekannte.
Als erstes und auch am lautesten sang der Hahn — „Fräulein, steh auf und backe Kuchen!”
Simpkin stöhnte auf.
Nun brannte Licht in einigen Dachböden und man hörte das Geräusch von Tanzen, und die Katzen der Stadt kamen auf die Straße.
„Alle Katzen außer mir,” sagte Simpkin.
Unter den Dachsimsen sangen die Spatzen und Stare von Weihnachtskuchen, auch die Dohlen im Kirchenturm wachten auf und obwohl es mitten in der Nacht war, sangen auch die Drosseln und Rotkehlchen, bis die Nacht von Gezwitscher erfüllt war.
All das ärgerte den armen hungrigen Simpkin!
Besonders einige schrille Stimmen, die hinter einem Holzgitter hervordröhnten ärgerten ihn. Ich glaube es waren Fledermäuse, da diese besonders helle Stimmen haben – gerade wenn sie im Schlaf reden, so wie der Schneider von Gloucester.
Sie sagten etwas merkwürdiges, das sich anhörte wie —
„Bss, sprach die blaue Fliege; summ, sprach die Biene;
Bss und summ sprachen sie, und so machen wir es auch!“
Und Simpkin ging davon und schüttelte dabei seine Ohren als hätte er eine Biene darin sitzen.
In dem Geschäft des Schneiders brannte Licht und als Simpkin sich anschlich um durch das Fenster zu schauen, sah er drinnen Kerzen brennen.
Da war ein Scherenschnipsen und ein Fadenknipsen und eine kleine Mäusestimme laut und munter—
„Vierundzwanzig Schneider,
wollten eine Schnecke fangen,
der beste Mann unter ihnen,
traute sich nicht sie anzulangen;
Sie stellte ihre Fühler auf
wie ein junges Kalb,
Lauft, ihr Schneider, lauft,
oder sie spießt euch damit auf!“
Dann, ohne Pause, fuhren die kleinen Mäusestimmen fort—
„Siebe der Dame´s Haferbrei,
Mahle ihr Mehl,
Geb noch eine Marone hinzu,
„Miau! Miau!” unterbrach Simpkin und kratzte an der Tür.
Aber der Schlüssel lag unter dem Kopfkissen des Schneiders und er kam nicht hinein.
Die kleinen Mäuse lachten bloß und versuchten sich an einem anderen Lied —
„Drei kleine Mäuse wollten etwas spinnen,
Mieze kam vorbei und blickte verdutzt nach drinnen.
Was hast du vor, mein kleiner Mann?
Mäntel nähen für den Ehrenmann.
Soll ich kommen und euch helfen mit den Knöpfen?
Oh nein, Miezekatze, du willst uns doch nur köpfen!“
„Miau, Miau!“ schluchzte Simpkin. „Hey Kitty-Tatze?” antworteten die kleinen Mäuse —
„Hey kitty Tatze, du kleine Hauskatze!
Die Händler tragen scharlachrot,
Seide am Kragen und gold am Saum;
So stolzieren sie, man glaubt es kaum!“
Sie klicken dabei mit ihren Fingerhütten im Takt, aber auch das ließ Simpkin unbeeindruckt. Er schnüffelte an der Tür des Geschäfts und Miaute dabei bitterlich.
„Und dann kaufte ich
einen Topf voll Milch,
und einen Laib Brot,
und für einen Groschen —
und auf der Küchenanrichte.” fügte eine freche Maus noch hinzu.
„Miau! Kratz! Kratz!” schlurfte Simpkin auf der Fensterbank, während die kleinen Mäuse drinnen alle auf einmal aufsprangen und mit ihren quietschenden Stimmen schrien – „Kein Garn mehr! Kein Garn mehr.” Sie schlugen die Fensterläden zu und schlossen Simpkin damit aus.
Aber durch die feinen Spalte der Fensterläden konnte er das Klicken der Fingerhütte und den Gesang der kleinen Mäuse immer noch hören —
„Kein Garn mehr! Kein Garn mehr!“
Simpkin gab schlussendlich auf und machte sich auf den Heimweg. Der arme alte Schneider schlief friedlich in seinem Bett, sein Fieber war weg.
Auf Zehenspitzen schlich sich Simpkin zur Anrichte und nahm ein kleines Päckchen aus Seide aus der Teekanne. Er schaute es sich im Licht des Mondes an und schämte sich für seine Bösartigkeit, verglichen mit der Güte und Hilfsbereitschaft der kleinen Mäuse!
Als der Schneider am nächsten Morgen aufwachte, war das erste was er auf der geflickten Decke sah ein Strang kirschfarbener, gedrehter Seide und daneben stand der reumütige Simpkin!
„Ach, ich bin erschöpft,“ sagte der Schneider von Gloucester, „aber ich habe meinen Garn!“
Die Sonne schien schon auf den Schnee, als der Schneider aufstand und sich anzog. Er ging hinaus auf die Straße, während Simpkin vorauslief.
Die Stare zwitscherten von den Schornsteinen und die Drosseln und Rotkehlchen sangen – aber sie sangen in ihren eigenen Stimmen, nicht wie in jener Weihnachtsnacht.
„Nun,” sagte der Schneider „ich habe meinen Garn aber keine Kraft mehr – noch habe ich mehr Zeit als für ein einziges Knopfloch. Heute ist die Hochzeit des Bürgermeisters und wo ist nun der kirschfarbene Mantel?“
Er schloss die Tür seines kleinen Geschäfts in der Westgate Straße auf und Simpkin rannte hinein - wie eine Katze, die etwas erwartet.
Aber Niemand war da! Nicht einmal eine einzige kleine braune Maus!
Die Regale waren abgewischt und sauber, die kleinen Fäden und die Seidenschnipsel waren alle ordentlich weggeräumt und lagen nicht mehr auf dem Boden verstreut.
Aber auf dem Tisch – welch eine Freude! – dem Schneider entfuhr ein kleiner Jauchzer – dort, wo er die Seidenausschnitte hatte liegen lassen – dort lagen der wohl schönste Mantel und eine bestickte Seidenweste, die jemals von einem Bürgermeister Gloucesters getragen wurden!
Dort waren Rosen und Stiefmütterchen auf dem Mantel und die Weste war bestickt mit Mohnblumen und Kornblumen.
Alles war fertig – bis auf ein einziges kischfarbenes Knopfloch. Und genau dort, wo das Knopfloch fehlte war ein kleines Stück Papier angebracht, wodrauf in klitzekleiner Schrift geschrieben stand —
KEIN GARN MEHR.
Und ab da an war das Glück auf der Seite des Schneiders von Gloucester - er hatte immer etwas zu Essen auf dem Tisch und mehr als genug Geld.
Er nähte die schönsten Westen für all die reichen Händler Gloucesters und für all die feinen Herren des Landes.
Solche Rüschen und bestickten Manschetten fand man sonst nirgends! Aber die Knopflöcher waren des Schneiders größter Triumph.
Die Nähte der Knopflöcher waren so sorgfältig gearbeitet –so sorgfältig, - dass man sich wundern muss, wie ein alter Mann mit Brille, mit krummen alten Fingern und Fingerhut so sticken kann.
Die Nähte dieser Knopflöcher waren so klein – so klein, - sie sahen aus, als wären sie von kleinen Mäusen gemacht.
Ende
Bergkristall
Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum etwas Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags begleiten uns durch das Leben. Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht und Schnee alle Fluren deckt, das Fest der Weihnacht. Wie in vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er bei uns der heilige Abend, der darauf folgende Tag der heilige Tag und die dazwischen liegende Nacht die Weihnacht. Die katholische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilandes mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier, in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtstunde als die Geburtstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die feierlichen Töne kommen, und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen beleuchteten Fenstern emporragt.
Mit dem Kirchenfeste ist auch ein häusliches verbunden. Es hat sich fast in allen christlichen Ländern verbreitet, daß man den Kindern die Ankunft des Christkindleins - auch eines Kindes, des wunderbarsten, das je auf der Welt war - als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding zeigt, das durch das ganze Leben fortwirkt und manchmal noch spät im Alter bei trüben, schwermütigen oder rührenden Erinnerungen gleichsam als Rückblick in die einstige Zeit mit den bunten, schimmernden Fittichen durch den öden, traurigen und ausgeleerten Nachthimmel fliegt. Man pflegt den Kindern die Geschenke zu geben, die das heilige Christkindlein gebracht hat, um ihnen Freude zu machen. Das tut man gewöhnlich am heiligen Abende, wenn die tiefe Dämmerung eingetreten ist. Man zündet Lichter und meistens sehr viele an, die oft mit den kleinen Kerzlein auf den schönen, grünen Ästen eines Tannen- oder Fichtenbäumchens schweben, das mitten in der Stube steht. Die Kinder dürfen nicht eher kommen, als bis das Zeichen gegeben wird, daß der heilige Christ zugegen gewesen ist und die Geschenke, die, er mitgebracht, hinterlassen hat. Dann geht die Tür auf, die Kleinen dürfen hinein, und bei dem herrlichen, schimmernden Lichterglanze sehen sie Dinge auf dem Baume hängen oder auf dem Tische herumgebreitet, die alle Vorstellungen ihrer Einbildungskraft weit übertreffen, die sie sich nicht anzurühren getrauen, und die sie endlich, wenn sie sie bekommen haben, den ganzen Abend in ihren Ärmchen herumtragen und mit sich in das Bett nehmen. Wenn sie dann zuweilen in ihre Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, durch welche die Großen in die Kirche zur Andacht gerufen werden, dann mag es ihnen sein, als zögen jetzt die Englein durch den Himmel, oder als kehre der heilige Christ nach Hause, welcher nunmehr bei allen Kindern gewesen ist und jedem von ihnen ein herrliches Geschenk hinterbracht hat.
Wenn dann der folgende Tag, der Christtag, kommt, so ist er ihnen so feierlich, wenn sie frühmorgens mit ihren schönsten Kleidern angetan in der warmen Stube stehen, wenn der Vater und die Mutter sich zum Kirchgange schmücken, wenn zu Mittage ein feierliches Mahl ist, ein besseres als in jedem Tage des ganzen Jahres, und wenn nachmittags oder gegen den Abend hin Freunde und Bekannte kommen, auf den Stühlen und Bänken herumsitzen, miteinander reden und behaglich durch die Fenster in die Wintergegend hinausschauen können, wo entweder die langsamen Flocken niederfallen, oder ein tobender Nebel um die Berge steht, oder die blutrote, kalte Sonne hinabsinkt. An verschiedenen Stellen der Stube, entweder auf einem Stühlchen oder auf der Bank oder auf dem Fensterbrettchen liegen die zaubrischen, nun aber schon bekannteren und vertrauteren Geschenke von gestern abend herum.
Hierauf vergeht der lange Winter, es kommt der Frühling und der unendlich dauernde Sommer - und wenn die Mutter wieder vom heiligen Christe erzählt, daß nun bald sein Festtag sein wird, und daß er auch diesmal herabkommen werde, ist es den Kindern, als sei seit seinem letzten Erscheinen eine ewige Zeit vergangen, und als liege die damalige Freude in einer weiten, nebelgrauen Ferne.
Weil dieses Fest so lange nachhält, weil sein Abglanz so hoch in das Alter hinaufreicht, so stehen wir so gerne dabei, wenn die Kinder dasselbe begehen und sich darüber freuen. -
In den hohen Gebirgen unsers Vaterlandes steht ein Dörfchen mit einem kleinen, aber sehr spitzigen Kirchturme, der mit seiner roten Farbe, mit weicher die Schindeln bemalt sind, aus dem Grün vieler Obstbäume hervorragt und wegen derselben roten Farbe in dem duftigen und blauen Dämmern der Berge weithin ersichtlich ist. Das Dörfchen liegt gerade mitten in einem ziemlich weiten Tale, das fast nie ein länglicher Kreis gestaltet ist. Es enthält außer der Kirche eine Schule, ein Gemeindehaus und noch mehrere stattliche Häuser, die einen Platz gestalten, auf welchem vier Linden stehen, die ein steinernes Kreuz in ihrer Mitte haben. Diese Häuser sind nicht bloße Landwirtschaftshäuser, sondern sie bergen auch noch diejenigen Handwerke in ihrem Schoße, die dem menschlichen Geschlechte unentbehrlich sind, und die bestimmt sind, den Gebirgsbewohnern ihren einzigen Bedarf an Kunsterzeugnissen zu decken. Im Tale und an den Bergen herum sind noch sehr viele zerstreute Hütten, wie das in Gebirgsgegenden sehr oft der Fall ist, welche alle nicht nur zur Kirche und Schule gehören, sondern auch jenen Handwerken, von denen gesprochen wurde, durch Abnahme der Erzeugnisse ihren Zoll entrichten. Es gehören sogar noch weitere Hütten zu dem Dörfchen, die man von dem Tale aus gar nicht sehen kann, die noch tiefer in den Gebirgen stecken, deren Bewohner selten zu ihren Gemeindemitbrüdern herauskommen, und die im Winter oft ihre Toten aufbewahren müssen, um sie nach dem Wegschmelzen des Schnees zum Begräbnisse bringen zu können. Der größte Herr, den die Dörfler im Laufe des Jahres zu sehen bekommen, ist der Pfarrer. Sie verehren ihn sehr, und es geschieht Gewöhnlich, daß derselbe durch längeren Aufenthalt im Dörfchen ein der Einsamkeit gewöhnter Mann wird, daß er nicht ungerne bleibt und einfach fortlebt. Wenigstens hat man seit Menschengedenken nicht erlebt, daß der Pfarrer des Dörfchens ein auswärtssüchtiger oder seines Standes unwürdiger Mann gewesen wäre.
Es gehen keine Straßen durch das Tal, sie haben ihre zweigleisigen Wege, auf denen sie ihre Felderzeugnisse mit einspännigen Wäglein nach Hause bringen, es kommen daher wenig Menschen in das Tal, unter diesen manchmal ein einsamer Fußreisender, der ein Liebhaber der Natur ist, eine Weile in der bemalten Oberstube des Wirtes wohnt und die Berge betrachtet, oder gar ein Maler, der den kleinen, spitzen Kirchturm und die schönen Gipfel der Felsen in seine Mappe zeichnet. Daher bilden die Bewohner eine eigene Welt, sie kennen einander alle mit Namen und mit den einzelnen Geschichten von Großvater und Urgroßvater her, trauern alle, wenn einer stirbt, wissen, wie er heißt, wenn einer geboren wird, haben eine Sprache, die von der der Ebene draußen abweicht, haben ihre Streitigkeiten, die sie schlichten, stehen einander bei und laufen zusammen, wenn sich etwas Außerordentliches begibt.
Sie sind sehr stetig, und es bleibt immer beim alten. Wenn ein Stein aus einer Mauer fällt, wird derselbe wieder hineingesetzt, die neuen Häuser werden wie die alten gebaut, die schadhaften Dächer werden mit gleichen Schindeln ausgebessert, und wenn in einem Hause scheckige Kühe sind, so werden immer solche Kälber aufgezogen, und die Farbe bleibt bei dem Hause.
Gegen Mittag sieht man von dem Dorfe einen Schneeberg, der mit seinen glänzenden Hörnern fast oberhalb der Hausdächer zu sein scheint, aber in der Tat doch nicht so nahe ist. Er sieht das ganze Jahr, Sommer und Winter, mit seinen vorstehenden Felsen und mit seinen weißen Flächen in .das Tal herab. Als das Auffallendste, was sie in ihrer Umgebung haben, ist der Berg der Gegenstand der Betrachtung der Bewohner, und er ist der Mittelpunkt vieler Geschichten geworden. Es lebt kein Mann und Greis in dem Dorfe, der nicht von den Zacken und Spitzen des Berges, von seinen Eisspalten und Höhlen, von seinen Wässern und Geröllströmen etwas zu erzählen wüßte, was er entweder selbst erfahren oder von andern erzählen gehört hat. Dieser Berg ist auch der Stolz des Dorfes, als hätten sie ihn selber gemacht, und es ist nicht so ganz entschieden, wenn man auch die Biederkeit und Wahrheitsliebe der Talbewohner hoch anschlägt, ob sie nicht zuweilen zur Ehre und zum Ruhme des Berges lügen. Der Berg gibt den Bewohnern außerdem, daß er ihre Merkwürdigkeit ist, auch wirklichen Nutzen; denn wenn eine Gesellschaft von Gebirgsreisenden hereinkommt, um von dem Tale aus den Berg zu besteigen, so dienen die Bewohner des Dorfes als Führer, und einmal Führer gewesen zu sein, dieses und jenes erlebt zu haben, diese und jene Stelle zu kennen, ist eine Auszeichnung, die jeder gerne von sich darlegt. Sie reden oft davon, wenn sie in der Wirtsstube, bei einander sitzen, und erzählen ihre Wagnisse und ihre wunderbaren Erfahrungen und versäumen aber auch nie zu sagen, was dieser oder jener Reisende gesprochen habe, und was sie von ihm als Lohn für ihre Bemühungen empfangen hätten. Dann sendet der Berg von seinen Schneeflächen die Wasser ab, weiche einen See in seinen Hochwäldern speisen und den Bach erzeugen, der lustig durch das Tal strömt, die Brettersäge, die Mahlmühle und andere kleine Werke treibt, das Dorf reinigt und das Vieh tränkt. Von den Wäldern des Berges kommt das Holz, und sie halten die Lawinen auf. Durch die innern Gänge und Lockerheiten der Höhen sinken die Wasser durch, die dann in Adern durch das Tal gehen und in Brünnlein und Quellen hervorkommen, daraus die Menschen trinken und ihr herrliches, oft belobtes Wasser dem Fremden reichen. Allein an letzteren Nutzen denken sie nicht und meinen, das sei immer so gewesen.
Wenn man auf die Jahresgeschichte des Berges sieht, so sind im Winter die zwei Zacken seines Gipfels, die sie Hörner heißen, schneeweiß und stehen, wenn sie an hellen Tagen sichtbar sind, blendend in der finstern Bläue der Luft; alle Bergfelder, die um diese Gipfel herumlagern, sind dann weiß; alle Abhänge sind so; selbst die steilrechten Wände, die die Bewohner Mauern heißen, sind mit einem angeflogenen weißen Reife bedeckt und mit zartem Eise wie mit einem Firnisse belegt, so daß die ganze Masse wie ein Zauberpalast aus dem bereiften Grau der Wälderlast emporragt, welche schwer um ihre Füße herum ausgebreitet ist. Im Sommer, wo Sonne und warmer Wind den Schnee von den Steilseiten wegnimmt, ragen die Hörner nach dem Ausdrucke der Bewohner schwarz in den Himmel und haben nur schöne weiße Äderchen und Sprenkeln auf ihrem Röcken, in der Tat aber sind sie zart fernblau, und was sie Äderchen und Sprenkeln heißen, das ist nicht weiß, sondern hat das schöne Milchblau des fernen Schnees gegen das dunklere der Felsen. Die Bergfelder um die Hörner aber verlieren, wenn es recht heiß ist, an ihren höheren Teilen wohl den Firn nicht, der gerade dann recht weiß auf das Grün der Talbäume herabsieht, aber es weicht von ihren unteren Teilen der Winterschnee, der nur einen Flaum machte, und es wird das unbestimmte Schillern von Bläulich und Grünlich sichtbar, das das Geschiebe von Eis ist, das dann bloß liegt und auf die Bewohner unten hinabgrüßt. Am Rande dieses Schillerns, wo es von ferne wie ein Saum von Edelsteinsplittern aussieht, ist es in der Nähe ein Gemenge wilder, riesenhafter Blöcke, Platten und Trümmer, die sich drängen und verwirrt ineinander geschoben sind. Wenn ein Sommer gar heiß und lang ist, werden die Eisfelder weit hinauf entblößt, und dann schaut eine viel größere Fläche von Grün und Blau in das Tal, manche Kuppen und Räume werden entkleidet, die man sonst nur weiß erblickt hatte, der schmutzige Saum des Eises wird sichtbar, Wo es Felsen, Erde und Schlamm schiebt, und viel reichlichere Wasser als sonst fließen in das Tal. Dies geht fort, bis es nach und nach wieder Herbst wird, das Wasser sich verringert, zu einer Zeit einmal ein grauer Landregen die ganze Ebene des Tales bedeckt, worauf, wenn sich die Nebel von den Höhen wieder lösen, der Berg seine weiche Hülle abermals umgetan hat, und alle Felsen, Kegel und Zacken in weißem Kleide dastehen. So spinnt es sich ein Jahr um das andere mit geringen Abwechslungen ab und wird sich fortspinnen, solange die Natur so bleibt und auf den Bergen Schnee und in den Tälern Menschen sind. Die Bewohner des Tales heißen die geringen Veränderungen große, bemerken sie wohl und berechnen an ihnen den Fortschritt des Jahres. Sie bezeichnen an den Entblößungen die Hitze und die Ausnahmen der Sommer.
Was nun noch die Besteigung des Berges betrifft, so geschieht dieselbe von dem Tale aus. Man geht nach der Mittagsrichtung zu auf einem guten, schönen Wege, der über einen sogenannten Hals in ein anderes Tal führt. Hals heißen sie einen mäßig hohen Bergrücken, der zwei größere und bedeutendere Gebirge miteinander verbindet und aber den man zwischen den Gebirgen von einem Tale in ein anderes gelangen kann. Auf dem Halse, der den Schneeberg mit einem gegenüberliegen den großen Gebirgszuge verbindet, ist lauter Tannenwald. Etwa auf der größten Erhöhung desselben, wo nach und nach sich der Weg in das jenseitige Tal hinabzusenken beginnt, steht eine sogenannte Unglücksäule. Es ist einmal ein Bäcker, welcher Brot in seinem Korbe über den Hals trug, an jener Stelle tot gefunden worden. Man hat den toten Bäcker mit dem Korbe, und mit den umringenden Tannenbäumen auf ein Bild gemalt, darunter 'eine Erklärung und eine Bitte um ein Gebet geschrieben, das Bild auf eine rot angestrichene hölzerne Säule getan und die Säule an der Stelle des Unglückes aufgerichtet. Bei dieser Säule biegt man von dem Wege ab und geht auf der Länge des Halses fort, statt über seine Breite in das jenseitige Tal hinüberzuwandern. Die Tannen bilden dort einen Durchlaß, als ob eine Straße zwischen ihnen hinginge. Es führt auch manchmal ein Weg in dieser Richtung hin, der dazu dient, das Holz von den höheren Gegenden zu der Unglücksäule herabzubringen, der aber dann wieder mit Gras verwächst. Wenn man auf diesem Wege fortgeht, der sachte bergan führt, so gelangt man endlich auf eine freie, von Bäumen entblößte Stelle. Dieselbe ist dürrer Heideboden, hat nicht einmal einen Strauch, sondern ist mit schwachem Heidekraute, mit trockenen Moosen und mit Dürrbodenpflanzen bewachsen. Die Stelle wird immer steiler, und man geht lange hinan; man geht aber immer in einer Rinne gleichsam wie in einem ausgerundeten Graben hinan, was den Nutzen hat, daß man auf der großen, baumlosen und überall gleichen Stelle nicht leicht irren kann. Nach einer Zeit erscheinen Felsen, die wie Kirchen gerade aus dem Grasboden aufsteigen, und zwischen deren Mauern man längere Zeit hinangehen kann. Dann erscheinen wieder kahle, fast pflanzenlose Rücken, die bereits in die Lufträume der höhern Gegenden ragen und gerade zu dem Eise führen. Zu beiden Seiten dieses Weges sind steile Wände, und durch diesen Damm hängt der Schneeberg mit dem Halse zusammen. Um das Eis zu überwinden, geht man eine geraume Zeit an der Grenze desselben, wo es von den Felsen umstanden ist, dahin, bis man zu dem ältern Firn gelangt, der die Eisspalten überbaut und in den meisten Zeiten des Jahres den Wanderer trägt. An der höchsten Stelle des Firns erheben sich die zwei Hörner aus dem Schnee, wovon eines das höhere, mithin die Spitze des Berges ist. Diese Kuppen sind sehr schwer zu erklimmen; da sie mit einem oft breiteren, oft engeren Schneegraben - dem Firnschrunde - umgeben sind, der übersprungen werden muß, und da ihre steilrechten Wände nur kleine Absätze haben, in welche der Fuß eingesetzt werden muß, so begnügen sich die meisten Besteiger des Berges damit, bis zu dem Firnschrunde gelangt zu sein und dort die Rundsicht, soweit sie nicht durch das Horn verdeckt ist, zu genießen. Die den Gipfel besteigen wollen, müssen dies mit Hilfe von Steigeisen, Stricken und Klammern tun.
Außer diesem Berge stehen an derselben Mittagseite noch andere, aber keiner ist so hoch, wenn sie sich auch früh im Herbste mit Schnee bedecken und ihn bis tief in den Frühling hinein behalten. Der Sommer aber nimmt denselben immer weg, und die Felsen glänzen freundlich im Sonnenscheine, und die tiefer gelegenen Wälder zeigen ihr sanftes Grün von breiten, blauen Schatten durchschnitten, die so schön sind, daß man sich in seinem Leben nicht satt daran sehen kann.
An den andern Seiten des Tales, nämlich von Mitternacht, Morgen und Abend her, sind die Berge langgestreckt und niederer, manche Felder und Wiesen steigen ziemlich hoch hinauf, und oberhalb ihrer sieht man verschiedene Waldblößen, Alpenhütten und dergleichen, bis sie an ihrem Rande mit feingezacktem Walde am Himmel hingehen, welche Auszackung eben ihre geringe Höhe anzeigt, während die mittäglichen Berge, obwohl sie noch großartigere Wälder hegen, doch mit einem ganz glatten Rande an dem glänzenden Himmel hinstreichen.
Wenn man so ziemlich mitten in dem Tale steht, so hat man die Empfindung, als ginge nirgends ein Weg in dieses Becken herein und keiner daraus hinaus; alle diejenigen, welche öfter im Gebirge gewesen sind, kennen diese Täuschung gar wohl; in der Tat führen nicht nur verschiedene Wege und darunter sogar manche durch die Verschiebungen der Berge fast auf ebenem Boden in die nördlichen Flächen hinaus, sondern gegen Mittag, wo das Tal durch steilrechte Mauern fast geschlossen scheint, geht sogar ein Weg über den obbenannten Hals.
Das Dörflein heißt Gschaid, und der Schneeberg, der auf seine Häuser herabschaut, heißt Gars.
Jenseits des Halses liegt ein viel schöneres und blühenderes Tal, als das von Gschaid ist, und es führt von der Unglücksäule der gebahnte Weg hinab. Es hat an seinem Eingange einen stattlichen Marktflecken Millsdorf, der sehr groß ist, verschiedene Werke hat und in manchen Häusern städtische Gewerbe und Nahrung treibt. Die Bewohner sind viel wohlhabender als die in Gschaid, und obwohl nur drei Wegstunden zwischen den beiden Tälern liegen, was für die an große Entfernungen gewöhnten und Mühseligkeiten liebenden Gebirgsbewohner eine unbedeutende Kleinigkeit ist, so sind doch Sitten und Gewohnheiten in den beiden Tälern so verschieden, selbst der äußere Anblick derselben ist so ungleich, als ob eine große Anzahl Meilen zwischen ihnen läge. Das ist in Gebirgen sehr oft der Fall und hängt nicht nur von der verschiedenen Lage der Täler gegen die Sonne ab, die sie oft mehr oder weniger begünstigt, sondern auch von dem Geiste der Bewohner, der durch gewisse Beschäftigungen nach dieser oder jener Richtung gezogen wird. Darin stimmen aber alle überein, daß sie an Herkömmlichkeiten und Väterweise hängen, großen Verkehr leicht entbehren, ihr Tal außerordentlich lieben und ohne dasselbe kaum leben können.
Es vergehen oft Monate, oft fast ein Jahr, ehe ein Bewohner von Gschaid in das jenseitige Tal hinüberkommt und den großen Marktflecken Millsdorf besucht. Die Millsdorfer halten es ebenso, obwohl sie ihrerseits doch Verkehr mit dem Lande draußen pflegen und daher nicht so abgeschieden sind wie die Gschaider. Es geht sogar ein Weg, der eine Straße heißen könnte, längs ihres Tales, und mancher Reisende und mancher Wanderer geht hindurch, ohne nur im geringsten zu ahnen, daß mitternachtwärts seines Weges jenseits des hoben, herabblickenden Schneebergs noch ein Tal sei, in dem viele Häuser zerstreut sind, und in dem das Dörflein mit dem spitzigen Kirchturme steht.
Unter den Gewerben des Dorfes, welche bestimmt sind, den Bedarf des Tales zu decken, ist auch das eines Schusters, das nirgends entbehrt werden kann, wo die Menschen nicht in ihrem Urzustande sind. Die Gschaider aber sind so weit über diesem Stande, daß sie recht gute und tüchtige Gebirgsfußbekleidung brauchen. Der Schuster ist mit einer kleinen Ausnahme der einzige im Tale. Sein Haus steht auf dem Platze in Gschaid, wo überhaupt die besseren stehen, und schaut mit seinen grauen Mauern, weißen Fenstersimsen und grün angestrichenen Fensterläden auf die vier Linden hinaus. Es hat im Erdgeschosse die Arbeitsstube, die Gesellenstube, eine größere und kleinere Wohnstube, ein Verkaufstübchen, nebst Küche und Speisekammer und allen zugehörigen Gelassen; im ersten Stockwerke oder eigentlich im Raume des Giebels hat es die Oberstube oder eigentliche Prunkstube. Zwei Prachtbetten, schöne geglättete Kästen mit Kleidern stehen da, dann ein Gläserkästchen mit Geschirren, ein Tisch mit eingelegter Arbeit, gepolsterte Sessel, ein Mauerkästchen mit den Ersparnissen, dann hängen an den Wänden Heiligenbilder, zwei schöne Sackuhren, gewonnene Preise im Schießen, und endlich sind auch Scheibengewehre und Jagdbüchsen nebst ihrem Zubehöre in einem eigenen, mit Glastafeln versehenen Kasten aufgehängt. An das Schusterhaus ist ein kleineres Häuschen, nur durch den Einfahrtsschwibbogen getrennt, angebaut, welches genau dieselbe Bauart hat und zum Schusterhause wie ein Teil zum Ganzen gehört. Es hat nur eine Stube mit den dazugehörigen Wohnteilen. Es hat die Bestimmung, dem Hausbesitzer, sobald er das Anwesen seinem Sohne oder Nachfolger übergeben hat, als sogenanntes Ausnahmstübchen zu dienen, in welchem er mit seinem Weibe so lang haust, bis beide gestorben sind, die Stube wieder leer steht und auf einen neuen Bewohner wartet. Das Schusterhaus hat nach rückwärts Stall und Scheune; denn jeder Talbewohner ist, selbst wenn er ein Gewerbe treibt, auch Landbebauer und zieht hieraus seine gute und nachhaltige Nahrung. Hinter diesen Gebäuden ist endlich der Garten, der fast bei keinem besseren Hause in Gschaid fehlt, und von dem sie ihre Gemüse, ihr Obst und für festliche Gelegenheiten ihre Blumen ziehen. Wie oft im Gebirge, so ist auch in Gschaid die Bienenzucht in diesen Gärten sehr verbreitet.
Die kleine Ausnahme, deren oben Erwähnung geschah, und die Nebenbuhlerschaft der Alleinherrlichkeit des Schusters ist ein anderer Schuster, der alte Tobias, der aber eigentlich kein Nebenbuhler ist, weil er nur mehr flickt, hierin viel zu tun hat und es sich nicht im entferntesten beikommen läßt, mit dem vornehmen Platzschuster in einen Wettstreit einzugehen, insbesondere da der Platzschuster ihn häufig mit Lederflecken, Sohlenabschnitten und dergleichen Dingen unentgeltlich versieht. Der alte Tobias sitzt im Sommer am Ende des Dörfchens unter Holunderbüschen und arbeitet. Er ist umringt von Schuhen und Bundschuhen, die aber sämtlich alt, grau, kotig und zerrissen sind. Stiefel mit langen Röhren sind nicht da, weil sie im Dorfe und in der Gegend nicht getragen werden; nur zwei Personen haben solche, der Pfarrer und der Schullehrer, welche aber beides, flicken und neue Ware machen, nur bei dem Platzschuster lassen. Im Winter sitzt der alte Tobias in seinem Stübchen hinter den Holunderstauden und hat warm geheizt, weil das Holz in Gschaid nicht teuer ist.
Der Platzschuster ist, ehe er das Haus angetreten hat, ein Gemsenwildschütze gewesen und hat Oberhaupt in seiner Jugend, wie die Gschaider sagen, nicht gut getan. Er war in der Schule immer einer der besten Schüler gewesen, hatte dann von seinem Vater das Handwerk gelernt, ist auf Wanderung gegangen und ist endlich wieder zurückgekehrt. Statt, wie es sich für einen Gewerbsmann ziemt, und wie sein Vater es zeitlebens getan hat, einen schwarzen Hut zu tragen, tat er einen grünen auf, steckte noch alle bestehenden Federn darauf und stolzierte mit ihm und mit dem kürzesten Lodenrocke, den es im Tale gab, herum, während sein Vater immer einen Rock von dunkler, womöglich schwarzer Farbe hatte, der auch, weil er einem Gewerbsmanne angehörte, immer sehr weit herabgeschnitten sein mußte. Der junge Schuster war auf allen Tanzplätzen und Kegelbahnen zu sehen. Wenn ihm jemand eine gute Lehre gab, so pfiff er ein Liedlein. Er ging mit seinem Scheibengewehre zu allen Schießen der Nachbarschaft und brachte manchmal einen Preis nach Hause, was er für einen großen Sieg hielt. Der Preis bestand meistens aus Münzen, die künstlich gefaßt waren, und zu deren Gewinnung der Schuster mehr gleiche Münzen ausgeben mußte, als der Preis enthielt, besonders da er wenig haushälterisch mit dem Gelde war. Er ging auf alle Jagden, die in der Gegend abgehalten wurden, und hatte sich den Namen eines guten Schützen erworben. Er ging aber auch manchmal allein mit seiner Doppelbüchse und mit Steigeisen fort, und einmal sagte man, daß er eine schwere Wunde im Kopfe erhalten habe.
In Millsdorf war ein Färber, welcher gleich am Anfange des Marktfleckens, wenn man auf dem Wege von Gschaid hinüberkam, ein sehr ansehnliches Gewerbe hatte, mit vielen Leuten und sogar, was im Tale etwas Unerhörtes war, mit Maschinen arbeitete. Außerdem besaß er noch eine ausgebreitete Feldwirtschaft. Zu der Tochter dieses reichen Färbers ging der Schuster über das Gebirge, um sie zu gewinnen. Sie war wegen ihrer Schönheit weit und breit berühmt, aber auch wegen ihrer Eingezogenheit, Sittsamkeit und Häuslichkeit belobt. Dennoch, hieß es, soll der Schuster ihre Aufmerksamkeit erregt haben. Der Färber ließ ihn nicht in sein Haus kommen; und hatte die schöne Tochter schon früher keine öffentlichen Plätze und Lustbarkeiten besucht und war selten außer dem Hause ihrer Eltern zu sehen gewesen: so ging sie jetzt schon gar nirgends mehr hin als in die Kirche oder in ihrem Garten oder in den Räumen des Hauses herum.
Einige Zeit nach dem Tode seiner Eltern, durch welchen ihm das Haus derselben zugefallen war, das er nun allein bewohnte, änderte sich der Schuster gänzlich. So wie er früher getollt hatte, so saß er jetzt in seiner Stube und hämmerte Tag und Nacht an seinen Sohlen. Er setzte prahlend einen Preis darauf, wenn es jemand gäbe, der bessere Schuhe und Fußbekleidungen machen könne. Er nahm keine andern Arbeiter als die besten und drillte sie noch sehr herum, wenn sie in seiner Werkstätte arbeiteten, daß sie ihm folgten und die Sache so einrichteten, wie er befahl. Wirklich brachte er es jetzt auch dahin, daß nicht nur das ganze Dorf Gschaid, das zum größten Teile die Schusterarbeit aus benachbarten Tälern bezogen hatte, bei ihm arbeiten ließ, daß das ganze Tal bei ihm arbeiten ließ, und daß endlich sogar einzelne von Millsdorf und andern Tälern hereinkamen und sich ihre Fußbekleidungen von dem Schuster in Gschaid machen ließen. Sogar in die Ebene hinaus verbreitete sich sein Ruhm, daß manche, die in die Gebirge gehen wollten, sich die Schuhe dazu von ihm machen ließen.
Er richtete das Haus sehr schön zusammen, und in dem Warengewölbe glänzten auf den Brettern die Schuhe, Bundstiefel und Stiefel; und wenn am Sonntage die ganze Bevölkerung des Tales hereinkam und man bei den vier Linden des Platzes stand, ging man gerne zu dem Schusterhause hin und sah durch die Gläser in die Warenstube, wo die Käufer und Besteller waren.
Nach seiner Vorliebe zu den Bergen machte er auch jetzt die Gebirgsbundschuhe am besten. Er pflegte in der Wirtsstube zu sagen: es gäbe keinen, der ihm einen fremden Gebirgsbundschuh zeigen könne, der sich mit einem seinigen vergleichen lasse. "Sie wissen es nicht", pflegte er beizufügen, "sie haben es in ihrem Leben nicht erfahren, wie ein solcher Schuh sein muß, daß der gestirnte Himmel der Nägel recht auf der Sohle sitze und das gebührende Eisen enthalte, daß der Schuh außen hart sei, damit kein Geröllstein, wie scharf er auch sei, empfunden werde, und das er sich von innen doch weich und zärtlich wie ein Handschuh an die Füße lege." Der Schuster hatte sich ein sehr großes Buch machen lassen, in welches er alle verfertigte Ware eintrug, die Namen derer beifügte, die den Stoff geliefert und die Ware gekauft hatten, und eine kurze Bemerkung über die Güte des Erzeugnisses beischrieb. Die gleichartigen Fußbekleidungen hatten ihre fortlaufenden Zahlen, und das Buch lag in der großen Lade seines Gewölbes.
Wenn die schöne Färberstochter von Millsdorf auch nicht aus der Eltern Hause kam, wenn sie auch weder Freunde noch Verwandte besuchte, so konnte es der Schuster von Gschaid doch so machen, daß sie ihn von ferne sah, wenn sie in die Kirche ging, wenn sie in dem Garten war und wenn sie aus den Fenstern ihres Zimmers auf die Matten blickte. Wegen dieses unausgesetzten Sehens hatte es die Färberin durch langes, anständiges und ausdauerndes Flehen für ihre Tochter dahin gebracht, daß der halsstarrige Färber nachgab, und daß der Schuster, weil er denn nun doch besser geworden, die schöne, reiche Millsdorferin als Eheweib nach Gschaid führte. Aber der Färber war deßohngeachtet auch ein Mann, der seinen Kopf hatte. Ein rechter Mensch, sagte er, müsse sein Gewerbe treiben, daß es blühe und vorwärtskomme, er müsse daher sein Weib, seine Kinder, sich und sein Gesinde ernähren, Hof und Haus im Stande des Glanzes halten und sich noch ein Erkleckliches erübrigen, welches letztere doch allein imstande sei, ihm Ansehen und Ehre in der Welt zu geben; darum erhalte seine Tochter nichts als eine vortreffliche Ausstattung, das andere ist Sache des Ehemannes, daß er es mache und für alle Zukunft es besorge. Die Färberei in Millsdorf und die Landwirtschaft auf dem Färberhause sei für sich ein ansehnliches und ehrenwertes Gewerbe, das seiner Ehre willen bestehen und wozu alles, was da sei, als Grundstock dienen müsse, daher er nichts weggebe. Wenn einmal er und sein Eheweib, die Färberin, tot seien, dann gehöre Färberei und Landwirtschaft in Millsdorf ihrer einzigen Tochter, nämlich der Schusterin in Gschaid, und Schuster und Schusterin könnten dann damit tun, was sie wollten: aber alles dieses nur, wenn die Erben es wert wären, das Erbe zu empfangen; wären sie es nicht wert, so ginge das Erbe auf die Kinder derselben, und wenn keine vorhanden wären, mit der Ausnahme des lediglichen Pflichtteiles, auf andere Verwandte über. Der Schuster verlangte auch nichts, er zeigte im Stolze, daß es ihm nur um die schöne Färberstochter in Millsdorf zu tun gewesen, und daß er sie schon ernähren und erhalten könne, wie sie zu Hause ernährt und erhalten worden ist. Er kleidete sie als sein Eheweib nicht nur schöner als alle Gschaiderinnen und alle Bewohnerinnen des Tales, sondern auch schöner, als sie sich je zu Hause getragen hatte, und Speise, Trank und übrige Behandlung mußte besser und rücksichtsvoller sein, als sie das gleiche im väterlichen Hause genossen hatte. Und um dem Schwiegervater zu trotzen, kaufte er mit erübrigten Summen nach und nach immer mehr Grundstücke so ein, daß er einen tüchtigen Besitz beisammen hatte.
Weil die Bewohner von Gschaid so selten aus ihrem Tale kommen und nicht einmal oft nach Millsdorf hinüber gehen, von dem sie durch Bergrücken und durch Sitten geschieden sind, weil ferner ihnen gar kein Fall vorkommt, daß ein Mann sein Tal verläßt und sich in dem benachbarten ansiedelt (Ansiedlungen in großen Entfernungen kommen öfter vor), weil endlich auch kein Weib oder Mädchen gerne von einem Tale in ein anderes auswandert, außer in dem ziemlich seltenen Falle, wenn sie der Liebe folgt und als Eheweib und zu dem Ehemann in ein anderes Tal kommt - so geschah es, daß die schöne Färberstochter von Millsdorf, da sie Schusterin in Gschaid geworden war, doch immer von allen Gschaidern als Fremde angesehen wurde, und wenn man ihr auch nichts Übels antat, ja wenn man sie ihres schönen Wesens und ihrer Sitten wegen sogar liebte, doch immer etwas vorhanden war, das wie Scheu oder, wenn man will, wie Rücksicht aussah und nicht zu dem Innigen und Gleichartigen kommen ließ, wie Gschaiderinnen gegen Gschaiderinnen, Gschaider gegen Gschaider hatten. Es war so, ließ sich nicht abstellen und wurde durch die bessere Tracht und durch das erleichtertere häusliche Leben der Schusterin noch vermehrt.
Sie hatte ihrem Manne nach dem ersten Jahre einen Sohn und in einigen Jahren darauf ein Töchterlein geboren. Sie glaubte aber, daß er die Kinder nicht so liebe, wie sie sich vorstellte, daß es sein solle, und wie sie sich bewußt war, daß sie dieselben liebe; denn sein Angesicht war meistens ernsthaft und mit seinen Arbeiten beschäftigt. Er spielte und tändelte selten mit den Kindern und sprach stets ruhig mit ihnen, gleichsam so, wie man mit Erwachsenen spricht. Was Nahrung und Kleidung und andere äußere Dinge anbelangte, hielt er die Kinder untadelig.
In der ersten Zeit der Ehe kam die Färberin öfter nach Gschaid, und die jungen Eheleute besuchten auch Millsdorf zuweilen bei Kirchweihen oder anderen festlichen Gelegenheiten. Als aber die Kinder auf der Welt waren, war die Sache anders geworden. Wenn schon Mütter ihre Kinder lieben und sich nach ihnen sehnen, so ist dieses von Großmüttern öfter in noch höherem Grade der Fall: sie verlangen zuweilen mit wahrlich krankhafter Sehnsucht nach ihren Enkeln. Die Färberin kam sehr oft nach Gschaid herüber, um die Kinder zu sehen, innen Geschenke zu bringen, eine Weile da zu bleiben und dann mit guten Ermahnungen zu scheiden. Da aber das Alter und die Gesundheitsumstände der Färberin die öfteren Fahrten nicht mehr so möglich machten und der Färber aus dieser Ursache Einsprache tat, wurde auf etwas anderes gesonnen, die Sache wurde umgekehrt, und die Kinder kamen jetzt zur Großmutter. Die Mutter brachte sie selber öfter in einem Wagen, öfter aber wurden sie, da sie noch im zarten Alter waren, eingemummt einer Magd mitgegeben, die sie in einem Fuhrwerke über den Hals brachte. Als sie aber größer waren, gingen sie zu Fuße entweder mit der Mutter oder mit einer Magd nach Millsdorf, ja da der Knabe geschickt, stark und klug geworden war, ließ man ihn allein den bekannten Weg über den Hals gehen, und wenn es sehr schön war und er bat, erlaubte man auch, daß ihn die kleine Schwester begleite. Dies ist bei den Gschaidern gebräuchlich, weil sie an starkes Fußgehen gewöhnt sind und die Eltern überhaupt, namentlich aber ein Mann wie der Schuster, es gerne sehen und eine Freude daran haben, wenn ihre Kinder tüchtig werden. So geschah es, daß die zwei Kinder den Weg über den Hals öfter zurücklegten als die übrigen Dörfler zusammengenommen, und da schon ihre Mutter in Gschaid immer gewissermaßen wie eine Fremde behandelt wurde, so wurden durch diesen Umstand auch die Kinder fremd, sie waren kaum Gschaider und gehörten halb nach Millsdorf hinüber.
Der Knabe Konrad hatte schon das ernste Wesen seines Vaters, und das Mädchen Susanna, nach ihrer Mutter so genannt, oder, wie man es zur Abkürzung nannte, Sanna, hatte viel Glauben zu seinen Kenntnissen, seiner Einsicht und seiner Macht und gab sich unbedingt unter seine Leitung, gerade so wie die Mutter sich unbedingt unter die Leitung des Vaters gab, dem sie alle Einsicht und Geschicklichkeit zutraute.
An schönen Tagen konnte man morgens die Kinder durch das Tal gegen Mittag wandern sehen, aber die Wiese gehen und dort anlangen, wo der Wald des Halses gegen sie her schaut. Sie näherten sich dem Walde, gingen auf seinem Wege allgemach über die Erhöhung hinan und kamen, ehe der Mittag eingetreten war, auf den offenen Wiesen auf der anderen Seite gegen Millsdorf hinunter. Konrad zeigte Sanna die Wiesen, die dem Großvater gehörten, dann gingen sie durch seine Felder, auf denen er ihr die Getreidearten erklärte, dann sahen sie auf Stangen unter dem Vorsprunge des Daches die langen Tücher zum Trocknen herabhängen, die sich im Winde schlängelten oder närrische Gesichter machten, dann hörten sie seine Walkmühle und seinen Lohstampf, die er an seinem Bache für Tuchmacher und Gerber angelegt hatte, dann bogen, sie noch um eine Ecke der Felder und gingen in kurzem durch die Hintertür in den Garten der Färberei, wo sie von der Großmutter empfangen wurden. Diese ahnte immer, wenn die Kinder kamen, sah zu den Fenstern aus und erkannte sie von weitem, wenn Sannas rotes Tuch recht in der Sonne leuchtete.
Sie führte die Kinder dann durch die Waschstube und Presse in das Zimmer, ließ sie niedersetzen, ließ nicht zu, daß sie Halstücher oder Jäckchen lüfteten, damit sie sich nicht verkühlten, und behielt sie beim Essen da. Nach dem Essen durften sie sich lüften, spielen, durften in den Räumen des großväterlichen Hauses herumgehen oder sonst tun, was sie wollten, wenn es nur nicht unschicklich oder verboten war. Der Färber, welcher immer bei dem Essen war, fragte sie um ihre Schulgegenstände aus und schärfte ihnen besonders ein, was sie lernen sollten. Nachmittags wurden sie von der Großmutter schon, ehe die Zeit kam, zum Aufbruche getrieben, daß sie ja nicht zu spät kämen. Obgleich der Färber keine Mitgift gegeben hatte und vor seinem Tode von seinem Vermögen nichts wegzugehen gelobt hatte, glaubte sich die Färberin an diese Dinge doch nicht so strenge gebunden, und sie gab den Kindern nicht allein während ihrer Anwesenheit allerlei, worunter nicht selten ein Münzstück und zuweilen gar von ansehnlichem Werte war, sondern sie band ihnen auch immer zwei Bündelchen zusammen, in denen sich Dinge befanden, von denen sie glaubte, daß sie notwendig wären oder daß sie den Kindern Freude machen könnten. Und wenn oft die nämlichen Dinge im Schusterhause in Gschaid ohne dem in aller Trefflichkeit vorhanden waren, so gab sie die Großmutter in der Freude des Gebens doch, und die Kinder trugen sie als etwas Besonderes nach Hause. So geschah es nun, daß die Kinder am heiligen Abende schon unwissend die Geschenke in Schachteln gut versiegelt und verwahrt nach Hause trugen, die ihnen in der Nacht einbeschert werden sollten.
Weil die Großmutter die Kinder immer schon vor der Zeit zum Fortgehen drängte, damit sie nicht zu spät nach Hause kämen, so erzielte sie hierdurch, daß die Kinder gerade auf dem Wege bald an dieser, bald an jener Stelle sich aufhielten. Sie saßen gerne an dem Haselnußgehege, das auf dem Halse ist, und schlugen mit Steinen Nüsse auf, oder spielten, wenn keine Nüsse waren, mit Blättern oder mit Hölzlein oder mit den weichen, braunen Zäpfchen, die im ersten Frühjahre von den Zweigen der Nadelbäume herabfielen. Manchmal erzählte Konrad dem Schwesterchen Geschichten, oder wenn sie zu der roten Unglücksäule kamen, führte er sie ein Stück auf dem Seitenwege links gegen die Höhen hinan und sagte ihr, daß man da auf den Schneeberg gelange, daß dort Felsen und Steine seien, daß die Gemsen herumspringen und -große Vögel fliegen. Er führte sie oft über den Wald hinaus, sie betrachteten dann den dürren Rasen und die kleinen Sträucher der Heidekräuter; aber er führte sie wieder zurück und brachte sie immer vor der Abenddämmerung nach Hause, was ihm stets Lob eintrug.
Einmal war am heiligen Abende, da die erste Morgendämmerung in dem Tale von Gschaid in Helle übergegangen war, ein dünner, trockener Schleier über den ganzen Himmel gebreitet, so daß man die ohnedem schiefe und ferne Sonne im Südosten nur als einen undeutlichen roten Fleck sah, überdies war an diesem Tage eine milde, beinahe laulichte Luft unbeweglich im ganzen Tale und auch an dem Himmel, wie die unveränderte und ruhige Gestalt der Wolken zeigte. Da sagte die Schustersfrau zu ihren Kindern: "Weil ein so angenehmer Tag ist, weil es so lange nicht geregnet hat und die Wege fest sind, und weil es auch der Vater gestern unter der Bedingung erlaubt hat, wenn der heutige Tag dazu geeignet ist, so dürft ihr zur Großmutter nach Millsdorf gehen; aber ihr müßt den Vater noch vorher fragen."
Die Kinder, welche noch in ihren Nachtkleidchen dastanden, liefen in die Nebenstube, in welcher der Vater mit einem Kunden sprach, und baten um die Wiederholung der gestrigen Erlaubnis, weil ein so schöner Tag sei. Sie wurde ihnen erteilt, und sie liefen wieder zur Mutter zurück.
Die Schustersfrau zog nun ihre Kinder vorsorglich an, oder eigentlich, sie zog das Mädchen mit dichten, gut verwahrenden Kleidern an; denn der Knabe begann sich selber anzukleiden und stand viel früher fertig da, als die Mutter mit dem Mädchen hatte ins reine kommen können. Als sie dieses Geschäft vollendet hatte, sagte sie:
"Konrad, gib wohl acht: weil ich dir das Mädchen mitgehen lasse, so müsset ihr beizeiten fortgehen, ihr müsset an keinem Platze stehen bleiben, und wenn ihr bei der Großmutter gegessen habt, so müsset ihr gleich wieder umkehren und nach Hause trachten; denn die Tage sind jetzt sehr kurz, und die Sonne geht gar bald unter."
"Ich weiß es schon, Mutter", sagte Konrad.
"Und siehe gut auf Sanna, daß sie nicht fällt oder sich erhitzt."
"Ja, Mutter."
"So, Gott behüte euch, und geht noch zum Vater und sagt, daß ihr jetzt fortgehst."
Der Knabe nahm eine von seinem Vater kunstvoll aus Kalbfellen genähte Tasche an einem Riemen um die Schulter, und die Kinder gingen in die Nebenstube, um dem Vater Lebewohl zu sagen. Aus dieser kamen sie bald heraus und hüpften, von der Mutter mit einem Kreuze besegnet, fröhlich auf die Gasse.
Sie gingen schleunig längs des Dorfplatzes hinab und dann durch die Häusergasse und endlich zwischen den Planken der Obstgärten in das Freie hinaus. Die Sonne stand schon über dem mit milchigen Wolkenstreifen durchwobenen Wald der morgendlichen Anhöhen, und ihr trübes, rötliches Bild schritt durch die laublosen Zweige der Holzäpfelbäume mit den Kindern fort.