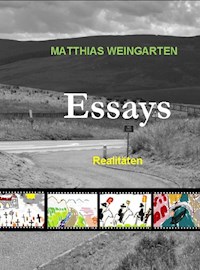
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Essays und Kurzgeschichten – ein bunter Strauß an Beschreibungen der Realität: Kleine Beobachtungen, Begegnungen, Anmerkungen. Ironisch, kritisch, unterhaltsam. Die Geschichten und Beobachtungen stammen beispielsweise aus Südtirol und Schottland oder befassen sich mit alltäglichen Ereignissen. Sie beschreiben, berichten, hinterfragen oder sind fast schon unwirklich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Weingarten
Essays
Realitäten
Essays
Matthias Sprißler (Weingarten)
Text und Gestaltung:
Copyright © 2016 Dr. Matthias Sprißler
Verlag: Dr. Matthias Sprißler, Tübingen, www.sprissler.orgDruck: epubli ein Service der neopubli GmbH, BerlinISBN
Umschlag, Fotos und Grafiken: Autor
Umschlagfoto: Schottland
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind, sofern es keine Personen der Zeitgeschichte sind, rein zufällig.
Ähnlichkeiten
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.
Dieser Satz findet sich, meist klein gedruckt, in vielen Büchern. Mal ganz vorn, mal im Nachwort. Und dennoch suchen die Leser regelmäßig fast verzweifelt und akribisch nach Ähnlichkeiten. Wer konnte der Figur Pate gestanden haben? Wer hat den Autor inspiriert? Wer könnte Modell gesessen sein? Kenne ich sie oder ihn? Oder will sich der Schreiber gar mit einer prominenten Person beschäftigen? Hat er den Satz nur drucken lassen, um sich vor denen zu schützen, die sich gern beschrieben sehen würden? Oder will er sich nur formal vor denen absichern, die er ganz bewusst ausgesucht und etwas verfremdet hat?
Die Antwort ist einfach: Nichts ist unmöglich, alles ist denkbar. Wer meint, sich oder einen anderen zu erkennen, sei es als Inspiration, sei es als Abbild einer Romanfigur, wird immer eine Gemeinsamkeit finden. Wer über seine Mitmenschen gut denkt, wird sich geehrt fühlen: Der Autor denkt an ihn und er sieht ihn als einen Menschen mit Ecken und Kanten, mit Licht und Schatten, nicht als eine von vielen grauen Mäusen. Wer dagegen ohnehin bereits mit sich und der Welt hadert, für den mag es Anlass zu neuem Ärger sein, auf den es dann aber auch nicht mehr ankommt.
Wer aber ganz sicher sein möchte, dass er sich an keiner Stelle meint erkennen zu müssen, der belässt es am besten beim Blick auf das Cover und stellt das Buch ins Regal zurück. Neugierde ist für ihn ohnehin ein Fremdwort.
Sollte auch nach diesen Sätzen noch Unsicherheit bestehen, so sei zur
Entscheidungsfindung folgendes verraten: Die Phantasie des Autors reicht nicht zur
Schaffung reiner Phantasiefiguren. Er möchte auch gar nicht über Aliens im Ufoanflug auf
Mutter Erde schreiben. So gibt es zwei Typen: Zum einen der Protagonist, der einer realen Figur in einigen Bereichen und Wesensarten nachempfunden ist und zum andern die primär der Phantasie entsprungene Figur, die - für den Leser kaum erkennbar - mit einzelnen Erscheinungsformen oder Charakterzügen dem Autor bekannter Menschen versehen ist, wobei die Person selbst mit der Geschichte aber nichts gemein hat.
Also - fast - alles - fast - zufällig.
Affe
Wer in Straßburg das Münster sucht, muss entweder den Besucherströmen oder seinem Stadtplan folgen. „Auf Sicht“ geht nicht. Erst wenige Meter vor dem Portal wird die Fassade sichtbar, als Bollwerk am Ende der Straße. Unzählige Versuche, die Fassade in ihrer Gesamtheit unverzerrt aufs Celluloid zu bannen oder in Pixel zu verwandeln, sind zum Scheitern verurteilt.
Ganz anders: Salisbury, das mittelalterliche Sarum, im Süden Englands. Auch hier führen die Straßen zur Kathedrale. Nach Passieren des letzten Hauses weitet sich der Blick: Die Kathedrale ruht im Grünen, vom Portal bis zur Turmspitze, von der Eingangsrosette bis zur Apsis in ihrer Ganzheit wahrnehmbar. Umgeben von grünem Rasen und alten Bäumen, ein Kontrast aus spitzen Bögen und Stein. Ein zum Himmel strebendes, harmonisch-geformtes Bauwerk, errichtet vor bald 1000 Jahren auf den Säulen der Erde. Umgeben von einem vielfach größeren cathedral close, einer Klosterbezirk genannten grünen Oase, der Domfreiheit. Das Gotteshaus im Paradies.
Im Paradies lebten die ersten Tiere. Zumindest ein Affenpärchen überlebte auch die Sintflut. Und nach der Beschreibung soll ein mit britischem Humor gesegneter Baumeister einen solchen Affen in der Kirche angebracht haben. Mit einer typischen Handbewegung: Kokosnusswerfen. Doch er hat sich im paradiesischen Dschungel gut versteckt, zwischen Heiligen und Helden, Säulen und Bögen. Erst eine freundliche Mitarbeiterin der Kirche kann den Besucher ans Ziel führen: Über dem Eingang zur Sakristei, vielleicht drei oder vier Meter über dem Boden, sitzt er tatsächlich, vor der Messe, in der Messe und nach der Messe: Der Affe mit der Kokosnuss.(2014)
Allerseelen
Die Dämmerung kriecht ins Tal. Erst langsam, dann immer schneller, unaufhaltbar. Berge und Tal verschmelzen zur Dunkelheit. In den Fenstern der Häuser gehen die Lichter an, Lichter im Leben. Orange Strahler werden eingeschaltet und langsam heller. Dann erstrahlen Fassaden von Burg und Kirche. Die Kirche selbst ist dunkel. Nur ein ewiges Licht schimmert durch das Fenster.
Vor der Kirche Kieswege. Dazwischen weiße Grabsteine. Steine mit Namen, Zahlen, Bildern. Steine als Bericht über verflossenes Leben. Steine der Erinnerung.
Hinter der Kirche nachtgrüner Rasen. Dazwischen zahllose Kreuze. Schwarze Kreuze aus Metall. Im Feuer geschmiedet für die Nachwelt, für die Ewigkeit. Kreuze in unterschiedlichen Kreuzformen. Kreuze in Strahlenform. Verzierte Kreuze, scharf gezeichnet vor dem nachtblauen Himmel. Himmel mit der Resthelligkeit der Vergangenheit, Resthelligkeit der hier schon untergegangenen Sonne. Einer Sonne, die nicht untergeht. Die morgen wieder aufgehen wird. Die untergeht und zugleich aufgeht. Die die Dunkelheit wieder durch Licht ersetzt. Tod durch Leben.
Den ganzen Tag zuvor waren die Lebenden bei den Toten. Haben am Grab gearbeitet. Für irdische Ordnung am Tor zum Jenseits. Für Schmuck gesorgt für diejenigen, die ihn nicht mehr benötigen. Aber die Lebenden brauchen ihn, zum Zeichen des Gedenkens, zum Ausdruck von Dankbarkeit.
Sie haben kleine und große Lichter aufgestellt, Kerzen in weißen und roten Gläsern. Zum Abschluss ihrer sorgenden Mühe haben sie die Kerzen angezündet. Ohne ihren Schein zu sehen, bei Tageslicht, zeitig vor dem Vesper, dem Besuch des Gasthofs, der ruhelosen Rückkehr ins rastlose Reich der Lebenden.
Doch nun ist es dunkel. Außerhalb des Friedhofs. Denn dort leuchten sie nun, hunderte Kerzenlichter in weißem und rötlichem Licht. Vier, fünf oder mehr Lichter auf jeder der kleinen Grabstätten. Jedes Licht eine Verbindung des Toten zu einem noch Lebenden. Sie leuchten in die Nacht, machen die Kreuze sichtbar. Sie leuchten allein, die Lebenden sind schon weg. Sie haben keine Zeit, das Zeichen der Hoffnung, das helle Licht in der dunklen Nacht zu sehen. In der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen.
(2013)
Arbeiter im Weinberg
Ein Vater hatte zwei Söhne und besaß einen Weinberg. Vor Jahren schon hatten die Söhne den Gutshof verlassen. Früher jedoch, als sie noch jung waren, mussten beide mitarbeiten, wenn es darum ging, für die Zukunft einen neuen Weinberg anzulegen. Er hatte die Söhne seinerzeit gerecht entlohnt. Unterschiedlich, aber doch gerecht. Zumindest wollte er sie gerecht bezahlen.
Wenn der Vater viele Jahre später, nun schon als weiser Greis, auf die Zeit zurückblickte, in der beide Söhne im Weinberg gearbeitet hatten, vermeinte er jedoch ein Rumoren in seinem Gewissen zu verspüren.
Nun, im hohen Alter, gestand er sich ein, dass beide mit ihrer Arbeit die Grundlage für gute Weinlesen gelegt hatten. Er konnte, wenn er das Etikett auf den Flaschen, die ihm der Kellermeister brachte, nicht betrachtete, selbst nicht mehr unterscheiden, aus wessen Sohnes Pflanzungen der gleichermaßen edle Tropfen stammte. Die Arbeit der Söhne hatte, wie er nun erkannte, denselben Wert gehabt.
Die Arbeit des Jüngeren, der nicht schnell genug beginnen konnte, der seine Arbeit schnell erledigen wollte und der immer noch, letztlich wertlos, ein bisschen mehr um die Pflanze herumgehäckelt hatte, noch ein Drähtchen mehr verbaut hatte, damit die Pflanze noch zwei Grad senkrechter stand. Er hatte sich von dieser Arbeitsweise damals beeindrucken lassen und hatte die von ihm als sehr gut erachtete Arbeit fürstlich entlohnt.
Die Arbeit des Älteren dagegen empfand er zeitweise als Zumutung. Spät begonnen, gerade noch rechtzeitig und immer nur das Nötigste. Es war ausreichend, was er vollbrachte, manchmal auch recht gut und insgesamt schon zufriedenstellend. Aber er hatte hierfür ein perfides Lohnsystem erfunden: Empfand er die Arbeit sehr gut, addierte er Lohn auf, empfand er sie nur ausreichend, zog er wieder ab, für zufriedenstellende Arbeit verrechnete er vorsorglich nichts.
Als er sich dann bei der zweiten Verkostungsrunde an das Resultat seiner Lohnordnung erinnerte, hätte er sich fast gar verschluckt: Gerade ein Zehntel hatte er dem duldsamen Älteren gewährt. Und doch war, wie ein weiteres Glas bestätigte, die Arbeit nachhaltig betrachtet, gleichwertig gewesen.
Als er sich dies eingestanden hatte, waren ihm sogar Gewissensbisse gekommen. Nein, er war immer ehrlich, hatte sein Wort gehalten. Keiner konnte sich beklagen. Seine Regeln waren bekannt, er hatte nie dagegen verstoßen. Und dennoch: War es richtig, dem jüngeren Sohn dank seines selbst formulierten Regelwerks den vielfachen Lohn zu geben?
Ausführen
Wer hat sie nicht schon gesehen! Zuhause in den meisten Städten, Besitzerin eines Fahrrades. Tierlieb. Man sieht sie meist bei gutem Wetter. Einige Exemplare lassen sich auch von schlechtem Wetter nicht beeinträchtigen. Genüsslich, nicht gemütlich radeln sie über den Asphalt. Nur Asphalt ist gut genug für Reifen und Federung. Sie fühlen sich vorbildlich. Ohne Helm, natürlich an der Schule vorbei. Auf dem Fußweg („er läuft doch und ich muss doch dabei sein“). Bewegung an der frischen Luft. Und der oder die Kleine soll doch auch raus. Braucht doch Auslauf. Will sich bewegen. Und genau dies darf er oder sie, manchmal sieht man das nicht genau, auch. Stets bei Fuß, im Rhythmus der Pedale. David gegen Goliath im Kampf um Rollwiderstand, Gegenwind, Hitze, harten Asphaltbelag. Ausruhen? Aber nein, wir müssen uns doch bewegen. An manchen Tagen nimmt sie etwas Wasser für ihn mit. Solange es nicht zu heiß ist. Sie schwitzt nicht gern. Kürzlich überholte sie einen Kollegen. Kein guter Herr. Läuft selbst mit. Und die Kleine bei Fuß japst nicht einmal. Kein gutes Training. Hat sie beim Überholen richtig gehört? Spricht er etwa mit dem Kleinen? Unglaublich. Sie spricht nicht („bin ich denn Franz von Assisi?“), sie pfeift. Ja, sie pfeift. Laut und durchdringend. Mit ihrer Pfeife. Mehr braucht sie nicht. Die Pfeife, ja sie, die Pfeife. Die Pfeife macht den Mann aus ihr. Den Rudelführer, das alpha-Tier. Sie führt, der Kleine spurtet. Japst nach Luft, kann nicht einen einzigen Gang zurückschalten. Am Berg. Mit seinem Ball. Seinem Spielball. Man muss sie konsequent führen. Wer damit spielt, trägt ihn auch. Notfalls zwischen den Zähnen. So wie sie die Pfeife trägt, sie, die Pfeife.
Fünfzehn Minuten sind eine gute Zeit. Die Kleine braucht den Auslauf. Nun sind sie am Ziel. Die Wiese am Ortsrand. Endlich aus dem Sattel. Endlich Pause. Nur noch zuschauen. Wie er spielt. Den Ball zurückbringt. Das Pfeifen verstehen lernt.
Sie macht es gern. Diesen Sportunterricht. Sie liebt es, wenn sie neben ihrem (K)Rad her hetzen. Hecheln. Heulen. Den Ball in der Linken, ihre Wasserflasche in der rechten Hand. Auf ihre Trillerpfeife reagieren. Auf der Wiese springen, sprinten, schneller springen. Weit werfen. Weiter werfen. Und auf Pfiff wieder bei ihr sind. Bei Fuß. Für das Ausführen zurück. Ihre Kleinen, die achtjährigen, die neunjährigen oder die zehnjährigen, ihre Schülerinnen. Die kleinen Olympioniken, die sie dank akademischem Pfeifenkurs führen darf. Sie, die Führerin. Ihre Riege. Zum Gau-Turnfest. Auf dem Weg zur Goldmedaille. Wenigstens zum goldenen Handschlag, Ihrer Besoldung, ihrem Pfeifenlohn, vergleichbar dem Oberarzt. Dankbar. Die Pfeife. Für die Pfeife.
Aqua alta
Die Lagune liegt schwarz und unruhig vor San Marco. Der Abend ist kalt, es regnet seit Stunden in Strömen. Die Tage sind noch kurz um diese Jahreszeit, Ende März. Zwischen den Palazzi hasten die Vaporetti von Haltestelle zu Haltestelle durch den Canale Grande. Nur wenige Fahrgäste stehen unter dem Dach; die Panoramasitze an Heck und Bug sind nass und leer.
Das Wasser steigt. Unaufhaltbar und stetig. Beginnt die Piazza San Marco langsam zu überfluten, einzukreisen. Von der offenen Lagune, von den Seitenkanälen und aus den Kanalschächten. Immer glänzender wird der Platz, immer besser spiegeln sich die Lichter in der steigenden Wasserfläche auf der Piazza. Die Kaffeehausmusiker lassen sich nicht beirren. Sie spielen. Klassik. Im vorderen Bereich beginnen die Kellner im dunklen Anzug, weißen Hemd, Krawatte und Gummistiefeln damit, Sofas, Sessel und Stühle auf die Tische ins Trockene zu retten. Zwei Tische weiter hinten wird zugleich der nächste Gang serviert. Mit Musik. Die Melodie von „It`s time to say goodbye“, verbunden mit Bildern eines sinkenden Salons auf dunklem Meer, dringt immer stärker ins Gedächtnis. Stattdessen: Walzer.
Unter einer kleinen Kanalbrücke sucht eine ganze Kolonne Gondeln für ein paar Sekunden Schutz. Die Gondolieri muten wie Außerirdische an, im langen schwarzen Regenmantel, Kapuze, triefend nass. In den Gondeln Asiaten in bunten Regenjäckchen. The show must go on.
(2013)
Bitzlemann
Die Kirche von Lustnau steht nur leicht erhöht im Neckartal. Wandert man heute von der Lustnauer Kirche stets steil bergan, erreicht man nach einer Wegstunde die Ortschaft Pfrondorf. Auf halber Strecke führt der Weg an einer steilen Schlucht entlang durch dichten Laubwald. Hier in dieser Schlucht lebte einst, will man den Erzählungen alter Frauen aus Pfrondorf Glauben schenken, der Bitzlemann.
Es war ein kalter Wintertag im Januar des Jahres 1831. Vor zwei Tagen war der alte Findeisen gestorben. Die noch viel zu junge Witwe trug seither schwarze Kleidung, auch wenn sie im Innern froh war, dass der Alte endlich loslassen durfte. Nur das Begräbnis bereitete ihr Sorgen. Wie oft schon hatte sie als Kind und auch später noch vom Bitzlemann gehört. Groß soll er sein, dunkel im Gesicht, von Fell bedeckt. Gefährlich und unbesiegbar. Immer wieder soll er sich eine Leiche geraubt haben, meistens die besonders kalten Toten des Winters. Leichtes Spiel habe er gehabt. Da die Pfrondorfer bisher an einem eigenen Friedhof ebenso sparten wie an einer eigenen Kirche, mussten die Toten den Berg hinunter, entlang der tiefen Waldschlucht, nach Lustnau befördert werden. Der Totengräber von Lustnau hatte sich schon seit vielen Jahren geweigert, die Toten von Pfrondorf nach Lustnau zu holen. Er wusste genug, wusste, dass dort im Wald der Bitzlemann hauste, ein Verwandter des Teufels selbst. Er wusste dies, seit sein eigener Vater, auch er schon Totengräber, von einem Leichentransport kurz nach Neujahr nie mehr zurückgekommen war. Erst im Frühjahr hatten Holzfäller die zerschlagenen Reste seines Schlittens gefunden. Tief unten, am Grund der Waldschlucht. All dies ging der jungen Witwe seit Stunden durch den Kopf. Aber sie hatte keine Wahl, sie musste fahren. Mit Hilfe eines Nachbarn hob sie den Leichnam auf einen großen Schlitten und band ihn fest. Schweren Schrittes und mit Herzklopfen zog sie ihn aus dem Dorf hinaus. Sie sah die Dörfler an ihren Fenstern stehen, sah manchen gar sich noch bekreuzigen. Wie wenn sie selbst des Teufels wäre. Am Rand der Hochebene musste sie aufsitzen. Sie hatte keine andere Möglichkeit, als sich auf die steifen, langsam gefrierenden Beine des Toten zu setzen. Ihr schauderte. Ein kurzer Antritt reichte aus, um den Schlitten zu beschleunigen. Langsam aber stetig fuhr er über den Feldweg nach unten auf den Waldrand zu. Dort begann das steilste Stück, hinunter zum Rand der Schlucht, dann in einer leichten Kurve wieder aus dem Wald hinaus. Schon kurz nach Einfahrt in den Wald bemerkte sie die Veränderung: Der knirschende Schnee wurde weniger, immer glänzenderes und glatteres Eis bedeckte den Weg. Sie versuchte zu bremsen, vergeblich. Sie versuchte zu lenken, unmöglich. Dann sah sie das leere Holzfass am Wegrand, aus dem die letzten Wassertropfen gefrierend auf den Weg liefen. Das muss er gewesen sein, der Verwandte des Teufels, der Bitzlemann. Ihr Herz drohte zu zerplatzen, das Blut schoss ihr in den Kopf. Sie schrie, wie sie noch nie geschrien hatte. Lustnauer Kinder erzählten später, an diesem Tag einen lauten Schrei gehört zu haben. Und mit den letzten Tönen ihres vergeblichen Schreiens schoss der Schlitten über den Wegrand hinaus und stürzte ungebremst in die Tiefe der Schlucht. Schon im freien Fall sah sie ihn: Groß, fellig und dunkel, gierig feixend, den Bitzlemann, neben einem Baum in der Schlucht stehen. Der Schlitten schlug hart auf. Dann war es still im Wald, totenstill. Ein Suchtrupp aus Pfrondorf fand am Tag darauf den Schlitten und die durchtrennten Schnüre, mit denen die Leiche befestigt war. Die Leiche und die Witwe wurden nie wieder gesehen. Der Bitzlemann war wieder da gewesen.
Noch im gleichen Jahr bauten die Pfrondorfer den Friedhof und begannen mit der Errichtung einer Kirche. Und der Wald mit der Schlucht wird seither „Bitzle“ genannt, obwohl seit jenem Wintertag niemand mehr den Bitzlemann je gesehen hatte.
(2013 - Idee: Helga)
Blutfreitag
Freitag. Ein Freitag im Süden von Deutschland. Der Besucher aus Tokio steht am Rand der Straße. Auf dem Bürgersteig, wie die Leute hier sagen. Er war kein Bürger, nur Besucher. Aber keiner der Tausenden auf dem Bürgersteig wies ihn weg.
Paukenschläge kommen näher, Trompeten und Fanfaren. Ein langer Zug von Verkleideten zieht vorüber. Zu Fuß und auf Pferden. Alpenländische Trachten, schwarze Fräcke, weiße Röcke. Immer neue Gruppen mit Stangen, an denen bunte Stoffe hängen.
Der Besucher ist ratlos. Was geschieht um ihn herum? Ein großer Mann, kostümiert mit schwarzem Frack und Zylinder reitet auf einem kleinen Schecken dicht an ihm vorbei, winkt mit der Hand. Will er ihn mitnehmen?
Wo er nicht weiterkommt, hilft ihm sein Smartphone. Suche „Süddeutschland, Verkleidung“. Sekunden später die Antwort: „Brauchtum im alemannischen und rheinischen Raum, Umzüge verkleideter Personen, meist mit Musik, als Fastnacht oder Karneval bezeichnet; religiös; `Die Fastnachtsbeichte` (Zuckmayer).“
Nun weiß der Mann das Notwendige. Dem Netz sei Dank.
(2013)
Blutsbande
Blutspur durch Europa
Es war Mord. Eiskalter Justizmord sogar. Mordmerkmal niedrige Beweggründe, um des eigenen politischen Fortkommens willen. Brutal, erniedrigend und blutig ausgeführt, fast wie eine Exekution.
Er ging geschickt vor. Wusch seine Hände zusätzlich in Unschuld, obwohl er sie sich selbst nicht einmal schmutzig gemacht hatte. Er war nur der Entscheider. Er selbst würde niemals töten. Hierfür hatte er Handlanger. Überwiegend gewissenlose Spielernaturen, zu allem bereit, wenn die Kasse stimmte oder der Chef es anordnete.
Nur einer, Herr Lang, genannt der Hauptmann, war nicht ganz so abgebrüht. Gewissensbisse plagten ihn. Dass die Mutter des Opfers hinzugekommen war, hatte ihn dann doch etwas mitgenommen. Das Opfer hatte ihm nichts getan, ein ungefährlicher Schwätzer. Nicht einmal reich war er. Warum sein Chef hier auf dem Mord bestand? Er saß doch fest im Sattel, hatte die Zügel sicher in der Hand. War schon einige Jahre hier als eine Art Reichsstatthalter.
Die ganze Aktion verlief dann aber doch unkompliziert, ohne Nachspiel. Dass der Reichsstatthalter bald darauf abberufen wurde, hatte nichts damit zu tun. Herr Lang zog es dann aber doch vor, die Gegend zu verlassen. In Oberitalien wollte er nochmals durchstarten. Letztlich war er dann aber selbst der Schwätzer: Zog nur noch umher und erzählte sie wieder und wieder. Die Geschichte vom Mord. Und wenn er es besonders spannend machen wollte, zog er ein kleines Glasfläschchen aus seinem Umhang und hielt es den Zuhörern und Zuschauern hin. Diese wiederum verfielen in schweigsame Ehrfurcht oder Entsetzen, als er erklärte, dass der bräunliche Inhalt das Blut des Opfers wäre.
Diese Reaktion der Zuhörer wiederum entging anderen nicht und entwickelte deren Begehrlichkeiten. Ein einmaliges Ausstellungsstück, das auch neuen wirtschaftlichen Aufschwung bringen könnte. Dies wiederum erhöhte den Wert des Inhalts des Fläschchens, bis er letztlich aufgeteilt wurde: Mantua, Reichenau, Weingarten und Brügge – nach all diesen Orten soll ein Bruchteil gelangt sein.





























