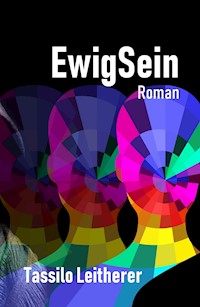
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"EwigSein" beschreibt das Leben und Wirken eines Mannes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt zu verändern. Er ist ein Außenseiter der Gesellschaft, ein Aussätziger, der glaubt, Schuld am Tod seiner Mutter zu haben. Diese will er durch Experimente an Frauen zurück ins Leben holen und auf diese Weise den Tod besiegen. Roberto und Truman - die einzigen Freunde des Protagonisten - stehen stets an seiner Seite. Doch auch sie verbergen ein düsteres Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tassilo Leitherer
EwigSein
Roman
© 2019 Tassilo Leitherer
Verlag und Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Paperback ISBN: 978-3-7482-6029-5
Hardcover ISBN: 978-3-7482-6030-1
e-Book ISBN: 978-3-7482-6031-8
Umschlaggestaltung: Leitherer – Kommunikation
Bilder: © pixabay.com
Lektorat/Korrektorat: Jutta Leitherer
www.tassilo-leitherer.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Über den Autor
Tassilo Leitherer wurde 1985 in Aschaffenburg geboren und lebt heute in München. Er ist als freier Redner, Mediator, Konfliktmanager und Kommunikationsberater selbstständig.
2009 erschien seine erste Erzählung „Die Sehnsucht nach der richtigen Welt“. Im Juni 2010 folgte sein erster Gedichtband „Träume wie die Wirklichkeit“, und im Oktober 2011 sein erster Roman „Die sieben Stufen des Wahnsinns“.
Der Erlös seines 2012 erschienenen Gedichtbandes „Die Phantasie der Wirklichkeit“ kommt Straßenkindern in Bolivien zu Gute.
In den Gedichtbänden „Spiegelbild der Wirklichkeit“ (2015) und „Erinnerung der Wirklichkeit“ (2018) beschäftigt sich der Autor mit dem Alltag, mit Tod und Hoffnung und der Bewältigung von Trauer.
In „Die Schönheit dieser Wirklichkeit“ (2018) erzählt Leitherer Episoden aus dem Alltag, Fabeln und Geschichten, die sich mit den schönen Augenblicken dieses Lebens beschäftigen.
Der Roman „MenschSein“ (2018) beschreibt ein Leben ohne Gefühle und die Suche nach eben diesen und wirft die Frage auf, was uns als Menschen ausmacht.
Glaube denen, die die Wahrheit suchen,und zweifle an denen, die sie gefunden haben.
André Gide
Damals
Heute war Freddys großer Tag. Er war einer der Pioniere seiner Zeit. Genauso wie es seine Vorgänger Fluffy, Rudolph und Winston gewesen waren.
Vielleicht würde er der größte von ihnen werden. Ein Held, der in die Geschichte eingehen würde. Gleichbedeutend mit großen Namen wie Galilei, Röntgen oder Einstein. In einem Atemzug genannt mit Juri Gagarin und Neil Armstrong.
Ein Symbol für den Anbeginn einer neuen Zeit. Menschen wie Sir Edmund Hilary, der als erster den Mount Everest bestieg, oder Robert Edwin Peary, der in die Geschichte einging als derjenige, der die erste Flagge im Boden des Nordpols versenkte.
Irgendwann einmal würde die Menschheit zurückblicken und anerkennend nicken. Sie würde sich zurückerinnern und gleichzeitig das Genie und den Mut des Förderers von Freddy bejubeln.
Dieser Förderer war ich. Vom ersten Tag an habe ich Freddy begleitet. Als er auf die Welt kam, säuberte ich den kleinen Wurm. Da seine Mutter nach der Geburt nichts von Freddy wissen wollte, kümmerte ich mich um ihn. Ich putzte ihn, fütterte ihn, gab ihm Wärme und Liebe. Ich half Freddy bei seinen ersten Schritten in die neue Welt, die auf ein so kleines Wesen ganz sicher beängstigend wirken musste.
Freddy vertraute mir blind. Hätte ich ihm gesagt, er solle von einer Brücke springen, Freddy hätte dies ohne jeden Zweifel sofort getan, vielleicht mit einem Schlachtruf wie „Geronimo“ auf den Lippen.
Zumindest dann, wenn Freddy hätte sprechen können. Freddy war nicht direkt stumm, er sprach ganz einfach eine andere Sprache als ich und die meisten anderen in seinem Umfeld.
Oft waren es einfache Laute, meistens jedoch nur Gesten wie ein Zucken der Nase, ein Wackeln mit den Ohren oder ein Wedeln des Schwanzes.
Trotz unserer Unterschiede waren Freddy und ich wie Brüder. Mit sechs Jahren fühlte man sich fremd, wenn man so aufwuchs, wie ich es tat. Freddy war hier mein Anker, der mir zeigte, dass ich nicht alleine war.
„Nun mach schon!“, drängte mich Truman und riss mich aus meinen Gedanken. Er hatte diese Worte nicht direkt gesprochen. Vielmehr hatte das Funkeln in seinen Augen seine Aufforderung nach außen getragen.
Truman war ebenfalls ein Bruder. Genau genommen war er sogar noch mehr als Freddy. Seit ich denken konnte, war er an meiner Seite. Ein treuer Ratgeber, der mich überall hin begleitete, mir Ratschläge gab und mir so meinen Weg im Leben wies. Truman war groß gewachsen, blond, hatte blaue Augen mit einem alles durchdringenden Blick. Ein gutaussehender Junge, der um seine Ausstrahlung wusste und diese einzusetzen vermochte.
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ Das war Roberto, ein weiterer Bruder. Auch er sprach diese Worte nicht aus. Sein Nicken verriet mir, was er dachte, so gut kannte ich ihn. Roberto war das genaue Gegenteil von Truman. Er war eher klein, dicklich, hatte dunkle Haare und trübe schwarze Augen. Roberto war ganz und gar unscheinbar und doch war er ebenso wichtig wie Truman. Ich wusste, ich konnte mich jederzeit auf Roberto verlassen.
„Aua!“, stieß ich auf einmal aus. Ich besah meine Hand und entdeckte Blut. „Freddy!“, rief ich und kämpfte gegen die Tränen, die langsam in meine Augen traten, an.
Truman schnaubte missbilligend, als wollte er mir sagen, ich solle keine Memme sein. Truman war stets bemüht, meine Entwicklung zum Waschlappen zu verhindern.
„Es ist ok zu weinen“, versicherte mir hingegen Roberto durch eine stumme, sanfte Berührung meiner Schulter. Worte waren nicht nötig. Für seine Geste erntete Roberto einen giftigen Blick von Truman. Die beiden mochten sich nicht besonders. Sie waren wie Feuer und Wasser. Sie kamen nur miteinander aus, weil es mich gab. Ich war das Bindeglied zwischen Truman und Roberto. Roberto jedenfalls war der Einfühlsame der beiden. Tränen waren für ihn vollkommen in Ordnung und er zeigte gerne seine Gefühle.
„Nicht streiten, Jungs“, forderte ich Truman und Roberto auf. „Immerhin stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Zeit.“
Freddy sah dies offensichtlich anders. Er wand sich auf einmal in meinem Griff und fühlte sich unwohl. Sein hellbraunes Fell wischte dabei über die Wunde an meiner Hand, die mir Freddy selbst zugefügt hatte. Die dunklen Blutflecken zeichneten sich unschön auf Freddys Fell ab. Ich nahm mir vor, ihn später gründlich zu waschen.
„So, rein mit dir“, sagte ich entschieden, öffnete die Tür zur Mikrowelle und setzte Freddy hinein. Es war nicht ganz leicht, die Tür zu schließen, ohne dass Freddy entkam. Drei Versuche waren nötig, zwischen denen ich Freddy immer wieder mühsam in der Küche einfangen musste. Er war wieselflink, das musste man ihm lassen.
Truman und Roberto waren mir dabei keine große Hilfe. Sie waren immer schnell mit einem Rat zur Stelle, packten aber niemals selbst an. Wenn es etwas gab, das mich an Truman und Roberto ärgerte, dann war es genau diese Eigenschaft.
Meine Großmutter hatte mich jedoch gelehrt, immer tolerant zu sein. Jeder Mensch hat seine Eigenheiten, seine Stärken und Schwächen und diese galt es zu akzeptieren. Vor allem dann, wenn diese Menschen Freunde oder mehr noch Brüder sind. Leider war dies die einzige Lehre, die mir meine Großmutter mit auf den Weg geben konnte.
Bevor ich mehr von ihr lernen konnte, starb sie. Das heißt, eigentlich starb sie nicht im klassischen Sinne. Sie war nicht krank oder litt an Altersschwäche. Sie war noch nicht einmal dement. Aber all diese Dinge zählen nicht, zumindest nicht für Busse.
Statt mir etwas von Toleranz zu erzählen, hätte sie mir vielleicht etwas vom nach links und rechts Schauen beim Überqueren der Straße erzählen sollen. Offensichtlich kannte sie diese Weisheit nicht, sonst wäre sie heute noch am Leben. Mehr Erinnerungen als diese blieben mir nicht an meine Großmutter. Ich wusste nur, wie wichtig sie meiner Mutter gewesen war. Womöglich war meine Großmutter meiner Mutter ebenso wichtig, wie meine Mutter mir wichtig war. Es existierte kein Wesen auf dieser Erde, das mir mehr bedeutete als meine Mutter.
Jedenfalls hatte ich es nach einigen Versuchen geschafft, Freddy in die Mikrowelle zu setzen und die Luke zu schließen. Freddy füllte beinahe den gesamten Raum aus. Er war dick. Ich hätte Freddy nicht immer so viel Futter geben sollen. Ob sich der Teller in der Mikrowelle in Anbetracht dieses Fleischklopses drehen würde, wagte ich zu bezweifeln. Man musste sehen, ob dies ein Problem darstellen würde.
Roberto deutete auf den Regler an der Mikrowelle, an dem sich die Leistung regulieren ließ. Es schien beinahe so, als wollte er sagen, ich sollte 700 Watt einstellen. Es war ein guter Rat. Seine Ratschläge trug er jederzeit besonnen vor. Roberto dachte nach, bevor er sich auf seine stille Weise mitteilte.
Truman schüttelte jedoch energisch den Kopf und zeigte auf die 1000 Watt-Anzeige. Für ihn hieß es immer ganz oder gar nicht, etwas tun oder etwas nicht tun. Halbe Sachen kamen für Truman niemals in Frage. Truman war außerdem impulsiv und preschte nach vorne. Nachdenken konnte man später immer noch.
„Ok“, sagte ich und drehte das Bedienelement ganz nach rechts. Bis zum Anschlag. Roberto schüttelte traurig den Kopf. Er war jedes Mal traurig, wenn man seine Ratschläge nicht beachtete.
Truman hielt zwei Finger in die Luft. 2 Minuten, bedeutet er mir damit und ich stellte eben diese Zeit ein. Roberto schwieg.
Ich drehte die Zeitschaltuhr auf die vorgeschlagene Zeit, atmete tief durch, ignorierte Freddy, der von innen mit seinen scharfen Krallen vergeblich an der Scheibe kratzte und drückte den Startknopf.
Das Licht ging in der Mikrowelle an und sie begann zu brummen, wie sie das immer tat. Es spielte keine Rolle, ob man sich eine Suppe heiß machte, ein Brot auftaute oder der Wissenschaft diente. Die Geräusche waren stets die gleichen.
„Mist“, murmelte ich. Der Teller in der Mikrowelle drehte sich zwar, Freddy jedoch wollte nicht stillhalten. Offensichtlich geriet er in Panik.
„Ganz ruhig“, sagte ich zu ihm, auch wenn er mich wahrscheinlich durch die dicke Scheibe und das Brummen des Geräts nicht verstehen konnte. „Alles ist gut.“
Und genau so war es auch. Alles war gut. Zumindest für eine Weile. Nach einigen Sekunden hatte sich Freddy beruhigt. Vielleicht war er auch einfach nur erschöpft, denn er sackte apathisch auf dem Teller zusammen. Wie gebannt starrte ich in die Mikrowelle. Ich spürte links und rechts von mir die Gesichter Trumans und Robertos, die ebenfalls sehen wollten, was nun geschah.
„Gleich ist es soweit“, murmelte ich. Truman und Roberto nickten zustimmend.
Dann, ohne jede Vorwarnung, explodierte Freddy.
Freddy, das Frettchen war tot. Doch war sein Tod nicht umsonst. Er hatte im Dienste der Wissenschaft gehandelt und würde in die Geschichte eingehen.
Doch nun musste ich erst einmal die Mikrowelle reinigen. Ich seufzte, denn wusste ich, wie wenig hilfreich mir dabei Truman und Roberto sein würden.
„Wärt ihr doch ein bisschen mehr wie Freddy“, sagte ich zu den beiden, die beschämt wegsahen, und ging in die Kammer, um das Putzzeug zu holen.
Heute
Die sanfte Berührung einer Hand ließ mich die Augen öffnen. Ich erkannte diese sofort als Robertos Hand. Truman weckte mich niemals so ruhig.
Truman vertrat die Ansicht, die einzig richtige Art, jemanden zu wecken, sei die schockartige. Ein Signalhorn, eine Papiertüte, die man aufblies und mit den Händen zum Platzen brachte, oder wahlweise eine Trompete. Truman konnte eigentlich gar nicht Trompete spielen und ich fragte mich jedes Mal, woher er dieses Instrument hatte, aber zum Wecken eines Menschen mittels einer Trompete war es vielleicht sogar ganz gut, das Instrument nicht zu beherrschen.
Roberto sah mich an. Sein gütiger Blick fragte mich, wie ich geschlafen hatte.
Ich rieb mir die Augen und blinzelte. Die Sonne schien mir direkt ins Gesicht. Ich hatte wohl vergessen, die elektrische Abdunkelung meines Schlafzimmers zu betätigen, als ich gestern ins Bett ging. Ich vergaß es jede Nacht.
Das war der Nachteil der Bauweise meines Hauses. So sehr ich die vielen großen Glasflächen auch zu schätzen wusste, so negativ wirkten sie sich auf einen gesunden Schlaf aus.
Dennoch mochte ich Glas. Mein Haus hatte ich auf einer Bergspitze errichtet. Es thronte über der Stadt. Der großen Stadt. Nachts waren Millionen Lichter zu sehen, wenn man hinausblickte. Jedes dieser Lichter stand für ein Leben und jedes dieser Leben gehörte mir und meinen Experimenten.
Nachts war ich der unangefochtene König. Sogar das Meer verneigte sich vor mir, wenn es mehrere hundert Meter unter meiner Festung hart gegen die Felswand schlug und dabei in Milliarden kleiner Wassertropfen zerplatzte.
Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, schätzte ich die Uhrzeit auf den späten Vormittag.
Die Nacht lag mir mehr als der Tag. Vielen Menschen in der Geschichte war es so gegangen. Winston Churchill etwa stand stets erst gegen Mittag auf. Dann gönnte er sich seinen ersten Drink, während er die Kriegsgeschehnisse verfolgte.
Und auch Albert Einstein war dafür bekannt, lieber länger zu schlafen und dafür nachts zu arbeiten. In der Nacht lag die Ruhe. Nachts störte einen niemand und man konnte sich voll und ganz seinen Gedanken hingeben. Es gab keine schönere Zeit als die tiefen Nachtstunden.
„Ja, danke“, antwortete ich schließlich auf Robertos stumme Frage. Roberto war wie immer fertig angezogen. Dabei war Roberto eher der legere Typ. Er mochte Jeans und grobe Hemden, die er gerne bequem und weit trug, um seinen Bauchansatz zu verbergen.
Ich sah mich um, konnte Truman jedoch nicht entdecken. Das war ungewöhnlich. Normalerweise begrüßten mich sowohl Roberto als auch Truman jeden Morgen.
„Was heckt Truman aus?“, fragte ich Roberto.
Roberto deutete nach unten. Truman musste bereits im Labor sein. Auch das war ungewöhnlich. Truman bereitete selten das Labor vor. Es musste schon einen besonderen Grund geben, heute eine Ausnahme zu machen. Ich beschloss, ihn selbst zu fragen.
Mein Traum kam zurück zu mir. Ich sah Freddy, das Frettchen. Ein wenig Wehmut überkam mich, als ich mich an das Experiment zurückerinnerte. Sicherlich, ich war noch sehr jung gewesen, und doch hätte ich vorhersehen müssen, was geschehen würde.
Freddy gehörte meine ganze Dankbarkeit. Er hatte mir zu einer neuen Erkenntnis und damit einer neuen Sicht aufs Leben verholfen. Ohne Freddy wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt war. Der Erfolg war nicht mehr fern.
Ich warf die seidene Bettdecke zur Seite. Nackt erhob ich mich aus meinem Bett. Ich tat dies langsam, bedächtig und mühsam. Es gab Dinge, die durch Training und Übung besser wurden, und es gab Dinge, die immer gleichblieben. Meine Schmerzen und meine Trägheit fielen in die zweite Kategorie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht trat ich ans Fenster. Robertos Blicke störten mich nicht. Wir kannten uns ein ganzes Leben, zu lange, um so etwas wie Scham zu empfinden.
Und selbst wenn, hätte mich dies ganz sicher nicht davon abgehalten, nackt zu schlafen. Ich mochte das Gefühl der Freiheit, die kühlen seidenen Laken auf meiner Haut und die Gewissheit, von nichts belastet zu sein. Auch deshalb mochte ich die Nacht. In meinen Träumen schmerzte mein Bein niemals.
Die Stadt – am Tag sah sie weniger beeindruckend aus als in der Nacht. In der Ferne konnte ich den Smog erkennen. Die Menschen, die dort wohnten, brachten sich jeden Tag ein kleines bisschen um. Sie bemerkten es nicht einmal, bis sie schließlich Teer husteten, Blut spuckten und qualvoll starben.
Ich hingegen atmete saubere Luft. Mein Haus verfügte über eine fortschrittliche Luftfilteranlage, die jeden Keim und jeden Schmutzpartikel herausfilterte. Ich nahm einen tiefen Zug dieser gereinigten Luft. Geschmacklos, geruchlos – so wie sie sein sollte.
Roberto fuchtelte unruhig mit den Armen. Beeile dich, wollte er mir sagen und mich zur Eile antreiben.
„Geh schon einmal vor und hilf Truman“, wies ich ihn an.
Widerwillig folgte Roberto meiner Anweisung. Nach all den Jahren, die wir nun schon zusammen waren, konnten sich Roberto und Truman noch immer nicht so recht leiden. Der einzige Grund, warum sie zusammenarbeiteten, war ich.
Ohne ein weiteres Wort verschwand Roberto. Seufzend blickte ich ihm nach. Es war schwer, Robertos Gedanken zu lesen. Auch wenn wir uns schon lange kannten und keinen einzigen T ag voneinander getrennt gewesen waren, so war er mir meist noch immer ein Rätsel. Ich wusste nie genau, was er ausheckte, was er dachte und fühlte.
Was ich mit Sicherheit sagen konnte, war, dass diese Gefühle existierten. Roberto war ein sehr emotionaler Mensch. Er war einfühlsam und bedacht. Er handelte nie in Zorn, Wut oder Aggression.
Darin bestand wohl auch der größte Unterschied zwischen ihm und Truman. Truman war analytisch und gleichzeitig impulsiv und aufbrausend. Eine Kälte wohnte in ihm, die mir manchmal Angst machte. Aus Gefühlsduseleien machte er sich nichts. Effizienz stand bei ihm an oberster Stelle. Manchmal nahm diese Kälte eine perfide Grausamkeit an. Immer öfter fragte ich mich, ob er überhaupt in der Lage war, Mitgefühl zu empfinden. Gerade in der letzten Zeit steigerte sich seine aufbrausende Art und mündete in extremen Wutanfällen. In seinen zornigen Phasen machte er einen beinahe gefährlichen Eindruck.
Dennoch waren wir Brüder. Ich war davon überzeugt, mich immer auf Truman verlassen zu können, egal, was auch kam. Er würde mich niemals verraten oder verletzen. Diese Gewissheit bedeutete mir sehr viel. In meinem Leben gab es nur Roberto und Truman. Sie waren meine Freunde und meine Familie. Mehr hatte, wollte und brauchte ich nicht.
In aller Ruhe – alles andere wäre mir unmöglich gewesen - duschte ich mich und wusch die letzten Reste der nächtlichen Benommenheit von mir ab.
Es würde ein aufregender Tag werden. Vielleicht würde heute der Durchbruch gelingen. Was bei Freddy misslungen war, würde heute ganz sicher glücken. Natürlich hatte ich nicht vor, irgendetwas oder irgendwen in eine Mikrowelle zu stecken. Diese Erfahrungen lagen hinter mir. Nein, heute stand etwas Anderes auf dem Programm.
Ich stieg aus der Dusche und nahm dabei die Griffe in Anspruch, die überall im Bad angebracht waren. Ich trocknete mich ab. Der Duschvorleger fühlte sich warm und weich unter meinen Sohlen an. Ich mochte dieses Gefühl.
Nachdem ich mich angezogen hatte, verließ ich mein Schlafzimmer. Wie jeden Morgen sah ich mich um. Dieses Haus hatte ich nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet. Natürlich hatten mich Roberto und Truman beraten und doch war es so, wie ich es wollte. Trotz allem war auch dieses Haus nur ein Werkzeug. Es sollte gar nicht den Zweck eines Zuhauses erfüllen, sondern lediglich meinem Ziel dienen. Diesem Ziel ordnete ich alles unter.
Eigentlich fühlte ich mich an jedem Ort fremd. Auch wenn ich mich hier geborgen fühlte und in Sicherheit wusste, so gab es da doch Zweifel. Ich mochte die Einsamkeit und die Isolation. Mein Haus – dieses Haus – gab mir eben jene Dinge.
Und doch fühlte ich mich fremd. Die vielen Jahre, die ich hier nun schon mit Roberto und Truman lebte, konnten daran nichts ändern.
Als ich den Gang gemächlichen Schrittes entlangging, sah ich kurz in Robertos Zimmer. Seine Zimmertür stand stets offen. Alles war akkurat, gepflegt und aufgeräumt. Der Raum erschien wie am allerersten Tag nach unserem Einzug.
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sich nicht ein einziges Detail in diesem Raum verändert hatte. Auf einem Regal standen einige südamerikanische Kunstwerke. Masken, Figuren und ein Glas, in dem ein Schrumpfkopf schwamm. Roberto hatte mir seiner Echtheit versichert. Mir jedoch erschien der Kopf stets viel zu neu, um eine echte, alte Reliquie zu sein.
Irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor. Viele Stunden hatte ich bereits in dieses leere, tote Gesicht gestarrt und mir den Kopf zermartert, doch bisher war ich noch nicht darauf gekommen, woher ich dieses Gesicht kannte. Ich wusste, ich würde auch morgen wieder an dem Zimmer vorbeigehen, hineinblicken, den Schrumpfkopf anstarren und mir dieselbe Frage stellen: Wem gehörte dieser Kopf und warum stellte ihn Roberto in seinem Zimmer aus ?
Ich schüttelte die Gedanken ab, schlurfte weiter und kam zu Trumans Zimmer. Die Tür zu Trumans Refugium war stets geschlossen. Ich achtete seine Privatsphäre. Ich hatte das Zimmer nur einmal – am Tag unseres Einzugs - von innen gesehen. Seitdem blieb mir sein Inneres verborgen. Was Truman in den Stunden tat, in denen er in diesem Zimmer verweilte, vermochte ich nicht zu sagen.
Niemals hörte man Geräusche oder andere Hinweise darauf, dass das Zimmer bewohnt war. Truman war mein Freund, weshalb ich ihn nicht durch irgendwelche Fragen zu nahe treten wollte.
Wahrscheinlich benutzte Truman den Raum ohnehin ausschließlich zum Schlafen. Immerhin war er ansonsten die ganze Zeit um mich herum. Und doch war es komisch. Als hätte Truman etwas zu verbergen. Jeden Morgen fragte ich mich, was das nur sein könnte? Welche Geheimnisse konnte Truman vor mir haben?
Roberto verheimlichte mir nicht einmal seinen angeblich echten Schrumpfkopf – wie schlimm mussten da die Geheimnisse sein, die hinter Trumans Tür warteten?
Ich durchschritt humpelnd den Flur, erreichte den obersten Treppenabsatz und kämpfte mich die Stufen der Wendeltreppe hinab, die aus hellem Alabaster gefertigt waren. Treppenstufen fielen mir von Jahr zu Jahr - oder vielmehr von Tag zu Tag - schwerer. Sie stellten für normale Menschen kein Hindernis dar. Niemand sonst dachte über Treppenstufen nach. Ich tat es.
Dann stand ich in der Empfangshalle meines Hauses. Empfangshalle war eigentlich das falsche Wort, denn empfangen wurde hier niemals irgendwer. Ich veranstaltete keine Dinnerpartys, keine Mottoabende und keinen Lesezirkel.
Sprache war etwas sehr Ungenaues. Diese Erkenntnis habe ich schon früh in meinem Leben gewonnen. Sie war erschreckend inadäquat, um die wirklich wichtigen Dinge zu beschreiben. Die Menschen rühmten sich stets mit ihrem hohen Grad der Zivilisiertheit und des hohen Grades technischer Entwicklung. Dabei war diese selbsternannte „Krone der Schöpfung“ in all den Jahrtausenden noch nicht einmal in der Lage gewesen, eine angemessene Sprache zu entwickeln.
Ich seufzte. Man musste eben mit den Dingen auskommen, die einem zur Verfügung standen. So war das Leben. Die Empfangshalle jedenfalls war schlicht und spektakulär zugleich. Die gesamte Einrichtung des Hauses war in klarem Weiß gehalten. Die Halle des Foyers war ungefähr acht Meter hoch. Eine gläserne Kuppel erhob sich am oberen Ende und tauchte die Halle in ein helles Licht. Die Akustik der Halle war bemerkenswert. Hätte ich Wert auf soziale Kontakte gelegt, hätte man in dieser Halle ohne weiteres klassische Konzerte aufführen können.
Da ich diese Möglichkeiten jedoch niemals nutzte, war sie vollkommen wertlos. Sie hatte keinen Bestand und irgendwann würde diese Halle und mit ihr das gesamte Haus verfallen und schließlich ganz verschwinden. So wie es mit allen Dingen geschah. Dieser Gedanke erschreckte mich immer wieder. Die Endlichkeit eines jeden Seins war die Triebfeder meines Handelns. Ihr musste ein Ende gemacht werden. Zumindest ein ganz bestimmtes Leben durfte nicht zu Ende sein. Diesem Ziel galt meine ganze Energie. Dem EwigSein.
Die warmen Strahlen der Sonne, die durch die Kuppel fielen, verrieten mir, wie spät ich tatsächlich dran war. Roberto und Truman warteten sicher bereits ungeduldig. Besonders Truman ließ es mich spüren, wenn ich zu spät kam. Er war dann den ganzen Tag unleidlich. Je nachdem wie verärgert er war, wurde auch das Weckritual am nächsten Morgen gestaltet. Gewiss reinigte er bereits seine Trompete. Auf deren grelle, schräge Töne konnte ich jedoch gut verzichten.
Rasch setzte ich mich in Bewegung und eilte in die Küche. In fremden Augen wäre diese sicherlich ebenso spektakulär gewesen wie die Empfangshalle. Viele Sterneköche hätten mich um diese Küche beneidet. Für mich war die Küche lediglich eine logische Konsequenz. In ein solches Haus konnte man keinen Holzofen einbauen und auch keinen Reisekühlschrank.
Alles musste seine Ordnung haben. Störte man diese natürliche Ordnung, würde das universelles System einen dies früher oder später spüren lassen. Im System lagen die Lösung und gleichzeitig das Problem.
Das System legte fest, wie schnell ein Wesen alterte. Gleichzeitig lag in der Änderung dieses Systems und der Abwandlung seiner Parameter das Potential, einen solchen Alterungsprozess zu stoppen. Es war logisch und paradox zugleich. Systemtheorie und Chaostheorie waren auf irritierende Art und Weise miteinander verbunden. Sie waren wie zwei Brüder, die sich nicht leiden konnten und doch wussten, wie eng sie durch ihre geschwisterlichen Bande für immer miteinander verbunden sein würden. Würde sich nur einer durchsetzen, würde die Welt in sich zusammenbrechen.
Kain und Abel – der Tod des einen würde den Untergang des anderen bedingen. So war es in den meisten Leitbüchern der Weltreligionen zu finden und es lag viel Wahrheit in diesen mythischen, ganz sicher überzeichneten, jedoch dadurch nicht weniger wahren Erzählungen.
Ich trat mühsam an den Kühlschrank, öffnete ihn und entnahm, ohne genau hinsehen zu müssen, eine Flasche. Darin befand sich eine grünlich schimmernde Flüssigkeit. Die Flasche enthielt alles, was man zum Leben benötigte. Vitamine, Eiweiß, Spurenelemente und bestimmte Enzyme, die meine Leistungsfähigkeit steigern sollten.
Dieses Getränk gab es in keinem Laden dieser Welt zu kaufen. Die Flüssigkeit wurde eigens für mich von einem Labor in der Ukraine produziert. Verschiedene Geschmacksrichtungen sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Diesen Luxus gönnte ich mir, auch wenn er genau genommen nicht nötig war. Wirklich identifizieren ließ sich die Geschmacksrichtung allerdings nicht. Einmal im Monat erhielt ich eine Lieferung, die mich voll und ganz versorgte.
Roberto und Truman tranken nie eine dieser Flaschen. Überhaupt sah ich die beiden niemals etwas zu sich nehmen.
So wie ich waren Roberto und Truman besondere Wesen. Deshalb machte ich mir darüber keine Gedanken. Die beiden konnten auf sich selbst achten und wussten, was gut für sie war. Ich mischte mich nicht ein. Wir waren Gefährten und uns unserer Andersartigkeit bewusst. So war es schon immer gewesen und so würde es immer sein.
Ich schloss den Kühlschrank, öffnete die Flasche, trank deren Inhalt in einem Zug und stellte die Flasche danach arglos auf den Küchentisch, der aus einer massiven Marmorplatte bestand. Ich wusste, dass die Flasche später nicht mehr da sein würde. Jasmin würde sich darum kümmern.
Dann machte ich auf dem Absatz kehrt, verließ die Küche und kehrte in die Halle zurück. Dort nahm ich die Treppe, diesmal jedoch jene Stufen, die nach unten führten.
Es waren genau vierzig. Auch zu dieser Zahl finden sich überall auf dieser Welt - sowohl in der Wissenschaft als auch in der Metaphysik – Bezüge.
Vierzig steht für einen Zeitraum, der Wende und Neubeginn ermöglicht: Vierzig Tage lang verschwinden - astronomisch gesehen - die Plejaden, ein mit bloßem Auge gut erkennbarer Sternhaufen im Zeichen des Stiers, hinter der Sonne.
Vierzig wird zur Zahl der Flucht, aber auch zur Zahl der Erwartung und der Vorbereitung. Vierzig Tage dauerte die Sintflut. Vierzig Tage war Moses auf dem Berg Sinai, um die Gesetzestafeln von Gott in Empfang zu nehmen. Vierzig Jahre dauerte die Wüstenwanderung des Volkes Israel von Ägypten ins gelobte Land. Vierzig Tage fastete Jesus, bevor er mit seinem öffentlichen Reden und Wirken begann. Vierzig Tage liegen zwischen Ostern und der Himmelfahrt des angeblich göttlichen Wesens mit dem Namen Jesus Christus.
In der ägyptischen Mythologie spielt die Vierzig ebenfalls eine Rolle. Dort plante man nach diesem astrologischen Vierzigerschema das Erntekalendarium. Das gleiche tat man im antiken Griechenland. In Ägypten deutete man diese Zeit als „Vierzig Tage des Todes“ und des Fernbleibens von Osiris. Während dieser Zeit war striktes Fasten vorgeschrieben.
In Mesopotamien trug die Gottheit Enki ebenfalls jene Symbolzahl. Enki war der Gott des Wassers und der Flut.
Es mag Zufall sein, doch diese Zahl trat auch später geschichtlich immer wieder auf. So bestand die Deutsche Demokratische Republik vierzig Jahre und die Schwangerschaft des Menschen beträgt in der Regel ebenfalls vierzig Wochen.
Die Vierzig stand für Neuanfang, Wandel und Zerstörung. Sie stand für Leben, Entstehung und Geburt. Sie war in sich zerrissen und zeigte das fragile Gleichgewicht dieser Welt. Leben und Tod, Geburt und Untergang, System und Chaos.
Ich hatte niemals geplant, vierzig Stufen von der Empfangshalle bis zum Untergeschoss einzurichten. Auch hier spielte der Zufall eine Rolle. Ich interpretiere diesen Zufall als das Chaos. Das, was am Ende dieser Stufen wartete, war hingegen das System. Das System, in dem ich die Variablen manipulierte. Das war meine Aufgabe, meine Berufung und Bestimmung. Vielleicht war es auch mein Untergang, aber das wäre nur logisch und fair.
Ich erreichte den unteren Treppenabsatz und war völlig außer Atem. Zu viele Stufen. Und doch war ich zu stolz, mir einen Aufzug einzubauen. Der Tag, an dem ich keine Treppen mehr bewältigen konnte, würde der Tag meines endgültigen Untergangs sein. Dieser Tag würde zudem das Scheitern all meiner Ziele bedeuten. So weit durfte und würde ich es nicht kommen lassen.
Hier unten war es dunkel. Ich machte mir nicht die Mühe, das Licht einzuschalten. Seit Jahren ging ich jeden Tag diesen Weg. Ich wusste ganz genau, was ich tat und wohin ich gehen musste. Von einem Haken griff ich nach einem weißen Laborkittel. Ich warf ihn mir über und schritt auf eine der sieben Türen zu, die sich hier unten befanden.
Labor Nummer Eins. Ich öffnete die Tür. Strahlendes Licht empfing mich. Kaltes, klares, unbarmherziges Licht. Wehklagen und Schmerzensschreie erwarteten mich. Eine Frau lag nackt auf einer Untersuchungsliege. Ihre Hand- und Fußgelenke waren daran gefesselt. Ihr Gesicht war panikverzerrt.
Links von der Liege stand Roberto. In seinem Gesicht erkannte ich Milde und Mitleid. Roberto strich der Frau die langen blonden Haare aus dem Gesicht oder zumindest versuchte er es. So richtig wurde er ihnen nicht Herr. Er flüsterte leise, tröstende Worte, die die Frau offensichtlich nicht verstand und auf die sie in keiner Weise reagierte.
Rechts der Liege stand Truman. Sein Blick war eisig und klar. Vielleicht war er sich der Grausamkeit bewusst, doch er wusste auch um die Notwendigkeit derselben.
Als ich den Raum betrat, blickten mich meine Gefährten an.
„Lasst uns beginnen“, sagte ich und trat zu ihnen.
Damals
Fluffy lag ganz ruhig in meiner Hand. Der sonst so muntere Fellball war in meiner Obhut groß geworden und so vertraute er mir.
Sein Vertrauen war gerechtfertigt, fand ich. Immerhin wollte ich ihm nichts Böses. Der Zahn der Zeit hatte einfach etwas an Fluffy genagt. Sein früher so flauschiges Fell war stumpf geworden.
Es glänzte nicht mehr in den verschiedenen Brauntönen, die sich mit weißen Farbtupfern abwechselten, sondern war heute nur noch matt. Fluffy wirkte schmutzig, verbraucht und alt.
Meine Mutter erlaubte mir nicht allzu viel Fernsehkonsum, gelegentlich schaltete sie mir jedoch das Telekolleg ein. Meistens geschah dies, wenn sie Männerbesuch hatte. Meine Mutter nannte diese Männer „Onkels“, auch wenn ich bereits früh erkannte, wie unwahrscheinlich eine Verwandtschaft mit eben jenen Männern war.
Auch wenn ich noch klein war und von Genetik noch nichts verstand, konnte ich mir nicht vorstellen, Rothaarige, Asiaten oder Dunkelhäutige in meiner Verwandtschaft zu haben. Das kam mir ganz einfach komisch vor. Dennoch stellte ich keine Fragen. Meine Mutter mochte dies nicht und ich respektierte es.
Tat ich es doch brannte in ihren Augen jedes Mal ein Feuer aus Scham und Zorn, der sich mit der tiefen Traurigkeit einer kalten Septembernacht abwechselte, die genau wusste, dass der Sommer nun zu Ende war.
Jedenfalls setzte mich meine Mutter vor den Fernseher, schaltete das Telekolleg ein und drehte die Lautstärke weiter auf, als es für das menschliche Gehör gut sein konnte. Nicht selten nahm ich zwei unserer abgewetzten Sofakissen und presste mir diese an die Ohren. Erst durch diesen Filter erreichte die Lautstärke der Sendung ein akzeptables Niveau. Tat ich dies nicht, klingelten meine Ohren noch mehrere Stunden später.
Im Gegensatz zu anderen Kindern in meinem Alter fand ich die Sendungen beim Telekolleg spannend. Zumindest nehme ich an, dass andere Kinder damit nichts anfangen konnten. Ich hatte niemals Kontakt mit ihnen und kannte Gleichaltrige quasi nur vom Hörensagen. Die einzigen beiden Freunde, die ich hatte, waren Truman und Roberto, die meistens mit vor dem Fernseher saßen.
Irgendwie war es schon komisch: Meine Mutter sprach stets nur mich an und schien meine Freunde zu ignorieren. Dabei war ihre Stimme jederzeit voller Güte. Manchmal wirkte sie arg mitgenommen, meist dann, wenn ein ganz spezieller Onkel, Onkel Carlos, zu Besuch gewesen war. Ihre Augen waren dann geschwollen und rot. Manchmal erkannte ich getrocknete Tränen auf ihren Wangen.
Wenn ich sie fragte, was geschehen war, lächelte sie mich nur an. „Nichts. Alles ist gut!“ Danach umarmte sie mich, drückte mich fest an sich und ihr Zittern ging dabei nicht selten auf mich über.
Roberto und Truman wurden niemals von meiner Mutter umarmt. Sie redete nicht mit ihnen und sie streichelte sie nicht. Für meine Mutter waren die beiden nur Luft, sie existierten nicht.
Roberto hatte deswegen häufig eine Träne im Augenwinkel. Meist dann, wenn mich meine Mutter wieder einmal in ihre Arme nahm und er nicht in denselben Genuss jener Zärtlichkeit kam. Roberto sehnte sich offensichtlich ebenfalls nach körperlicher Nähe.
Truman hingegen schien die Missachtung meiner Mutter rein gar nichts auszumachen. Sein kalter Blick musterte sie oft abschätzig und es schien schwer vorstellbar, dass Truman eine solche Behandlung seitens meiner Mutter oder irgendeines anderen Menschen hätte gefallen können.
Jedenfalls saß ich eines Tages auf dem Boden vor unserem Fernseher. Ich saß gerne auf dem Boden. So lange ich auf dem Boden saß, tat mir mein Bein nicht weh. In meinen Händen hielt ich die Kissen, die ich mir an die Ohren drückte, da die Lautstärke wieder einmal ihr Maximum erreicht hatte und meine Mutter, wie üblich, die Fernbedienung mitgenommen hatte. Roberto saß links von mir, Truman an meiner rechten Seite. Keiner von beiden hielt sich die Ohren zu, wohl auch deshalb, weil wir nur zwei Sofakissen besaßen und ich diese in Beschlag genommen hatte.
Fluffy schlief auf meinem Schoss und das trotz des Lärms. Im Alter brauchte der Körper nun einmal mehr Schlaf. Im Telekolleg wurde eine Sendung gezeigt, die sich mit Waschmittel beschäftigte. Mir fielen die erstaunlichen Resultate auf, die die Marke, die auch meine Mutter verwendete, hervorbrachte. Alte Wäsche erstrahlte in neuem Glanz. Wirklich erstaunlich. War das Waschmittel so etwas wie ein Jungbrunnen? Konnte man damit alte Sachen neu machen und Schäden beheben? Offensichtlich war dem so. Die Werbung würde mich doch ganz gewiss nicht anlügen.
Truman war wohl zu derselben Erkenntnis gekommen, denn er stieß mich hart mit seiner Faust an, was ich noch Tage später spürte, und anhand des großen blauen Flecks an meinem Oberarm sehen konnte. „Was ist?“, rief ich, um den infernalischen Lärm des Fernsehers zu übertönen.
Truman deutete mit einem Finger auf Fluffy, der noch immer auf meinem Schoß schlief. Er wirkte in diesem Moment ganz besonders alt und verbraucht. Ich blickte wieder zu Truman, der mich mit seinem ganz speziellen Grinsen anblickte, das eine Idee ankündigte.
Truman musste jedoch nichts sagen, denn war ich zu derselben Erkenntnis gelangt. Auf meiner linken Seite spürte ich ein leichtes Tippen. Roberto. Er schlug mich niemals mit der Faust.
Ich sah ihn fragend an, diesmal ohne etwas zu brüllen. Ich wusste, der Fernseher würde meine kindliche Stimme ohnehin übertönen.
Roberto wies mit einem Nicken zum Fernseher, auf dem noch immer von dem Testsieger geschwärmt wurde. Dann hob er die Hand und streckte den Daumen nach oben.
Truman und Roberto erhoben sich beinahe simultan. Ich tat es ihnen gleich, wenn auch wesentlich langsamer, alles andere war mir nicht möglich, mein Bein verhinderte dies. Dabei hielt ich Fluffy sanft in meinen Händen, darum bemüht, ihn nicht zu wecken.
Meine Mutter bekam von alledem nichts mit. Sie war in ihrem Schlafzimmer mit Onkel Carlos verschwunden. Zu dritt gingen wir zur Treppe, die in den Keller führte. Mit jedem Schritt, nahm der Druck auf meine Ohren ab. Eine wahre Wohltat!
Wir stiegen barfuß die kalte Treppe hinab, der scharfkantige Betonboden stach mir dabei in die Sohlen. Davon ließ ich mich jedoch nicht von unserem Vorhaben abbringen. Es tat sogar gut. Der Schmerz an meinen Sohlen lenkte mich von den anderen Schmerzen ab, die mich seit meiner frühesten Kindheit an begleiteten.
Ich schaltete das Licht im Keller ein und trat an unsere Waschmaschine heran. Noch nie hatte ich dieses Gerät benutzt und wusste auch nicht wirklich, wie sie funktionierte. Zumindest hatte ich es nicht gewusst. Die Werbesendung hatte die Bedienweise jedoch eindeutig demonstriert.
Ich drückte den Knopf auf dem „Öffnen“ stand, sogleich schwang die runde Luke auf. Ich besah meine Hände, in denen der stumpfe Fluffy lag und die Augen geöffnet hatte, jedoch keinerlei Anstalten machte, sich meinem Griff zu entwinden.
„Bald bist du wieder wie neu!“, versprach ich Fluffy leise. In der Zwischenzeit hatte Roberto ein dreckiges T-Shirt, das wohl vor langer Zeit einmal weiß gewesen war, in die Trommel gelegt. Er nickte mir zu und ich verstand: Fluffy sollte es angenehm haben. Das T-Shirt würde ihn wärmen und weich polstern. Es war eine gute Idee.
Ich gab Fluffy einen Kuss, sein einstmals so weiches Fell, war scharf und struppig. Es stach mir in die kindliche Haut rund um meinen Mund. „Du hast wirklich eine Erneuerung verdient“, murmelte ich und setzte Fluffy auf das T-Shirt in der Trommel.
Fluffy sah mich verständnislos an, aber er vertraute mir und so machte er keine Anstalten zu fliehen. Stattdessen rollte er sich zu einer Kugel zusammen und schlief weiter.
„Mach´s gut“, sagte ich und schloss leise und vorsichtig die Trommel. Ich wollte Fluffy nicht wecken. Von oben war noch immer der Lärm des Fernsehers zu hören. Mir schien, als würde ich weitere Geräusche vernehmen. Ein gleichmäßiges Klopfen, als würde jemand mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen.
Ich zuckte mit den Schultern und wand mich wieder der Waschmaschine zu. Truman hatte bereits die Einspülkammer für das Waschmittel herausgezogen und hielt die Flasche mit dem Testsieger-Waschmittel in der Hand. Er grinste von einem Ohr zum anderen, sah dabei jedoch nicht wirklich fröhlich aus. Nur voller kalter Vorfreude.
Ich nahm die Flasche entgegen und füllte einen ordentlichen Schluck in die Kammer. Ich überlegte einen Moment, sah zu Roberto und, als dieser mir bestärkend zuwinkte, schüttete ich noch mehr von dem Waschmittel hinterher. Viel hilft viel. Am Ende war der gesamte Inhalt der Waschmittel-Flasche in der Kammer, die nun überzulaufen drohte. Die leere Flasche warf ich arglos hinter mich und schloss die Kammer.





























