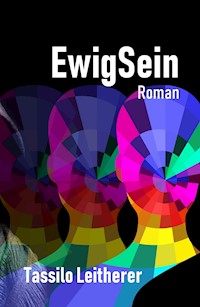2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gefühle machen das Leben aus. Sie bestimmen, was oder vielmehr wer wir sind. Doch was wäre, wenn wir unfähig wären, die kleinsten Emotionen zu empfinden? Was, wenn wir weder Liebe noch Trauer, Freude oder Schrecken, Geborgenheit oder Sehnsucht, Hass oder Zuneigung spüren könnten? In genau dieser Situation befindet sich der Protagonist in dem Roman "MenschSein". Gefühle sind ihm nicht nur fremd, er sieht sich sogar vollkommen außer Stande, die kleinsten Emotionen zu erleben oder sie zu verstehen. Bereits seit seiner Geburt fehlen ihm sämtliche Gefühle. Er passt sich an, um nicht aufzufallen. Er weiß, dass niemand ihn verstehen würde, ihn, ein Wesen, ausschließlich beherrscht von der kalten Logik. Die Welt geht nicht besonders wohlwollend mit Andersartigkeit um. Gleichzeitig spürt der Protagonist eine Leere in sich, ihm fehlt der Sinn im Leben. Glück, so glaubt er, ist das Ziel; ohne Gefühle jedoch lässt sich Glück nicht erreichen. Aus diesem Grund unternimmt er alles, um seine Gefühle zu finden und sie zu entwickeln, und beschreitet dabei extreme Wege. Gelingt es ihm am Ende, das MenschSein zu erreichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tassilo Leitherer
MenschSein
Roman
© 2018 Tassilo Leitherer
Druck: Tredition
ISBN (Paperback): 978-3-7469-5990-0
ISBN (Hardcover): 978-3-7469-4990-1
ISBN (e-Book): 978-3-7469-4991-8
Umschlaggestaltung: Leitherer – Kommunikation
Bilder: © pixabay.com
www.tassilo-leitherer.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Über den Autor
Tassilo Leitherer wurde 1985 in Aschaffenburg geboren und lebt heute in München. Er ist als freier Redner, Mediator, Konfliktmanager und Kommunikationsberater selbstständig.
2009 erschien seine erste Erzählung („Die Sehnsucht nach der richtigen Welt“). Im Juni 2010 folgte sein erster Gedichtband („Träume wie die Wirklichkeit“), und im Oktober 2011 sein erster Roman („Die sieben Stufen des Wahnsinns“).
Der Erlös seines 2012 erschienenen Gedichtbandes „Die Phantasie der Wirklichkeit“ kommt Straßenkindern in Bolivien zu Gute.
In den Gedichtbänden „Spiegelbild der Wirklichkeit“ (2015) und „Erinnerung der Wirklichkeit“ (2018) beschäftigt sich der Autor mit dem Alltag, mit Tod und Hoffnung und der Bewältigung von Trauer.
In „Die Schönheit dieser Wirklichkeit“ (2018) erzählt Leitherer Episoden aus dem Alltag, Fabeln und Geschichten, die sich mit den schönen Augenblicken dieses Lebens beschäftigen.
Du bist Mensch und darfst es sein.
Prolog
Ich stand auf dem Gehsteig und blickte auf die Straße. Ein kleines Mädchen fuhr dort mit ihrem Fahrrad entlang. Es war ein Sonntag, weswegen kaum Autos fuhren. Die gepflegten Vorgärten in dem gepflegten Vorort, in der ich mich gerade befand, quollen jedoch von passionierten Hobbygärtnern geradezu über.
In letzter Zeit – so schien es mir – wucherten diese Siedlungen immer schneller. Es galt als Statussymbol, einen möglichst gepflegten Garten und einen sauber gestrichenen Gartenzaun zu besitzen, dessen Farbe am besten auch noch mit dem des Hauses harmonierte.
Mir bedeutete all dies überhaupt nichts. Weder der Status, der hinter diesen Dingen steckte, noch die angebliche Ästhetik, die ich in keiner dieser Siedlungen erkennen konnte.
Alle waren so damit beschäftigt, sich um ihre Gärten zu kümmern, dass niemand auf das kleine Mädchen achtete. Beinahe konnte man den Eindruck gewinnen, die Frauen und Männer hatten einen größeren Teil ihrer Herzen für ihre Buchsbäumchen reserviert als für die eigenen Kinder.
Da ich weder von Rasen noch möglichst rundgeschnittenen Buchsbäumchen abgelenkt war, hörte ich das Dröhnen des Motors schon von weitem. Die passionierten Hobbygärtner nahmen diese Art Lärm nicht wahr, ebenso wenig wie das Mädchen selbst. Die überdimensionalen Kopfhörer – in der Trendfarbe Pink - die das Mädchen auf dem Kopf trug, sowie die extrem laute Musik, deren quietschende Stimmen nicht einmal der Motorenlärm gänzlich zu übertönen vermochte, verhinderten jedwede Außenwahrnehmung.
So war das scheinbar heutzutage. Je greller und piepsiger die Musik, desto größer der Erfolg. Keine Ahnung, woran das lag. Es interessierte mich auch nicht.
Neben den pinken Kopfhörern war auch alles andere an dem Mädchen pink. Die pinken Rüschensöckchen, die aus den pinken Lacksandalen herausragten und an den pummeligen Kinderwaden des Mädchens wie eine Tortenverzierung aussahen, das pinke Kleidchen, das auch aus einem Puppenhaus gestohlen worden sein könnte, und natürlich der pinke Lippenstift, der dicker aufgetragen war als bei den Damen, die in zwielichtigen Bahnhofsvierteln auf Kundenfang gingen.
Das Dröhnen wurde lauter. Das Mädchen fuhr Schlangenlinien auf der gepflegten Vorortstraße, deren Gehwege jeden Samstag von den Hobbygärtnern akribisch gereinigt wurden. Ich konnte mir vorstellen, dass es die Anwohnerschaft entsetzte zu sehen, wie schlimm ihre geliebte Straße an jenem Tag - nur einen Tag nach dem Straßenkehrtag - verschmutzt wurde.
Jetzt war das Dröhnen ganz nah. Ich sah das Auto. Es war ironischerweise ebenfalls pink. Eines jener Muscle-Cars, die viele in besonders grellen Farben kauften, weil sie glaubten, damit noch mehr aufzufallen. Auch dies musste scheinbar so sein. Der Fahrer des Wagens war bis zu diesem Tag sicher glücklich mit seinem Gefährt und den neidischen Blicken der Menschen, die ihm sehnsuchtsvoll nachsahen. Jeder wollte doch schon als Kind einmal in einem echten Barbie-Mobil unterwegs sein.
Dem Mädchen fiel das Auto allerdings trotz aller Auffälligkeiten nicht auf. Das „LaLaLa“ aus ihren Kopfhören war stärker als das donnergleiche Dröhnen des V8-Motors. Auf einmal geriet der Wagen ins Schleudern. Vielleicht hatte der Fahrer das Mädchen auf ihrem signalpinken Fahrrad gesehen und versuchte erfolglos auszuweichen, vielleicht war er jedoch auch ganz einfach betrunken.
Das Fahrzeug schleuderte immer stärker. Nichts konnte es bremsen. Nicht einmal das Mädchen auf dem Fahrrad, dessen pinke Erscheinung für einen Moment mit dem pinken Lack des Muscle-Cars verschmolz, bevor es in die Luft geschleudert wurde. Während das Mädchen dahinsegelte, stabilisierte sich das Auto. Der Fahrer gab noch einmal Gas und verschwand.
Auf einmal ruhten alle Blicke auf dem Mädchen. Stille. Es war einer jener Momente, in denen man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Natürlich nur, wenn da nicht das Dröhnen des V8 Motors gewesen wäre, der volle Leistung bringen musste, um die Fluchtchancen des Fahrers zu erhöhen.
Das Fahrrad landete zuerst. Im Gartenteich eines betagten Herren mit einem löchrigen Strohhut und einem nicht gerade der neuesten Mode entsprechenden Karo-Hemd, das so gar nicht mit seinem sanft-beige gestrichenen Haus harmonieren wollte. Das Mädchen landete in einem jener Vorgartenteiche, in denen teure Karpfen den ganzen Tag nichts anderes taten, als im Kreis zu schwimmen. Heute wurde ihre Routine empfindlich gestört. Ertrinken jedenfalls musste das Mädchen nicht. Dafür war es schon zu spät.
Entsetzte Schreie hallten durch die Straßen. Weinende Frauen wurden von ihren blassen Ehemännern gestützt. Einige wenige – die tapferen – eilten zu dem Teich, nur um dort festzustellen, dass sie nichts mehr für das Mädchen tun konnten. Die Emotionen kochten über. Eine ganze Heerschaar an Psychologen musste in den darauffolgenden Wochen die Anwohner behandeln. Die meisten sollten für immer Alpträume behalten. Angeblich hat sich eines der Paare sogar kurz nach diesem Unfall umgebracht. Sie konnten mit dem Gesehenen einfach nicht fertig werden. Zu groß war der Kontrast zu ihren gepflegten Vorortrasen.
Mich ließ all das kalt. Mein Puls beschleunigte sich nicht. Ich verspürte weder Trauer noch Entsetzten. Schrecken und Verzweiflung gelang es ebenfalls nicht, mein Herz zu berühren. Ja nicht einmal das Mitleid, so etwas Schlimmes mitangesehen haben zu müssen, hatte eine Chance. Ich stand einfach da, als ob nichts geschehen wäre. Dies ist wohl einer der Momente, in denen ich etwas fühlen müsste, dachte ich mir, doch war ich nicht in der Lage, irgendetwas zu fühlen. Außer dem physischen Schmerz, der sich einen Augenblick später in meinem Kopf ausbreitete. Der pinke Kopfhörer hatte mich an der Stirn getroffen.
Das bin ich
„Hallo! Ich bin Pascal. Ich bin 39 Jahre und ledig. Und ich habe keine Gefühle.“
So hätte meine Vorstellung ausgesehen, wenn ich einer Selbsthilfegruppe beigetreten wäre. Und natürlich, wenn ich Pascal heißen würde. So heiße ich natürlich nicht. Ich brauchte nur einen Namen, um diese Floskel anschaulicher zu gestalten. Ein ganzes Leben beschränkt auf diese wenigen Informationen. Zugegeben, mehr gibt es auch nicht zu berichten. Erlebnisse machen immerhin nur dann Sinn, wenn man sie genießen kann.
Wenn nicht, sind sie einfach nur überflüssiger Ballast, der den Speicher belegt. In meinem Fall war alles, mein gesamtes Leben, nur Ballast. Jeder Sinneseindruck, jede Erfahrung, jeder einzelne Tag meiner Existenz. Wertloser Müll, von dem ich mich nicht trennen konnte, der mir aber auch nichts brachte. Jemand hätte einen grünen Punkt an meinem Kopf anbringen sollen, damit der ganze Mist endlich recycelt werden konnte. Niemand tat es.
Für den Fall, dass ihnen das jetzt alles zu schnell ging, noch einmal zum Mitlesen. Ich heiße nicht Pascal, ich bin keine 39 Jahre alt und ich habe keine Gefühle. Viele von ihnen werden jetzt sagen, dass sie solche Menschen kennen. Jeder hat einen Menschen in der Nachbarschaft, von dem er genau das behauptet. Jeder hatte einmal einen Freund oder eine Freundin, die er nach Beendigung der Beziehung als gefühlslos beschrieb. Jeder nannte schon einmal seinen besten Freund kaltherzig, wenn dieser nicht ebenfalls in Tränen ausbrach, wenn das geliebte Löwenkopfkaninchen in der prallen Hochsommersonne einen Hitzeschlag erlitten hatte.
In meinem Fall ist das alles anders. Ich habe tatsächlich keine Gefühle. Ich lebe, ohne zu wissen, was Liebe, Glück, Zuversicht, Hoffnung, Freude, Zufriedenheit, Hass, Neid, Verzweiflung, Furcht und die zahllosen anderen Gefühle, die jeder von ihnen kennen dürfte, sind. Für mich sind all diese Dinge nur leere Worthülsen. Ich bin in der Lage, deren Bedeutung zu verstehen, kann sie jedoch nicht nachvollziehen. Nicht weil ich nicht will, sondern weil ich es einfach nicht kann.
Mein Puls schlägt nicht schneller, wenn ich eine schöne Frau erblicke. Auch dann nicht, wenn ich einen fürchterlichen Horrorfilm sehe, in denen der Protagonist gerade von einem bösen Clown enthauptet wird. Auch dann nicht, wenn ich in ein Flugzeug steige. Ich kenne weder Höhenangst, noch die Liebe zur Freiheit, die manch einer über den Wolken verspürt.
In mir herrscht nichts als emotionale Leere. Manch einer würde es als Kälte bezeichnen, doch ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Begriff ist. Ich zitterte niemals vor einer schweren Prüfung. Ich stotterte nicht vor meinem ersten Bewerbungsgespräch und musste auch keine Slipeinlagen unter die Achseln kleben, als ich mein Diplom überreicht bekam. Ich lebe, ohne zu wissen, warum ich das tue.
Welchen Sinn macht ein Leben ohne Gefühle? Macht ein Leben mit Gefühlen Sinn? Ich kann es nicht beurteilen. Normalerweise müsste ich jetzt so etwas wie Ich bedauere, dass ich keine Gefühle habe sagen. Die Wahrheit ist allerdings, dass ich nicht in der Lage bin, diese Tatsache oder überhaupt irgendetwas zu bedauern.
Ich bin einfach nur neugierig. Nun könnte man sagen, Neugierde sei auch ein Gefühl. Ich sehe das anders. Gefühle sind all diejenigen Dinge, die das Herz dazu bringen, schneller zu schlagen. Bei meiner Neugierde ist dies nicht der Fall. Ich will einfach einmal wissen, wie es ist, wie alle anderen zu sein. Vielleicht wäre es mir dann möglich, einen Sinn im Leben zu finden. Schade, dass die Kybernetik noch nichts so weit vorangeschritten ist wie in vielen Science-Fiction-Filmen. Vielleicht hätte ich mich sonst einmal mit R2-D2, Wally oder irgendeinem anderen berühmten Film-Roboter darüber unterhalten können, wie es ihnen geht. Sie hätten mich ganz sicher verstanden.
Letztlich bin auch ich nichts anderes als ein Roboter. Eine Maschine, die aus organischem Material besteht. Aus Zellen, die keinen wirklichen Zweck erfüllen. Ich bin ein Organismus, der mechanisch funktioniert, der aber keinen Sinn erfüllen kann, weil die Software fehlerhaft ist.
Für sie klingt all das hart? Ist es so? Ich kann es nicht beurteilen. Auch dafür müsste ich in der Lage sein, etwas zu fühlen. Im Gegensatz zu Gefühlen, die ich nicht wahrnehmen kann, kann ich sehr wohl Schmerzen fühlen. Das klingt jetzt etwas sonderbar, aber das liegt wohl an unserer Sprache, in der „Fühlen“ und „Gefühle“ sehr leicht miteinander verwechselt wird.
Wissen sie, was das komischste ist, wenn man nicht in der Lage ist, etwas zu empfinden, aber Schmerz fühlen kann? Ich verrate es ihnen: Man fürchtet sich nicht vor Schmerzen. Natürlich weiß ich, dass ich echte Schmerzen unbedingt vermeiden sollte, mein Puls beschleunigt sich bei dem Gedanken daran jedoch nicht. Nicht einmal die Androhung von Schlägen oder sogar Folter vermag es, mich zu erschrecken. Ich bin klug genug, nicht ins offene Messer zu laufen – im wahrsten Sinne des Wortes – oder auf eine heiße Herdplatte zu langen, doch vermeide ich dies nur, weil es nicht logisch wäre, mich selbst zu verletzen. Die Ressourcen, die zur Reparatur notwendig wären, wären vergeudet.
Eigentlich wäre ich der ideale Geheimagent. Aus mir würde niemand irgendetwas herausbekommen. Als Geheimnisträger wäre ich von unschätzbarem Wert. Ein Training, in dem ich lernen würde, wie man der schlimmsten Folter widersteht, wäre vollkommen unnötig. Das einzige Problem ist, dass Agenten zumeist Patrioten sind. Ein Patriot wiederum ist jemand, der sein Land oder zumindest die Organisation, für die er arbeitet, oder wenn all das nicht, dann zumindest das Geld liebt. Ich denke, sie wissen, warum ich folglich ein schlechter Agent wäre. Vaterlandsliebe? Gier? Was ist das?
Nun könnte man meinen, mein Leben sei ziemlich einfach. Viele Menschen sind der Meinung, Gefühle würden das Leben erschweren. Emotionen stehen immer nur im Wege und verhindern, dass der Mensch sein wahres Glück findet. Ich kann ihnen hiermit – sozusagen als Insider – folgendes verraten: Das ist vollkommener Unsinn. Das Glück ohne Gefühle erreichen? Wie bitteschön soll das denn gehen? Glück basiert auf Gefühlen, es ist sogar der Idealtypus des vollkommenen Gefühls. Auch wenn schnell gesagt wird, Gefühle stünden einem im Weg, ist genau das Gegenteil der Fall. Gefühle öffnen Türen, die ansonsten verschlossen bleiben.
Das ist natürlich nur meine Sicht. Allerdings müssen sie mir zugestehen, dass ich eine ziemlich gute Quelle darstelle. Immerhin bin ich nicht in der Lage zu fühlen und habe mein Glück bislang nicht finden können. Schlimmer noch, ich habe nicht einmal den leisesten Hauch einer Ahnung, wo ich es suchen soll, oder worin mein Glück besteht. Mir stehen also nicht meine Gefühle im Weg, sondern meine Unfähigkeit zu eben diesen.
Es wird ihnen hoffentlich nicht zu kompliziert. Mir selbst geht es oft so, wenn ich darüber nachdenke. Die fehlenden Stücke des Puzzles, das sich mein Leben nennt, sind so verworren, dass es mir meistens unmöglich scheint, sie zusammenzuführen. Ich bin ein lebendes Paradoxon, dessen Lösung unmöglich scheint. Selbstverständlich empfinde ich keine Verzweiflung, wenn ich diesen Punkt einmal wieder erreicht habe. Ich wünschte, ich würde so etwas wie Verzweiflung empfinden, dann wäre ich zumindest schon einmal einen Schritt weiter. Fehlanzeige.
Hinzu kommt, dass ich ununterbrochen an diesen Punkt gelange. Wieder und wieder stoße ich gegen die Wand in der gedanklichen Sackgasse. Jedes Mal fängt mein Kopf an zu schmerzen, meine Schläfen pochen und ich erleide körperliche (seelisch geht ja nicht) Qualen. Wäre ich so wie sie, würde mein Unterbewusstsein verhindern, dass ich ständig über mich und mein Dilemma nachdenke. Es würde wissen, dass ich immer wieder gegen die Wand laufe und dies ungeheuerliche Schmerzen zur Folge hat. Es würde sich selbst unterbewusst vor den Schmerzen schützen, aus Angst, diese zu erleiden.
Mein Unterbewusstsein vermag dies freilich nicht. Genauso wenig wie ich Gefühle wie Angst kenne, kennt sie mein Unterbewusstsein. Warum also sollte es mich schützen? Im Gegenteil, mein Unterbewusstsein ist immer sachlich. Deswegen schickt es mich ununterbrochen auf die gedankliche Reise. Logisch gesehen macht das Sinn. Durch das wiederholte Versuchen muss ich irgendwann die Lösung finden. Theoretisch.
Ich möchte sie nicht weiter langeweilen. Ich bin mir sicher, dass sie vielmehr daran interessiert sind, wo und wie ich meine Gefühle suchte und ob ich sie am Ende gefunden habe. Nur eines noch: Es mag Ihnen manchmal vielleicht so vorkommen, dass ich doch gelegentlich etwas empfinde. Manche Wörter mögen einen Hinweis darauf geben. Seien sie sich sicher, dem ist nicht so. Es ist ganz einfach schwierig, in einer Welt, die von Gefühlen beherrscht wird, aufzuwachen, ohne sich den ganz gebräuchlichen Wortschatz zu eigen zu machen. Aus Gewohnheit sagt man dann Dinge, weil es ganz einfach normal ist, sie zu sagen. Natürlich weiß man, wie dumm es ist, ein bestimmtes Wort zu gebrauchen, aber es ist einfacher, sich derselben Sprache wie alle anderen zu bedienen, als jedes Mal umständlich über eine Umschreibung nachzudenken.
Mein Geist funktioniert wie eine Maschine, daher bin ich stets darauf bedacht, möglichst effizient zu handeln. Wichtig ist nur, das Ziel zu erreichen. Kleine Ziele erreiche ich dabei mühelos und außerordentlich effizient. Das große Ziel jedoch, an dessen Ende das Glück im Leben steht, kann ich niemals erreichen.
Niemand gibt mir vor, worin dieses besteht. Ein Roboter bekommt von seinem Besitzer das Ziel vorgegeben, ein Mensch von seinem emotionalen Bewusstsein, doch was ist mit mir? Ich irre durch die Welt, durch mein Leben, ohne ein Ziel und ohne Hoffnung, denn ich bin nicht in der Lage, Hoffnung zu empfinden. Hätte ich einen Knopf zur Selbstzerstörung, so hätte ich ihn wohl schon betätigt, aber wer auch immer mich geschaffen hat, diese Funktion muss er wohl vergessen haben.
Eigentlich gibt es für mich nur einen Ausweg: Ich muss meine Gefühle finden. Doch wie es so ist im Leben – egal ob es das eines fühlenden Wesens oder eben eines Geschöpfes wie mir ist – steht vor dem Finden immer die Suche. Sie fragen sich sicher, wie ich darauf komme, das Auffinden der Gefühle könnten mein Lebensziel sein. Nun, auch hier bin ich mir in dieser Frage nicht sicher. Allerdings habe ich jede andere Möglichkeit ausgeschlossen. Einzig diese Option steht mir noch offen. Deswegen versuche ich es.
Der Knackpunkt an meiner Suche ist das Fehlen jeder Leidenschaft mit der ich meine Sucher führen muss. Jeder von ihnen weiß bestimmt, wie wichtig Neugierde und Leidenschaft sind, wenn man etwas zu erreichen versucht. Stellen sie sich einmal vor, sie besäßen nichts davon? Würde ihre Suche dann noch Sinn ergeben? Wären sie motiviert weiterzusuchen, oder würden sie aufgeben, sobald die kleinste Schwierigkeit im Wege steht? Es ist schwierig, sich durchzusetzen, wenn man keine Sehnsucht verspürt, etwas wirklich erreichen zu wollen.
Zu Recht werden sie jetzt fragen, wie ich dann überhaupt die Suche nach meinen Gefühlen durchziehen kann. Die Antwort darauf ist ziemlich banal: Ich habe nichts Besseres zu tun. Mein logischer Geist legt die Prioritäten fest und eben jene Suche steht auf dieser Liste ganz oben. Nach der Logik sollte ein Wesen immer nach Perfektion streben. Mein Dasein ist alles andere als perfekt. Folglich gibt es gar keine andere Möglichkeit für mich, als die Suche zu beginnen und zu Ende zu bringen, koste es, was es wolle, selbst, wenn das meinen Tod bedeuten sollte. Der Vorteil, den ich hier natürlich besitze, besteht in dem völligen Fehlen der Angst vor dem Tod.
Vielleicht sollte ich mich vor dem Tode fürchten. Vielleicht ist die Angst vor dem Tod der Schlüssel zu mir und meinen Gefühlen. Doch ich kann es nicht erzwingen. Meine Theorie lautet: Die Gefühle kommen von alleine, sobald ich einen gewissen Punkt überschritten habe. Manch einer mag das unter Umständen Hoffnung nennen, für mich ist es jedoch vielmehr eine weitere Theorie, die auf dem Ausschlussverfahren basiert. Wenn ich genauer darüber nachdenke, besteht mein gesamtes Leben aus Theorien. Woraus sollte es auch sonst bestehen? Erfahrungen, die ohne Gefühle ablaufen, sind nichts weiter als Theorien.
Zum Beispiel: Ich habe meinen Studienabschluss geschafft. Normalerweise müsste ich mich freuen. Also würde ich die Erfahrung der Freude machen. Zu so etwas bin ich nicht in der Lage. Meine Art damit umzugehen besteht darin, mir eine Theorie zusammenzustellen, wie die Erfahrung der Freude wohl aussehen würde. Anschließend versuche ich diese Theorie nach außen zu tragen und zu leben. Ich tue dies, um einen Schein zu wahren. Ich setze eine Maske auf und verfeinere diese immer weiter. Ich lebe eine Lüge.
Auf diese Weise unterziehe ich meine Theorien immer einem Reality-Check. Es wird sie überraschen zu hören, wie schnell die meisten meiner Theorien an der Realität scheitern. Keine meiner Theorien hat den Reality-Check vollkommen bestanden.
Wie genau diese Theorien aussehen? Nun, am besten ich erzähle ihnen ein bisschen davon. Hier ist mein Leben. Wenn sie im Gegensatz zu mir in der Lage dazu sein sollten, Spaß zu empfinden, dann wünsche ich ihnen nun eben diesen. Natürlich ohne zu wissen, ob eben dies angemessen ist.
Wann ist ein Mensch ein Mensch
Wann beginnt ein Mensch zu fühlen? Bereits im Mutterleib? Bei der Geburt? Wenn ein Baby in der Lage ist, seine ersten Worte zu sprechen? Vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem Leben überhaupt erst als Leben angesehen wird? Wann wäre das dann? Mit dem ersten Herzschlag? Mit der Vereinigung von Eizelle und Spermium?
In diesem einen Fall muss ich eindeutig gestehen, dass es einer der wenigen Aspekte in meinem Leben ist, der leicht zu klären ist. Ich habe niemals angefangen zu empfinden. Darf ich mich also überhaupt als Mensch bezeichnen? Mein Körper hat keine Endorphine ausgestoßen, als ich durch den Geburtskanal gepresst wurde. Wenn die Erzählungen meiner Eltern zutreffen, habe ich nicht einmal geweint, als ich auf die Welt kam. Erst mit der Durchtrennung der Nabelschnur begann ein Schreianfall. Dieser war jedoch wohl eher auf den Schmerz zurückzuführen, der damit verbunden war, als auf ein Gefühl der Trennungsangst.
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt mit der Geburt, ja sogar der allererste richtige Lebensabschnitt. Ich kann mich natürlich ebenso wenig wie jeder andere Mensch an diesen Augenblick erinnern. Was ich jedoch mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass mir das egal war. Zumindest, wenn ich damals bereits in der Lage gewesen sein sollte einzuordnen, was da um mich herum geschah. Was sollte mich meine Geburt auch schon groß kümmern? Angst vor dem, was mich außerhalb des wohlig warmen Mutterleibes erwartete? Wohl kaum. Melancholie, weil ich meine Heimat verloren hatte? Wohl kaum. Die Befürchtung, die Familie, in die ich hineingeboren wurde, ätzend zu finden? Wohl kaum.
Niemand sprach es offen aus, aber ich denke, meine Geburt sorgte für große Verwunderung. Bestimmt bezeichnete mich das Personal als Baby, das bei der Geburt nicht schrie. Allzu häufig dürfte so etwas bei einem ansonsten gesunden Kind sicher nicht vorkommen. Der anwesende Arzt, die Hebamme sowie die Krankenschwestern hatten an diesem Abend zu Hause bei ihren Familien etwas zu erzählen. Vielleicht rettete meine Emotionslosigkeit ja sogar die eine oder andere Beziehung. Endlich gab es einmal wieder etwas, über das man sich nach Jahren, Monaten, Wochen oder Tagen der Langeweile und des Schweigens unterhalten konnte. So etwas kann sicher dabei helfen, eine Trennung zu vermeiden.
Wenn ich wie sie wäre, würde ich mich ganz gewiss über diese gute Tat freuen. Das Problem ist: Ich bin nicht sie. Und so lässt auch dieser Gedanke mich vollkommen kalt. Was interessieren mich schon irgendwelche Ärzte, Hebammen und Schwestern, an die ich mich nicht einmal erinnern kann? Es würde mich nicht einmal kümmern, wenn ich mich an sie erinnern könnte.
Sie sind mir, um es einmal in der Sprache gefühlsgelenkter Menschen zu sagen, vollkommen scheißegal. Verzeihen sie mir diesen Ausdruck. Wie sie sehen, versuche ich mich immer wieder der Redensweise gefühlsgelenkter Wesen anzupassen. Meistens gelingt mir das ganz gut. Wie sie sich vorstellen können, ist es für einen Außenseiter der Gesellschaft unverzichtbar, sich zu tarnen. Nur wenn jemand, der aus der Reihe tanzt, in der Lage ist, so zu tun, als wäre er wie alle anderen, kann er ein halbwegs normales Leben führen.
Als Baby wusste ich das natürlich noch nicht. So etwas zu erkennen, dauert für gewöhnlich Jahre. Wahrscheinlich ist es sogar unmöglich, sich völlig anzupassen. Fehler werden immer wieder vorkommen. Es reicht ein unachtsamer Moment. Zumindest ist dies meiner Erfahrung nach so. Eine perfekte Tarnung existiert nicht. So bedacht wie ich es heute bin, war ich damals jedenfalls noch nicht. Deswegen simulierte ich auch kein Weinen in den Tagen nach meiner Geburt. Wenn meine eigentliche Geburt bereits ungewöhnlich erschienen war, so waren die Tage darauf wohl nur mit dem Wort „Sensation“ zu betiteln.
Drei Tage verbrachte ich mit meiner Mutter im Krankenhaus. In dieser Zeit habe ich kein einziges Mal geweint oder geschrien. Wenn ich etwas wollte, dann habe ich höchstens ein Wimmern von mir gegeben oder etwas Wirres gebrabbelt. Das war alles. Dem Klinikpersonal kam mein Verhalten so ungeheuerlich vor, dass sie einige Tests anordneten. Reaktionstests sollten bestimmen, ob mein Gehirn richtig ausgebildet war, eine Untersuchung der Tränenkanäle sollte Klarheit schaffen, ob ich so etwas überhaupt besaß. Alles war in bester Ordnung.
Es gab damals wie heute keine Neugeborenenpsychologen. Hätte es sie geben, hätte ein solcher vielleicht erkannt, dass bei mir auf einer tieferen Ebene etwas nicht stimmte. Körperlich jedenfalls war ich vollkommen normal. Ich war nach der Ansicht aller Ärzte ein Mensch wie jeder andere, eben ein ganz normales Kind. Meine Mutter machte sich keine Sorgen. Sie zerbrach sich auch nicht den Kopf darüber, warum ich wohl niemals schrie. Sie war einfach glücklich, so einen netten kleinen Mann zu haben, der sich bereits als Säugling zu benehmen wusste.
Mütter neigen generell dazu, ihr Kind zu idealisieren. „Mein Sohn ist der klügste, der hübscheste, der cleverste, der fröhlichste und der bravste Junge, den es überhaupt gibt.“
Das sagen sie sogar, wenn ihr Kind, ein fetter, kleiner, schwerfälliger Schwamm ohne Haare, dafür aber einem zerknautschtem Pummel-Gesicht ist. Ganz objektiv betrachtet.
Warum sind Mütter so blind, wenn es um ihr eigenes Baby geht? Ist es, weil Kinder als Spiegelbild ihrer Eltern betrachtet werden und sich Eltern daher fürchten, sich einzugestehen, dass ihr Spiegelbild ein hässlicher Idiot ist? Oder sind es auch in diesem Fall die Endorphine, die in solchen Mengen ausgeschüttet werden, die ausreichen, jeden Realitätssinn zu vernichten? Positive Emotionen, die Zweifel an der Fehlbarkeit des eigenen Fleischs und Blutes gar nicht erst aufkommen lassen? Das ist es! Zumindest halte ich dies für die wahrscheinlichste Theorie.
Meine Mutter sah mich auf alle Fälle als den perfektesten Jungen an, der jemals auf diese Welt gekommen war. Für sie hätte ich auch die Reinkarnation Jesus Christus sein können. Wäre ich in der Lage gewesen, Gefühle zu entwickeln, hätte ich wahrscheinlich schon in frühen Jahren einen Gottkomplex entwickelt. Gut, dass mir eben dies erspart geblieben war. Mein Vater war im Übrigen nicht besser. Vom ersten Tage an klügelte er aus, was aus mir später einmal werden würde.
„Präsident der Vereinigten Staaten“, rief er als erstes aus.
„Dafür muss er doch dort geboren sein, Schatz“, holte ihn meine Mutter auf den Boden der Tatsachen zurück.
„Bundeskanzler!“ Mein Vater ließ nicht locker.
„Ja, das ginge“, gestand meine Mutter freudestrahlend nach kurzer Bedenkzeit ein.
„Mein kleiner Prinz wird später Bundeskanzler!“
Vielleicht wäre dies der Moment gewesen, in dem ein emotional kompetentes Baby geschrien hätte. Ich freilich starrte meine Mutter einfach nur an, ohne jede Gefühlsregung und mit ausdruckslosem Gesicht.
„Schau! Er lächelt!“, rief mein Vater aus.
Ich kann ihnen versichern, dass ich nicht gelächelt habe. Wieder so ein Fall der gestörten Wahrnehmung. Gerne würde ich seufzen, aber warum sollte ich das tun?
In diesem Moment wurde die erste Entscheidung getroffen, die mein Leben betraf. Der Name Kevin, den ich eigentlich erhalten sollte, wurde kurzerhand gestrichen. Aus heutiger Sicht kam mir das natürlich zu Gute. Nicht etwa weil Kevin ein besonders scheußlicher Name ist – einem Menschen ohne Gefühle sind derlei Kleinigkeiten egal – sondern vielmehr aus praktischen Gesichtspunkten. Kevin ist der Name mit den geringsten Zukunftsaussichten. Studien belegen, dass Kinder, die Kevin heißen, in allen Lebensbereichen benachteiligt werden. In der Schule werden sie diskriminiert und erhalten schlechtere Noten, im wahren Leben werden sie ausgelacht. Insofern war es ganz gut, dass meine Eltern von diesem Namen abkamen. Oder komme ich ihnen wie ein Kevin vor? Eben.
Stattdessen nannten mich meine Eltern … naja, das will ich hier nicht sagen. Ich muss immerhin darauf achten, mich nicht zu outen und zu verraten. Ich schätze, die Welt geht nicht besonders gut mit einem Menschen ohne Gefühle um. So viel sei gesagt: Es war ein politischer Name. Ich war immerhin der kleine Bundeskanzler. Ich kann schon jetzt ihre nächste Frage beantworten. Nein, ich heiße nicht Helmut und auch nicht Gerhard. Doch das ist eigentlich schon zu viel Information.
Zu Recht werden sie sich an dieser Stelle fragen, woher ich denn eigentlich so genau weiß, was damals im Krankenhaus geschehen ist. Ob ich über übersinnliche Fähigkeiten verfüge? Nein, übersinnliche Fähigkeiten besitze ich genau so wenig, wie ich mich noch daran erinnern kann, was damals passiert ist. Bis auf meine Unfähigkeit zu empfinden, war ich vollkommen normal, in diesem Punkt hatten die Ärzte Recht.
Können sie sich etwa an ihre Geburt erinnern? Na also. Der Grund, warum ich über die Geschehnisse so umfassend informiert bin, sind die zahllosen Stunden, die der Camcorder, der ununterbrochen lief, festhielt. Mein Vater war ein Technikfetischist, der solche Angst davor hatte, bestimmte Dinge zu vergessen, dass er kurzerhand alles aufnahm. Es wird sie nun vielleicht wundern, aber er hatte sogar einen vordergründig rationalen Grund dafür.
Mein Großvater erkrankte bereits frühzeitig an Alzheimer und konnte sich schon wenige Jahre später an absolut nichts mehr erinnern. Mein Vater fürchtete sich davor, das gleiche Schicksal zu erleiden.
„Was ich aufnehme, kann ich niemals vergessen“, sagte mein Vater immer.
Ich muss gestehen, dass das außerordentlich schlüssig klang. Selbst für einen Logiker wie mich. Übrigens sollte mein Vater niemals an Alzheimer erkranken. Er war fit und gesund bis zu seinem Tode. Dieser setzte allerdings recht früh ein. Sein Tod kam der Krankheit des Vergessens sozusagen zuvor. Ein Schutzmechanismus? Die vielen tausend Stunden Bildmaterial waren demnach vollkommen umsonst entstanden. Ironie des Schicksals nennt man so etwas wohl. Auch wenn Ironie für mich ein nur schwer fassbares Konstrukt darstellt, trifft es in diesem Fall wohl den Nagel auf den Kopf.
Ob sich mein Vater wohl jemals fragte, wenn er an ruhigen Abenden die alten Videos ansah, ob er mich nicht doch hätte Kevin nennen sollen?
Dinge, die mich nicht berühren
An dieser Stelle möchte ich ihnen von Dingen berichten, die den Rest der Welt in Aufruhr versetzen, mich jedoch vollkommen kalt lassen. Ich versuche ihnen auf diese Weise zu verdeutlichen, wie stark meine Gefühlslegasthenie – wie ich es manchmal nenne - ausgeprägt ist. Ich nenne Ereignisse, die mich nicht interessieren. Sie sind mit Emotionen aufgeladen, die ich ganz einfach nicht teilen kann.
Bislang haben sie nur wenig über mich erfahren. Da ich ihnen allerdings ein wenig über meine Geburt erzählt habe, erscheint mir folgendes Beispiel passend:
Wussten sie, dass die Banane kurz vor dem Aussterben steht? Nein? Nun, jetzt wissen sie es. Bereits seit etwa siebentausend Jahren wird die Banane angebaut. In der Form, in der sie heute in jedem popeligen Supermarkt zu finden ist, existiert die Frucht allerdings nicht in der Natur. In ihrer natürlichen Form enthält die Banane Samen, die das Essen erschweren. Deswegen hat der Mensch die Banane ganz einfach verändert. Heute enthält die eigentliche Frucht keine Kerne oder Samen mehr. Um Bananen zu kultivieren, werden so genannte Schösslinge verwendet. Dabei handelt es sich um Ausläufer der Frucht, die aus den Stauden herauswachsen.
Ich möchte sie nicht mit zu vielen Details langweilen, deswegen sei an dieser Stelle nur gesagt, dass dies dazu führt, dass alle Bananen genetisch gleich sind und sich daher nicht gegen Krankheitserreger oder Schädlinge zur Wehr setzen können. Die Folge davon? Nunja, immer mehr Bananen werden von Schädlingen befallen, gegen die sie sich nicht wehren können. Mehr und mehr Plantagen werden auf diese Weise unbrauchbar. Wie sie sicher wissen, essen Babys gerne Bananen. Sobald sie in der Lage sind, etwas anderes als Muttermilch zu sich zu nehmen, stopfen die meisten Eltern ihren Nachwuchs mit Bananen voll. Immerhin enthält eine Banane alles, was für ein gesundes Leben notwendig ist.
Stellen sie sich nun die Verzweiflung zahlloser Eltern vor. In Zukunft gibt es womöglich keine Bananen mehr! Eine katastrophale Meldung! Wie soll denn nun aus den Kindern noch etwas werden? Eigentlich sind sie dem Untergang geweiht! Es ist wahrlich eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, vielleicht sogar eine Bedrohung für die Zukunft der Menschheit?
Zugegeben, auch ich esse gerne Bananen. Sie schmecken mir und das sage ich vollkommen emotionslos. Nur weil ich keine Gefühle habe, heißt das nicht, dass ich keine Geschmacksknospen besitze. Diese sind bei mir sogar äußerst fein ausgebildet. Vielleicht ist dies der Versuch meines Körpers, meine Behinderung in Bezug auf meine fehlenden Gefühle zu kompensieren.
Man kennt das ja. Blinde hören Hindernisse, indem sie klackende und schnalzende Geräusche von sich geben und anhand des Schalls, der zurückkommt, erkennen, was sich vor ihnen befindet. Sie haben davon noch nie gehört? Die Technik nennt sich Echo-Ortung und ist mehr und mehr auf dem Vormarsch. Sie sollten einmal recherchieren, es lohnt sich.
Allerdings spielt es hier gerade keine Rolle. Worauf ich eigentlich hinauswollte, ist mein feinausgeprägter Geschmackssinn, der das Aroma von Bananen liebt. Natürlich sehe ich auch die gesundheitsfördernden Aspekte der Banane. Vitamine, Ballaststoffe, Proteine, Fruchtzucker – alles das, was ein Organismus zum Überleben braucht. Die Banane ist also wirklich ein großartiges Produkt. Ihr Aussterben ist von enormer Bedeutung. Wirkliche Ersatzprodukte gibt es nicht. Zumindest keine, die an die positiven Eigenschaften einer Banane heranreichen. Sollte die Banane wirklich verschwinden, wären nicht nur Babys von einer weniger gesunden Ernährung bedroht, sondern auch alle anderen Menschen.
Kein Wunder, dass allmählich eine Art Panik beginnt und sich immer weiter ausbreitet. Angefangen von Forschern, über Wirtschaftsunternehmen, Landwirte, Politiker, Mediziner, Ernährungsberater, den Einzelhandel, bis hin zu den Eltern, die nicht mehr wissen, was sie ihrem Kind zu Essen geben sollen. Es ist eine Tragödie historischen Ausmaßes, welche zwar noch nicht von allen im vollen Umfang erfasst wird, es jedoch nur eine Frage der Zeit ist, bis die Massenhysterie losbricht.
So schlimm diese Lage auch sein mag, ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Es interessiert mich nicht. Soll ich etwa weinen, weil die Banane verschwindet? Das kann ich nicht. Die Geschichte der Welt hat doch gezeigt, dass es immer weitergeht. Neue Tierarten folgen ausgestorbenen, und so ist das eben auch bei Pflanzen. Meldungen dieser Art lassen mein Herz nicht schneller schlagen. Auch wenn ich weiß, von welcher Bedeutung sie sind.
Da fällt mir ein weiteres Beispiel ein: Naturkatastrophen irgendwo am anderen Ende der Welt. Immer wieder kommt es dazu. Egal ob Flutwelle, Erdbeben, Unwetter, sintflutartige Regenfälle oder Dürren. Jeder regt sich darüber auf. Die Menschen wetteifern quasi darum, wer am betroffendsten ist. Manchmal scheint es mir, als wäre es das höchste Ziel gefühlsbetonter Wesen, gerade eine Träne mehr aus dem Auge zu drücken als der andere. Natürlich gilt das nur in der Außenwirkung. In den eigenen vier Wänden interessiert das alles niemanden mehr. Wurde mittags im Kreise von Freunden oder Kollegen noch getönt, wie viel Geld man spenden werde, ist von Vorhaben dieser Art am Abend schon nichts mehr übrig.
„Schatz, der verdammte Fernseher – findest Du nicht, dass das Bild zu unscharf ist?“
Na klar, das Ding ist ja auch schon fast zwei Jahre alt.
Die Antwort der Frau „Du hast Recht Liebling. Lass uns einen neuen kaufen!“, ist da doch nun wirklich nachzuvollziehen.
Ebenso nachzuvollziehen ist das Fehlen liquider Mittel für eine angemessene Spende. Möglicherweise werfen sie mir nun eine gewisse emotionale Involvierung vor. Dem ist nicht so. Im Gegenteil: Mir ist es vollkommen egal, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Ob es nun ein neuer Fernseher ist, oder ein halb verhungertes Kind vor dem Tode bewahrt wird – es interessiert mich nicht. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist die Heuchelei. Warum sagen die Leute nicht gleich mittags unter Kollegen und Freunden, dass sie ihr Geld lieber für einen neuen Fernseher ausgeben, als es zu spenden? Das wäre doch zumindest ehrlich.
Ich kann mir denken, warum man sich mit Spenden rühmt, aber nicht, wieso es angesehener ist zu spenden, als etwas für sich zu kaufen. Verstehen sie, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Und um ganz ehrlich zu sein: So egal mir irgendwelche Katastrophen und die Folgen irgendwo auf der Welt sind, so egal ist es mir auch, ob sie mich verstehen. Ich möchte ihnen lediglich einen Eindruck von meinen inneren Vorgängen geben.
Jedenfalls waren dies nun einmal zwei Dinge, die mir vollkommen egal sind. Eigentlich sogar drei, wie sie sicher erkennen, wenn sie genau aufgepasst haben. Warum interessiert es die Menschen, was anderswo auf der Welt geschieht, oder anders gesagt, warum interessiert es die Menschen, wie andere über sie denken, wenn sie sich zu Geschehnissen am anderen Ende der Welt und ihrer Reaktion darauf äußern?
Eigentlich haben doch all diejenigen, die sich einen neuen Fernseher kaufen, Recht. Immer zuerst an sich selbst denken. Das ist der erste Grundsatz der Evolution. Die Stärksten überleben. Der Stärkste kann man nur dann sein, wenn man jeden Vorteil nutzt. Ein paar tausend Tote steigern die eigenen Chancen aufs Überleben und auf die Herrschaft. Warum sagt nur nie jemand diese Wahrheit in einer geselligen Runde?
Es gibt ein Sprichwort: Der Esel nennt sich immer zuerst. Hat der Esel damit nicht Recht? Ist es nicht logisch, zuerst an sich selbst zu denken und sich zuerst zu nennen? Immerhin sollte jeder sich doch selbst am bewusstesten sein. Es ist wie bei einer Suchmaschine im Internet. Die Treffer mit der höchsten Rate an Übereinstimmung stehen ganz oben. Also sollte man sich doch auch als erstes nennen, weil man sich der eigenen Position am sichersten ist. Das wäre zumindest logisch.
Warum dem nicht so ist und jeder stets so zwingend darauf erpicht ist, sich bloß nicht zuerst zu nennen oder in der Öffentlichkeit das Bild zu erwecken, er würde nicht als allererstes an sich denken, kann ich einfach nicht begreifen. Ich würde es gerne verstehen, doch ist mir eben dies unmöglich. Ich verfüge nicht über die Grundvoraussetzung, einen Sachverhalt dieser Beschaffenheit zu verstehen. Wäre ich ein Computer, würde man wohl sagen, dass meine Software fehlerhaft ist.
Wie jedoch repariert man eine biologische Software? Gibt es vielleicht ein Update? Gefühl 2.0? Vielleicht würde mir dies helfen, meinen Sinn im Leben zu finden. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich. Lösungen sind selten so einfach. Ich werde wohl weitersuchen müssen. Diese Suche ist mir im Übrigen nicht egal. Was mir jedoch egal war, war der Tod meiner Eltern.
Menschen sterben irgendwann. So ist die Natur. Der Tod gehört dazu. Weinen macht da keinen Sinn. Warum sollte ich weinen? Ob mir nun eine Tasse in der Küche herunterfällt und ich ihre Überreste auf nimmer Wiedersehen im Mülleimer entsorge, oder jemand stirbt, macht keinen Unterschied. Zumindest nicht für mich. Irgendwann ist jeder auf sich selbst gestellt.
Mehr gibt es und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen.
KindSein und NachbarSein
Natürlich wusste ich von frühester Kindheit an, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich kann mich erstaunlicherweise an viele Dinge erinnern, als wären sie gerade erst passiert, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Wissen sie noch etwas aus der Zeit, als sie ein Kleinkind waren? Nein? Ich schon. Sie kennen bestimmt die Situation, wenn jemand in Ihrem Freundeskreis ein kleines Kind hat. Übrigens beglückwünsche ich sie zu Ihren Freunden, bzw. dazu, dass sie überhaupt welche haben. Ich habe keine.
Aber zurück zur Sache. Sie gehören sicher auch zu den Menschen, die ein kleines Kind regelrecht belästigen, wenn sie es sehen oder? Kleine Kinder sind süß, und scheinbar liegt es in der menschlichen Natur, seiner Begeisterung durch Laute wie „Didi“, „DuDu“, DaDa“ oder ähnlichem Ausdruck zu verleihen. Oft klauen Menschen bei solchen Gelegenheiten auch die Nase des Kindes oder machen komische Geräusche, indem sie ihre Lippen auf den Bauch des Babys pressen und so fest blasen, dass ihre Köpfe ganz rot anlaufen. Sie wissen, wovon ich rede oder?
Haben sie sich schon einmal überlegt, ob das Kind all das wirklich möchte? Einmal mag das vielleicht noch unterhaltsam für ein Kleinkind sein, doch irgendwann ist es nur noch genervt. Nun, sie werden sich wahrscheinlich nicht an die Zeit erinnern, als man ihnen auf dem Bauch herumgeblasen hat, ich kann es jedoch.
Natürlich war ich nicht genervt, das hätte ja immerhin ein Gefühl dargestellt, aber ich fühlte mich durchaus gestört. Ich wollte meine Ruhe. In der Wachstumsphase eines Babys ist viel Schlaf erforderlich. Die sonderbaren Laute und die Abdrücke zahlloser Lippenstifte auf meinem kleinen, runden Babybauch verhinderten diese Ruhe.
Ich kann Ihnen verraten, dass es für ein Wesen ohne Gefühle geradezu fatal ist, sich in einer solchen Situation zu befinden. Ein Kind ohne Gefühle weint nicht. Interessanterweise fällt es den Menschen auf, wenn ein Kind weint. Alle anderen Gefühlsregungen hingegen scheinen vollkommen falsch aufgefasst zu werden. Die Bauchpuster glaubten immer, ich würde lachen, wenn sie sich an meinem Bauch ausließen. Dies entsprach definitiv nicht der Wahrheit. Ich schaute neutral. Eben ganz genau so wie ich es immer tat. Die einzige Möglichkeit dieser unangenehmen Situation zu entkommen, wäre es gewesen zu weinen, doch dazu war ich nicht fähig.
Folglich musste ich zahllose Stunden sinnlosen Gebrabbels und Geknutsches von mir fremden und mir vollkommen gleichgültigen Menschen ertragen, die immer der Meinung waren, sie täten mir dadurch einen Gefallen. Manchmal frage ich mich noch heute, ob diese Störungen, die mich von dem so elementaren Schlaf abhielten, irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich gehabt haben.
Vielleicht werde ich diese erst in einigen Jahren spüren. Ich kann meinen Arzt schon sagen hören „Sie haben einen orangen-großen, bösartigen Tumor im Kopf.“
Sollte es so weit kommen, ist dies sicher auf meine Schlafdefizite im Kindesalter zurückzuführen. Wie sonst sollte ich auch eine solche Krankheit erlangen? Ich ernähre mich gesund und nehme keinerlei Giftstoffe auf. Ich bin definitiv nicht die Zielgruppe von unheilbaren Krebsformen. Das Gute an einer solchen Situation wäre, dass dem Arzt meine Emotionslosigkeit nicht komisch vorkommen würde. In vielen Fällen, in denen Menschen schlechte Nachrichten dieser Art erhalten, sind sie im ersten Moment vollkommen abgestumpft und zeigen keinerlei emotionale Regung.
Welch ein schöner Moment. Ein Augenblick, in dem ich nicht darauf achten müsste, irgendwelche Gefühle vorzugaukeln, die ich gar nicht habe. Ob dies die Diagnose wiedergutmachen würde? Natürlich war meine Äußerung an dieser Stelle Ironie. Wie sollte ich einen schönen Moment erkennen.
„Ich weiß, dass das sehr schwer zu verarbeiten und zu akzeptieren ist“, würde der Arzt wohl sagen.
Nun gut, hier werde ich dann doch gezwungen sein, ein klein wenig zu lügen. Die Erwiderung „Es ist mir vollkommen egal“, würde dann wohl doch auf Unverständnis stoßen. Aber ein zustimmendes Nicken wäre schon in Ordnung. Dazu kann ich mich nach einem Leben ohne Gefühle und dem Versuch, mich meiner Umwelt anzupassen, problemlos abfinden.
Immerhin könnte es schlimmer kommen. Ein plötzlicher Tod zum Beispiel. Das wäre wirklich unangenehm. Wie soll man da seinen Nachlass sinnvoll regeln? Ein paar Wochen Vorlauf sind da schon nicht schlecht. Wenn ich also irgendwann sterbe, dann wäre es gut, wenn es eine Krebsdiagnose wäre. So hätte ich noch genug Zeit, mich um alles zu kümmern. Leider bezweifle ich ernsthaft, dass es eine solche Krankheit sein wird, die mir einst den Weg aus dieser Welt bereiten wird.
Ich weiß, auch der menschliche Körper, wie jede andere Maschine, muss regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten. Deswegen gebe ich nicht nur meinen Computer in regelmäßigen Abständen zum Fachhandwerker, sondern begebe auch mich selbst zu genau festgelegten Wartungspunkten in die Hände von Fachpersonal. Insofern würde eine Erkrankung frühzeitig erkannt und der Heilungsprozess gestartet werden können. Selbst wenn ich es könnte, würde ich mir keine Sorgen um meine Gesundheit machen. Mehr kann man nicht für sich tun.
Ich bin besser gewartet als der Ferrari eines Nachbarn, der für einige Zeit neben mir wohnte. Dieser schraubte nach jeder einzelnen Fahrt an seinem Schatz herum. Er war einer der wenigen Nachbarn, mit denen ich gelegentlich kommunizierte. Nicht etwa, weil ich besondere Sympathie für ihn empfand – das war ja unmöglich – sondern weil ich seine Effizienz, Pedanterie und Beharrlichkeit bewunderte. Er erinnerte mich ein wenig an mich selbst. Sehr schnell musste ich jedoch feststellen, dass es über die eben genannten Attribute hinaus keine weiteren Gemeinsamkeiten gab.
Er trank, konsumierte Drogen und schlug seine Frau. Zumindest dann, wenn er nicht gerade mit irgendeiner bezahlten Kraft den Beischlaf praktizierte. Gelegentlich schlug er sogar wie von Sinnen das eine oder andere Fenster ein. Ein emotionales Wrack durch und durch und damit das genaue Gegenteil von mir selbst.