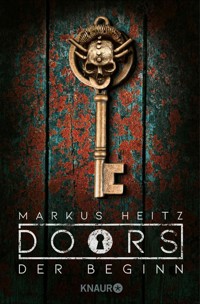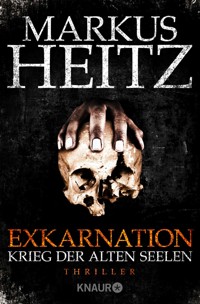
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der alte Mythos der Seelenwanderung: atemberaubend spannend erzählt vom »Meister der Phantastik« Markus Heitz. »Mein Name ist, nein, war Claire. Mein neues Leben begann an dem Tag, als ich ermordet wurde.« Ein Wagen rast unvermittelt auf sie zu und überrollt sie. Claire stirbt an Ort und Stelle, obwohl sie ihrem Mann noch helfen wollte, der vor ihren Augen bei einem Überfall erschossen wird – doch ihre Seele verlässt die Erde nicht. Beherrscht von dem Wunsch, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen, fährt sie in den Leib der Selbstmörderin Lene von Bechstein. Doch Lenes Körper war eigentlich für jemand anderen vorgesehen, und Claire gerät mitten hinein in einen uralten Krieg. »Exkarnation - Krieg der Alten Seelen« von Markus Heitz ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Markus Heitz
EXKARNATION
– Krieg der Alten Seelen –
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Mein Name ist, nein, war Claire.
Mein neues Leben begann an dem Tag, als ich ermordet wurde.
Ein Wagen rast unvermittelt auf sie zu und überrollt sie. Claire stirbt an Ort und Stelle, obwohl sie ihrem Mann noch helfen wollte, der vor ihren Augen bei einem Überfall erschossen wird – doch ihre Seele verlässt die Erde nicht. Beherrscht von dem Wunsch, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen, fährt sie in den Leib der Selbstmörderin Lene von Bechstein. Doch Lenes Körper war eigentlich für jemand anderen vorgesehen, und Claire gerät mitten hinein in einen uralten Krieg.
Inhaltsübersicht
Zitat
Prolog
Zitat
Kapitel I
Zitat
Kapitel II
Zitat
Kapitel III
Zitat
Kapitel IV
Zitat
Kapitel V
Zitat
Kapitel VI
Zitat
Kapitel VII
Zitat
Kapitel VIII
Zitat
Kapitel IX
Zitat
Kapitel X
Zitat
Kapitel XI
Zitat
Kapitel XII
Zitat
Kapitel XIII
Zitat
Kapitel XIV
Zitat
Kapitel XV
Zitat
Kapitel XVI
Zitat
Kapitel XVII
Zitat
Kapitel XVIII
Zitat
Kapitel XIX
Zitat
Kapitel XX
Zitat
Kapitel XXI
Epilog
Glossar
Danksagung
Das Gewaltigste in der Welt ist das,
was sich weder sehen noch hören
noch betasten lässt.
LAOTSE (6. Jh. v. Chr.)
Prolog
Deutschland, Sachsen, Leipzig
Was tut sie, Henri?«
Artjom zog den Gurt enger, damit sich die Kevlarweste besser an den Körper presste. In seiner Rechten hielt er eine H&K MP5K mit aufgesetztem Schalldämpfer, deren Gurt er sich nun umlegte. Er hatte im Moment keine Augen für die vier Tabletcomputer, die im Rettungswagen flimmerten und Bilder aus der Wohnung der Frau zeigten, die sie überwachten; über seinem Gesicht lag wie über dem der übrigen drei Männer und zwei Frauen eine Sturmhaube, die eine Aussparung für den Mund ließ.
»Genau das, was sie soll«, entgegnete Henri und schaltete zwischen den gestochen scharfen Einstellungen hin und her, der Anblick aus dem Innern der Räume wechselte auf den kleinen, hochauflösenden Flachmonitoren. »Sie ist bereits im Badezimmer. Sieht gut aus.«
»Alles klar. Checken.« Artjoms Anweisung sorgte dafür, dass zwei Männer und eine Frau ihre Waffen sowie den Sitz ihrer Headsets ein letztes Mal prüften. »Doc?«
Die andere Frau sah in ihren Rettungsarzt-Rucksack und nickte ihrem Assistenten zu.
»Alles dabei«, bestätigte dieser, verschloss die zwei großen Metallkoffer und warf sich die Trageriemen über die Schultern.
Artjom sah in die Runde und bemerkte die Anspannung in den Augen der Versammelten.
Alles dabei bedeutete: Spritzen, Infusionsbestecke, Defibrillator, Blutkonserven, eine ganze Apotheke, um den Kreislauf wieder in Gang zu bringen, und diverse illegale Substanzen, die so ziemlich jedes Organ in einem Körper zum Funktionieren brachten.
Die Nacht würde eine Bewährungsprobe für sie darstellen, und der kleinste Fehler könnte nicht nur Monate der Vorbereitung zunichtemachen: Die fatalste Konsequenz wäre das Ende ihrer Meisterin, ihrer hera. In Absolutheit.
»Zeig sie mir.« Artjom schaute zu, was die ausgespähte Frau in ihrer Stadtwohnung tat.
Henri schaltete, zoomte.
Sie war hübsch, Mitte dreißig, und hatte lange, mahagonifarbene Locken sowie von Natur aus hohe Wangenknochen, die ihr Gesicht betonten.
Den Unterlagen nach hatte sie sich nach der Geburt ihrer zwei Kinder die Brüste richten lassen, auch die Nase war einst krumm gewesen. Den Rest ihres Körpers hielt sie mit Sport und gesunder Ernährung in Schach, was ihr laut den Bildern hervorragend gelang.
Sie trug die Haare offen und ließ sich eben Wasser in die große Wanne. Zahllose Kerzen brannten ringsum und verbreiteten in dem ebenso praktisch wie geschmackvoll eingerichteten Raum eine ruhige Atmosphäre.
Sie zog den weißen Bademantel aus und präsentierte ihren Zuschauern einen einwandfreien Körper. Weder zu dünn noch zu dick, proportioniert und straff. Doch Artjom fühlte sich bei dem Anblick in keiner Weise erregt. Er war Profi wie der Rest seiner Truppe im Rettungswagen.
Die Dunkelhaarige prüfte das Wasser, gab einen weiteren Schluck Wein in das große Ballonglas, das auf der Kommode neben der Tür stand. Ihre Bewegungen wirkten schwerfällig, als schliefe sie gleich ein. Dennoch leerte sie den Alkohol in einem Zug und stieg mit unsicheren Bewegungen in die Wanne.
»Bereitmachen«, befahl Artjom seinem Team. Er schob sich einen Kaugummi in den Mund, um ihn leise mit den Zähnen zu bearbeiten, bevor er nervös mit den Fingern auf dem Gurt seiner Waffe trommelte.
Die Frau legte sich ins Wasser, das Brust und Unterkörper vollständig bedeckte, und schloss die Lider.
Henri zoomte, murmelte angespannt etwas Unverständliches.
Sie alle sahen, wie ganz langsam eine Träne aus ihrem linken Augenwinkel rann, der rechte Arm mit dem leeren Glas rutschte über den Rand.
So verharrte die Dunkelhaarige.
Die Sekunden vergingen und wurden zu Minuten; der elektronische Sensor der Wanne hatte die Gefahr erkannt, die vom einströmenden Wasser ausging, und stoppte den Zulauf automatisch.
Es war vollkommen ruhig im Bad. Und im Wagen.
Die Frau rührte sich nicht, nur die Brust hob und senkte sich, verursachte dabei kleine Wellen.
»Komm schon, Mädchen«, murmelte die Ärztin, um die Stille zu durchbrechen.
»Scheiße, die schläft uns ein«, fluchte Henri und zoomte das entspannte Gesicht noch näher heran. »Nein, nein, du dumme Schlampe! Bleib wach! BLEIB WACH! Fuck!«
Artjom nahm das Prepaid-Handy und wählte eine Nummer. Das Telefon in der Wohnung läutete.
Sie hörten das Klingeln über die Lautsprecher und sahen, wie die Frau zusammenzuckte. Dabei zerbrach das dünnwandige Behältnis zwischen ihren Fingern, Blut floss aus einem Schnitt in ihrer Hand.
Und floss.
Und floss …
Seufzend setzte die Dunkelhaarige die scharfkantigen Reste des Stiels an der Armbeuge an und stach durch die wunderschöne reine Haut, dann zog sie das Glas leise ächzend bis nach vorne zum Handgelenk.
Aus dem klaffenden Schnitt ergoss sich augenblicklich das Rot.
»Alles klar. Wir sind wieder im Spiel.« Henri sah zufrieden auf einen anderen Monitor, der nach einem Klick die Umgebung des Fahrzeugs zeigte. Zwischen den abgestellten Autos der Anwohner regte sich nichts. »Keiner da, der uns Ärger macht.«
Das Badewasser färbte sich rosa, Blut rann tiefrot an der Außenseite der Wanne hinab und traf auf die weißen Fliesen.
Die Frau setzte den langen Stiel ebenso am anderen Arm an und schnitt sich unter Tränen die Ader ebenso auf, wenn auch mit unsicheren Bewegungen.
»Dann raus mit uns«, befahl Artjom.
Henri griff kommentarlos eines der Tablets und setzte sich an die Spitze, öffnete die Hecktüren und verließ den Rettungswagen, der äußerlich nicht von einem herkömmlichen zu unterscheiden war.
Die Besatzung hingegen schon.
Die komplett weißgekleideten Männer und Frauen, gepanzert, maskiert und schwerbewaffnet, hetzten durch die kalte Januarnacht über die Tschaikowskistraße zum Eingang des Appartementhauses; der Assistent der Ärztin schleppte eine Aluliege. Die Situation kannte jeder von ihnen genau; sie wussten, was zu tun war.
Es kostete das Team nur Sekunden, das Türschloss zu überwinden. Den Code und den künstlichen Fingerabdruck, aufgezogen auf einen dünnen Gelspatel, besaßen sie schon lange.
Leise und nahezu geräuschlos gingen sie durch die winzige Lobby die Treppe hinauf und von dort in den kleinen Flur, immer mit den Waffen im Anschlag und bereit, auf mögliche Störungen mit maximaler Geschwindigkeit und Härte reagieren zu können.
Vor dem Appartement blieb die Truppe stehen.
Artjom und Henri betrachteten das Überwachungsbild auf dem Display des Tablets, das ausschließlich das Bad in der Totalen zeigte.
Die Frau hielt die aufgeschlitzten Arme unter Wasser, um das Schließen der Wunden zu verhindern, und wirkte trotz der Tränen erleichtert. Sie verlor zusehends an Kraft und rutschte in der Wanne abwärts, bis ihr Kinn an die blassrosa Oberfläche heranreichte.
»Jetzt?« Henri zoomte ihr Gesicht erneut heran.
Artjom zog den Schlüssel hervor und schob ihn langsam ins Schloss, damit es von drinnen nicht zu hören war. »Noch nicht.« Er nahm das Tablet an sich und beobachtete ganz genau.
Die Frau schreckte noch einmal hoch, als die Wellen gegen ihre Lippen schwappten. Ein rötlicher Strich zeichnete sich dort auf ihrer Wange ab, wo sie das eingefärbte Wasser bereits berührt hatte. Mit einem erstickten Jammern und einem erlahmenden Weinen rutschte sie tiefer, bis nur noch wenige Locken auf dem Wasser trieben.
»Das wird eng«, warnte die Ärztin.
»Noch nicht.« Artjom sah die Luftblasen, die zur Oberfläche stiegen.
Es waren viele.
»Schritte im Treppenhaus«, warnte die Nachhut über die Headsets.
»Wir sollten rein«, murmelte die Ärztin.
Die Blasen wurden weniger. Schließlich blieb die Oberfläche ruhig.
»Jetzt!«, befahl Artjom, entsperrte die Tür und trat zurück. Fortan war er für das Sichern zuständig.
Die Gruppe stürmte die luxuriöse Wohnung und hatte keinerlei Augen für die Einrichtung, die sorgfältig aufeinander abgestimmt war. Mit geschulterten Waffen rückten sie ins Bad vor.
Zwei Männer fischten die Frau aus dem Wasser, der Assistent bereitete die Liege vor, auf welche sie gebettet wurde. Vier Handtücher aus der Kommode dienten dazu, das von der Haut perlende Wasser und das Blut aufzunehmen.
Die Ärztin prüfte den Puls und Herzschlag. »Beides weg«, sagte sie zufrieden. »Sie ist tot.«
»Perfekt.« Artjom blickte auf die Leiche. »Warten.«
Das Team verharrte, die einen sicherten, die anderen hielten sich bereit.
»Stillstand vor zwei Minuten eingetreten«, verkündete die Ärztin angespannt. »Das sollte reichen.«
»Noch warten.« Artjom sah auf seine Uhr.
Niemand widersprach.
Der Zeiger ruckte Sekunde um Sekunde vor, machte die drei Minuten voll.
»Und … los!«
Mit enormer Geschwindigkeit verschloss die Ärztin zuerst die klaffenden Wunden, während ihr Gehilfe sofort eine Bluttransfusion in den beinahe leergelaufenen Leib vornahm. Die zweite Maskierte übernahm im Wechsel Herzmassage und die Beatmungsmaske.
Die Ärztin bereitete anschließend den Defibrillator vor und jagte diverse Mittel und Adrenalin mit den Konserven in die Blutbahn. Der Assistent verkabelte die Patientin mit einem tragbaren Vitalwertemessgerät; die Kontaktpflaster kamen auf die Stellen an der Brust, falls es nötig sein würde, dem Herz einen Schock zu versetzen.
Artjom stand auf der Schwelle zum Bad, sah abwechselnd zu ihnen und zur geschlossenen Eingangstür des Appartements. Bislang verlief alles störungsfrei.
Beatmung und Herzmassage wurden fortgeführt, um das frisch eingeleitete Blut mit Sauerstoff anzureichern und durch die Adern zu pressen.
Die Ärztin gab noch mehr Adrenalin in den Venenzugang und versetzte dem Brustkorb der Frau auf Herzhöhe einen Hieb.
Ein kurzes Fiepen erklang aus dem Überwachungsgerät, das sofort in einen hektischen Ton überging.
»Kammerflimmern.« Die Ärztin legte die mit Gel bestrichenen Elektroden an. »Weg«, befahl sie und löste aus.
Das leise Pfeifen des Herzmonitors zeigte ihnen, dass der erste elektrische Schock nicht ausgereicht hatte, um das Organ normal schlagen zu lassen.
Der Defibrillator summte und war Sekunden darauf wieder aufgeladen.
»Weg«, rief sie erneut.
Es knallte während der Entladung, und aus dem Fiepen des Überwachungsgeräts wurde ein rhythmisches Piepsen.
Artjom klatschte symbolisch in die Hände. »Bestens. Gute Arbeit. Das Stabilisieren, Wunden sichern und so weiter erfolgt im Wagen.« Er hob die MP5K und machte den Anfang beim Abrücken.
Mit einem schnellen Tastendruck am Headset öffnete er einen Kanal zum wartenden zweiten Team, das Yosha unterstand. Er und die necessaria mochten sich nicht, aber sie spielten im gleichen Team, wenn auch autark voneinander. »Dein Aufräumtrupp übernimmt den Rest«, gab er durch.
»Da«, erwiderte Yosha auf Russisch.
»Und vergiss den wratsch nicht.«
»Meine Aufträge gehen dich nichts an, nabaldaschnik«, kanzelte Yosha ihn ab und unterbrach die Leitung. Es war alles gesagt.
Mit der Frau auf der Trage gingen sie die Treppe hinunter, wieder kam ihnen niemand entgegen. Der Zeitpunkt war perfekt ausgesucht.
Erst als sie über die Tschaikowskistraße huschten, wurden sie von den Insassen eines vorbeifahrenden Wagens mit großen Augen angestarrt.
Henri kniete sich ab und brachte seine MP5K in Anschlag, ein roter Punkt wurde auf der Kopfstütze des Fahrers sichtbar.
»Nein«, pfiff ihn Artjom zurück. »Das wäre zu viel Aufsehen. Sie werden es in ein paar Minuten für eine optische Täuschung gehalten haben, und selbst wenn nicht, wird ihnen keiner glauben.« Er sicherte, während die Truppe in den Rettungswagen einstieg, die Liege auf der Halterung verankerte und ihre Plätze einnahm. Die Versorgung der Wiederbelebten ging weiter, jeder Handgriff saß.
Artjom schwang sich als Letzter ins Innere und betrachtete das hübsche, noch bleiche Gesicht der Bewusstlosen. Er und sein Team hatten alles richtig gemacht, jede Phase des Ablaufs verlief bestens.
Jetzt musste sie nur noch aufwachen. Dann war alles in bester Ordnung.
* * *
Auf Zeus’ Befehl schuf Prometheus Menschen und Tiere.
Als aber Zeus sah, dass die Anzahl der Tiere
höher war als jene der Menschen, befahl er Prometheus, einige Tiere zu
Menschen umzuformen.
Prometheus tat, wie ihm geheißen.
Und so kommt es, dass mancher zwar
eine menschliche Gestalt hat,
aber eine animalische Seele in sich trägt.
AESOP, Prometheus und die Menschen (um 600 v. Chr.)
Kapitel I
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)
Claire stand am Fenster ihres kleinen irischen Cafés namens Uisce, trank einen heißen Kaffee und betrachtete durch die Brille den Platz des Alten Markts mit dem Eselsbrunnen, der sich mehr und mehr mit Leben füllte. Noch war es früh am Morgen, aber die Einheimischen und ein paar Touristen tummelten sich bereits in der Altstadt. Ein schöner Tag.
Sonnenstrahlen schienen schräg von oben in den Gastraum, der halbhoch dunkel vertäfelt war. Durch die weiße Decke hielt er genügend Licht in sich, um keinen Spelunkencharakter zu bekommen.
Überall hingen keltische Symbole an den grüngestrichenen Fachwerkbalken; Landschaftsfotografien an den Wänden weckten die Lust auf die einmalige Insel, wo Claire auf einer Urlaubsreise den Mann ihres Lebens fand. Der Klassiker, mit Happy End.
Wo bleibt er denn? Heute hatte ihr Finn versprochen, seine neusten Fotografien zu zeigen, die er auf der Kräheninsel geschossen hatte. Finn liebte die Natur und konnte sie herrlich durch die Kameralinse in Szene setzen.
Sie hatte die Einkäufe bereits erledigt und alles in die Kühltheke geräumt. Der Teig für die Pancakes war zubereitet, die Scones buken im Ofen vor sich hin und verbreiteten im gesamten Gastraum ihren appetitlichen Geruch. In knapp fünfzehn Minuten würde sie den Eingang des Uisce aufschließen und sich freuen, neue und bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen.
Das schönste Kompliment hatte sie von einer irischen Reisegruppe erhalten, die nach dem Genuss ihres Irish Stew und weiteren Köstlichkeiten allen Ernstes annahm, sie sei eine Irin und habe die einzig wahren Rezepte verbotenerweise gestohlen. Claire kochte intuitiv, schaute nur gelegentlich auf die Zutatenliste und tat danach das, was man in Irland auch machte: genau das Richtige.
Um diese Uhrzeit kamen außer den Stammgästen auch Frühstücker, die das Preis-Leistungs-Verhältnis der Hotels unangemessen fanden, zudem die Besonderheiten-Sucher und die Reisenden, die auf dem Weg zum Flughafen einen kleinen Zwischenstopp einlegten.
Man wollte sehen, was die kleine Stadt zu bieten hatte, vom Beatles-Museum bis zu den historischen Bibliotheken und Einkaufsmöglichkeiten. Zwar reichte Leipzigs langer Schatten bis hierher, doch Halle und seine Einwohner waren selbstbewusst, nicht zuletzt wegen des gemeinschaftlichen Kampfs gegen das Hochwasser.
Es ist gut hier. Claire lehnte sich mit der Schulter an die Scheibe und hielt Ausschau nach Finn, der mal wieder auf sich warten ließ. Er wollte vor seinem Telefontermin noch bei ihr auf einen Kaffee hereinschauen, wie er das immer in den letzten Jahren getan hatte.
Das Ulkige für Außenstehende war, dass sie dabei stets schwiegen. Es war wie eine kleine Meditation, um besser in den Tag zu kommen. In Wochen, in denen ihn sein Beruf zwang, als freier Buchhandelsvertreter verschiedener Kleinverlage quer durch die Republik zu reisen, fühlte sich Claire ohne dieses Ritual kraftloser.
Sie grüßte den Fahrer der Stadtreinigung, der mit dem gedrungenen orangefarbenen Wagen die Rinne kehrte und den Eselsbrunnen mit den beiden Statuen obenauf dabei geschickt umkurvte.
Er winkte zurück und versprach gestikulierend, später vorbeizukommen.
Sie hob prostend die Hand mit der Tasse und lächelte ihm zu, woraufhin er ihr gespielt sein Herz zuwarf und sie zum Lachen brachte. Vergebliche Mühe.
Claires Liebe gehörte seit achtzehn Jahren dem gleichen Mann.
Sie war mit Finn einige Zeit in Irland geblieben, bis er sie gedrängt hatte, mit ihm nach Deutschland zu gehen, wo er nach einem erfolgreichen Leben als Immobilienmakler neu anfangen wollte. Das war zwar plötzlich gekommen, aber sie hatte sich gefreut, in die Heimat zurückzukehren.
Seit zehn Jahren betrieb sie das Uisce am Alten Markt, auch wenn ihre Schwester sie anfangs für verrückt erklärt hatte. In Halle, das ein wenig stiefmütterlich von Leipzig als Flughafenvorort behandelt wurde, ein irisches Café zu eröffnen, erschien Nicola wie ein Irrwitz. Aber seit fünf Jahren lief es unglaublich gut für Claire, so dass sie zwei Angestellte hatte und auch ihre Tochter gelegentlich aushelfen musste. Immer mehr Touristen entdeckten Halle, das 2013 wegen der Flut besonders häufig in den Medien gewesen war und einiges an Aufmerksamkeit erhielt. Ein kleiner positiver Effekt des zerstörerischen Wassers.
Claire schlürfte am Kaffee, der aufsteigende Dampf legte sich auf ihre dicken Brillengläser.
Die fast fünfzig Lebensjahre hatten Spuren an ihrem Körper hinterlassen, ihr Rücken schmerzte, sobald sie länger als eine Stunde schuftete. Aber sie liebte es zu sehr, um wegen ein paar Zipperlein ihr Café aufzugeben.
Wer sich täglich um süßen Teig und kalorienhaltige Speisen wie gebratenen Black Pudding, Würstchen oder Bacon kümmerte, hatte keine Modellmaße. Finn liebte sie genau so und nannte sie solas, sein Licht. Abgesehen davon war es ihr nicht mehr ganz so wichtig. Auf sich achten, ja. Aber Diäten und dergleichen strafte sie mit Verachtung. Ihre Tochter Deborah sah wie eine Kopie der umwerfend attraktiven Frau aus, welche Claire einst gewesen war, und erfüllte ihre Eltern mit Stolz.
Claire blies eine schwarze Strähne zur Seite und richtete mit einer Hand die grüne Schürze, die über dem einfachen weißen Polo-Shirt und den schwarzen Hosen lag. Zum Friseur müsste ich mal wieder.
Der alte blaue Passat Kombi ihres Mannes hielt etwa zehn Meter entfernt auf der anderen Straßenseite an und stieß rückwärts in die einzige freie Parklücke.
Finn stieg aus, ein drahtiger Mann von sechzig Jahren, mit einem Lausbubengrinsen auf dem Sommersprossengesicht. Er trug den grün-schwarz karierten Anzug und das dunkelrote Hemd mit der Karo-Fliege. Da er wusste, dass Claire am Fenster stand, winkte er, bevor er die hintere Tür öffnete und die Aktentasche herausnahm, in der er die Fotos aufbewahrte.
Claire winkte zurück. Sie freute sich so sehr, ihn zu sehen – dabei war es keine zwei Stunden her, dass sie das Haus verlassen hatte, um ihre Besorgungen zu machen.
Liebe. Einfach Liebe.
Finn setzte die Schirmmütze auf und wollte sich gerade in Bewegung setzen, als ein maskierter Mann unvermittelt aus dem Schatten eines Gebäudes von der Seite an ihn herantrat; das Messer in seiner Faust war drohend nach vorne gerichtet.
Claire hielt vor Schreck kurz die Luft an, dann suchte sie hektisch ihr Handy in der Schürzentasche, wählte die Nummer der Polizei und stellte schnell die Tasse ab. Sicherlich hielt der Räuber ihren Gatten für einen Banker oder vermutete in der Aktentasche etwas Teures, dabei waren darin nichts anderes als die Kontrollabzüge der neuen Fotografien.
»Polizeinotruf, was kann ich für Sie tun?«, hörte sie die Stimme einer Beamtin aus dem Lautsprecher.
»Mein Name ist Claire Riordan, ich bin am Alten Markt in Halle.« Sie öffnete die Tür, zog einen herrenlosen Schirm aus dem Ständer daneben und betrat den Platz. »Mein Mann wird gerade überfallen. Kommen Sie rasch!«
Sie beendete den Anruf und lief los, packte den Schirm mit beiden Händen. Sie hatte in Irland einige Zeit Hockey gespielt und ein wenig Hurling, was zu beachtlicher Schlagsicherheit und Kraft geführt hatte. Das bekommt dieses Arschloch zu spüren!
Ein blaues Leuchten im Ohr des Räubers irritierte Claire kurz. Ein Bluetooth-Stecker? Finn redete auf den Mann ein und hielt ihm die Tasche anbietend hin. »Jetzt nimm sie schon, du Arsch«, rief Claire wütend. »Oder verpiss dich sofort. Ich habe die Polizei gerufen!«
Der Maskierte sah zu ihr hinüber und sagte etwas, was sie nicht verstand – doch ihren Mann dazu brachte, sich mit einem entsetzten Schrei auf den größeren Gegner zu werfen.
Hinter sich hörte sie einen Motor laut aufheulen.
Claire rechnete unbewusst mit dem Quietschen der Bremsen, während sie die Straße überquerte. »Los, du bloody bastard!« Sie hob drohend ihre Waffe.
Das Wagengeräusch folgte ihr.
Als sie sich umdrehte, sah sie das große Fahrzeug dicht hinter sich: eine hohe Windschutzscheibe, eine breite Schnauze mit Rammschutz, und hinter dem Steuer eine zierliche, braunhaarige Frau. Ein blaues Leuchten in ihrem Ohr.
Der Rammschutz riss Claires Beine weg und brach ihr sofort beide Oberschenkel.
Während sie die Lippen zu einem Schmerzensschrei öffnete, krachte sie mit dem Gesicht auf die Motorhaube, was ein blechernes Scheppern und ein knöchernes Krachen in ihren Ohren erzeugte.
Ihr Mund füllte sich sofort mit Blut. Sie rutschte über die Haube und die Scheibe hinauf, drehte sich dabei unkontrolliert, sah mal den Himmel, mal das Glas, mal die kleinen Wölkchen, dann die toten Fliegen. Sie glaubte, den Geruch verrottender Chitinpanzer wahrzunehmen.
Ihr Kopf glitt auf der Dachreling entlang, die Haut wurde abgeschält wie von einem Gemüsehobel, ihre langen Haare verfingen sich büschelweise und rissen mit grellem Schmerz aus. Es gab nur noch Blutgeruch und -geschmack.
Abrupt erreichte sie das Ende des Fahrzeugs und stürzte wirbelnd wie ein Papierknäuel dem Asphalt entgegen. Claire sah den sonnenbeschienenen Eselsbrunnen und die unbeteiligten Figuren, die sich von ihr abzuwenden schienen.
Mit dem Aufschlag auf der Straße erklang ein deutliches Knack, das ihr durch den ganzen Leib schoss und sämtliche Sinneseindrücke überlagerte – und von da an gab es keine Qualen mehr.
Claire fühlte sich plötzlich von jeglichem Halt befreit, als habe man ihr eine Droge injiziert, die ihr einen Trip verschaffen sollte. Sie vermutete ein Beruhigungsmittel, das ein Notarzt ihr verabreichte.
Doch die Leichtigkeit endete nicht, sie ging in einen schwebenden Zustand über, befand sich plötzlich über dem Alten Markt und sah auf die Szenerie herab.
Eine Ahnung befiel sie: Sie hatte mehrmals von Menschen und deren Nahtoderfahrungen gelesen, die das Verlassen des Körpers beschrieben. Oh Gott, nein, nein! Ich … Claire sah ihren Körper einige Meter unter sich auf der Straße liegen, verdreht, entstellt und partiell abgeschält. Eben kam ein nachfolgendes Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen, ohne sie zu überrollen.
Finn! Sie blickte sich um und entdeckte ihren Mann, der auf dem Bürgersteig lag und aus der Nase blutete, da er einen Hieb abbekommen zu haben schien. Er warf dem Maskierten eben seinen Geldbeutel zu, schaute zu ihrer Leiche und schrie ihren Namen, die Adern am Hals traten dick hervor.
Aus der Ferne ertönten Sirenen, Menschen näherten sich von verschiedenen Seiten dem Schauplatz. Auch der Mann von der Straßenreinigung rannte herbei und streifte seine Handschuhe ab.
Der Wagen, der sie erfasst hatte, stand ruhig und mit blubberndem Motor daneben. Das Blech war durch ihren Körper in Mitleidenschaft gezogen worden, ihr Blut, Hautfetzen und Haarbüschel hafteten trophäengleich daran.
Claire vermochte nicht zu denken, der Unglaube lähmte jegliche Überlegung und erstickte jeden Funken Vernunft. Sie fand nichts Rationales an dem, was sie gerade erlebte.
Ihre Sicht verdunkelte sich, die Farben schwanden. Der Alte Markt versank in Monochrom, gelegentlich zuckten silberne Lichtblitze über ihn hinweg, durch Gebäude und Menschen. Es machte den Ort unwirklich, zu animierten Schwarz-Weiß-Zeichnungen eines Comics.
Der Räuber steckte das Messer mit einer routinierten Bewegung weg, nahm Finns Aktentasche, hob den Geldbeutel auf, und griff unter seine Lederjacke.
Was geschieht jetzt? Claire wollte schreien und Finn warnen, der auf allen vieren halb kriechend, halb robbend auf ihren zerschundenen Leib zuhielt. Das Blut, das aus ihrem Körper rann, war tintenschwarz. Mehr und mehr verlor die Umgebung das Licht, als befände Halle sich im Zentrum einer Sonnenfinsternis.
Der Maskierte zog eine schallgedämpfte Pistole, deren Anblick Claire aus Gangsterfilmen kannte.
Er richtete den klobigen Lauf auf den Rücken ihres ahnungslosen Gatten, dann lösten sich drei schnelle, sichere Schüsse. Der Mann nutzte die Waffe nicht zum ersten Mal.
Die Wucht reichte aus, um das Hemd vorne aufplatzen zu lassen. Große finstere Blutspritzer flogen, Gewebeteilchen wurden herausgefetzt, und weiße Knochensplitter sprengten aus dem Oberkörper.
Finn brach abrupt zusammen.
Menschen gingen schreiend in Deckung, auch das Licht verringerte sich geradezu schreckhaft, während der Mörder eilends, aber nicht aufgeregt in das wartende Auto stieg.
Das Verbrecherpärchen flüchtete im Geländewagen zusammen mit dem Portemonnaie und dem Aktenkoffer, rammte zwei Fahrzeuge auf der Schmeerstraße aus dem Weg. Die Fahrerin gab Gas, als wäre ihnen der größte Überfall des Jahres mit Millionenbeute gelungen.
Das kann nicht passiert sein. Claire sah auf ihre kaum erkennbare, wie mit schwarzer Farbe angemalte Leiche – die zerrissene Kleidung, die offenen Wunden und Brüche –, die ihr unsagbar fremd erschien.
Das gleißende Blitzen in den Fassaden, auf dem Boden und an den Leuten nahm zu, steigerte sich. Es war überall, unsichtbare Stroboskope und Miniaturgewitter entluden sich ohne Takt. Gebäudekanten wurden beleuchtet, Fensterrahmen, Gesichtszüge, die Statuen auf dem Eselsbrunnen. Der Alte Markt mit den Menschen darauf war in der von allen Seiten drückenden Dunkelheit kaum mehr zu erkennen und wurde nur durch die Entladungen gelegentlich erhellt.
Dennoch sah Claire genau, wie sich Finns Hand bewegte.
Er lebt noch! Ihr Mann brauchte sie, ihre Tochter brauchte sie. Claire musste bleiben, unter allen Umständen.
Bei Finn.
Bei Deborah.
Bei ihrer kleinen Familie.
Und sie musste die Räuber aufspüren, die ihnen das angetan hatten, wegen Nichtigkeiten. Nur sie hatte das Gesicht der Fahrerin gesehen und würde es wiedererkennen. Claire verlangte nach irischer Rache, nicht nach deutscher Gerechtigkeit, für ihre Schmerzen und die ihres geliebten Finn.
Das Letzte, was sie sah, bevor die allmächtige Finsternis auch das letzte Wetterleuchten erdrückte, war, wie Passanten zögerlich an ihren Leichnam herantraten, wie ganz Mutige mit einer oberflächlichen Untersuchung begannen und der Straßenreiniger versuchte, sie wiederzubeleben.
Danach gab es nichts mehr, außer Claires Gedanken.
Sie bestand nur aus Denken, aus Willen, aus Unkörperlichem, das in der Dunkelheit hing, kein Oben und kein Unten, keine Geräusche, kein Atmen.
Sie driftete nicht in das berühmte Licht.
In ihr entstanden eine Million Bilder und verschwanden, überlagerten sich, formten Collagen, verschwanden, flammten schlagartig auf und verwandelten sich zu einem wirren Film, dann zu einem Gemälde, danach zu einem Eindruck, der Furcht in ihr auslöste.
Claire vermochte nichts davon zu steuern. Gar nichts.
Diese unbändige Flut schwappte durch ihren Verstand und spülte ihn davon. Claire driftete dahin, tauchte in die Bilder ein, ertrank in den Gefühlen, welche mit ihnen kamen, wollte lachen und weinen, schreien und flehen …
Nichts von alledem gelang ihr.
Sie spürte den Wahnsinn in sich aufsteigen und suchte einen Anker in dem Überbordenden: Ich muss zu Finn und Deborah. Sie brauchen mich!
Mantragleich wiederholte sie die Sätze wieder, wieder und immer wieder, während sie von alten Erinnerungen geflutet und regelrecht ausgewaschen wurde.
Aber sie wollte nicht sterben oder ihren Verstand verlieren. Ihr Wille war ungebrochen, die Erde und dieses Leben nicht zu verlassen.
Ich muss nur lange genug durchhalten, bis ein Arzt zur Stelle ist, der mich reanimiert.
Claire zwang ihre Gedanken auf ihren schwerverletzten Mann, auf ihre Tochter, auf die Menschen, die sie liebte. Der Tod sollte sie nicht in die Knie zwingen.
Die flirrenden Eindrücke kamen allmählich zur Ruhe wie ein langsamer werdendes Glücksrad, verblassten dabei und verloren ihre Leuchtkraft, bis die Finsternis sie erneut umhüllte und in den schwarzen Käfig einschloss.
Dann ging ein Ruck durch ihr Bewusstsein.
Ganz behutsam setzte ein silbernes Wetterleuchten ein, das sich rasend schnell näherte. Deutlich spürbar brachte es etwas mit, eine unsichtbare Existenz, wie wenn man mit geschlossenen Augen die Nähe einer Person fühlte. Sie brauste heran und wollte an Claire vorbeiziehen.
Intuitiv und ohne zu wissen, wie es gelang, suchte Claire deren Nähe, wurde angesogen, mitgerissen und gleichzeitig abgestoßen.
Claires Sinne schienen einer nach dem anderen zu erwachen. Sie meinte, ein wütendes Brüllen und Fauchen in der Finsternis zu hören wie von einem großen Brand, der sich der Vernichtung durch Löschwasser verweigerte.
Claire und diese andere unsichtbare Existenz touchierten sich leicht. Der Schmerz durchdrang Claire. Das Reißen und Brennen wurde intensiver, das Rauschen und Tosen nahm an Stärke zu, es roch nach Wunderkerzen und heißem Asphalt.
Das Wetterleuchten wurde greller, hektischer, es schlug Risse in der Dunkelheit und schuf Flächen, die Glasgletschern ähnelten.
Unvermittelt sah Claire durch das Flackern weitere Bilder – Erinnerungen, die nicht die ihren waren. Und doch drangen sie in ihren Verstand, sickerten in jeden Winkel und schienen sich ängstlich darin zu verkriechen, als fürchteten sie sich vor ihrer neuen Heimat, wie scheue Katzen, die man aus dem Tierheim zu sich holte.
Dann wurde die Helligkeit allgegenwärtig und verjagte die Finsternis – es gab einen physisch spürbaren Schlag, gefolgt von einem Kribbeln.
Claire holte Luft.
»Sie ist da! Ben, fahr los«, sagte ein Mann laut neben ihr.
Sie bemerkte den Geruch von Desinfektionsmittel, vernahm Stimmen, die miteinander sprachen und medizinische Anweisungen austauschten. Kein Zweifel, sie wurde von Notärzten versorgt, die sie reanimiert hatten.
Geschafft! Claire fühlte sich müde und angeschlagen, spürte jedoch keine Schmerzen. Der Untergrund, auf dem sie lag, fühlte sich weich an und bewegte sich sachte. Sie wurde in einem Fahrzeug durch die Gegend gefahren und befand sich vermutlich auf dem Weg ins Krankenhaus.
Die für sie viel wichtigere Frage war: Was ist mit Finn?
Sie öffnete die Lider, bekam sie einen Spalt weit angehoben.
Über ihr spannte sich ein weißer Fahrzeughimmel, an dem mehrere Infusionsbeutel pendelten. Die Schläuche mit durchsichtigen und roten Inhalten führten zu ihr hinab und endeten wahrscheinlich in ihren Armbeugen, sie konnte die Schrift auf den Beuteln nicht lesen.
Eine Ärztin und ein Arzt standen seitlich neben ihr und redeten leise, die Kittel und Latexhandschuhe waren mit getrockneten Blutspritzern behaftet.
Claire zwang sich, die Lider weiter zu öffnen – und sah unvermittelt ein blaues Augenpaar vor sich schweben, der Rest des Gesichtes lag bis auf den Mund hinter einer weißen Sturmhaube verborgen. Sie glaubte zunächst, sich die Maske einzubilden, und suchte gleich darauf nach einer Erklärung: Möglicherweise handelte es sich um einen feuerabweisenden Überzug.
Aber das Auto, das mich überfuhr, hat nicht gebrannt.
»Hera! Hört Ihr mich?«, raunte der Mann freudig, und sofort verstummten die Gespräche im Wagen.
Claire drehte den Kopf, in der Hoffnung, Finn auf einer Liege neben sich zu entdecken.
Doch dort saß nur eine weißgekleidete Frau mit einem offenen Kittel über einer schusssicheren Weste und einer Haube über dem Gesicht. Die Maskierte starrte aufmerksam aus dem kleinen Fenster in der Hecktür, als müsse sie auf Verfolger achten. In ihren behandschuhten Fingern hielt sie eine mattschwarze Maschinenpistole, deren Existenz durch das unschuldige Hell noch mehr betont wurde.
Claire blinzelte und spürte Panik, als sie sich weiter umblickte und überall Waffen an den Anwesenden entdeckte.
Und: Finn ist nicht da.
Sie schluckte, versuchte vergebens, zu sprechen. Verzweifelt suchte sie nach einer neuerlichen Erklärung für das, was gerade geschah, fand aber keinen Ansatz, außer völlig abwegigen Dingen wie Organhandel und Lösegelderpressung.
Der Mann zog die Sturmhaube ab und zeigte ein freundliches, mit Aknenarben übersätes Gesicht, auf dem eine unglaubliche Erleichterung zu sehen war. Claire erschien es, er habe eine sehr gute Freundin oder gar seine Jugendliebe vor sich, die er gerade vor dem Tod bewahrt hatte.
Claire hingegen war sich vollkommen sicher, diesen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben zu erblicken.
»Hera«, sagte er ergriffen. »Ich grüße Euch.«
Die Ärztin mit den Bluthandschuhen trat von der anderen Seite an die Liege. »Sind die Schmerzen zu ertragen, hera, oder braucht Ihr noch etwas von dem Mittel?«
Der Mann sah Claire die Verwunderung an. »Hera Anastasia, ich bin es: Artjom«, sprach er behutsam und nachdrücklich, damit sie es sicher verstand. »Wir sind alle hier. Eure treuen necessarii.«
»Ich will zu Finn«, schluchzte Claire heiser.
»Finn?« Artjom runzelte die Stirn. »Hat sie Finn gesagt?«
»Sie ist noch durcheinander vom Wiedereintritt. Wir kennen das ja.« Die Ärztin zog eine Spritze auf und drückte den Inhalt in einen Zugang, gleich darauf spürte Claire eine entspannende Wärme. »Ich gebe ihr etwas zum Runterkommen und zum Beleben. Kann sein, dass der Blutverlust zu hoch war. Im Wasser war schwer zu erkennen, wie viel sie tatsächlich verlor.«
»Wieso Wasser?«, erwiderte Claire gebrochen. »Wo war denn Wasser auf der Straße?« Sie verstand immer weniger, je mehr die Unbekannten zu ihr sprachen. Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, nach dem Aufprall in einer Pfütze oder gar im Brunnen gelandet zu sein. Wovon reden die?
Nun richtete sich Artjom auf. »Ben, halt an. Hier stimmt was nicht.«
Der Wagen bremste sanft und kam zum Stehen.
»Die hera ist durcheinander«, beharrte die Ärztin und injizierte ein weiteres Mittel. »Gib ihr noch einige Minuten.«
Claire fühlte, wie ihr Herz schneller pochte und ihr Kopf sich klarer anfühlte, auch wenn ihr dafür der Schweiß ausbrach. Das Denken gelang ihr wesentlich besser, doch die Panik verringerte sich keineswegs.
Artjom musterte ihr Gesicht. »Das erscheint mir zu gravierend für eine simple Orientierungsstörung.« Er wandte sich der Ärztin zu. »Zumal die hera bereits mehrere Reisen hinter sich brachte.«
Ein weiterer Mann, dessen kurze, blonde Haare unter den Augenlöchern in der Maske hervorspitzten, erschien neben der Liege. »Sie benimmt sich wie eine Anfängerin«, sagte er alarmiert. »Zudem sagte sie, sie wolle zu Finn.«
Die Ärztin riss die Lider auf. »Oh, bei allen … Nein. Nein, das kann nicht sein!«
Artjom hob die Hand, wohl um mit der Geste Ruhe in den Wagen zu bringen, dann richtete er den Blick seiner blauen Augen auf Claire, in dem etwas Gefährliches lag, auch wenn sein Mund sie anlächelte. »Wer ist Finn?«
Claire fühlte eine neuerliche Angstattacke, die glühend in ihr aufstieg und bis in die Haarwurzeln schoss. Das Herz polterte und pumpte in ihrer Brust, sie wurde wach und wacher. Wenn er nach Finn fragt, können sie ihn unmöglich gesehen haben. »Was geschieht gerade?«, flüsterte sie bebend.
»Wer ist Finn?«, wiederholte er kalt.
»Fuck! Du dumme Schlampe, sag mir sofort, wie dein verkackter Name ist!«, schrie sie der Blonde an und versetzte ihr einen Stoß gegen die Schulter.
Sie zuckte vor Schreck zusammen.
»Nein«, entfuhr es der Ärztin wieder, die Artjom entsetzt anstarrte. »Wir haben die Falsche.«
»Beschissene Diebin«, schrie der Blonde außer sich. »Fuck, was hast du dir dabei gedacht, unserer hera den Körper zu stehlen?« Er holte zum Faustschlag aus.
Claires Reflexe ließen sie die Arme in die Höhe reißen – und sie sah die Gliedmaßen, die unmöglich ihre eigenen sein konnten: Die Unterarme waren mit Verbänden umwickelt, die Finger schlank und die Nägel dunkelgrün lackiert.
Ich bilde mir das alles ein. Ich bin tot und … das ist eine Zwischenwelt oder eine Hölle oder ein Traum oder … Claires Verzweiflung kehrte mit bestechender Klarheit und Intensität zurück. Sie konnte sich nichts aus den Informationen der Unbekannten zusammenreimen.
»Das heißt, die hera ist noch da draußen«, fügte Artjom an und fing den Schlagarm des Blonden ab, sah abgebrüht auf die Uhr an dessen Handgelenk. »Ich kann mir vorstellen, wie wütend sie ist. Beeilen wir uns lieber.« Er ließ den Arm los.
Die Ärztin sackte zusammen. »Das schaffen wir niemals. Wo finden wir auf die Schnelle eine Person mit diesen Voraussetzungen?«
Artjom schüttelte den Kopf. »Ruhe bewahren! Wir brauchen ein Zwischenlager für die Meisterin. Noch ist nichts verloren.« Er sah auf Claire. »Du hingegen bist es schon. Du hast den Kreislauf betrügen wollen, und wir gaben dir ungewollt die Gelegenheit dazu.« Seine rechte Hand bewegte sich zur Seite und nahm eine leere Spritze, die er mit Luft vollsog. »Wir ziehen unser Angebot zurück. Geh dahin, wo du hergekommen bist.«
Claire wollte aufbegehren, wurde aber von dem Blonden an den Schultern festgehalten.
»Artjom«, kam der warnende Ruf von vorne durch das kleine Fensterchen aus der abgetrennten Fahrerkabine. »Ein Polizeiwagen hält hinter uns.«
Mehrfaches leises Klicken erklang, als die automatischen Waffen entsichert wurden.
Claire schrie und trat um sich, ohne nachzudenken, doch schon wurden ihre Beine festgehalten. »Hilfe!«
»Schalt die Sirene und das Blaulicht ein und fahr los«, befahl der Anführer; die Nadel senkte sich nach unten, in Richtung von Claires Arm.
Das Martinshorn setzte ein, das Fahrzeug beschleunigte rasch. Der Fahrer drosch die Gänge in schneller Folge hinein.
»Zieh hinfort, unwillkommene Seele«, sagte Artjom zu ihr. »Du hast genug Schaden angerichtet.«
Ein heftiger Einschlag traf den Rettungswagen abrupt von der rechten Seite. Dann kippte das Auto langsam nach links – und mit ihm alles, was sich darin befand.
* * *
Fürstentum Monaco, Monte Carlo
Faina Zacharovna, gerade einundzwanzig geworden, sah aufgeregt aus dem Seitenfenster und erkannte den Jugendstilbau, auf den die Limousine zufuhr.
»Wir sind zu spät«, sagte sie drängelnd und prüfte mit kurzem Tasten den Sitz ihrer Hochsteckfrisur; in den blonden Haaren schimmerten echte Perlen.
»Die Frauen unserer Familie kommen niemals zu spät.« Neben Faina saß ihre Mutter Nadeschda, die aufgrund guter Gene eher wie ihre ältere Schwester wirkte. »Sie warten ohnehin alle auf uns.« Sie prüfte mit raschem Blick den Glanz ihrer Ringe und das Feuer der Diamanten darin.
Beide Zacharov-Ladys hatten sich schick gemacht. Sie wollten gesehen werden in den teuersten, schönsten Designerkleidern, um entsprechend Eindruck zu machen. Die Tochter in Rot, die Mutter in Schwarz.
Der Ort, auf den die Limousine zuhielt, war berühmt, geschichtsträchtig und überaus beeindruckend. Wer die Anfahrt auf das abendliche, hell beleuchtete Casino überstanden hatte, ohne vor Begeisterung über den imposanten Anblick des Gebäudes und der schimmernden Springbrunnen in Ohnmacht zu fallen, auf den lauerte die nächste Herausforderung: Vor dem Eingang drängten sich die Fotografen hinter den Absperrungen auf den Treppenstufen. Der Weg in die berühmte Spielbank führte nach dem Anhalten durch das Blitzlichtgewitter, das aufflammte, sobald sich die Wagentür öffnete.
Nadeschda beugte sich zu ihrer Tochter und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Sagte ich nicht, dass sie auf uns warten, Ina?«
Der CLS 350 fuhr in den Kreisverkehr, auf dem ein einzelner Springbrunnen stand, und vorbei am Hotel de Paris. Sehr präsent standen Motorradstreifen am Straßenrand, um deutlich zu machen, dass sich niemand um seine Sicherheit sorgen musste.
Der Wagen hielt vor der mit Seilen geschaffenen Schneise, der rote Teppich schmiegte sich an die Stufen ins Casino. Zwei Livrierte eilten heran und öffneten die Türen.
»Ich wünsche dir viel Spaß«, raunte ihre Mutter. »Und bitte halte dich dieses Mal mit Männergeschichten zurück.« Sie stieg aus.
Faina folgte ihr.
Hektisches Verschlussklicken und unentwegte, arrhythmische Lichtentladungen erzeugten einen optisch-akustischen Sturm, der in höchster Weise positiv irritierend wirkte und in Faina Endorphine freisetzte, so dass ihr Lächeln sich von selbst aufs Gesicht legte. Ihr Name wurde von wildfremden Menschen gerufen, damit sie sich umdrehte und eine bessere Aufnahme von ihrem hübschen Gesicht gelang.
Faina ging neben ihrer Mutter betont langsam und grazil die Stufen hinauf, ohne auf die drängelnden Bitten zu hören. Wer sie ablichten wollte, musste sich Mühe geben. Sie war keine billige Society-Göre. Faina genoss die Aufmerksamkeit, aber sie heischte nicht danach.
Zwei Angestellte der Spielbank standen auf dem Absatz und geleiteten die Damen ins marmorne Innere, wo sie im säulengestützten Atrium vom Direktor persönlich begrüßt wurden; eine Hostess mit gefüllten Champagnergläsern auf dem Tablett kam zu ihnen, flankiert von einer Kollegin mit Kanapees.
Tochter und Mutter nahmen sich je ein Glas und schlenderten durch die opulente Halle aus dem 19. Jahrhundert.
Faina fand es wunderschön. Helle Pfeiler stemmten eine bemalte Galerie, die Seitenwände waren bemalt, und in der Decke saß ein großes Glasfenster. Bronzekandelaber spendeten den Gästen Licht, alles war geputzt und poliert. Blattgoldene Stuckopulenz. Nur wer genauer hinsah, erkannte, dass es Risse in mancher Wandverkleidung gab. Es machte den Ort für Faina umso charmanter, weil er Geschichte barg.
Der Gala-Abend war etwas Besonderes, auch für monegassische Verhältnisse. Selten sah die Welt so viele reiche Menschen in einem Gebäude versammelt, höchstens bei der Selbsthilfegruppe Unglücklicher Multimillionäre oder auf einer Pferdeauktion in Dubai oder beim Treffen ehemaliger amerikanischer Präsidenten, hatte ein Szene-Magazin satirisch geschrieben.
Nadeschda berührte Faina am Arm. »Da drüben sind die Adelsons. Entschuldige mich, aber ich muss zu ihnen und mich für den Kaviar bedanken, und zwar so, dass sie mir keinen weiteren mehr schenken.«
»Geh nur. Ich finde Anschluss.« Sie lächelte über den Rand des Glases, die berstenden Bläschen des Getränks kitzelten an ihrer Nasenspitze.
Ihre Mutter blickte warnend. Sie hatte dazu schon alles im Wagen gesagt.
Faina zwinkerte und wandte sich zum Podest, auf dem sich der Direktor des Casinos in Stellung brachte und das Mikrofon für seine offizielle Rede an die Lippen hob.
Ihre Clutch hatte sie unter den rechten Arm geklemmt, die Linke hielt das Glas. Während der Mann sprach, scannte sie die Anwesenden auf potenzielle Beute.
»Ich freue mich«, schallte es auf Französisch durch die Boxen, »dass so viele Gäste erschienen sind, um an unserem Abend teilzunehmen, der ganz im Zeichen des guten Werks steht. Alles, was heute Abend verloren wird, fließt in die Casino-Royale-Stiftung und kommt wohltätigen Zwecken zu. Was Sie mit Ihren Gewinnen tun, Herrschaften, überlasse ich ganz Ihnen, aber glauben Sie mir: Zum ersten Mal werden Sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn Ihre Zahl beim Roulette fällt oder Sie einen Black Jack haben.«
Leises Gelächter erklang.
Danach machte der Direktor Platz für den fürstlichen Schirmherrn, der ankündigte, ebenfalls seinen Teil zum Abend beizutragen.
Die Ansprache verkam in Fainas Ohren zu Gemurmel, sie scannte mit den Augen intensiv nach Frischfleisch.
Doch es war zu voll. Die Gesichter verschwammen zu einer Masse, es war schwer, attraktive Jungmänner zu entdecken. Sie sagte sich, dass es an den Tischen, an einer der Bars oder in einem der Restaurants mehr Chancen gäbe, das Verlangen zu stillen.
Der Schirmherr war zum Ende gekommen. Der Durchgang wurde geöffnet, und die betuchten Gäste ergossen sich durch den Salle Renaissance mit den elektronischen Spielgeräten, die geflissentlich ignoriert wurden, in den Hauptsaal des Casinos. Roulette, Black Jack und Craps standen im Mittelpunkt. Heute gab es hier keine kleinen Einsätze.
Faina trank ihren Champagner aus und nahm sich ein zweites Glas. Sie sickerte in den wohlduftenden Strom ein und trieb behutsam dahin, sah sich nippend um und genoss das Ambiente.
Die Schönheit des Belle-Époque-Gebäudes lenkte die junge Frau kurzzeitig von ihrer Jagd ab. Sie wurde hineingesogen in die Kinoszenerie, die in diesen Mauern real wurde und in jener Nacht das Set für ihren Film sein sollte.
Faina drehte sich im Gehen einmal um die eigene Achse, ihre Blicke schweiften, und ihre Gedanken sprangen hin und her.
Welcher Film würde es wohl werden?
Eher James Bond wie in Casino Royale? Oder Sag niemals nie? Mehr Octopussy? Wenn sie sich richtig erinnerte, war das Casino noch in anderen Streifen zu sehen. Faina musste grinsen. Ein Typ wie Bond wäre genau der Richtige. Allerdings konnte sie sich nicht entscheiden, ob er wie Daniel Craig oder ein Sean Connery oder … nein. Kein Pierce Brosnan.
Die junge Frau tigerte durch den Salle Europe, der sich mehr und mehr füllte, während sich ihr Glas zusehends leerte; der Alkohol stieg ihr zu Kopf und machte sie noch gieriger.
Der weiche Teppichboden dämpfte die Schritte, sie sah zu den Kristallleuchtern und der schimmernden Decke hinauf. Auch hier herrschte die wundervoll anzuschauende Jugendstiloptik vor. In die goldverzierten Wände waren überlebensgroße Gemälde eingebettet, die einen Hauch Museum in den Spielertempel trugen.
An den Tischen lief der Spielbetrieb. Das Hüpfen der Roulettekugeln erklang, man hörte lautes Auflachen von Gewinnern und leisen Beifall, wenn ganz besonders gewagt vorgegangen wurde.
Faina stellte sich an einen der grünbefilzt bezogenen Roulettetische in der Nähe der langgezogenen Bar und beobachtete die Spieler, die mit 50er-Chips als Minimum ihre Einsätze tätigten.
Zwei junge Männer gefielen ihr. Sie waren komplett unterschiedlich; der eine blond und glattrasiert, der andere dunkelhaarig und verwegen mit gepflegten Stoppeln im Gesicht. Sie waren beide wohl um die dreißig, trugen Designerkleidung und keine Ringe an den Fingern, die eine Ehe signalisierten.
Sie sahen gelegentlich auf, musterten Faina. Der Blonde lächelte sie an, der Brünette schien die Strategie des abweisenden Gesichtsausdrucks zu fahren.
Das ist bestens. Sie stellte das leere Glas auf einem Tablett ab, das an ihr vorbeigetragen wurde, und nahm mit einem gelungenen Hüftschwung am Tisch Platz. Es würde tatsächlich ein Bond-Abend werden.
Dem Croupier schob sie zweitausend Euro aus ihrer Clutch hin und bekam 50er-Chips dafür, die auf dem grünen Filz sehr auffielen.
In aller Ruhe tätigte Faina ihre Einsätze und bemerkte sehr genau die Blicke, die ihr sowohl der Brünette als auch der Blonde gelegentlich zuwarfen. Sie hatten Interesse an ihr. Sie selbst wusste noch nicht, wen sie spannender fand. Besser: auf wen sie mehr Appetit hatte.
Der Mitspieler zu ihrer Rechten erhob sich und verabschiedete sich aus der Runde, er wurde mit allgemeinem Nicken verabschiedet.
Sofort nahm ein Mann Platz, dessen betörendes Parfüm Faina förmlich überrollte. Er hatte ihre Aufmerksamkeit, denn er roch keinesfalls nach einem der üblichen Duftwässer: Weihrauch, Ambra und zwei unterschwellige Noten, die sie nicht erkannte, aber unglaublich appetitanregend fand.
»Guten Abend«, sagte er mit warmer, dunkler Stimme. Sein Akzent war schwer einzuordnen, sie tippte auf einen Deutschen.
Faina sah ihn nicht an, während sie antwortete.
»Wehe, Sie gewinnen, Monsieur. Ihr Vorgänger wagte es nicht.« Sie las an den abweisenden Mienen ihrer beiden ersten Opfer ab, dass sie ihn als gefährlichen Nebenbuhler einstuften.
»Ich schwöre, dass ich alles tun werde, um das zu verhindern. Mein Glück wartet an anderen Schauplätzen als dem Spieltisch, Madame. Ich bin der perfekte Gast für diesen Abend.«
Die Umstehenden lachten leise.
Faina erhaschte einen Blick auf seine Hand, die sich beim Tätigen der Einsätze in ihr Blickfeld schob. Kräftig, doch gepflegt, kurze Nägel, keinerlei Schmuck, nicht einmal eine Uhr. Er legte keinen Wert auf Accessoires.
Der Mann spielte mit 50ern wie alle anderen am Tisch und tätigte immer nur einen Einsatz, immer nur auf ganze Zahlen und verlor ständig. Er bestellte sich im Gegensatz zu den Mitspielern keinen Alkohol, sondern Kaffee und Wasser. Er schien bei klarem Verstand bleiben zu wollen. Die Getränke wurden auf kleinen Tischchen hinter den Spielerinnen und Spielern deponiert.
Faina trank ihren vierten Champagner und fühlte sich ebenso angeheitert wie gierig. Es wurde Zeit, dass sie Beute machte; sie musste sich entscheiden: einen der beiden hübschen Männer gegenüber oder der Fremde neben ihr, von dem sie nicht wusste, wie er aussah.
Aber seine Stimme und sein Geruch sind ungehörig attraktiv!
Risiko. Sie setzte auf die Elf und nahm sich vor, den Fremden zu wählen, sollte die Zahl fallen, ganz gleich, wie er aussah.
Faina leckte sich über die Lippen. Ihr Hunger wuchs.
»Nichts geht mehr«, erklang die Anweisung des Croupiers, die weiße Kugel surrte noch immer am oberen Rand des Kessels, das Rad drehte sich schwindelerregend rasch.
Dann senkte sich das weiße Bällchen abwärts, prallte gegen einen der Abweiser, hüpfte auf dem rotierenden Rad zwischen den Kammern hin und her, bis es sich klackernd für eines der Fächer entschieden hatte.
Faina brauchte einige Sekunden, bis sie die Zahl in ihrem Schwips ausmachte. »Gewonnen!«, jubelte sie und verlor für einen Lidschlag die Contenance.
»Madame, sosehr ich es Ihnen gönne, aber die Zehn«, warf der gut riechende Mann neben ihr ein, »war mein Feld. Sie hatten die Elf.«
»Nein, hatte ich nicht.« Faina wollte sich nicht zu ihm drehen, bis der Streit entschieden war.
Der Croupier wiegte lächelnd den Kopf. »Madame, Sie hatten die Elf. Der Monsieur ist im Recht.« Seine beiden Kollegen stimmten zu.
»Nein. Ich habe es gesehen«, sprang der Blonde zu Fainas Rettung herbei. »Es war die Zahl der Mademoiselle.«
»Sie haben sicherlich ein Kamerasystem, mit dessen Hilfe wir nachvollziehen können, wer welchen Jeton legte«, machte der duftende Unbekannte den diplomatischen Vorschlag.
»Messieurs dames, bitte«, sprang die Aufsicht des Tisches ein. »Wir haben das System heute leider mit Rücksicht auf die Privatsphäre unserer Gäste ausgeschaltet. Sie müssen sich auf unsere guten Augen und unser Wort verlassen.«
Faina leerte ihren Champagner. Sie wusste, dass sie sich geirrt hatte. »Ich hatte die Zehn«, beharrte sie trotzdem, und der Blonde nickte. Sie wollte wissen, wie sich der Mann neben ihr benehmen würde.
»Ich schlage Ihnen vor, Mademoiselle, wir lassen den Gewinn einfach stehen. Kommt die Zahl noch einmal, teilen wir ihn uns. Einverstanden?«
Nun wandte sich Faina doch zu ihm um, weil sie es nicht länger aushielt, nur zu einem Geruch und einer Stimme zu reden.
Der Anblick passte perfekt: groß, breit gebaut, ein klassisches Gesicht, die kurzen schwarzen Haare waren nach hinten gelegt. Die dunklen Augen wirkten zuerst braun, doch dann sah sie, dass sie mehr ins Rötlich-Auberginefarbene gingen. Der klassische dunkle Maßanzug saß wie auf den Leib geschneidert. Wie bei Bond.
Allerdings: Der Mann war sicherlich vierzig, vielleicht auch etwas älter. Er würde besser zu ihrer Mutter passen.
Andererseits …
»Von mir aus. Kommt meine Zahl«, entgegnete Faina kampflustig und tippte auf die Zehn, »schulden Sie mir einen Gefallen, Monsieur.«
»Aha. Wir erhöhen den Einsatz um Dinge, die abseits des Spieltisches geschehen?« Er lächelte amüsiert. »Ich warnte Sie, Madame, dass ich bevorteilt bin, sollten Sie danach trachten.«
Erneut lachten die Umstehenden. Der Unbekannte eroberte fraglos die Herzen, auch die der übrigen Damen.
Faina nahm den Kampf auf: Er sollte ihr Opfer sein.
»Bitte, das Spiel zu machen«, rief der Croupier, und das Setzen begann. Kein anderer wählte die strittige Zahl. Niemand wollte sich einmischen. »Nichts geht mehr.«
Die Kugel schnurrte, hopste und kam auf dem Zahlenfeld zum Liegen.
»Die Zehn, schwarz«, wurde laut vermeldet, und ein halblautes Aufstöhnen erklang um ihren Tisch: 61250 Euro standen den beiden Gewinnern zu.
»Nun schulden Sie mir was«, sagte Faina und lächelte.
»Ihre Zahl war die Elf, Madame. Ich schulde Ihnen gar nichts«, hielt er dagegen und lächelte, wie es nur ein smarter Bösewicht in Filmen vermochte: verführerisch, lockend und mit einer Spur verborgener Gefahr, die unanständig anziehend wirkte. Faina musste herausfinden, was es mit ihm auf sich hatte.
»Was halten Sie davon: Lassen wir die knapp 62000 stehen?« Sein Blick wurde herausfordernd.
Laut wurde am Tisch die Luft eingesogen, das Getuschel setzte ein; leise erklang Beifall ob der Tollkühnheit.
»Es ist viel Geld, das ich verlieren würde.«
»Wenn wir verlieren« – er beugte sich zu ihrem Ohr, damit niemand sonst seine Worte vernahm –, »gehöre ich an diesem Abend Ihnen, Mademoiselle. Sie können von mir verlangen, was immer Sie möchten.«
Faina schauderte, ließ sich jedoch nichts anmerken. Sie hoffte, dass sich ihre harten Brustwarzen unter dem roten Kleid nicht abzeichneten. »Was immer ich möchte?«
Er nickte.
»Sie würden meine Kleider bügeln, Monsieur?«
»Mit Hingabe.«
»Die ganze Nacht in der Ecke stehen und eine Vase festhalten?«
»Niemand kann Vasen besser halten als ich.«
»Eine alte Oma überfallen?« Sie musste grinsen.
»Sie sind verdorben, wie es scheint.« Er deutete eine Verbeugung an. »Ich würde es behutsam tun, aber ja.«
Sie hielt ihm die Hand hin. »Dann lassen wir den Einsatz stehen.«
Er schlug ein, und seine Finger waren weich, aber kräftig.
Die Beifallsbekundungen wurden überlaut, so dass sich noch mehr Neugierige einfanden. Rasch machte der Wagemut die Runde, und so setzte niemand sonst in diesem Spiel. Alle sahen auf den Stapel mit den 61250 Euro und die Kugel, die im Kessel auf die Reise geschickt wurde.
Fainas Herz schlug bis zum Hals. Sie hoffte so sehr, dass die Zehn nicht ein drittes Mal fiel, auch wenn die Wahrscheinlichkeit stets die gleiche blieb. Theoretisch konnte die Zehn den ganzen Abend lang hintereinander fallen – oder niemals.
Die Kugel schoss dahin, schien länger zu brauchen als vorher, als würde sie den Weg nicht finden. Die Gespräche verstummten nach und nach.
Klickernd und klackend sprang das weiße Bällchen über die Zahlenfelder, prallte von den Kanten ab und kam schließlich zum Erliegen.
»Die Elf, rot«, verkündete der Croupier und zog den beachtlichen Jetonstapel mit dem Schieber zu sich. »Die Herrschaften haben verloren.«
»Aber die gute Sache gewann«, erwiderte der Unbekannte und erhob sich unter dem Beifall der Zuschauer, dann hielt er seine Hand anbietend in Richtung Faina. »Erlauben Sie mir, dass ich Sie zu einem Drink entführe?«
Faina lächelte. »Bien sûr, Monsieur.« Sie hakte sich bei ihm ein und ließ ihn entscheiden, wohin sie entschwanden. Wegen des großen Andrangs hatte man inzwischen zwei weitere Säle geöffnet. »Oh, übrigens, Sie schulden mir was«, raunte sie ihm zu.
»Wir haben verloren.«
»Aber Sie hatten recht: Die Elf war meine Zahl!« Sie lachte auf, und er stimmte mit ein.
Ihr Hunger war kaum noch zu ertragen, und sein erregender Duft verstärkte ihn. Mehr als einen Drink würde sie ihm nicht gönnen, dann war der Mann fällig.
Sie erreichten mit wenigen Schritten die Bar des Salle Europe, und er bestellte einen Fresh Death für sich und einen Mary Pickford für sie. Damit traf er genau ihren Geschmack.
»Mein Name ist Kaitan«, stellte er sich vor und deutete einen Handkuss an.
»Faina«, erwiderte sie.
»Jack«, erklang eine dritte Stimme, und sie wandten sich erstaunt zur Seite, wo sich der Blonde vom Spieltisch näherte. »Gutes Spiel.«
»Danke«, erwiderte Kaitan. »Versuchen Sie doch, es besser als wir zu machen.« Er zeigte auf die Tische. »Es sind genug da.«
»Oh, nein. Lieber nicht. Ihre Show war zu gut.« Jack sah anscheinend nicht ein, das Feld zu räumen, was Faina unter anderen Umständen gut gefunden hätte. Sie mochte es, wenn sich Männer um sie stritten. Aber im Moment nicht. Sie hatte ihre Wahl getroffen, und Jack machte es gerade unnötig kompliziert.
Also klärte sie die Situation auf die einfachste Weise: Die junge Frau beugte sich zu Kaitan und umfasste mit einer Hand sein Gesicht, dann küsste sie ihn leidenschaftlich. Er erwiderte die Zärtlichkeit sofort.
Faina war wie vom Blitz getroffen, ihr Körper reagierte umgehend auf den stattlichen Mann. Es kribbelte in ihr, und sie konnte sich kaum mehr losreißen. Die Zeit verging, während sich ihre Lippen und Zungen berührten.
Als er sie sanft von sich schob, war Jack verschwunden.
Faina wollte es zu Ende bringen. Jetzt, hier.
Sie leerte ihren Drink in einem Zug, er tat es ihr nach. Sie waren sich einig.
Ohne ein weiteres Wort zu sagen, gingen sie durch den Hauptraum und wählten im Salle Blanche einen der salons privés, in denen an normalen Tagen Spiele im kleineren Rahmen und familiären Ambiente ausgetragen wurden. Heute blieb er leer, aber nicht unverschlossen, wie Faina erfreut feststellte. Von der roten Absperrkordel ließ sich ihr Verlangen nicht aufhalten.
Sie schoben sich heimlich hinein.
Der Raum lag in schummrigem Licht, das von außen durch die Terrassentür und Fenster hereinfiel; es roch nach altem Holz und Pflegemittel, ein wenig Rauch und geheimer Atmosphäre.
Weit draußen auf dem Meer blinkten Lichter auf dem schwarzen Wasser und wetteiferten mit den Sternen. Schemenhaft erkannte Faina die kleine Außenanlage des Casinos, auf der im Sommer mit dem Glück gespielt wurde.
Kaitan drückte die Türen fest zu und verkeilte sie mit einem der schweren Stühle, so dass sie auf keinen Fall überrascht werden konnten. Die Geräusche von draußen drangen nicht herein, die Isolierung war gut.
Währenddessen zog Faina mit einer raschen Bewegung das rote Designerkleid aus und präsentierte sich ihm in schwarzer Unterwäsche, die knapper nicht sein konnte. »Die Kameras hier drinnen werden auch ausgeschaltet sein.« Leicht spreizte sie die Arme vom Körper ab und zeigte ihren trainierten Körper. Gleich würde es losgehen. »Kommen wir zu meinem Gefallen«, sprach sie erregt und ein klein wenig heiser.
Kaitan warf das Jackett ab, und seine trainierte Figur kam überdeutlich zum Vorschein. Er musste Zehnkämpfer oder Kampfsportler oder beides sein.
In der nächsten Sekunde hatte er etwas an beiden Händen, das im Licht silbrig schimmerte. Als er die Finger zu Fäusten ballte, erkannte Faina die Objekte: Schlagringe.
Sie wich vor ihm zurück, strauchelte und wollte zur Tür – doch er schob sich ihr in den Weg. Panik stieg in ihr auf. Der Ausdruck in seinen ungewöhnlichen Augen hatte sich geändert, war hart und unnachgiebig geworden.
»Schön, dass ich dich endlich gefunden habe«, sagte Kaitan und näherte sich mit geschmeidigem Gang, der Faina an den eines Raubtieres erinnerte. »Mein wahrer Name ist Eric von Kastell, und ich jage Wandler wie dich schon sehr lange. Ich habe Fragen.«
Ein Treffer, und sie wäre tot. Faina warf sich herum und rannte auf die Fenster zu. Nur weg von dem Verrückten. »Dudka!«, zischte sie auf Russisch.
»Nein, bin ich nicht«, erwiderte Eric und wechselte in ihre Sprache. »Du hast zu viele getötet.«
»Was?« Das Fenster widersetzte sich ihrem Rütteln. Faina nahm den großen Kerzenleuchter vom Bartresen zu ihrer Linken.
Er näherte sich, zeigte sich nicht besonders von ihrer Waffe beeindruckt. »Dafür, dass du so jung bist, eine beachtliche Leistung. Leider keine gute.«
Fainas kaum stillbarer Hunger nach Sex war blanker Angst gewichen. »Hilfe!«, schrie sie und holte zum Schlag gegen die Scheibe aus. Sie musste weg.
»Die salons privés sind schallisoliert«, kommentierte Eric und eilte auf sie zu. Ihrem ersten hektischen Hieb mit dem Kerzenleuchter und dem nachfolgenden Stoß mit den langen Eisendornen wich er geschickt aus. »Niemand wird dich hören, Wandelwesen.«
»Sie sind wahnsinnig!«
Er lachte – und stutzte plötzlich beim Blick auf den Silberleuchter.
Faina nutzte sein Zögern. Sie versuchte, an ihm vorbei und zur Tür zu gelangen. Aber Eric war schneller und versetzte ihr einen einfachen Stoß mit der flachen Hand gegen die halbnackte Brust, so dass sie nach hinten auf den Roulettetisch stürzte. Der Kerzenhalter fiel dumpf polternd auf den Teppich.
In der nächsten Sekunde saß er auf ihr, seine Knie drückten ihre Oberarme auf die Platte; eine Hand lag an ihrer Kehle, die andere presste den Schlagring schmerzhaft gegen ihre Wange.
»Bitte, nicht das Gesicht«, hauchte sie erschrocken. »Ich bin Model.«
Eric sah sie verblüfft an. »Du bist vor allem«, raunte er, »die Falsche.«
Die Tür zum salon privé flog auf, als wäre der Stuhl dahinter gar nicht existent; knackend brach die Lehne unter dem Druck.
Auf der Schwelle stand Nadeschda, die den Zugang wieder schloss und mit einem langen Splitter verkeilte. »Was wird das?«
»Mamuschka«, sagte Faina schluchzend. »Ruf die Polizei.«
Ihre Mutter sah zuerst zu ihr, dann zu Eric. »Weg von meiner Tochter«, befahl sie drohend und streifte ihr schwarzes Kleid achtlos ab, unter dem sie keine Unterwäsche trug.
Eric stieß ein verständnisloses Lachen aus.
»Mamuschka!«, rief Faina entsetzt. »Was tust du?«
»Mein Kleid nicht ruinieren«, erwiderte sie trocken, während sich ihr Körper bereits verformte. »Es war teuer.« Mit leisem Knistern der Knochen verwandelte sich die Russin in ein Mischwesen aus Mensch und Tiger, kurzes Fell spross aus der Haut. Schritt um Schritt kam sie auf den Tisch zu.
Faina schrie vor Entsetzen.
Ein Grollen drang aus dem leicht geöffneten Maul, die spitzen, langen Reißzähne waren deutlich zu erkennen. Die muskulösen Arme spannten sich an, lange gekrümmte Krallen saßen an den prankenähnlichen Händen.
»Ich sagte: Weg von meiner Tochter«, sprach das Scheusal knurrend und setzte ein wütendes Fauchen hinterher, die Ohren klappten nach hinten.
Da traf Faina etwas an der Schläfe, und sie wurde ohnmächtig.
* * *
Hast du etwas, so gib es her, und ich zahle, was recht ist.
Bist du etwas, o dann tauschen die Seelen wir aus.
FRIEDRICH SCHILLER, Das Werte und Würdige (1797)
Kapitel II
Deutschland, Sachsen, Leipzig
Claire fiel von der Liege und prallte mit Artjom zusammen, der ihren Sturz durch seinen Körper unbeabsichtigt abfederte. Die Infusionsnadeln glitten aus ihrem Fleisch, was sie als leichtes Ziepen wahrnahm, eine Blutkonserve flog an ihnen vorbei und zerplatzte an der Seitenwand, tünchte die Verkleidung rot; der metallische Geruch breitete sich unverzüglich aus.
»Scheiße«, hörte sie den Blonden fluchen, der nach seinem Gewehr griff. »Welcher Wichser übersieht denn einen Rettungswagen?«
In Claire gewann das Pragmatische die Oberhand, um ihr Leben zu retten. Alles andere würde danach erfolgen. Ich muss zu Finn! Sie trat Artjom in den Schritt und robbte über ihn hinweg, hechtete zur Doppeltür und löste die Verriegelung.
Ein Flügel klappte auf und krachte auf die Straße.
Rotierendes Blaulicht fiel auf sie. Vor ihr stand der Polizeiwagen, vor dem die Unbekannten hatten entkommen wollen.
»Artjom, sie haut ab!«, rief die Ärztin und stemmte sich in die Höhe. An ihrem Kopf hatte sie eine Platzwunde, in der Hand eine Pistole mit überlangem Magazin, und sie richtete den Lauf auf Claire.
Sie rollte sich hinaus, landete auf dem kühlen Asphalt und spürte Plastiksplitter der zerstörten Lampen in ihre Haut stechen. Schräg neben ihr stand ein Müllwagen mit verbeulter Front, der die Ambulanz gerammt und umgestoßen hatte. Ob jemand darin saß, erkannte sie von ihrer Position aus nicht.
Erstaunlich leicht erhob sie sich und bemerkte, dass sie nackt war. Der Körper, in dem sie sich bewegte, schien jünger als ihr eigener zu sein, wie ein ungläubiger, rascher Blick an ihr hinab verriet. Schlank, definierte und feste Brüste, eine kleine bunte Tätowierung auf dem Spann.
Das kann alles nicht real sein.