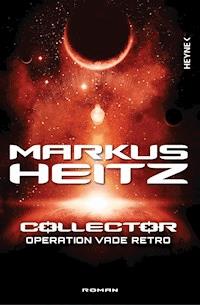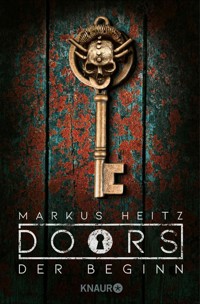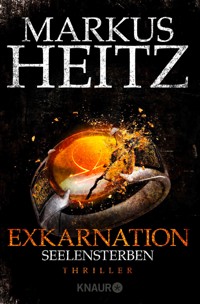
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der 2. und abschließende Band der "Seelenwanderer"-Duologie von Bestseller-Autor Markus Heitz Eine Seelenwanderin auf der Jagd nach einem skrupellosen Entführer. Eine uralte Vampirin auf einer Rettungsmission, die sie an Orte führt, von denen es kaum ein Entkommen gibt. Ein Mann ohne Gedächtnis, der versucht, die Schuldigen zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich ihre Wege kreuzen … In "Exkarnation – Seelensterben" laufen die Fäden aus sämtlichen dunklen Thrillern von Markus Heitz zusammen. Was nach einem fulminanten Ende klingt, birgt die Keimzelle für neue Abenteuer. Und neue Herausforderungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Markus Heitz
Exkarnation – Seelensterben
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Seelenwanderin auf der Jagd nach einem skrupellosen Entführer.
Eine uralte Vampirin auf einer Rettungsmission, die sie an Orte führt, von denen es kaum ein Entkommen gibt.
Ein Mann ohne Gedächtnis, der versucht, die Schuldigen zu finden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Wege dieser drei kreuzen …
Das dunkle Finale: Hier findet das Rätsel rund um die Seelenwanderer seine lang erwartete Auflösung
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Epilog
Glossar
Danksagung
Bonus-Track Exemplum von Markus Heitz
Begriffe
Prolog
Lene? Wo bleibst du?«, schallte Eugens Ruf durch die große Halle der Gründerzeitvilla und drang bis zu ihr ins Arbeitszimmer. »Wir warten mit dem Essen, verdammt.«
Claire hob die Augenbrauen, während sie sich vor dem Computer aufrichtete. Er flucht. Laut und deutlich.
So kannte sie den Mann nicht. Er hatte sich in den letzten Tagen seit der Eröffnung von Deborahs Café in Halle verändert, Stunde um Stunde. Spürbar.
Aus dem einst liebevollen und verständigen Vater war ein aufbrausender Kerl geworden, der jede Kleinigkeit monierte und üppige Strafen über die Töchter ausgoss, wenn sie einen Fehler begangen hatten. Sobald Tränen aus den Augen der Kleinen flossen, brach er zusammen wie ein schlecht gebautes Kartenhaus, entschuldigte sich für sein schreckliches Verhalten und verschwand in den Park oder verbarrikadierte sich im Kaminzimmer bei Musik und Alkohol und frönte hadernd der Schwermut.
Claire erhob sich, band ihre Mahagonilocken zusammen und klappte den Rechner zu. Es muss was in der Firma sein, das ihm zusetzt. Sie würde ihn bitten, den Stress nicht an den Kindern auszulassen. Sport. Ich lasse ihn mehr Sport machen.
Langsam ging sie in ihrem gemütlichen Hausanzug über die Galerie zur Treppe, die abwärtsführte.
Sie hätte Sport auch dringend nötig; ihre Essgewohnheiten drohten Marlenes makellose Figur zu ruinieren. Denn sie, Claire Riordan, steckte im Körper und im Leben der Industriellen Marlene von Bechstein: Chefin der VoBeLa, der Von Bechstein Laboratories. Unveränderlich und unwiederbringlich.
Die Seele der wahren Marlene wiederum war den Machtspielen der Seelenwanderer zum Opfer gefallen und vergangen. Claire hatte sich nach dem Einzug ihrer Seele in den fremden Körper entschieden, ihre Rolle als Lene weiterzuspielen. Dazu gehörte auch, die Töchter Charlene und Pauline im Glauben zu lassen, sie hätten ihre Mutter nicht verloren.
Claires eigene Schwester Nicola und ihre leibliche Tochter Deborah wussten mittlerweile Bescheid und spielten das Spiel mit. Indem sie vorgaben, Lene sei eine Freundin der Riordan-Familie, konnten sie den Kontakt zueinander halten.
So lebte Claire in einer neuen und zugleich in ihrer alten Welt. Aber gerade nach den letzten Tagen und Wochen voller Unruhe schien es, als wurde sie wirklich mehr und mehr zu Marlene, der freundlichen, doch bestimmten Geschäftsfrau. Vielleicht aus Selbstschutz? Nur im Umgang mit den Kindern blieb sie weich und nahbar.
Sie trat ins Esszimmer und sah ihren Mann alleine am Tisch sitzen, der nach wie vor Hemd und Krawatte trug, an den Ärmeln blitzten die Manschettenknöpfe. Das Essen auf den Tellern der Kinder war zur Hälfte gegessen. Es roch nach Drama.
»Wo sind Charlene und Pauline?«, fragte sie ohne Gruß und setzte sich ihm gegenüber. Sie nahm sich ein aufgeschnittenes Brötchen, die Butter und Wurst.
»Auf ihren Zimmern«, grollte Eugen. Er schlug die Zähne mit viel Wucht in sein Brot und kaute, als würde er es erst töten müssen. »Ich habe sie eben hochgeschickt.«
»Haben sie sich gestritten?« Claire ahnte, dass es einen viel harmloseren Grund gab.
»Sie haben mich genervt«, erwiderte er widerwillig wie ein Verbrecher beim Verhör.
»Genervt.« Sie legte die Hälften auf ihren Teller und faltete die Hände zusammen. »Und wie?«
»Sie haben sich Witze erzählt und gelacht«, antwortete er undeutlich.
Claire setzte sich gerade hin und atmete tief ein. Die Marlene-Seite trat zutage. »Du hast deine Töchter auf ihre Zimmer geschickt, weil sie lustig waren«, fasste sie fassungslos zusammen.
Eugen zeigte entschuldigend auf seinen Tabletcomputer. »Ich lese gerade einen Artikel, der wichtig ist. Er handelt von Absatzzahlen der bekanntesten Energydrinks. Es ist ein tolles Geschäft, in das wir mit den VoBeLa einsteigen könnten«, erwiderte er halb zerknirscht und halb angreifend. »Es geht um Millionen.« Er tippte auf ein leeres Döschen, das neben seinem Glas mit Schorle stand. »Den Hersteller haben wir schon. Alles lückenlos zertifiziert. Er sucht eine Abfüllanlage und den Vertrieb. Das Zeug macht wach ohne Ende.«
»Hat es als Nebenwirkung, dass man zum mürrischen Mann wird?«, fragte Claire schneidend. Sie erinnerte sich, dass er ihr bei der Eröffnung des Cafés eine Überraschung versprochen hatte, die zu Hause wartete. Zweifellos war es das neue Projekt, aber sie freute sich vom ersten Tag an nicht darüber. Es nimmt ihn zu sehr in Beschlag. Die Kinder brauchen ihn.
»Nein, hat es nicht«, rief er erbost. »Es ist vollkommen ohne Nebenwirkungen. Ganz im Gegensatz zu dir und den Gören. Ihr macht mich krank.« Er starrte sie an, dann biss er ab. Kaute hektisch und las auf dem Tablet. »Millionen, Lene. Damit können wir deine kostspielige Parfum-Sache wieder reinholen. Der Gewinn davon ist, gelinde gesagt, überschaubar.«
Claires Kiefer klappte herunter.
Sie kannte Eugen aufgrund ihrer kurzen Zeit in diesem Haus nicht gut genug, um die Ernsthaftigkeit seiner Worte einschätzen zu können. Aber es klang, als würde ihn dieses neue Produkt sehr unter Druck setzen.
Sei mehr Marlene. Anstatt auf die Provokation einzugehen, strich sie Butter aufs Brötchen und legte Wurstscheiben darauf. Nach kurzem Zögern entfernte sie einige wieder. Zwei reichen.
»Du bist überarbeitet«, sagte sie freundlich. »Sport hilft dir sicherlich. Ich stelle einen Personaltrainer ein. Was hältst du davon?«
»Wird dir guttun«, gab er zurück. »Ich fühle mich fit.«
»Es geht darum, dass du Stress hast«, erwiderte sie ruhig. Sie nahm sein Tablet und aktivierte den Browser, gab die passenden Suchbegriffe ein.
»Gib es bitte wieder her, Lene«, hörte sie Eugen sagen.
»Iss mal zu Ende. Du bekommst es gleich.« Die meisten Frauen und Männer auf den Websites sahen zu geschniegelt und zu gestählt aus. Mit denen wollte niemand in Konkurrenz treten.
Aber dann fand sie einen Hünen, der damit warb, der beste Motivator gegen Schweinehund und Stress zu sein. Sein Name war Ares L. Löwenstein, und er sah nicht nur beeindruckend aus, sondern hatte bei allen Muskeln auch ein Bäuchlein. Schnell sandte sie ihm via Mail eine Anfrage und schob das Tablet wieder zu Eugen, der inzwischen aufgegessen hatte.
»Alles erledigt.« Claire lächelte ihm zu und merkte selbst, dass die Herzlichkeit fehlte.
Aber er goss sich Rotwein ein und trank das Glas in einem Zug zu zwei Dritteln leer. »Noch lange nicht«, gab er zurück und öffnete die Kalkulationen wieder. »Du hast es dir nicht angeschaut, oder?«
»Was?«
»Meine Berechnungen zum Drink.«
Hatte sie wirklich nicht. »Mir steht der Sinn nicht danach.«
»Weil du gerade an Fabian denkst?«, gab er betont harmlos zurück und wischte auf dem Display herum.
Wieder ein Pfeil von der Größe einer Harpune.
Claire langte nach ihrem Glas Wasser und zwang sich, ganz langsam zu trinken, um die Gedanken zu sortieren, bevor sie als wütender Wust über ihre Lippen kämen und die Lage verschlimmerten.
Ihr Leibwächter Fabian Vacinsky war ebenfalls ein Seelenwanderer wie sie selbst. Er hatte Claire nach ihrer Seelenwanderung beigestanden, damit sie erstens überlebte und zweitens nicht den Verstand verlor. Sie fühlte eine gewisse Verbundenheit und große Sympathie, und ja, sie musste sich eingestehen, dass sie seine Nähe mochte und sich geborgen fühlte. Sicherer. Aber Claire war sich darüber hinaus keiner Schuld bewusst, schon gar nicht Eugen gegenüber. Mit Rücksicht auf die Familie verbat sie sich jegliche tiefer gehenden Gefühle für Fabian. Eine Beziehung zu ihrem Bodyguard würde ihre Situation verkomplizieren. Das würde auch Marlene so handhaben.
Eugen schien ihr Schweigen als Eingeständnis zu interpretieren.
»Na schön«, sagte er und erhob sich. Er nahm das Tablet und das Rotweinglas. »Ich bin im Kaminzimmer und will nicht gestört werden. Weder von dir noch von den Gören oder Fabian.« Das Glas stellte er auf das Tablet und goss es randvoll, dann steckte er das Musterfläschchen ein und zog sein Smartphone hervor.
Er verließ den Raum und telefonierte.
»Hier ist Eugen von Bechstein, mein Lieber. Ja, ich habe mir die Zahlen angeschaut. Sieht wirklich gut aus. Ich berechne gerade, was es die VoBeLa kosten würde, die Umrüstung an den Abfüllanlagen vorzunehmen, und wenn es Ihnen nichts ausmacht, sollten wir nochmals essen gehen, um Details zu besprechen.« Seine Stimme entfernte sich und wurde zu einem Gemurmel, dann fiel die Tür zum Kaminzimmer mit einem Krachen ins Schloss.
Claire fluchte leise auf Gälisch. Sport. Viel Sport. Innerlich kühlte sie ab. Der Personaltrainer sollte Eugen so in den Arsch treten, dass der Idiot, der gerade in ihm wohnte, ihm zum Hals rausflog. Sehr viel Sport.
»Charlene, Pauline«, rief sie gespielt fröhlich. »Kommt runter. Der große böse Wolf ist weg. Ihr habt sicher Hunger.«
Mit erleichtertem Lächeln kamen die Töchter die Treppe runtergerannt und zu ihr ins Esszimmer. Sie umarmten ihre Mutter und setzten sich artig an den Tisch.
»Wisst ihr«, sagte Claire und freute sich über die zwei, »Papa ist im Moment ein bisschen gereizt. Aber er hat euch sehr, sehr lieb.«
Die Kinder nickten und griffen nach den angebissenen Broten.
Claire wünschte sich, dass eine ihrer Seelengaben die Stimmung bei Menschen zum Heiteren verändern könnte. Ich würde eine Eheberatung eröffnen und wäre reich. Nur zufriedene Kundschaft.
Aber leider vermochten das ihre Kräfte nicht. Dafür konnte sie beispielsweise anderen Menschen und Seelenwanderern mit einem Schlag die Seele rauben. Sie töten.
»Wer will ein Eis?«, fragte sie und fuhr den Kindern liebevoll über die Schöpfe.
Charlene und Pauline rissen begeistert die Finger in die Luft.
Claire dachte an die drohenden Gefahren, die im Krieg der Alten Seelen noch auf sie lauerten.
Sie sah die beiden Mädchen an, die Fratzen machten und kicherten und sich anstupsten. Eine schöne Gabe wäre es, wenn sich die Gegner zu Tode lachen.
Das war bedauerlicherweise für sie keine Option.
Auch nicht für Marlene.
[…] schriftliches Versuchsprotokoll I/1/BZ
(Filmdokumentation in Datenbank abgelegt: File I/89/0827/222)
Fragestellung:
Kann die verkapselte Seelenenergie (anima) mittels Succinitolyse genullt werden?
Vermutung:
Innerhalb eines gewissen Zeitrahmens durchaus.
Verwendete Materialien:
*BZ
*PeMo
*Proband: a-Spezies Wandelwesen (canis lupus), Box I/89
Versuchsaufbau und -durchführung:
Fixierung des sedierten Wandelwesens innerhalb des BZ, zentriert, humane Form
Initialisierung der Succinitolyse mittels PeMo
Zeitdauer der Succinitolyse: 10 Sekunden
Intensität der Succinitolyse: mittel (PM-Raster Stufe 5, Zwischenspeicherung mit Bündelung)
Beobachtung (ggf. Messwerte nachtragen):
Sekunde 1–3:
Lichtbildung, keine Auswirkung
Sekunde 3–3,5:
Umwandlung des Probanden in halb humanoiden Canis-lupus-Zustand
Sekunde 3,6–3,9:
Umwandlung des Probanden in Canis-lupus-Reinform
Sekunde 4–7,21:
Erwachen des Probanden aus der Sedierung, Schreien, Kreischen
Sekunde 7,22–8,9:
Umwandlung des Probanden in halb humanoiden Canis-lupus-Zustand, Aufbäumen, Schreien, Kreischen, Flammen aus Mund, Nase und Augen; dann aus der kompletten Hautoberfläche
Sekunde 9–9,4:
Ausbreitung des Feuers über Proband
Sekunde 9,5–10,3:
komplette, unbeabsichtigte Succinit-Pyrolyse, Proband zu 100 % eingeäschert
Auswertung:
Proband I/89 durchlief bei der Succinitolyse mehrere Stadien der Wandlung, was auf eine Abwehrreaktion der anima schließen lässt.
BZ erlitt keinerlei Schaden.
Fehleranalyse:
Energie zu hoch?
Nächster Versuch startet mit geringerer Kraft.
Empfohlen: PM-Raster auf Stufe 2, Zwischenspeicherung mit Bündelung. […]
Kapitel I
Ares Leon Löwenstein betankte seine Harley Night Rod Special, die mattschwarz lackiert und mit verchromten Doppelauspuffen friedlich und stumm neben der überdachten Zapfsäule stand; der schweren, bulligen Maschine sah man die Kraft an, die im Motor wohnte. Sie passte hervorragend zu ihrem Besitzer, der mit zwei Metern Größe, einer muskulösen Figur und ein bisschen Bauch auf jedem anderen Bike geradezu lächerlich ausgesehen hätte.
Die Digitalanzeige der Säule veränderte sich ohne Geräusch, spulte die Zahlen für Menge und Preis hinauf. Die Pumpe summte hingegen lautstark.
Um Ares herum parkten nur zwei weitere Autos. Gegen Mitternacht war es ruhig an der kleinen, leicht schmuddeligen Tankstelle, die er bevorzugt aufsuchte. Sie gehörte keinem gigantischen Konzern an, und das unterstützte er.
Die Scheinwerfer brannten aus der Decke des Unterstands mit vergilbtem Licht auf ihn nieder, unzählige tote Insekten hinter dem Schutzglas dimmten die Helligkeit. Zusammen mit dem leichten Nebel ergab sich eine surreale Szenerie. Es roch nach Treibstoff und Abgasen, dazu einem Hauch heißen Wurstwassers, das von den Snacks stammte, die im Häuschen verkauft wurden.
Bis vor kurzem war der glatzköpfige Hüne mit dem Musketierbart noch Smart gefahren, aber ein jüngst überstandenes Abenteuer hatte verlangt, die Maschine seiner Rockervergangenheit aus der Garage zu holen. Einige nicht zugelassene offensichtliche Modifikationen hatte er rückgängig machen lassen, um die Night Rod auf der Straße fahren zu dürfen; die nicht sichtbaren blieben. Früher war Ares damit illegale Rennen gerast. Mit 179 Pferdestärken und knappen zweihundertfünfzig Kilogramm ließ man sehr viel stehen. Nun brauchte er sie, um sich legal in Leipzig zu bewegen, wenn auch meistens schneller als erlaubt.
Der Bluetooth-Stecker in seinem Ohr meldete einen eingehenden Anruf, den er mit einem kurzen Knopfdruck annahm; seine schwarze Lederjacke knirschte bei der Bewegung leise. »Löwenstein, Personaltrainer.«
»Ach, Papa«, hörte er die Stimme seiner ältesten Tochter. »Es ist Mitternacht. Du hast Feierabend.«
Ares lächelte. »Man hat nie Pause, wenn man Freiberufler ist.«
Bei zwölf getankten Litern schaltete die Automatik ab.
»Alles gut bei dir, Dolores? Wie ist die Klinik?« Er konnte nicht verhindern, dass er sich sofort um sie sorgte. Rauhe Schale, weicher Kern, sobald sein Beschützerinstinkt angesprochen wurde. Wieso rief sie um diese Uhrzeit an? Er versuchte, keine größere Beunruhigung aufkommen zu lassen. Es wird was Harmloses sein.
Denn die tödlichste Bedrohung der letzten Jahre gab es nicht mehr für sie und die Menschen, die ihm am Herzen lagen. Der Serienmörder, der Leipzig heimgesucht und seine Tochter zunächst entführt und dann schwer verletzt hatte, war tot.
Ares selbst war bei der Befreiungsaktion angeschossen worden. Während er zusammengeflickt im Krankenhaus lag und gegen die Decke starrte, kam der Moment, in dem er beschloss, wieder mehr von dem gefährlichen Mann zu sein, den er mitsamt seiner Zeit bei der Motorradgang hinter sich gelassen hatte. Die Skrupel durften weniger sein, wenn es darum ging, Ziele zu erreichen.
Er hatte der Welt wirklich die Gelegenheit gegeben, zu beweisen, dass es anders ging als mit verschärftem Nachdruck, aber er war enttäuscht worden. Schluss mit zu viel Freundlichkeit und Rücksicht gegenüber Arschlöchern. Seine eigenen Gesetze waren wieder in Kraft getreten.
»Die Leute in der Klinik geben sich Mühe, Papa«, erwiderte Dolores. »In ein paar Wochen bin ich raus.«
Mein toughes Mädchen. Wie immer wollte ihm ihr genaues Alter nicht einfallen. 21 Jahre? Die Zeit vergeht zu rasch. Ares zog den Stutzen aus der Tanköffnung, achtete darauf, dass kein Tropfen auf die Lackierung fiel, und hängte die Vorrichtung in die Halterung zurück. »Es wird Zeit. Wir vermissen dich alle.«
Er unterdrückte ein Seufzen. Es ging bei seiner Ältesten nicht um eine einfache Reha-Maßnahme. Es ging um den Kampf gegen immanente Angststörungen, die sie von der Attacke zurückbehalten hatte. Ihr ganzes Leben drohte aus den Fugen zu geraten, angefangen von ihrem Studium bis zu den einfachsten alltäglichen Abläufen.
Dolores lachte unbeschwert, und der Klang ließ sein Herz vor Freude schneller schlagen. »Ich wollte dich was fragen.«
»Schon klar.«
»Aber nicht ausrasten.«
Ares fragte sich, was genau die Warnung Aber nicht ausrasten bewirken sollte, da die Menschen automatisch in eine innerliche Habtachtstellung gingen.
Er erwiderte nichts außer einem väterlichen Brummen und ging voller böser Vorahnungen zum Kassenhäuschen, das ungefähr so groß wie eine Besenkammer war und ähnlich roch, nach nassem Hund und heißem Wurstwasser. Die Absätze seiner Boots klackten auf dem brüchigen Asphalt. Seinen Helm hatte er am rechten Griff der Maschine baumeln lassen.
»Kannst du mir Geld leihen?« Ares atmete auf. »Sicher. Wie viel? Alles über hunderttausend wird schwierig.« Ein Scherz, allerdings nur halbherzig gemeint. Geld zu besorgen fiel ihm leicht, dank der Rückkehr zur alten Form.
Das aggressive, hohe Motorengeräusch eines starken Bikes näherte sich in seinem Rücken der Tankstelle, die Gänge wurden rasch abwärts geschaltet. Die Suche nach seinem Geldbeutel hielt ihn davon ab, nach dem Fabrikat zu schauen. Dem Klang nach konnte es eine Sportmaschine sein, ein hochgezüchteter »Joghurtbecher«, wie die meist asiatischen, vollverkleideten Rennmaschinen geringschätzig von Traditionalisten genannt wurden.
»Du willst nicht wissen, warum?«
»Du wirst es brauchen. Solange es nicht für Drogen ist, gebe ich es dir.«
»Es kommen größere Anschaffungen auf mich zu, Opa. Das Kind will in ein renoviertes Zimmer«, hörte er sie sagen. Stolz und unterdrücktes Glück schwangen in ihrer Stimme mit.
Opa. Ares blieb vor der Kabine wie angewurzelt stehen. Er schluckte, bekam eine Gänsehaut vor Freude. Die Diagnose der Ärzte hatte gelautet, dass Dolores nach der Unterleibsverletzung durch den Mörder keinen Nachwuchs mehr bekommen könnte.
»Ich besorge dir auch mehr als hunderttausend«, sagte er und grinste vermutlich sehr debil, die Mundwinkel schossen in die Höhe und zogen die Bartenden mit.
Dann fiel ihm ein, dass Dolores keinen Freund hatte.
Keinen festen.
Aber es war nicht die Zeit, Fragen nach dem Vater seines Enkelkindes zu stellen. Das Wohl von Dolores und dem Nachwuchs stand im Mittelpunkt. Opa. Das Grinsen kehrte noch breiter zurück.
»Freust du dich?«
»Und wie!«, brach es aus ihm heraus, und er winkte Theo, dem Kassierer, zu, der rauchend hinter der Kasse stand und ihm lässig zunickte. Er schien sich nicht vor der explosiven Wirkung von Benzindämpfen zu fürchten oder hoffte sogar darauf, um die Versicherungssumme einzukassieren, insofern die Gesellschaft bei Selbstverschulden zahlte. »Ich …«
Jemand tippte ihm ins breite Kreuz. »Entschuldigung, darf ich mal vorbei?«, fragte eine melodische, aber nicht zu weibliche Frauenstimme.
Ares fiel auf, dass er wie eine Wand vor dem Eingang stand und den Durchgang ins Kassenhäuschen blockierte. Also machte er einen Schritt zur Seite.
An ihm ging eine zierliche Rothaarige vorbei, die einen schwarzen Kurzmantel aus Leder trug, dazu schwarze Lederhosen und Stiefel; die Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Sie roch nach einem Parfum, dessen Duft er noch nie an einer Frau wahrgenommen hatte und das sich gegen die Gerüche im Kabuff durchsetzte. Allerhöchstens reichte sie ihm bis zur unteren Brust. Vom Outfit her könnte man sie für ein Paar halten.
Ares wandte sich um und staunte.
Eine futuristisch anmutende BMW S 1000RR in Schwarz wartete aufgebockt an der Zapfsäule auf die Rückkehr ihrer Fahrerin. Auf den Tank waren drei weiße Dolche aufgesprüht worden. Wo an seiner Night Rod alles rund und geschwungen schien, gab es bei der S 1000RR nur kantiges Design.
Die perfekten Gegensätze. Ares fragte sich, wie die feingliedrige Rothaarige dieses Monstrum fuhr.
»Ich rufe dich an, wenn ich den genauen Entlassungstermin habe«, sagte Dolores in seinem rechten Ohr erleichtert, und er nickte sinnigerweise. »Das musste ich dir einfach erzählen. Noch länger hätte ich es nicht ausgehalten, ein Geheimnis draus zu machen, Opa. Und du bist nicht ausgeflippt.«
Ares lachte. »Wie könnte ich?« Da seine Tochter den Vater des Nachwuchses von sich aus nicht erwähnte, beließ er es dabei.
»Du bist der Beste, Papa!« Dolores legte auf.
Im gleichen Moment kam die Rothaarige aus dem Kassenhäuschen und ging an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten.
Sie schritt auf die BMW zu, ihr Gang war geschmeidig und lautlos wie der einer Jägerin. Das Alter ließ sich schwer schätzen, irgendwas um die vierzig. Wen man alles um Mitternacht an der Tanke trifft. Ares betrat das Innere und zog endlich den Geldbeutel hervor. Je näher er kam, desto mehr roch es nach alten Lappen, Benzin und nassem Hund, der Haschisch geraucht und Würste gefressen hatte.
»Hier, Theo.« Er reichte zehn Euro mehr als nötig über die Theke. Er mochte es, großzügig zu jenen zu sein, die es verdient hatten.
Aber der verstrubbelte Kassierer in seiner sehr fleckigen Fleecejacke schaute verliebt aus dem Fenster zu der Frau, die sich eben auf die Maschine setzte. »Die hat einen so geilen Arsch«, murmelte er zwischen zwei Zigarettenzügen; der Form nach war es eine Tüte, die er sich gebaut hatte. Damit war die Sorglosigkeit erklärt. »Hoffentlich kommt die öfter.«
»Ich gönn’s dir.« Ares vermisste einen Helm auf dem Kopf der Unbekannten. Das war nicht cool. Das war komplett unvernünftig, gerade bei einer Rennmaschine. Andererseits spielte es keine Rolle, ob man mit hundert oder knapp zweihundertachtzig Sachen gegen einen Baum prallte.
Sie ist alt genug und weiß, was sie tut, schob er die Sorge für die Unbekannte zur Seite. Die Nachwirkungen des Gesprächs mit Dolores machten ihn gerade weich. Sein Beschützerinstinkt schien stärker ausgeprägt als gewöhnlich. Sein Enkelkind würde er später niemals ohne Schutz fahren lassen.
Ein weiteres Motorrad kam angefahren, diesmal tatsächlich ein sogenannter »Joghurtbecher«, der Form nach irgendeine Honda. Das Modell kannte Ares nicht.
»Fuck«, murmelte Theo und drückte die selbstgedrehte Kippe im überfüllten Aschenbecher aus. »Die schon wieder.«
Ares verstand, was er meinte.
Der Fahrer trug die trendig gemusterte Lederkutte der HighspeedZ, einer Gang aus Berlin, die zu viele Hollywood-Streifen in Kombination mit Drogen konsumiert hatte und sich in der jungen Tradition von illegalen Straßenrennen-Machern sah. In erster Linie waren es gelangweilte Jungreiche auf der Suche nach dem Kick.
»Steigt was?«, fragte Ares.
Theo nickte abwesend und wandte die Augen nicht ab. »Gegen zwei Uhr wollten sie auf die Autobahn. Chapter-Rennen von LE nach Berlin.«
Der Mann ließ sein Bike vorrollen. Er und die Rothaarige wechselten ein paar Worte, dann stieg sie auf, während er sich schräg vor ihre Maschine schob und gestikulierte.
Ares konnte sich gegen seinen Beschützerinstinkt nicht wehren. Frauen belästigen ging gar nicht. Er legte eine Hand auf die Klinke. »Ich gehe mal nachschauen, ob sie …«
Die zierliche Frau stellte sich auf die Fußrasten, trat ansatzlos in einer geradezu akrobatischen Meisterleistung mit dem linken Bein zu und fegte den überraschten Mann vom Sattel seines Motorrads, das er mitriss. Fahrer und Maschine landeten auf dem Beton, laut splitternd brachen einige Plastikteile, und der Typ blieb einige Sekunden benommen liegen.
Währenddessen fuhr die Rothaarige einfach davon, die BMW röhrte gut hörbar.
»Wow«, entfuhr es Theo. »Leck mich am Dings: Die hat Mumm.«
Der HighspeedZ-Biker erhob sich, richtete seine Maschine wütend auf und sprang darauf, aufjaulend brauste sie los.
Ares wusste, dass er sie jagen würde. Und nach wie vor galt, dass Belästigung in seiner Gegenwart oder mit seinem Wissen nicht sein durfte.
»Bis morgen, Theo.« Er eilte zu seiner Night Rod und setzte sich den Helm auf, startete und verfolgte die beiden, bevor sie nicht mehr zu sehen waren.
Der Motor brodelte und wummerte, die Maschine schob ihn mit Wucht durch die eingetrübte Dunkelheit, stets dem milchigen Strahl des Honda-Scheinwerfers hinterher.
Vor ihm sah er den Biker, der Mühe hatte, den Anschluss an die S 1000RR zu halten. Die zierliche Frau beherrschte die Maschine zweifelsohne.
Ein Blick auf den Tacho zeigte Ares, dass er bereits mit mehr als hundert Sachen durch den Stadtbereich fuhr. Hoffentlich haben die Bullen heute Urlaub.
Nur mit sehr großer Mühe konnte er zu dem Biker aufschließen. Als er noch geschätzte fünfzig Meter von ihm weg war, jagten weitere Maschinen mit lautem, unangenehmem Surren rechts und links an ihm vorbei. Die schicken Jacken und Aufnäher machten klar, dass der gekränkte HighspeedZ-Typ sich Verstärkung geholt hatte. Freisprechanlagen in Helmen machten Kommunikation während der Fahrt jederzeit möglich. Die Rothaarige spielte sehr gekonnt mit ihren Verfolgern und verhöhnte sie. Sie ließ sie herankommen, dann gab sie kurz Gas, bog scharf ab oder vollführte tollkühne Manöver, die mehr als gefährlich waren. Es schien, als wöge die S 1000RR unter ihr nichts und wäre mit dem Boden verbunden.
Ares bemerkte, dass die Frau sie aus der Stadt lotste. Es ging auf eine Landstraße, die aus Leipzig hinausführte. Wenn sie schlau ist, hängt sie die Idioten einfach ab.
Dann verringerte sich die Geschwindigkeit der BMW, die Warnblinkanlage sprang an. Sie scherte in eine Haltebucht aus, die etwas versteckt von der Straße hinter Büschen lag, und wurde noch langsamer.
Mieses Timing für Motorschaden. Ares schaltete das Licht aus und folgte den Bikern in gemächlicher Fahrt. Er würde dafür sorgen, dass der Frau nichts geschah, und sich zu diesem Zweck anschleichen. Die HighspeedZ-Typen umkreisten die Rothaarige sofort, die ihre S 1000RR spielend leicht aufbockte, als wöge der Bolide keine geschätzte hundertachtzig Kilogramm. Die kantigen Honda- Rennmaschinen jaulten laut auf wie überwütende Hornissen. Es waren acht Gegner, alle mit Helmen und ledernen Protektorwesten ausgestattet, die einen guten Schutz gegen Schläge boten.
Ares stellte die Night Rod in sicherer Entfernung ab, verließ den Sattel und eilte geduckt im Schatten des Gebüschs zur bedrängten Frau. Dabei langte er in seine Jacke und zog einen Teleskopschlagstock heraus, mit einer kurzen Bewegung entfaltete sich der federnde Klickstock aus Karbon auf knappe vierzig Zentimeter. Den Einschlag würde man durch die Jacken spüren, Helmvisiere boten keinen Widerstand gegen die verdickte Spitze.
Ares hoffte, ihn nicht einsetzen zu müssen und durch ein paar Worte für Vernunft zu sorgen. Aber er würde nicht zögern, sollte es nötig sein, um die Rothaarige zu schützen.
Die HighspeedZ hatten ihre Maschinen kreisförmig um ihr Opfer positioniert, ließen die Lichter an und stiegen ab.
Der Biker, dessen Motorrad ramponiert aussah, zog den Helm ab und baute sich wütend vor der Rothaarigen auf.
»… wirst du büßen«, vernahm Ares, der sich herangeschlichen hatte. »Los, her mit deinem Ausweis! Ich will wissen, wo du wohnst. Du wirst mich nicht eher los, bis du mir den Schaden an meiner Maschine bezahlt hast.«
Ares fragte sich, was er wohl zu ihr an der Tankstelle gesagt hatte. Eine stillose Anmache vermutlich.
Die zierliche Frau lehnte sich locker gegen ihre S 1000RR und betrachtete den jungen blonden Mann mit arrogantem Lächeln. »Ich gebe euch die Möglichkeit, zu verschwinden. Oder eure Maschinen werden Schrott, und ihr landet alle im Krankenhaus. Ganz ohne Rennunfall.«
Bluff? Selbstüberschätzung? Ares glaubte ihr die Unerschrockenheit angesichts der Übermacht, ihre Haltung strotzte vor Souveränität. Er erinnerte sich an ihren Gang. Vermutlich war sie Kampfsportlerin. Aber gegen acht? Die in Helmen und Schutzkleidung stecken?
»Hast du dir was eingeworfen, Rotschopf?«, rief der Mann lachend und zog ein Springmesser aus der Jackentasche. »Mach jetzt hinne. Her mit dem Ausweis!« Er machte einen Schritt auf sie zu und hob den Arm mit der Klinge in der Hand. »Letzte Warnung. Oder ich verpasse dir ein paar blutige Andenken und hole mir den Ausweis selbst.«
Ares machte sich bereit, aus dem Hinterhalt einzugreifen. Die Option, mit mahnenden Worten und seinen zwei Metern Körperhöhe für Vernunft zu sorgen, ließ er fallen. Der Typ war ein feiges Arschloch. Sehr wahrscheinlich hatte die HighspeedZ-Meute noch mehr Waffen dabei.
»Du wagst es?« Die fragil wirkende Frau behielt den überheblichen Ausdruck auf dem schmalen, schönen Gesicht, hinter dem etwas Gefährliches lauerte. »Für eine letzte Warnung«, sprach sie und löste sich von der BMW, »ist es nun zu spät.«
Was dann geschah, ging viel zu rasch, als dass es Ares genau erkennen konnte.
Die Frau bewegte sich schneller als jeder Mensch, den er je in einem Kampf gesehen hatte. Seine Augen waren nicht in der Lage, ihren genauen Standort oder die Art ihrer Attacken festzuhalten. Schemenhaft erschien sie hier und dort.
Ein Biker nach dem anderen stürzte zusammen mit seiner Maschine, einige schrien auf, einige fielen ohne einen Laut. Helme wurden von den Köpfen gerissen und rollten umher, anschließend schepperte es laut, als die Rothaarige zwei davon aufhob und damit die Motorräder der HighspeedZ schwerstbeschädigte. Plastikteile flogen davon, die Scheinwerfer erloschen splitternd. Dunkelheit senkte sich auf die abgelegene Nothaltebucht.
Sie stieg über die Ohnmächtigen hinweg und warf die zerstörten Helme achtlos davon. Das schwache Licht der Gestirne schien auf ihre Züge. Sie lächelte. Kalt. Grausam.
Ares, dessen Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, überlief ein Schauder. Ganz deutlich sah er lange Fangzähne zum Vorschein kommen. Ich muss was von Theos Haschisch eingeatmet haben!
Die Rothaarige bückte sich und zog den bewusstlosen Biker an den blonden Haaren in die Höhe.
»Niemand bedroht mich mit einem Messer«, wisperte sie. »Und schneiden wolltest du mich. Dafür wirst du zahlen.« Nach kurzem Zögern biss sie ihm seitlich in die Halsschlagader und sog sein Blut aus ihm. Danach riss sie ihm den Kopf mit bloßen Händen vom Leib und schleuderte beides gegen den Baum.
Ares glaubte nicht, was er sah. Es konnte nicht sein.
Die Frau hob das Motorrad des Getöteten an und warf es mit Wucht gegen den Stamm, so dass es daran zerschellte. Anschließend zog sie ein Feuerzeug aus der Tasche und entzündete das ausgetretene Benzin.
In aller Ruhe schwang sie sich auf ihre S 1000RR und startete sie. Sie legte einen Gang ein – und hielt inne.
Langsam drehte sie den Kopf und blickte dorthin, wo Ares im Schatten stand.
Der Flammenschein beleuchtete ihr Gesicht und die roten Tropfen an ihrem Kinn. Die unerbittlichen, scheinbar dunkelgrauen Augen erfassten ihn, verengten sich für einen Herzschlag; die Farbe um die Pupillen schien ganz sachte aufzuleuchten. Ihr Blick war eine Warnung, ein Versprechen und barg eine uralte Grausamkeit, wie sie die Gegenwart nicht kannte.
Abrupt wandte sie sich um und gab Gas. Die Rennmaschine jagte davon und befand sich nach wenigen Sekunden außer Sichtweite.
Was zum … Ares blickte auf die Liegenden, die sich nicht rührten. Das Leben schenkte ihm ein Rätsel, um das er nicht gebeten hatte.
Konstantin Korff saß unter einem der zahlreichen Schirme, die sich über das schmale Barfußgässchen spannten, und trank einen doppelten Red Russian, den ihm die Bedienung nach kurzer Anweisung, wie man ihn zubereitete, gebracht hatte: Wodka, Kirschlikör, Minzblättchen, shaken, fertig. Das Irish Pub war nicht dafür bekannt, solcherart Getränke auf der Karte zu haben.
Kurz nach 18 Uhr drängten sich die Menschen rechts und links an den Tischen im Freien, die Gespräche verschmolzen zu einer lauten Geräuschkulisse, es roch nach Essen und Zigaretten. Die Wärmepilze fauchten von oben herab und verhinderten an diesem trockenkalten Winterabend, dass die Besucher froren; Vereinzelte hatten sich Decken über die Beine gelegt.
Durch die Anordnung der Tische aller Gaststätten ergab sich ein meterlanger Gang, eine Art Kopfsteinpflaster-Catwalk, auf dem die Passanten im Barfußgässchen liefen und von den Gästen gemustert wurden. Damit versiegte der Themenstoff nie.
Konstantin nahm die Umgebung wahr, interessierte sich aber nicht für das ungewollte Präsentieren der Flaneure. Er saß alleine und blätterte in diversen Zeitschriften rund ums Bestatterwesen. Das Smartphone lag umgedreht auf dem Tisch. Er trug schwarze Cargohosen und feste Schuhe, Polo-Shirt, darüber einen dicken schwarzen Mantel.
Seine dunkelbraunen Augen richteten sich auf die Zeilen, lasen die Neuigkeiten zu den Beerdigungstrends, zu veränderten Rechtsgrundlagen und dass ein Bundesland sogar plante, das Verstreuen der Asche an bestimmten Orten zu erlauben.
Als Inhaber des Ars Moriendi musste er sich keine Sorgen machen, dass durch eine solche Veränderung der Gesetze Kunden ausblieben, denn sein Bestattungsinstitut in der Nähe des Südfriedhofs lief dank des ausgezeichneten Rufs gut. Die knapp ein Dutzend Mitarbeiter konnten sich ihrer Stelle sicher sein.
Darüber hinaus arbeitete Konstantin als Thanatologe überall auf der Welt. Es gab wenige, welche die außergewöhnliche Präparierung der Verstorbenen dermaßen gut wie er beherrschten.
Meistens riefen ihn die Reichen und Mächtigen an, damit er tote Verwandte für die relative Ewigkeit behandelte. Mitunter kam es auch vor, dass er Einbalsamierte nachbearbeiten musste, wenn bei einem ersten Versuch eines Kollegen etwas misslungen war oder die Zeit ihre Spuren an den Verstorbenen hinterlassen hatte. Sogar Lenin erhielt von ihm Besuch und Behandlung.
Konstantin nippte lesend an seinem Red Russian. Der kühle Wind um sein neuerdings bartloses Gesicht fühlte sich noch ungewohnt an.
»Ideen haben die Leute«, murmelte er und grinste.
Im niederländischen Baarn hatten über hundert Bestattungsfahrzeuge einen Konvoi gebildet, der sich auf sechs Kilometer erstreckte, und damit den Weltrekord geholt.
Was wohl die Besucher dabei gedacht haben?
Er blätterte weiter und kam zu einer Berichterstattung über Online-Bestattungen, die in Amerika um sich griffen. Mittels Streaming wurden die Begräbnisse in die Welt übertragen. Mehr als eintausend Institute boten den Dienst bereits an.
Konstantin konnte sich gut vorstellen, dass es in weitläufigen Ländern wie USA, Kanada, Russland und vielleicht Australien durchaus ein Geschäftsmodell war, um die verstreute Verwandtschaft an der Beisetzung teilhaben zu lassen.
Befremdlich fand er es dennoch. Saß man zu Hause in Schwarz vor dem Monitor, oder wurde die Übertragung mit einem Beamer an die Wohnzimmerwand geworfen? Winkten die Besucher vor Ort gar in die Kamera, und stieß man zu Hause beim Leichenimbiss virtuell an?
Konstantin mochte den Gedanken, dass das Sterben den Menschen wieder nähergebracht wurde, weil es zum Leben gehörte. Aber online? War das die nächste Stufe von Online-Gedächtnisstätten? Kam danach die Webcam im Sarg mit einem Monitor auf dem Grabstein?
Nicht jede Neuerung ist eine Verbesserung.
Und wieder musste er grinsen: Zwei Seiten weiter bot ein Unternehmen eine besondere Dienstleistung an. Es presste die aschigen Überreste Verstorbener ins Vinyl und als Schallplatte. Somit spielte man auf dem Toten dessen Lieblingssongs ab. Oder sogar dessen Stimme.
Konstantin wollte nicht wissen, wie geschmacklos die Covergestaltung der Hüllen mitunter aussah. Die Zeiten ändern auch den Umgang mit dem Tod.
Seine Gedanken drifteten.
Auch sein Umgang mit dem Gevatter hatte sich gewandelt, seit er seinen eigenen Schnitterring trug, ein kostbares Kleinod für einen Todesschläfer, wie er einer war.
Brachte Konstantin früher jedem lebendigen Organismus in seiner Nähe das Ende, sobald er einschlief, konnte er nun an jedem beliebigen Ort seiner Wahl in Schlummer versinken, ohne zum Massenmörder zu werden. Er lebte mit einem gezähmten Fluch, gebändigt durch den Schmuck. Ablegen durfte er ihn daher höchstens für wenige Sekunden oder Minuten. Sonst würde der Hass des Gevatters auf den Todesschläfer ins Unermessliche steigen. Falls Konstantin gar ohne den Ring einschlief, müssten Dutzende, Hunderte, womöglich Tausende sterben.
Wie gerne wäre ich diesen Unsegen los. Konstantin klappte das Magazin nachdenklich zu und schob es auf den Tisch, nippte erneut am Drink und betrachtete dann seinen Ring aus geschnitztem, altem Elfenbein, den er an seinem linken Mittelfinger trug, weil er da am besten saß.
Er ähnelte auf seiner Oberseite einem Siegelring, in der Mitte saß ein fingernagelgroßer Harlekinopal, kreuzförmig eingespannt von vier Nelken aus Silber. Auf der Innenseite befand sich eine Gravur: ein Totenkopf.
Damit hatte sich sein Leben zum Besseren gewandelt – wobei die neu gewonnene Unbeschwertheit vor kurzem ein jähes Ende genommen hatte. Ausnahmsweise stand dies nicht mit seinem Dasein als Todesschläfer in Zusammenhang, sondern mit einem Bestattungsauftrag, der gefährliches Wissen zu ihm getragen hatte. Mehr als nur Wissen. Er musste unbedingt mit Marna darüber sprechen. Seine Freundin würde ihn als einer der wenigen Menschen auf der Welt nicht für verrückt halten, wenn er ihr berichtete, was geschehen war. Die Bedrohung lauerte in allem, was in der Lage war, zu reflektieren. Und im Schatten.
»Bist du klug, Oneiros?«, sagte eine Männerstimme auf Englisch mit Akzent.
Konstantin zuckte überrascht zusammen.
Neben ihm stand ein Mann, den er zwar aus den Augenwinkeln bemerkt, aber für einen der Kellner gehalten hatte.
Noch mehr überraschte ihn, mit dem Namen angesprochen zu werden, unter dem er bis vor einigen Jahren noch gearbeitet hatte. Als Auftragsmörder.
Gekrönt wurde seine Überraschung von dem Umstand, dass er diesen Mann neben sich nicht mehr in seinem Leben erwartet hätte. Das letzte Telefonat mit ihm hatte genau mit dieser Frage geendet. Bist du klug, Oneiros? Konstantin war die Antwort schuldig geblieben. Absichtlich.
Konstantins Anspannung schoss in die Höhe.
Der Inder im maßgeschneiderten dunklen Anzug setzte sich und brachte den Geruch eines würzigen Männerparfums mit, in dem sich Sandelholz nach vorne drängte. Sein natürlicher Teint war dunkelbraun, um Wangen und Kinn stand ein dichter, kurzer Bart, den Hals hatte er ausrasiert.
Braune Augen musterten Konstantin, auf dem Kopf trug er einen nachtlilafarbenen Turban. Seine rechte Hand hob sich, er winkte die Bedienung zu sich wie jemand, der es gewohnt war, Untergebene mit Gesten zu leiten; an der Hand schimmerten zahlreiche große Ringe in Gold und Silber.
Seine Aura wirkte. Der Kellner eilte unterwürfig heran, und der Mann deutete beiläufig auf die Mineralwasserflasche am Nachbartisch. Der Kellner nickte verstehend und huschte davon.
Konstantin wusste, wer neben ihm saß: Yama, wie er sich nannte, nach dem Hindu-Todesgott. Und Anführer der Thuggee Nidra, einer indischen Gruppierung von Todesschläfern.
Schweigend saßen sie nebeneinander.
Das Wasser wurde gebracht, der Kellner goss ein und zog sich gleich wieder zurück, als befänden sich zwei Könige am Tisch, die man nur kurz stören durfte. Und wahrlich geboten die beiden Männer über Leben und Tod in ihrer Umgebung, ohne dass es Leipzig ahnte.
In Konstantins Kopf balgten sich die verschiedensten Impulse, was zu tun und zu sagen sei. Schließlich räusperte er sich und sagte: »Ich weiß nicht, ob ich klug bin.«
»Hast du mir deswegen damals keine Antwort gegeben?«
»Ja.«
Dann zeigte Yama auf den Schnitterring. »Die Möglichkeit, Todesschläfer ungefährlich zu machen, hat damit etwas zu tun?«
»Möglich.« Konstantin wollte herausfinden, was Yama mit seinem Besuch bezweckte. Die Thuggee Nidra waren Auftragskiller, und jetzt saß ihr Anführer neben ihm, hatte vermutlich einen langen Weg von Mumbai bis nach Leipzig auf sich genommen – aber sicherlich nicht, um den Ring zu bewundern und tatenlos nach Indien zurückzukehren. Bestimmt will er Details. Um zu verhindern, dass man ihn von dem Fluch befreit.
Yama lächelte. »Die Thuggee Nidra sind besorgt, und damit bin ich es auch. Es hat sich herumgesprochen, dass Oneiros nicht mehr unterwegs ist. Dass er einen Weg fand, den Tod zu besänftigen. Dass es jedem von uns auf gleiche Weise ergehen kann, auch vielleicht gegen unseren Willen. Dabei bin ich stolz auf meine Gabe. Ihr verdanke ich sehr viel.« Der Inder zeigte mit den geschmeidebestückten Fingern auf sich und seinen Anzug. »Wohlstand. Macht.«
»Du willst Gewissheit.« Konstantin versuchte, sich seine Anspannung nicht anmerken zu lassen. Bei einem klassischen Zweikampf würde ihm sein Aikido nützlich sein, auch wenn er wusste, dass Yama ein Meister der indischen Kampfkunst Kalarippayat war.
Sein Besucher nickte andeutungsweise. »Erkläre es mir. Wenn ich es verstehe, muss ich nichts fürchten und nicht handeln.«
Das hoffe ich. Konstantin sorgte sich um Durga, die zu den Thuggee gehörte und mit der er einst ein Verhältnis gehabt hatte. Sie tauschten gelegentlich Nachrichten aus, was man der jungen Todesschläferin als Verrat auslegen konnte. Ob er mich über sie gefunden hat?
Konstantin nahm einen Schluck Red Russian und kaute auf dem Minzblättchen, das seinen frischen Geschmack schlagartig freigab. »Wir fanden eine Frau, eine Ärztin namens Isabella Dolores Sastre. Sie war in der Lage, mit dem Tod in Verbindung zu treten.«
»Demnach ist sie tot?«
Konstantin nickte. »Es gibt einige wie sie, die sich Todseher nennen. Sie wollen Leuten wie uns ein normales Leben ermöglichen und die Umwelt vor Schaden retten.« Er zeigte auf den Stein. »Sie fanden eine Möglichkeit: Wenn ein Todesschläfer einen Gevatterstein trägt, ist er für den Tod sichtbar. Der Tod spürt es, spürt mich und ist beruhigt. Weil er fühlt: Er kann mich jederzeit holen.«
»Eine Art Peilsender.« Yama trank sein Glas zügig leer. Sofort eilte der Kellner heran und goss nach, wie es gar nicht in einem Pub üblich war. »Welcher Art ist der Stein?«
»Bei mir ist es ein Harlekinopal. Diese Steine müssen eine ganze Reihe Tauglichkeiten mitbringen. Nur dann erfüllen sie ihre Funktion. Danach«, referierte Konstantin, was ihm die Ärztin vor ihrem Ableben erklärt hatte, »wird ein Stein durch einen Todseher an den Todesschläfer gebunden werden. Je stärker der Fluch …«
»Die Gabe«, verbesserte Yama bestimmt. »Du bist der Einzige, der es so sieht.«
Stumm widersprach Konstantin, dann fuhr er fort: »Je stärker die Wirkung, desto härter ist es.«
»Und wenn man den Ring ablegt?«
Konstantin wusste nicht, ob es klug war zu offenbaren, dass der Tod noch stärker wütete, sobald man den Peilsender, wie Yama es nannte, zu lange abnahm. Das könnte den Inder eher darin bestärken, es zu versuchen und seine Macht zu vergrößern. »Ist alles wie früher«, log er.
Der Mann trank vom frisch eingeschenkten Wasser und ließ seine Blicke über die Menschen schweifen, die plaudernd und lachend um sie saßen. »Sprichst du die Wahrheit, ist es weniger schrecklich, als ich angenommen habe«, befand er.
»Du musst es nicht fürchten. Der Vorgang, in dem die Steine gebunden werden, ist sehr aufwendig und nicht ohne das Wissen eines Todesschläfers zu vollziehen.« Konstantin erlaubte sich noch kein Aufatmen.
Sein umgedrehtes Smartphone summte und leuchtete gedämpft gegen die Tischplatte. Eine Nachricht war eingegangen, die er später lesen würde.
»Wie viele von den Todsehern gibt es?«
Mit dieser Frage hatte er gerechnet. »Mir sind zwei weitere bekannt. Sie leben in Amerika und Asien.« Keinesfalls würde er die Namen der Chi-Heilerin und des Chinesen preisgeben, ganz zu schweigen von der dritten Person. »Solltest du jemanden aus den Reihen der Thuggee kennen, der schlafen möchte, ohne den Tod zu bringen, stelle ich den Kontakt über …« – beinahe hätte er Durgas Namen erwähnt –, »über dich her.«
Yama lächelte mitleidig. »Keiner von uns wird seine Gabe an die Kette legen.« Seine braunen Augen richteten sich erneut auf den Ring. »Ich verstehe es nun«, sprach er. »Und ich fürchte es nicht mehr. Wer sich der Gabe und dieser Macht berauben möchte, soll es tun. Aber sollte jemand versuchen, mich oder einen von meinen Leuten zu behandeln, töte ich dich zuerst, Oneiros. Ob du was damit zu tun hast oder nicht, schert mich nicht.« Der Inder sah ihn eiskalt an. »Dich und alle, die in deiner Nähe sind. Es ist demnach in deinem und deren Interesse, dass du auf dem Laufenden bist, was die Aktivitäten der Todseher angeht.« Er erhob sich und zog einen Hunderter aus der Tasche, den er neben sein Glas legte. »Der Rest ist Trinkgeld. Namaste, Oneiros.«
Konstantin erwiderte die indische Grußfloskel nicht. Sein Sinn für Humor war in dem Augenblick erloschen, als Yama ihm drohte. Seinen Freunden. Und Marna.
Der Inder ging los und verschwand alsbald im Strom der Abendschwärmer.
Ich bin nicht sicher, ob es damit ausgestanden ist. Yama hatte sich die Erklärung angehört und würde danach trachten, sie eines Beweises zu unterziehen. Nicht, weil er Konstantin misstraute, sondern weil er lediglich dem glaubte, was er mit eigenen Augen sah.
Im Grunde müsste Konstantin die beiden Todseher anrufen und informieren, da er den Thuggee Nidra zutraute, auf irgendeine Weise Kenntnisse über sie zu erlangen. Yama war wie ein Hai: Hatte er einmal die Beute gewittert, verfolgte er sie, war die Spur noch so klein und schmal.
Konstantin nahm sein Smartphone. Genau das will er. Dass ich mit ihnen in Kontakt trete. Damit er mich belauschen kann. Statt Anrufe zu tätigen, öffnete er die Nachricht, die ihm geschickt worden war.
Ach?
Der Absender war Löwenstein, der wuchtige Personaltrainer und Theaterlaienschauspieler, der es dank seiner körperlichen Ausmaße inzwischen in kleinere TV-Filmrollen geschafft hatte. Natürlich immer als Bösewicht oder Türsteher, was nicht weit weg von der Vergangenheit des einstigen Rockers lag.
Konstantin las und wusste nicht, ob ihn Löwenstein veralbern wollte.
Korff, glauben Sie an Vampire?
Konstantin runzelte die Stirn.
Der Ex-Rocker gehörte für ihn zu dem Schlag Menschen, die erdverbunden waren und mit beiden Beinen fest im Leben standen, ohne Esoterik oder nur einem Hauch von Ahnung, was es alles gab, inklusive Todesschläfer und Todseher.
Daher schrieb er zurück:
Nein. Sie doch auch nicht. Wer fragt diesen Unsinn?
Kaum hatte er auf senden gedrückt, rauschte die Antwort rein.
Ich habe eine gesehen. Vor mir. Sie hat einen Motorradclub zerlegt.
Er dachte an seinen Lehrling im Ars Moriendi, Jaroslaf Schmolke, ein waschechter Grufti, ein Goth, wie die Menschen der schwarzen Szene genannt wurden. Manche von ihnen ließen sich aufsteckbare Zähne anfertigen, um zum Beispiel auf Partys den realistischen Anschein eines Vampirs zu erwecken. Vermutlich war Löwenstein darauf hereingefallen.
Es gibt keine Vampire! Ihr Auge hat sich täuschen lassen.
Konstantin trank den letzten Rest seines Red Russian.
Ihm ging gerade zu viel durch den eigenen Kopf, daher stand ihm nicht der Sinn nach solcher Art Korrespondenz, die seitens des Rockers kaum ernst gemeint sein konnte. Er schaltete das Nachrichtenprogramm aus.
Er musste sich einen Plan zurechtlegen, um Yama daran zu hindern, auf die Spur der Todseher zu kommen. Dem Inder traute er alles zu. Wirklich und einfach alles. Die Thuggee besaßen Einfluss, Geld und Kontakte in sämtliche Bereiche des Lebens.
Konstantin blickte sich in dem nächtlichen Leipziger Treiben um, fühlte sich allerdings weder beobachtet, noch sah er eine Person, die sich in Bezug auf ihn besonders auffällig benahm; dann wählte er Marnas Nummer. Er musste sich mit ihr treffen, um Dinge zu besprechen.
Wichtige Dinge.
Und eines davon hörte sich so merkwürdig an wie Löwensteins Frage nach Vampiren.
Da kam ihm in den Sinn, dass Vampire angeblich kein Spiegelbild besaßen.
Und keinen Schatten.
Wie beruhigend, dachte Konstantin sarkastisch und wartete darauf, dass seine Freundin abhob. Am Ende gibt es Blutsauger und andere Bestien doch.
Philipp Stahl spazierte die kopfsteingepflasterte Nikolaistraße hinauf, vorbei an der Kirche, die bei den Montagsdemonstrationen als Keimzelle und als Schutzort für die Mutigen gedient hatte.
Seine Kleidung war unauffällig, lediglich sein verwuschelter, brauner Lockenkopf konnte einem Vorbeihastenden durch Zufall ins Auge springen. Er liebte es, einer von vielen im Strom der Touristen und Einheimischen zu sein, wenn sich niemand nach ihm umdrehte. Aber es kostete ihn sehr viel Kraft, seine Aura zu zügeln, und ganz ließ sich diese Besonderheit nicht wegdrücken. Präsenz blieb Präsenz.
Der Himmel über ihm zeigte sich schneegrau, kühler Wind trieb die Menschen rasch durch die Straßen. Es roch nach Winter und Maronen, Eis knirschte unter den Schuhsohlen. Der kleine Markt, den er passierte, hielt sich wacker gegen die Kälte. Es kamen sogar Kunden, die bibbernd ihre Bestellungen hauchten und dabei weiße Wolken über blaue Lippen ausstießen.
Stahl staunte über die zahlreichen Renovierungen an den Fassaden der betagten Höfe rechts und links der Fußgängerzone, die in vollem Gange waren. Neubauten brachen allerorten aus dem Boden empor wie betonhafte Riesengewächse, flankiert von Kränen und Gerüsten. Und doch blieb das Alte meist in Form von Fassaden bestehen.
Der Seelenwanderer hatte die Stadt vermisst.
Der Ausbruch des offenen Krieges gegen Gregor Dubois forderte Opfer, sowohl materielle als auch persönliche. Leipzig war für Stahl pures Wohlfühlen, und darauf hatte er viele Wochen verzichtet, um nicht zum leichten Ziel für den gefährlichen Gegner zu werden.
Seine Abwesenheit schien die Stadt genutzt zu haben, um sich zu verschönern, zu verändern und noch mehr Turmdrehkrane aufzubauen.
Stahl sog die Eindrücke in sich auf und schloss sie ein. Davon würde er zehren, denn sein Aufenthalt war kurz. Ein Gespräch – mehr als Bittsteller denn als mächtiger Seelenwanderer –, und er reiste erneut ab. Dubois sollte es nicht zu leicht haben, ihn zu finden.
Sein Smartphone meldete sich mit dem Mars-Stück aus der Planeten-Sinfonie von Holst.
Wie passend, dachte er und nahm den Anruf entgegen. Er wusste, dass Hochschmidt an der anderen Seite saß. Mit ihr und Taranow hatte Stahl einst einen mächtigen Zusammenschluss gegen Dubois gebildet. Aber nach Taranows Eigenmächtigkeiten und seinem Tod, der aus seinen heimlichen Aktionen resultierte, standen sie zu zweit gegen ihren Feind, der zwar geschwächt, doch lange nicht bezwungen war.
»Ich bin in Leipzig«, sagte er sofort, ohne sich Zeit für eine Begrüßung zu nehmen.
»Sehr gut. Wann wirst du sie sehen?«
»Ich habe für morgen einen Termin vereinbaren können. Nicht als Stahl, sonst würde sie mich nicht empfangen. Sie erwartet einen italienischen Unternehmer aus Florenz, der Geschäfte mit VoBeLa machen möchte.«
Hochschmidt schwieg mehrere Herzschläge lang. »Du denkst, dass es klappt?«
»Sonst wäre ich nicht hier.«
»Warum fährst du nicht zu ihrer Villa?«
Stahl blieb vor dem Eingang in Specks Hof stehen und bog nach kurzem Zögern in den Durchgang ein. Er lief nicht alleine durch die Stadt. Fünf seiner necessarii begleiteten ihn, geschickt getarnt und unauffällig, aber stets in seiner Nähe, um zuschlagen zu können, sollte sich Unheil ihrem erus nähern. Zwar trug er eine SIG Sauer Mosquito mit sich, aber darauf alleine vertraute er nicht.
»Zu viele Möglichkeiten, mich nicht zu empfangen oder mich loszuwerden«, erklärte er leise, weil die Wände seine Worte reflektierten. »Sie könnte mich spielend beseitigen.«
Eine asiatische Touristengruppe strömte an ihm vorbei, die Besucher waren früh dran. Vermutlich reisten sie am gleichen Tag dank des straffen Reiseplans noch nach Berlin und Dresden.
Stahl musste nicht ausweichen. Die Menge teilte sich für ihn, als wäre er ein Felsbrocken, an dem man zu Tode gerieben werden konnte. Selbst seine gedrosselte Aura sorgte dafür, dass man Abstand zu ihm hielt wie zu einem Herrscher.
»Verstehe. In ihrem Büro wird sie es weniger wagen, ihre Kräfte gegen dich einzusetzen.«
»Zumindest hoffe ich das. Es sind zu viele Zeugen, und sie weiß, dass ich mich zur Wehr setzen würde.« Stahl hatte keinen blassen Schimmer, ob seine Gaben ausreichten, es mit Marlene von Bechstein aufzunehmen, die nach ihrer ungewollten Seelenwanderung zu einer Anomalie geworden war. Sie besaß die Fertigkeit, andere Seelen aufzulösen. Das bedeutete das ultimative Ende, ganz gleich, wie viele Seelenreisen man schon unternommen hatte. Taranow hatte ihre Macht vor Stahls Augen zu spüren bekommen und sich nicht zu wehren vermocht. Wie viele Gaben Bechstein darüber hinaus besaß, konnte er nur vermuten. »Sie wird mir hoffentlich einige Minuten Sprechzeit einräumen.«
»Nutze sie! Nutze jede Sekunde! Du musst Bechstein davon überzeugen, mit uns gegen Dubois zu ziehen«, betonte Hochschmidt und klang fast verzweifelt. »Unter allen Umständen.«
»Das weiß ich selbst«, erwiderte er barsch und erreichte einen Lichthof, in dem ein Café angesiedelt war. Er legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Schmuckkacheln an den Wänden, als wäre er das erste Mal hier. »Hast du was Neues herausgefunden?«, fragte er deutlich freundlicher. Er hatte sie nicht anfahren wollen.
»Ich habe seine kleine Burg bei Wien niederbrennen lassen, damit er versteht, dass er nirgends sicher ist. Aber mehr als ein Zeichen ist es nicht.«
»Er wird sie wieder aufbauen lassen.«
»Wird er. An den Börsen habe ich einige seiner Firmen attackiert, die Verluste können sich sehen lassen. Die Anleger verscherbeln die Aktien.« Hochschmidt gab einen Laut von sich, der ihren Unmut zum Ausdruck brachte. »Doch es bleiben Nadelstiche. Ohne das Wissen über Wien, das in Bechsteins Kopf sitzt, kommen wir nicht weiter. Die ganze Stadt ist ein einziges Dubois-Versteck. Was das Osmanische Reich nicht schaffte, wird uns auch nicht gelingen.«
»Wer sagt, dass wir sie erobern müssen?« Stahl spielte mit dem Gedanken, die Stadt niederzubrennen, um die Ratte aus dem Loch zu jagen.
»Ich bin dagegen«, hakte Hochschmidt sofort ein, da sie ahnte, was in ihm vorging. »Wir sind keine Barbaren.«
»Es ist Krieg, Marie. Dabei gehen Dinge in Flammen auf.«
»Aber keine Städte mehr. Wir haben aus dem letzten Weltkrieg gelernt.« Sie räusperte sich. »Es wäre hilfreich, wenn du ihr wenigstens die Verstecke in Wien entlocken könntest, an denen sich Dubois gerne verkriecht. Sobald wir diese ausfindig gemacht haben und stürmen konnten, werden wir hoffentlich genug Hinweise auf andere Zentralen finden. Ohne seine Rückzugsorte sollten wir ihn rascher aufspüren. Meine Leute haben sich in die Datenbanken der großen Flughäfen gehackt. Seine verschiedenen Identitäten kennen wir, und seine Privatjets sind unter Beobachtung.«
Es klang nach purer Verzweiflung, was sie gegen den Feind unternahmen. Und Stahl hörte ihr an, dass es noch etwas gab. »Was bedrückt dich?«
»Es ist kein Bedrücken. Es ist mehr ein … mulmiges Gefühl.«
»In Bezug auf?« Stahl setzte seinen Weg durch die anschließende Passage fort und bog nach links ab, um an dem kleinen Brunnen vorbeizugehen, der in einem benachbarten Lichthof stand.
»Als hätten wir etwas übersehen.« Im Hintergrund wurde leise gesprochen. »Ich schicke dir die Mail mit den Unterlagen, die ich an Land ziehen konnte.«
Stahl schlenderte in die Grimmaische und bog nach links ab. Er wollte dem Grassi- Museum einen Besuch abstatten, denn die Sonderausstellung zu Musikinstrumenten interessierte ihn sehr. Das Haus hatte Flöten, Harfen, Schalmeien und Kuriositäten zusammengetragen, die jeweils nur einmal gebaut worden waren. »Unterlagen?«
»Ich bin zerstreut, entschuldige«, sagte sie unwirsch. »In Wien hat die Stiftung Mise en Garde die beiden riesigen Flaktürme im Augarten gekauft. Angeblich will sie die Bauten instand setzen und eine Begegnungs- und Aussöhnungsstätte daraus machen.«
»Hat diese Stiftung etwas mit Dubois zu tun?«
»Er brauchte keine Stiftung. In Wien darf er sich fast alles erlauben, und deswegen bin ich stutzig geworden. Lies es dir in Ruhe durch und sag mir deine Meinung. Doch ich glaube, es könnte mehr dahinterstecken. Mise en Garde kauft überall in Europa die heruntergekommenen Nazi- Festungsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg.«
Stahls Alarmsinne schlugen an. »Klingt, als steckte ein Seelenwanderer dahinter, der sich gute, sehr sichere Verstecke reservieren will.«
»Das ist haargenau mein erster Gedanke gewesen«, sagte Hochschmidt erleichtert. »Ich vermute, diese Stiftung wird von einem Seelenwanderer als Tarnung genutzt. Er nutzt Dubois’ aktuelle Schwäche, um sich in seinem Revier niederzulassen.«
»Was nicht das Schlechteste wäre.«
»Schau dir die Anzahl von Bunkern an, die in den letzten Jahren gekauft wurden. Ich fände es nicht gut, wenn unsere Theorie stimmt, denn damit gäbe es überall Rückzugsorte für einen eventuellen neuen Gegner, in die wir nicht eben hineinmarschieren könnten.«
»Ich lese es mir durch.« Stahl wurde ungeduldig und unruhig. Je mehr er der Frau zuhörte, desto mehr schienen sich die Schlingen um sie zuzuziehen. »Sobald ich …«
»Eduardo ist tot.«
Wie auf dem Kopfsteinpflaster festgefroren blieb er stehen.
Sofort umschwärmte und umrundete ihn die Masse in der belebten Fußgängerzone. Niemand kam ihm näher als einen Meter, und niemand wunderte sich darüber. Es schien das Natürlichste von der Welt zu sein, diesem Mann gebührenden Respekt zu zeigen. Keiner wagte es, den Blick zu heben, nicht einer riss sein Smartphone oder die Kamera in die Höhe, um ein Bild von ihm zu schießen.
Stahl schluckte. »Wie?«
»Sie fanden ihn im Teatro del Giglio, in Lucca, umgeben von einer großen Wasserpfütze. Ich vermute, es war der Unbekannte, der Jagd auf Seelenwanderer macht.«
»Schick mir alles zu diesem Fall.«
»Wir sollten necessarii hinsenden.«
»Die brauchen wir im Kampf gegen Dubois«, wies er sie ein weiteres Mal unfreundlicher zurecht als beabsichtigt. Langsam ging er weiter auf den Augustusplatz und setzte sich auf eine Bank. »Meldeten sich bei dir irgendwelche von Taranows necessarii?«
»Nein. Sie sind untergetaucht. Dennoch ist es wichtig, dass wir nicht abwarten«, appellierte sie.
»Erst rede ich mit Bechstein. Danke.« Er legte auf und schloss die Augen, lehnte sich langsam nach hinten. Ruhe. Er brauchte ein bisschen innere Ruhe.
Die Sonne schien ihm ins Gesicht, die Tram fuhr ratternd und klingelnd vorbei. Verkehrslärm mischte sich mit Gesprächsfetzen, gelegentlich wehten Tabakqualm und Kaffeegeruch vorüber. Es klang vertraut und so normal alltäglich, dass es ihn entspannte.
Viele Dekaden hatte er gelebt, geherrscht, im Verborgenen die Fäden gezogen und die Mächtigen etlicher Länder an ihren Strippen tanzen lassen. Etliches hatte er auf den Weg gebracht, Europas Geschicke geführt und manche schlimmen Krisen verhindert.
»Ist alles in Ordnung, erus?«, vernahm er Peters Stimme über den kleinen Sender im linken Ohr. »Ihr seht erschöpft aus.«
Zur Antwort hob Stahl nur die Hand und blieb in seiner Position. Er hatte keine Lust, zu reden.
Seine Gedanken kreisten weiter um die anstehenden Aufgaben.
Sie mussten Dubois rasch ausschalten, und dafür benötigten sie Bechsteins Wissen. Anschließend würde der geheimnisvolle Jäger der Seelenwanderer eine Falle gestellt bekommen, und danach stand die Überprüfung der Stiftung Mise en Garde auf seiner Liste der zu erledigenden Dinge. Drei Herausforderungen für ihn und Hochschmidt.
Er öffnete die Augen und blickte hinauf zum Krochhochhaus, auf dem zwei Figuren auf je eine Glocke einschlugen und die Zeit verkündeten. Die Klänge vermochten sich kaum gegen die rumpelnden Straßenbahnen durchzusetzen, doch er vernahm sie genau.
Stahl schaltete mit einem Fingerdruck die Übertragungsfunktion seines Ohrsenders ein. »Zeit zum Mittagessen«, sagte er. »Suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Vorschläge?«
Er sah eine junge, schlanke Frau mit langen Haaren auf einem Rennrad vorbeifahren, die einen großen Dudelsack unter dem linken Arm hielt.
Auf der Litfaßsäule ihm gegenüber klebte ein Werbeflyer für eine Elektroband namens Solitary Experiments, die bald ein Konzert zusammen mit dem Gewandhausorchester geben würde. Beides war eine ungewöhnliche, spannende Kombination. Spannend wie Leipzig.
»Ich wäre für Italienisch, aber ich lasse mit mir reden.« Stahl blickte der Frau nach, die bei ihren Manövern aussah, als würde sie das Kunststück öfter vollbringen. Ihre dunklen Haare wehten im Wind.
Dudelsack. Es war lange her, dass er ihn gespielt hatte. Das letzte Mal in der Bretagne, vor mehr als dreihundert Jahren. Es waren spannende Zeiten in Guérande gewesen.
»Ist keiner hungrig?«
Niemand antwortete ihm.
Es gab nicht einmal ein leises Knacken, das auf einen Funkversuch hindeutete.
Misstrauisch wandte Stahl den zerzausten Kopf, fuhr sich durch die Haare und sah sich genau um.
Doch sosehr er sich anstrengte, er entdeckte keinen seiner necessarii.
Langsam stand er auf und zwang sich, keine hektischen Bewegungen zu machen, die einen feindlich gesinnten Beobachter annehmen ließen, er habe erkannt, dass etwas nicht stimmte. Gravierend nicht stimmte.
Stahl streckte sich, wobei er die SIG Sauer Mosquito im Achselholster mit einer unauffälligen Bewegung lockerte, falls er sie ziehen musste. Manchmal hatte ein guter Schuss Vorteile gegenüber dem Einsatz der Gaben: Er war schlicht unauffälliger, als Pflastersteine mit unsichtbarer Kraft aus dem Boden zu reißen und sie gegen Feinde zu schleudern.
»Wir sollten die Batterien der Sender prüfen«, sprach er absichtlich arglos. »Meiner hat wohl nicht mehr genug Saft. Wenn ihr mich hört: Wir treffen uns am Eingang zur Mädler-Passage, schräg gegenüber vom Gewandgäßchen.«
Stahl schwenkte in Richtung Moritzbastei und verfiel in leichtes Traben, als er das Fundament des Steilen Zahns passiert hatte.
Er lief vorbei an der Bastei und der Mensa, dann bog er in die Magazingasse ein und schlug mehrere Haken, um in einem Umweg durch den Petersbogen zu eilen und sich in der Nische eines Dönerladens niederzulassen. Von dort konnte er durch das Fenster die Straße beobachten.
Stahl wartete und hielt Ausschau, bestellte sich einen Ayran.
Aber es tauchte keine Person auf, die er kannte, weder feindliche necessarii noch Dubois noch jemand Verdächtiges. Ebenso wenig gab es spürbaren Aufruhr unter den Passanten oder Einsatzsirenen der Polizei.
Es schien, als hätten seine eigenen Leute den Dienst quittiert. Sang- und klanglos.
Stahl nippte an dem salzigen Joghurtgetränk.
Es gab mehrere Möglichkeiten, weswegen seine Leute fehlten, aber keine davon gefiel ihm. Hinter allem vermutete er Dubois und ärgerte sich. Nicht eine seiner Sicherheitsvorkehrungen schien gegriffen zu haben, der Gegner hatte genauso gelauert, war allerdings erfolgreicher als Stahl und Hochschmidt.
Aus dem Radio dudelte türkische Popmusik, die Kunden gingen ein und aus, bestellten Döner, Lahmacun, vegetarische Fladenbrotfüllungen, und es roch unglaublich gut nach geröstetem Fleisch. Kurze Worte wurden über die Theke mit den Leuten gewechselt, Lachen erklang, Wechselgeld klimperte.
Stahl gab sich keiner trügerischen Sicherheit hin, nur weil die Welt im Dönerladen in Ordnung war. Er zog sein Handy hervor und rief Hochschmidt an, erklärte ihr die Lage.
»Verschwinde aus Leipzig«, riet sie ihm aufgeregt. »Sofort.«
»Ich muss Bechstein sehen«, widersprach er und wusste doch, dass ihr Rat der bessere war. »Außerdem liegt mein Laptop im Hotelsafe.« Dass er sich mehr um seine Gottesanbeterin sorgte, verschwieg er ihr. Hetty stand auf dem Schreibtisch, in ihrer Plexiglastragebox. Man konnte ihn unvernünftig nennen, dass er das Insekt mit sich führte. Andere hatten Katzen und Hunde, die sie auf Schritt und Tritt begleiteten, er liebte Gottesanbeterinnen.
»Das lässt sich alles besorgen«, wischte sie seinen vorgeschobenen Einwand zur Seite. »Dein Leben ist wichtiger.«
Stahls Kampfgeist verbat es ihm, sich zurückzuziehen. Er wollte wissen, was mit seinen necessarii geschehen war; wollte seinen Laptop an sich nehmen; wollte seine Gottesanbeterin retten. Würde es Dubois darauf ankommen lassen, am helllichten Tag eine Breitseite gegen ihn abzufeuern?
Die ernüchternde Antwort lautete: Ja.
»Du denkst gerade darüber nach, trotzdem zurück ins Hotel zu gehen«, sagte ihm Hochschmidt auf den Kopf zu und klang wie eine Ehefrau, die ihrem Mann eine Standpauke halten wollte. »Dubois war inzwischen längst …«
»Ich melde mich später.« Stahl legte auf. Ihre Bedenken hatten ihm das nötige Quentchen Ansporn gegeben, ihrem Feind die Stirn zu bieten, wo auch immer er sich versteckte und was immer er ihm entgegenwarf. Sobald man eine Falle ahnte, war es keine gute Falle mehr.
Stahl bezahlte seinen Ayran und verließ den Laden, ging vorbei an der Thomaskirche und dem Alten Rathaus auf den Brühl und schwenkte an den grauenhaft sinnfreien Glaskästen der Höfe vorbei in die Nikolaistraße ein, um zu seinem Hotel zu gelangen.