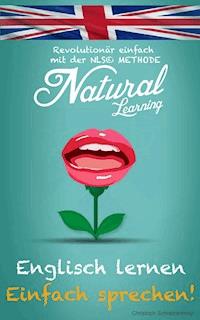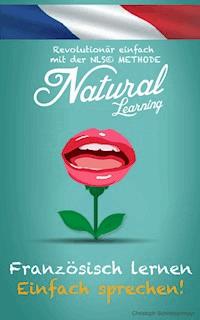Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band dokumentiert ein Forschungsprojekt zum fach- und sprachintegrierten Lehren und Lernen an Universitäten und ermöglicht so vielfältige Einblicke in das Zusammenspiel von relevanten Inhalten, anspruchsvollen Aufgaben und dialogischen Lernprozessen im universitären Fremdsprachenunterricht. Über mehrere Jahre hinweg wurden in einem Programm für Deutschlandstudien an einer japanischen Universität Daten zu den Interaktionsprozessen im Unterricht, zur Entwicklung der Lernenden und ihrer Sicht auf das Geschehen erfasst und mit Hilfe verschiedener Forschungsansätze ausgewertet. Aus der Studie ergeben sich wichtige Impulse für die Planung fach- und sprachintegrierter Programme und deren Erforschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schart
Fach- und sprachintegrierter Unterricht an der Universität
Untersuchungen zum Zusammenspiel von Inhalten, Aufgaben und dialogischen Lernprozessen
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8235-5 (Print)
ISBN 978-3-8233-0184-4 (ePub)
Inhalt
1Einleitung
Wie lassen sich im Klassenraum Bedingungen schaffen, unter denen es Lernende als sinnvoll und zugleich als persönlich bereichernd empfinden, sich in einer fremden Sprache auszutauschen, obwohl alle Anwesenden die Muttersprache teilen? Wie ermutigt man sie, ihre Gedanken, Gefühle oder Intentionen in noch wenig vertraute Worte zu fassen, dabei mit der Fremdsprache zu experimentieren und immer wieder an die Grenzen ihres Könnens zu gehen? Wie finden das Erlernen der Fremdsprache und die Beschäftigung mit relevanten Inhalten zu einer Symbiose? Und wie können Lehrende den Unterricht so arrangieren, dass er die Teilnehmenden dazu einlädt, sich als eine Lerngruppe zu verstehen, in der gemeinsam neues Wissen erschlossen und Fähigkeiten entfaltet werden?
Diese Fragen bilden eine treibende Kraft der vorliegenden Studie. Denn in der Auseinandersetzung mit ihnen entwickelte sich das Konzept von Fremdsprachenunterricht, auf das wir in den folgenden Kapiteln aus vier unterschiedlichen Perspektiven Schlaglichter werfen möchten. Es handelt sich aber zugleich auch um jene Fragen, mit denen man unweigerlich konfrontiert wird, sobald man sich auf die nunmehr fast fünf Jahrzehnte währende Geschichte des kommunikativen Paradigmas der Fremdsprachendidaktik einlässt. Auf den ersten Blick zeigt sich diese vor allem als eine Erfolgsstory: Welche Forscherin, welcher Lehrer und erst recht welcher Lehrbuchverlag würde heute noch offensiv und ohne Selbstzweifel den Anspruch von sich weisen, Teil dieser kommunikativen Bewegung zu sein?
Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch, dass das Bemühen um einen kommunikativ ausgerichteten Fremdsprachenunterricht auf vielfältige Widerstände und Beharrungstendenzen trifft, die sich über die Jahrzehnte hinweg als sehr beständig erwiesen haben. Gemeint sind damit nicht die offensichtlichen Probleme, die ihre Ursache in den institutionellen Rahmenbedingungen finden, in großen Klassen beispielsweise oder in Backwash-Effekten bestimmter Prüfungsformate. Ich denke eher an jene Hemmnisse, die sich auch in einem institutionell günstigen Umfeld unmittelbar aus den Entscheidungen über einzelne Elemente des Unterrichtsgeschehens ergeben, etwa aus der Strukturierung von Inhalten und Lernaktivitäten, aus dem kommunikativen Verhalten von Lehrenden und Lernenden bzw. ihren subjektiven Vorstellungen darüber, wie Interaktion lernförderlich organisiert werden sollte.
Als Folge kommt es zu jenen vielfach kritisierten Begleiterscheinungen des kommunikativ orientierten Fremdsprachenunterrichts, der Künstlichkeit und Realitätsferne des Austauschs im Klassenraum beispielsweise oder dem Phänomen, dass fremdsprachliches und intellektuelles Niveau nicht deutlich voneinander unterschieden werden, was gerade bei erwachsenen Lernenden leicht zur Unterforderung, wenn nicht Infantilisierung führt. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Dominanz der Lehrperson. Mit ihr geht die Tendenz einher, das interaktive Potenzial der Lerngruppe auf eine Abfolge von Zwiegesprächen oder sogar nur ein monotones Abfrageritual zu verengen. Und da ist schließlich auch die Herausforderung, Lern- und Interaktionsprozesse so zu verschmelzen, dass die Fremdsprache nicht nur als ein zu erlernender Gegenstand erlebt wird, sondern tatsächlich auch als ein Mittel, mit dem sich Handlungsabsichten erreichen lassen.
Seit Anbruch des kommunikativen Zeitalters in den 1980er Jahren verwendet die Fremdsprachendidaktik einen beträchtlichen Teil ihrer Energie darauf, solche Schwierigkeiten aufzuzeigen und ihnen mit innovativen Konzepten zu begegnen. Dabei lassen sich drei unterschiedliche Lösungsansätze beobachten. Als einen ersten, inzwischen weit verbreiteten Ansatz möchte ich die zahlreichen Versuche anführen, der Künstlichkeit des Sprechens zu entkommen, indem man die Selbstbezogenheit des Klassenraums durchbricht und direkte Kontakte zu Menschen aus der Kultur der Zielsprache aufbaut. Die vor allem durch die digitale Revolution erweiterten Möglichkeiten haben es seit den 1990er Jahren erheblich erleichtert, diese Idee in die Unterrichtspraxis umzusetzen. Es wurden eine Vielzahl von sogenannten living language links (Legutke/Müller-Hartmann 2000) für alle Niveaustufen und in unterschiedlichen Formen der Kommunikation entwickelt (Biebighäuser et al. 2012). Solche Begegnungen mit Sprecherinnen und Sprechern der Fremdsprache sind natürlich nicht auf virtuelle Räume beschränkt. Lernende können mit ihnen auch in einen unmittelbaren Austausch treten. Das beginnt mit der Einladung von Gästen in den Klassenraum, reicht über Recherchen im näheren Umfeld der Schule, etwa einem Flughafen (Legutke 2006) oder einer Jugendherberge bis hin zu Studienreisen in die betreffenden Regionen1.
Ein zweiter Lösungsansatz besteht darin, die Künstlichkeit des Geschehens selbst sinnvoll zu nutzen. Der grundlegende Gedanke dabei ist es, dass sich der Gebrauch der Fremdsprache auch dann mit realitätsnahen Handlungsintentionen verbindet, wenn der Klassenraum zu einer fiktiven oder virtuellen Welt wird, mit der sich die Lernenden tatsächlich identifizieren, weil sie für deren Entstehen und deren Entwicklung Verantwortung übernehmen. Die bereits zum traditionellen Inventar der Fremdsprachendidaktik zählenden Rollenspiele werden dadurch auf eine qualitativ neue Ebene geführt und in ihrem Lernpotenzial erheblich erweitert. Denn Lernende erhalten die Chance, selbständig Situationen in der Fremdsprache zu konstruieren, diese auszugestalten und in ihnen zu agieren. Auch zu dieser Ausformung kommunikativen Unterrichts lassen sich wiederum eine ganze Reihe didaktischer Konzepte zuordnen, etwa die Improvisationen, wie sie Kurtz (2001) beschreibt, Storyline-Projekte (Bell 2013; Kocher 1999), globale Simulationen (Arbeitsgruppe Simulationen 2005, Arendt 2003) oder Theaterprojekte (Birnbaum 2013; Kirsch 2013).
Der dritte Lösungsansatz schließlich soll im Zentrum des vorliegenden Bandes stehen. Er setzt auf die Prämisse, dass sich die Bedingungen für einen realitätsnahen Gebrauch der Fremdsprache vor allem dann verbessern, wenn die Motivation zum sprachlichen Handeln von den Inhalten ausgeht. Sobald diese Inhalte die Notwendigkeit des Fremdsprachenlernens in sich tragen, so die Hoffnung, wird gleichsam en passant authentisch kommuniziert, denn die fremde Sprache dient nur noch als ein Medium, das Informationen von Interesse und Relevanz transportiert: „the ultimate dream of Communicative Language Teaching“, wie Dalton-Puffer (2007:3) es formuliert.
Auf der Basis dieser Überlegungen entstanden in Kanada und in der Sowjetunion bereits in den frühen 1960er Jahren – und damit die kommunikative Wende vorwegnehmend – Immersionsprogramme (Snow 1993; Stryker/Leaver 1997). Diese Anstöße wurden dann ab Mitte der 1980er Jahre von der Fremdsprachendidaktik aufgegriffen und fanden in Konzepten wie dem Content-based Language Learning (CBI, auch: Modern Languages across the Curriculum; vgl. Brinton/Snow 2017; Grenfell 2002), dem bilingualen Sachfachunterricht (Diehr et al. 2016; Rüschoff et al. 2015) bzw. Content and Language Integrated Learning (CLIL, Ball et al. 2015; Coyle et al. 2010) oder dem Integrated Content and Language in Higher Education (ICLHE, Schmidt-Unterberger 2018; Smit 2015) eine sehr konsequente praktische Umsetzung.
Parallel zu diesem, dezidiert inhaltsorientierten Zugang vollzog sich innerhalb der Fremdsprachendidaktik jedoch noch eine weitere Entwicklung, die sich weniger auf die Inhalte als auf die Lehr- und Lernaktivitäten konzentrierte. Ihr lag die Idee zugrunde, dass eine realitätsnahe Interaktion im Klassenraum vor allem durch eine aufgabenbasierte Gestaltung erreicht werden könne. Rückblickend stellt sich die Frage, weshalb dabei die Inhalte zunächst vernachlässigt wurden. Natürlich finden sich eine Reihe von Publikationen, in denen diese Tendenz frühzeitig erkannt und kritisiert wurde (siehe Kap. 2.5), doch ein breiter gestreutes Bewusstsein für das große Potenzial, das sich aus den Synergieeffekten einer Verbindung von Inhalten und Aufgaben ergibt, lässt sich erst in jüngster Zeit erkennen (Ahmadian/García Mayo 2017; Rüschoff 2015).
Die Nachteile einer weitgehenden Separation dieser beiden Aspekte treten inzwischen deutlich zu Tage. Da steht beispielsweise auf Seiten des inhaltsbasierten Unterrichtens die Einsicht, dass die Interaktionsprozesse im Klassenraum allein durch die Integration fachlicher Inhalte den traditionellen, lehrerdominierten Mustern nicht entkommen (Bonnet 2013; Dalton-Puffer 2007; Hall 2010). Und da ist auf Seiten des aufgabenbasierten Unterrichts die ernüchternde Erkenntnis, dass man auch nach mehr als 30 Jahren intensiver empirischer Erforschung einzelner Aufgaben zu keinem Unterrichtskonzept gelangt ist, mit dem sich ein mehrwöchiger Kurs sinnvoll füllen ließe (Ellis 2018; Skehan 2016).
Und wenn van den Branden (2016) als einer der aktivsten Akteure auf diesem Themenfeld durchaus selbstkritisch bezweifelt, ob es weltweit überhaupt Lehrende gäbe, die das Konzept des aufgabenbasierten Lehrens und Lernens (Task based language teaching/ TBLT) tatsächlich konsequent umsetzten, so ist das ein weiterer deutlicher Ausdruck dafür, dass der Ansatz eher ein akademisches Projekt darstellt als ein praxisnahes didaktisches Modell (siehe auch Kap. 2.5). Ein Problem, dass sich nicht zuletzt auf eine einseitige Betonung der Aktivitäten zurückführen lässt.
Eine Erwiderung auf van den Brandens Bedenken liefern die Autorinnen und Autoren dieses Buches. In vier Teilstudien dokumentieren sie Antworten auf die eingangs genannten Fragen anhand eines konkreten Lehr- und Lernumfeldes – dem Intensivprogramm für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio. Und sie widerlegen dabei van den Brandens Skepsis, denn in diesem Programm werden – das kommunikative Paradigma konsequent weiterführend – der inhaltsbasierte und der aufgabenbasierte Ansatz auf sehr entschlossene Art und Weise miteinander verknüpft. Die Studie kann somit veranschaulichen, wie das Zusammenspiel von relevanten Inhalten (Kap. 2.4), anspruchsvollen Aufgaben (Kap. 2.5) und dialogischen Lernprozessen (Kap. 2.6) in der Praxis des DaF-Unterrichts vor dem Hintergrund der Bedingungen an japanischen Universitäten gestaltet werden kann. Es wird zugleich deutlich, welche Möglichkeiten dieses Konzept von Fremdsprachenunterricht eröffnet und vor welche Herausforderungen es Lehrende wie Lernende stellt.
Auch hinsichtlich des Untersuchungsdesigns zeichnet sich die Studie durch eine besondere Herangehensweise aus, denn sie vereint mehrere Forschungsperspektiven, die auf der Basis unterschiedlicher methodologischer und methodischer Überlegungen dieselben Daten fokussieren. Das ermöglicht nicht nur eine detaillierte Untersuchung des Geschehens vor Ort, sondern macht zugleich am Beispiel eines unterrichtlichen Kontextes deutlich, welchen Beitrag verschiedene Ansätze in der Fremdsprachenforschung zu einem besseren Verständnis der Lehr- und Lernprozesse leisten können – aber auch, wo ihre jeweiligen Grenzen liegen.
Die vier vertretenen Perspektiven nehmen jeweils ein eigenes Kapitel dieses Buches ein. Nachdem in einem Überblickskapitel das Forschungsdesign des Gesamtprojekts und das untersuchte Unterrichtskonzept dargestellt wurden (Kap. 2), leiten Davide Orlando und Hidemi Hamano mit einer Evaluationsstudie zum empirischen Teil des Buches über (Kap. 3). Sie greifen auf die Daten aus studentischen Unterrichtsevaluationen der Studienjahre 2009/10 bis 2015/216 zurück, wobei sie sich vor allem auf die Grundstufe (A1/ A2) konzentrieren, diese jedoch auch in den größeren Kontext des gesamten Programms einordnen. Sie stützen sich dabei sowohl auf eine statistische Auswertung als auch auf qualitative Verfahren der Datenanalyse.
Die weiteren drei Forschungsperspektiven nutzen einen anderen Datenkorpus. In den Studienjahren 2012/13 und 2015/16 wurde in zwei vergleichbaren Lerngruppen die unterrichtliche Interaktion zu jeweils einer gesamten thematischen Einheit („Wohlstandsindikatoren“ und „Rechtliche Regelungen zum Pfänden“) aufgezeichnet. Daraus ergaben sich 600 Minuten dokumentiertes Unterrichtsgespräch im Plenum und in Gruppenarbeiten, die komplett transkribiert wurden und den Ausgangspunkt für die drei unterschiedlichen Analyseansätze bilden.
Einem soziokulturellen Ansatz folgend untersucht Michael Schart in seiner Teilstudie das Lernen als einen kollektiven Prozess und betrachtet die Interaktionsmuster im Klassenraum (Kap. 4). Er verbindet dabei die soziokulturelle Diskursanalyse (Littleton/Mercer 2013) mit Verfahren, wie sie zur Untersuchung von Lern-Engagement entwickelt wurden (Lambert et al. 2017; Philp/Duchesne 2016). Sein Augenmerk liegt auf der Frage, welche Aushandlungsprozesse unter den Bedingungen des oben beschriebenen Unterrichtsdesigns stattfinden, ob bzw. wie die Lernenden zu gemeinsamer Wissensproduktion kommen und welche Rolle dabei die Materialien und die Lehrkraft spielen. Im Unterschied zu vergleichbaren Interaktionsstudien beschränkt er sich nicht auf die sprachbezogenen Episoden in der Interaktion bzw. jene Phasen, in denen der Austausch auf sprachliche Hürden stößt. Dem Schwerpunkt des Unterrichtskonzepts entsprechend, bezieht er auch die thematische Ebene in seine Analyse ein und beschreibt unterschiedliche Niveaus der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Texten bzw. Aufgabenstellungen.
Grit Liebscher und Sara Marsh befragen in Kapitel 5 die Interaktionsdaten aus konversationsanalytischer Perspektive. Am Beispiel von Situationen, in denen die Interaktion durch Lachen der Teilnehmenden unterbrochen oder begleitet wird, verdeutlichen sie, wie sich einzelne Phänomene in der unterrichtlichen Interaktion mit der Qualität der Lehr- und Lernprozesse in Verbindung bringen lassen. Ihr Beitrag veranschaulicht das Potenzial, das eine mikroanalytische Sicht auf eng begrenzte Phasen von Interaktion im Unterricht birgt.
Ein weiterer Zugang zu den Daten findet sich in Kapitel 6: Olga Czyzak wählt einen kognitiven Ansatz, denn sie interessiert sich für die individuellen Lernprozesse, die durch das Unterrichtsdesign angeregt werden. Dafür muss sie zunächst die Interaktionsdaten in ein Format bringen, in welchem sie einer Lernersprachenanalyse zugänglich werden. Ein Verfahren, das sie eingehend thematisiert, bevor sie die Sprachverwendung der einzelnen Lernenden im Hinblick auf Komplexität, Korrektheit und Wortschatz untersucht. Die Autorin kann dabei aufzeigen, wie sich der Erwerb formaler Strukturen in einem Unterricht ohne grammatischen Syllabus bis zum Zeitpunkt der Aufnahmen nach ca. 6-7 Monaten Unterricht vollzogen hat. Sie liefert damit wichtige empirische Evidenz zur fachdidaktischen Auseinandersetzung um die „richtige“ Balance zwischen Inhalt und Sprache im fach- und sprachintegrierten Unterricht und vergleichbaren Kontexten.
In den einzelnen Kapiteln zu den vier genannten Forschungsansätzen geht der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse jeweils eine eingehende Beschäftigung mit methodologischen und methodischen Aspekten voraus. Der Band möchte auf diese Weise am Beispiel eines konkreten Untersuchungskontextes auch dazu beitragen, die Interaktionsforschung als bedeutsamen Bereich der Fremdsprachendidaktik weiterzuentwickeln. Und er versteht sich ausdrücklich als eine Einladung, die Daten aus weiteren Blickwinkeln zu betrachten. Alle Daten zum Projekt sind daher frei auf einer Internetseite zugänglich2.
2Grenzgänge: Forschungsdesign und Forschungskontext
2.1Vorbemerkung
Die vorliegende Studie ist von Grenzgängen geprägt. Sie lässt sich als Gesamtprojekt nicht passgenau einschlägigen Kategorien der Fremdsprachenforschung zuordnen. Sowohl hinsichtlich des Forschungsdesigns als auch beim Forschungsgegenstand führt sie Ansätze zusammen, die in der Fremdsprachenforschung bislang eher getrennt voneinander praktiziert wurden. Dieser unkonventionelle Charakter der Studie ergibt sich unmittelbar aus ihrer Anlage, denn sie betrachtet unterrichtliches Geschehen in einem konkreten lokalen Kontext aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Gerade darin lag für die Beteiligten ein besonderer Reiz der gemeinsamen Arbeit. Aber zugleich wird es dadurch notwendig, die Problematik der Verortung des Forschungsprojekts etwas ausführlicher darzulegen, was ich mit diesem Kapitel des Bandes leisten möchte.
Das Bild von den Grenzgängen lässt sich dabei im buchstäblichen Sinne zunächst auf uns selbst beziehen, die Forschungsgruppe, die sich zu diesem Projekt zusammengefunden hat. Wir bewegen uns in unserer Arbeit zwischen Sprachen und Kulturen und leben zum größten Teil seit vielen Jahren in Ländern, die wir als zweite oder sogar dritte Heimat empfinden. Aber dieser Aspekt soll nicht im Fokus stehen, wenn ich an dieser Stelle von Grenzgängen spreche. Im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache sind solche beruflichen Biografien wohl eher der Normalfall und Kooperationen, die mehrere Kontinente überspannen, kommt ebenfalls kein Seltenheitswert zu. Weitaus wichtiger erscheint mir der Hinweis darauf zu sein, dass wir auch in unserer alltäglichen Arbeit zwischen zwei Welten pendeln, denn wir überschreiten beständig jene Grenzlinie, die zwischen Theorie und unterrichtlicher Praxis geschaffen wurde. Das liegt in der Natur unserer beruflichen Aufgaben. Es gehört zu den Besonderheiten und großen Vorzügen der DaF-Forschung außerhalb des deutschsprachigen Raumes, dass sie zumeist von Personen betrieben wird, die zur gleichen Zeit auch als Deutschlehrende tätig sind. Beide Aufgabenbereiche wechseln einander ab, gehen ineinander über oder sind – wie im vorliegenden Fall – untrennbar miteinander verwoben. Ein Aspekt, auf den in den folgenden Kapiteln noch mehrfach Bezug genommen wird.
In diesem Kapitel möchte ich mich zunächst auf zwei weitere Grenzgänge konzentrieren, die aus meiner Sicht den Charakter dieser Studie in besonderer Weise prägen. Ein erster wird bereits im Titel dieses Buches benannt und auch in der Einleitung angerissen. Er bezieht sich auf den Gegenstand unserer Untersuchung, einen Lehr- und Lernkontext, von dem sich nicht so genau sagen lässt, ob es sich nun eher um Fremdsprachenunterricht mit inhaltlichem Schwerpunkt handelt oder um thematischen Unterricht, der in einer Fremdsprache abgehalten wird (mehr dazu siehe Kap.2.4 und 2.5).
Aber auch mit Blick auf die unterschiedlichen Forschungsansätze überwinden wir mit dieser Studie einige der Grenzen, die sich in der empirischen Unterrichtsforschung der letzten Jahrzehnte etabliert und bedauerlicherweise auch verfestigt haben. Unser multiperspektivisches Vorgehen setzt somit notwendigerweise forschungsmethodologische und -methodische Überlegungen voraus, denen ich mich im folgenden Abschnitt ausführlicher zuwenden werde. Dabei geht es zum einen um die unterschiedlichen Rollen der Beteiligten im Forschungsprozess und angemessene Verfahren der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse. Zum anderen wird aber auch zur Sprache kommen, wie unterschiedlich der Prozess des Fremdsprachenlernens in den einzelnen Teilstudien konzipiert wurde, um das Unterrichtsgeschehen in einem möglichst facettenreichen Bild nachzeichnen zu können.
2.2Forschungsperspektiven
2.2.1Impulse
Der Beginn des Forschungsprojekts, das die Autorinnen und Autoren in diesem Band aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten werden, lässt sich nicht genau datieren. Es reiht sich nahtlos ein in eine Folge von Studien, die während der letzten 15 Jahre im Intensivprogramm für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio durchgeführt wurden (Kap. 2.8.2). Ein entscheidender Impuls ging jedoch von einer curricularen Veränderung im Jahr 2009 aus. Zu dieser Zeit wagten wir – u.a. als Konsequenz aus einer umfassenden Evaluation des Programms in den vorangegangenen Jahren – eine Neuausrichtung mit ungewissem Ausgang: wir1 stellten einen der Anfängerkurse konsequent auf die Prinzipien des aufgaben- und inhaltsbasierten Unterrichts um.
Seit diesem Neubeginn vor nunmehr fast zehn Jahren konzipieren wir die Aufgaben mit dem Anspruch, kollaborative Interaktion bzw. kollaboratives Lernen im Klassenraum zu fördern. Die Beschäftigung mit formalen Fragen der deutschen Sprache verlagern wir in reflexive Phasen, die der inhaltlichen Arbeit immer unter- bzw. nachgeordnet sind. Alle Materialien werden nach inhaltlichen Kriterien erstellt. Sie zeichnen sich durch einen relativ hohen Grad an Komplexität aus und bieten damit vielfältige Möglichkeiten zum selbstständigen Experimentieren und Entdecken. Die Lernenden sollen durch die Kombination von herausfordernden Aufgabenstellungen und Themen ermutigt werden, die Fremdsprache intensiver als zuvor bedeutungsbezogen und kreativ zu benutzen (siehe Kap. 2.5).
Im Zuge der Umstellung des Unterrichtskonzepts begannen wir zugleich damit, verstärkt Inhalte aus dem Fachstudium (Fachbereiche Jura und Politikwissenschaft) bereits in die ersten Unterrichtsmonate zu integrieren. Wir versuchen also, Überlegungen zum aufgabenbasierten Unterricht (TBLT), wie sie etwa von Samuda/Bygate (2008) oder Willis/Willis (2007) vorgelegt wurden, mit inhaltsbasierten Konzepten zu verbinden und unter den Bedingungen unseres Lehr- und Lernkontextes möglichst stringent umzusetzen (zum Unterrichtskonzept siehe ausführlicher Kap. 2.3 bis 2.6).
Es war nicht so, dass wir uns blauäugig in diese Herausforderung begaben. Van den Brandens (2006:1) Bedenken hinsichtlich der Alltagstauglichkeit der akademischen TBLT-Konzeptionen war für uns zu diesem Zeitpunkt weit mehr als eine Vermutung. Da wir in den Jahren zuvor bereits vielfältige Erfahrungen mit aufgaben- und inhaltsbasierten Unterrichtssettings gesammelt hatten – manche eher ernüchternd (Schart 2008), andere ermutigend (Schart 2005; Schart et al. 2010; siehe auch Kap. 2.8.2) – , waren wir uns im Klaren darüber, dass uns diese Form des Unterrichtens vor vielfältige Schwierigkeiten und Hindernisse führen würde. Wir wussten beispielsweise, mit welchen Bedenken und Widerständen wir auf Seiten der Studierenden zu rechnen hatten. Wir konnten somit absehen, dass uns ein langwieriger Prozess bevorstehen würde, in dem verschiedene Komponenten aufeinander abzustimmen wären: nicht nur die Materialentwicklung oder die Gestaltung der Interaktionsmuster, sondern auch Aspekte wie die Unterrichtsatmosphäre oder die Erwartungshaltungen sowie die Wahrnehmung des Geschehens auf Seiten aller Beteiligten. Unser gestalterischer Enthusiasmus war daher von Beginn an immer eingehegt von einer selbstkritischen Haltung und der Frage: Was bedeutet dieser Wechsel der Unterrichtskonzeption eigentlich für die Lernenden, für die Lernprozesse und für uns als verantwortliche Lehrende?
Somit ist das Erkenntnisinteresse, das dieser Studie zugrunde liegt, genuin aktionsforschender Natur, auch wenn es sich im Verlauf des Forschungsprozesses weiterentwickelte und sich letztlich zu einem multiperspektivischen Projekt mit mehreren Fragestellungen auffächerte. Unser wichtigstes Anliegen war und ist es, ein deutlicheres Bild von den Auswirkungen des eigenen Handelns als Lehrende zu bekommen, als dies durch spontane Reflexionen im oder nach dem Unterricht möglich ist. Diese ursprüngliche Motivation bringt es mit sich, dass der Charakter der vorliegenden Studie von den besonderen Merkmalen der Aktionsforschung geprägt wird (vgl. (Altrichter et al. 2018:113ff; Schart/Schocker 2013).
2.2.2Aktionsforschung
Die Aktionsforschung1 basiert auf dem bereits von (Dewey 2012 [1916]:142) formulierten Grundgedanken, dass Forschung kein Privileg von Personen darstellen dürfe, die sich hauptberuflich mit akademischer Wissensproduktion beschäftigen. Und er verwies in seinen Arbeiten immer wieder auf die Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern, ihre alltäglichen Erfahrungen mit Unterricht und Schule eingehend zu reflektieren und anhand der gewonnenen Erkenntnisse das eigene Handeln zu verbessern. Seit Deweys Tagen erlebte die Idee von forschenden Lehrenden jedoch eine sehr wechselvolle Geschichte: Zeiten der besonderen Aufmerksamkeit folgten Jahrzehnte, in denen sie kaum Beachtung fand. Sie wurde immer wieder neu entdeckt und mit unterschiedlichen Akzentsetzungen beschrieben, so dass sie uns heute in einer zuweilen verwirrenden Vielfalt von Begriffen begegnet: als Aktionsforschung oder Handlungsforschung, LehrerInnenforschung oder Praxisforschung (siehe auch Altrichter et al. 2014:285f). Noch weitaus facettenreicher stellt sich die Situation im englischsprachigen Raum dar, wo sich unter dem Oberbegriff action research zahlreiche Konzepte subsummieren lassen.2
Ungeachtet der Unterschiede im Detail und der – nicht immer überzeugenden – gegenseitigen Abgrenzungsbemühungen steht bei all diesen Konzepten das bereits von Dewey vorgezeichnete Prinzip im Zentrum: Lehrenden arbeiten kontinuierlich und selbstverantwortlich an der Weiterentwicklung ihres Arbeitsumfeldes, indem sie die eigene Praxis systematisch untersuchen. Mit der so gewonnenen empirischen Evidenz ergänzen sie ihre Intuition und ihre Erfahrungen. Sie schaffen sich gleichsam einen weiteren Trittstein, der ihnen Standsicherheit verleiht, wenn sie in den komplexen, ungewissen und mitunter auch paradoxen Situationen ihres Berufsalltags Entscheidungen treffen müssen (vgl. Schart/Legutke 2012:157ff).
Seit den 1990er Jahren lässt sich beobachten, wie dieses Verständnis von Professionalität eine stetig wachsende Bedeutung erfährt und sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fremdsprachenlehrenden etabliert.3 Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die Diskussionen um die Aktionsforschung von Beginn an immer auch geprägt waren von den Zweifeln an ihrer Realisierbarkeit und ihrem Potenzial. Kritisiert wurden und werden in erster Linie all jene Aspekte, die diese Form einer vermeintlichen Laienforschung vor dem Hintergrund akademischer Qualitätskriterien als mangelbehaftet erscheinen lassen. Die Argumente der Skeptiker haben über die zurückliegenden Jahrzehnte hinweg mehrfach ausführliche Erwiderungen erfahren – von Blum (1955) über Altrichter (1990:157ff), Zeichner/Noffke (2002) bis hin zu Greenwood (2015). Sie brauchen daher an dieser Stelle nicht ausführlich diskutiert zu werden. Ich möchte mich hier auf die beiden zentralen Kritikpunkte an einer von Lehrenden in Eigenregie betriebene Forschung konzentrieren: Sie betreffen zum einen das methodische Vorgehen beim Forschungsprozess und zum anderen die Art des generierten Wissens.
Im Hinblick auf die wissenschaftlichen Gütekriterien ist die Kritik an der Aktionsforschung leicht nachvollziehbar. Daten zu sammeln und sie zu strukturieren, ergibt noch keine Wissenschaft, wie Greenwood (2002:136) treffend bemerkt. Wer einen bestimmten Wissenschaftsbereich mit neuen Erkenntnissen bereichern will, kommt nicht umhin, die Vorleistungen anderer Forscherinnen und Forscher zu rezipieren und sich mit den methodologischen und methodischen Gepflogenheiten des betreffenden Gebietes auseinanderzusetzen. Gütekriterien wie die Objektivität, verstanden als Distanz zum untersuchten Gegenstand, und die Validität, verstanden als Gültigkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse, können dabei – je nach Fragestellung und Gegenstand – unerlässliche Qualitätskriterien darstellen.
Die Schwäche dieser Argumentation zeigt sich jedoch, sobald man die Beweggründe forschender Lehrerinnen und Lehrer in Augenschein nimmt. Einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten, gehört sicher nicht zu ihren dringlichsten Anliegen. Ihr Fokus ist vielmehr auf das eigene Arbeitsumfeld gerichtet. Der Versuch, persönliche Distanz zum Untersuchungsfeld zu schaffen, wäre somit geradezu kontraproduktiv. Und auch die Forderung nach generalisierbaren Erkenntnissen erscheint aus dieser Perspektive wenig zielführend. Ausschlaggebend ist letztlich, ob bzw. in welcher Weise der Forschungsprozess dazu beiträgt, die Praxis besser zu verstehen und sie weiterzuentwickeln.
Deshalb können forschende Lehrkräfte auch auf den zweiten der oben genannten Kritikpunkte – die Zweifel am Wert des generierten Wissens – mit Gelassenheit reagieren, liegt es doch im Wesen von Aktionsforschungsprojekten begründet, dass idiosynkratische Erkenntnisse entstehen. Eine enge Bindung des Wissens an einen lokalen Kontext erscheint unabdingbar und es ist für die Qualität solcher Unternehmungen vollkommen unerheblich, ob dabei der Stand des wissenschaftlichen Diskurses letztlich nur ein weiteres Mal bestätigt wird. Diese Sichtweise „demystifiziert“ (Bray et al. 2014) den akademischen Betrieb und stellt das traditionelle Prestigefälle zwischen Wissenschaft und Unterricht in Frage: eine nicht zu unterschätzende Triebkraft für das professionelle Selbstbewusstsein von Lehrenden.
Möglich wird diese Form von Aktionsforschung aber erst dadurch, dass Lehrende für ihre Untersuchungen auf Instrumente zur Datengewinnung und -analyse zurückgreifen können, die sie trotz ihrer vielfältigen Arbeitsaufgaben handhaben können. Prinzipiell steht ihnen zwar der gesamte Werkzeugkasten der empirischen Sozialforschung zur Verfügung, doch die begrenzten Ressourcen erfordern eine sehr genaue Abwägung von Aufwand und Nutzen. Und so sind in den letzten Jahren vielfältige alltagskompatible Ansätze von Aktionsforschung entstanden. Sie sollen Lehrende dabei unterstützen, die kritische Reflexion des eigenen Arbeitsumfeldes mit Evidenz anzureichern, ohne dafür einen wissenschaftlich fundierten und dementsprechend aufwändigen Forschungsprozess initiieren zu müssen. Zu solchen alltagskompatiblen Verfahren gelangt man beispielsweise, indem man übliche Lernaufgaben zugleich auch nutzt, um Daten über Lernprozesse zu gewinnen4, oder indem man Modelle bereitstellt, an denen sich Lehrende bei ihren Untersuchungen orientieren können5.
Sofern Lehrende ihre Aktionsforschung als eine Strategie der beruflichen Weiterentwicklung und der Verbesserung von Schule und Unterricht konzipieren, brauchen sie akademischen Qualitätsstandards nur sehr bedingt gerecht zu werden. Sie müssen weder generalisierbares Wissen anstreben noch sich punktgenau im wissenschaftlichen Diskurs verorten. Was in erster Linie zählt, ist die ökologische Validität des hervorgebrachten lokalen Wissens im Sinne der Bewährung im Unterrichtalltag. Der Frage, mit welcher Intention Lehrerinnen und Lehrer beginnen, ihr berufliches Umfeld systematischer in den Blick zu nehmen, und in welcher Rolle sie sich selbst dabei sehen, kommt somit eine maßgebliche Bedeutung zu. Diesem Punkt möchte ich mich daher genauer zuwenden.
2.2.3Rollenfindung
Für mich als einen der Lehrer in all jenen Kursen, aus denen die Daten für dieses Forschungsprojekt stammen, nahm die Studie ihren Ausgang an der Reflexion des eigenen Unterrichts. Ich wollte wissen, inwiefern es mir gelingt, durch das Zusammenspiel von Aufgaben, Materialien und Lehrerhandeln Räume für dialogische Lernprozesse zu schaffen. Wie ich weiter unten (Kap. 2.6) noch ausführlicher beschreiben werde, ging es mir also darum, zu einem besseren Verständnis der interaktiven Prozesse im Klassenraum zu gelangen. Damit sind zunächst zwei zentrale Merkmale der Aktionsforschung angesprochen: die Studie setzt an Themen an, die sich unmittelbar aus der Unterrichtspraxis ergeben und sie wird von den betroffenen Lehrenden selbst konzipiert und durchgeführt. Meine Rolle verstand ich somit von Beginn als die eines forschenden Lehrers. Ich kann mich also im weiteren Textverlauf nicht als vermeintlich objektiver Beobachter hinter der Analyse eines Geschehens verbergen, an dessen Zustandekommen ich unmittelbar beteiligt war. Die persönliche Einbindung in die untersuchten Prozesse werde ich daher immer wieder thematisieren.
Eine weitere Besonderheit der Aktionsforschung liegt darin, dass sie auf langfristige Forschungszyklen setzt. Auch das trifft auf diese Arbeit zu, denn sie ist – wie im Detail noch zu zeigen sein wird – eng verknüpft mit weiteren Studien, die sich demselben Unterrichtskontext widmen. Als im Jahr 2003 mit der empirischen Erforschung des Intensivprogramms für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio begonnen wurde, geschah dies unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit und in der Überzeugung, dass eine kontinuierliche Entwicklung von Curriculum und Unterrichtsgestaltung nur auf dem Fundament evidenzbasierter Entscheidungen möglich sein würde (siehe Kap. 3). Dass dieses Fundament durch unterschiedliche Perspektiven auf das Geschehen und methodische Herangehensweisen an Stabilität gewinnen würde, lag auf der Hand. Und so wurden von Beginn an kleinere Aktionsforschungsprojekte, die ich in einzelnen Lerngruppen durchführte, durch umfassendere Untersuchungen ergänzt, an denen auch andere Forschende teilnahmen.
Auch in der vorliegenden Studie war es daher ein naheliegender Schritt, nach Möglichkeiten zu suchen, weitere interne und externe Kolleginnen und Kollegen in den Forschungsprozess zu integrieren. In diesem Bestreben, verschiedene Sichtweisen einzubinden und das Projekt zugleich in der professionellen Gemeinschaft von Lehrenden zu verankern, spiegeln sich typische Eigenarten von Aktionsforschung. Zugleich führt diese Erweiterung jedoch auch dazu, dass der Charakter der Studie mit dem Begriff der Aktionsforschung nur unzureichend beschrieben werden kann. Da wir uns als Forschungsgruppe verstehen, die neben der kontinuierlichen Programmentwicklung auch einen Beitrag zum Wissensgenese in den Bereichen Deutsch als Fremdsprache bzw. in der Fremdsprachenforschung leisten möchte, weist unser Projekt ebenso einige Gemeinsamkeiten zum Konzept der Entwicklungsorientierten Forschung auf, was ich im Folgenden detaillierter begründen werde.
2.2.4Entwicklungsorientierte Forschung
Es gibt eine Reihe guter Gründe dafür, weshalb sich die vorliegende Studie neben der Aktionsforschung zugleich auch der Entwicklungsorientierten Forschung1 zugerechnet werden kann. In der Fremdsprachenforschung der letzten Jahre trifft dieser Ansatz auf stetig wachsende Resonanz, was sich meines Erachtens auf die Hoffnung zurückführen lässt, endlich einen Weg gefunden zu haben, die oft beschriebene und viel kritisierte Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. Die Entwicklungsorientierte Forschung verheißt somit dem akademischen Betrieb, seine Legitimation gegenüber der Praxis zu stärken.
Auch die Fachdidaktiken haben diesen Ansatz im Rahmen ihrer Bestrebungen, das forschende Lernen zu fördern, für sich entdeckt (z.B. unter der Bezeichnung „Fachdidaktische Entwicklungsforschung“, Prediger et al. 2012). Er wird als eine effektive Möglichkeit wahrgenommen, um Studierende mit dem Einsatz empirischer Methoden vertraut zu machen, die Herausbildung einer „forschenden Grundhaltung“ bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern zu fördern (Wissenschaftsrat 2001, siehe auch Fichten 2017; Lehmann/Mieg 2018) und nicht zuletzt, um Brücken aus der Welt der Theorie in den unterrichtlichen Alltag zu schlagen (z.B. (Grünewald et al. 2014; Lindner/Mayerhofer 2017). Die wissenschaftlich reflektierte Auseinandersetzung mit dem Design von Praxis wird so zu einem wichtigen Element der Vorbereitung auf die künftige Berufstätigkeit, wodurch sich wiederum die Lehramtsausbildung ihrem Charakter nach anderen Professionswissenschaften wie etwa die Architektur oder der Informatik annähert.
Aus akademischer Perspektive fällt dabei die Abgrenzung zur oben genannten Aktionsforschung leicht. Beide tragen zwar interventionistischen Charakter, aber letztere – so eine verbreitete Sichtweise – werde vornehmlich von Lehrenden selbst betrieben und kümmere sich um die Lösung vermeintlich kleinteiliger praktischer Probleme oder das Verstehen eng begrenzter Situationen (vgl. Bakker 2018:15). Die Entwicklungsorientierte Forschung tritt hingegen mit dem Anspruch auf, pädagogische Innovationen auf der Basis von Theoriewissen zu konzipieren und deren Umsetzung in der Unterrichtspraxis systematisch in einem iterativen Prozess zu untersuchen, um die Ergebnisse dann wieder in die wissenschaftliche Theoriebildung einspeisen zu können.
Ein erstes spezifisches Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung in der Fachdidaktik ergibt sich demnach aus der engen Verknüpfung von theoretischen und unterrichtspraktischen Aspekten. Im Unterschied zum experimentellen Zugang zu Lehr- und Lernprozessen, wie er beispielsweise von der psycholinguistischen Fremdsprachenforschung praktiziert wird, geht es nicht darum, die Faktorenvielfalt des Unterrichtsgeschehens auf laborähnliche Bedingungen zu reduzieren. Vielmehr akzeptiert die Entwicklungsorientierte Forschung die Komplexität gelebter Praxis und versucht, an deren Verbesserung mitzuwirken. Nicht das Überprüfen von Theorien steht im Fokus, sondern das Übersetzen von Theorien in einen konkreten unterrichtlichen Kontext. Als Ergebnis entstehen Ideen für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung unterrichtlicher Arrangements. Sie können zu neuen Materialien ebenso führen wie zu innovativen Lösungen für einzelne Unterrichtsaktivitäten oder komplette Programme. Immer jedoch wird die Intervention holistisch gedacht. Sie ergibt sich erst aus der Abwägung der im betreffenden Praxisumfeld wirkenden Faktoren und Interessen. In diesem Sinne muss sie als ein „Produkt eines Kontextes“ (Reimann 2005:63) gesehen werden. Die Qualität der Entwicklungsorientierten Forschung zeigt sich daher zunächst – und dabei deutliche Parallelen zur Aktionsforschung aufweisend – an der Innovationskraft der eingebrachten Ideen, der Nützlichkeit der Intervention und auch ihrer Nachhaltigkeit (Bakker/van Eerde 2015:6; Reinmann 2005).
Die zentrale Frage bei diesem Forschungsansatz ist somit, ob es den Handelnden tatsächlich gelingt, sich auf die Komplexität eines unterrichtlichen Kontextes einzulassen und erfolgreich Weiterentwicklungen in der Unterrichtspraxis anzustoßen. Dem steht die Gefahr entgegen, die Rolle des Interventionsdesigns überzubetonen, wie Richter/Allert (2017) anmerken. Denn das würde den Forschungsprozesses auf seine technologischen Aspekte verengen. Er empfiehlt daher als naheliegende Maßnahme, die Handelnden in der Praxis möglichst umfassend zu beteiligen, womit er freilich auf eine weitere Verbindungslinie zur Aktionsforschung verweist.
Das zweite spezifische Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung wird darin gesehen, dass die Akteurinnen und Akteure im folgenden Schritt auch die Verantwortung für ihre theoriebasierten Entwürfe übernehmen und der Frage nachgehen, welche Folgen sich aus diesen für den unterrichtlichen Alltag ergeben. Dafür steht ihnen die gesamte Palette der empirischen Verfahren zur Verfügung, denn die Entwicklungsorientierte Forschung versteht sich nicht als eine Forschungsmethode, sondern eher als ein forschungsmethodologischer Rahmen. Es wird ein iterativer Prozess in Gang gesetzt, um die Auswirkungen der Intervention gleichlaufend zu ihrer praktischen Umsetzung zu erfassen und auf der Grundlage datenbasierter Einsichten das Design immer wieder neu anzupassen. Die Unterschiede zur Aktionsforschung ergeben sich dabei wohl vor allem durch die Konsequenz, mit der die Instrumente empirischer Sozialforschung Anwendung finden und sind somit nicht grundsätzlicher, sondern allenfalls gradueller Natur.
Dass die Ergebnisse aus solchen praktischen Problemlösungen dann wiederum – vor allem in Form von Design-Prinzipien – in die Theoriebildung einfließen, macht das dritte spezifische Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung aus.2 Dieser Anspruch erzeugt jedoch ein Spannungsfeld zwischen der bereits genannten praktischen Relevanz als Gütekriterium und jenen Anforderungen, die an die Qualität wissenschaftlicher Theoriebildungsprozesse gestellt werden. Als Lösungsmöglichkeit bietet es sich an, die unterschiedlichen Perspektiven von Forschung und Praxis zum ersten anzuerkennen und zum zweiten zielgerichtet als Quelle für den Erkenntnisgewinn zu nutzen (Brahm/Jenert 2014:50). Mit ihrer Akzentuierung der Genese theoretischen Wissens hebt sich die Entwicklungsorientierte Forschung also zunächst deutlich von der Aktionsforschung ab, um sich ihr jedoch im nächsten Schritt gleich wieder anzunähern.
Diese Widersprüchlichkeit tritt auch an der Frage zu Tage, welche Reichweite die aus Entwicklungsorientierter Forschung resultierenden Theorien anstreben sollten. Während etwa Prediger (2018) den lokalen Charakter der Theorien erwähnt und damit – der Aktionsforschung gleich – die ökologische Validität betont, sehen andere Autorinnen und Autoren (z.B. Barab/Squire 2004; Collins et al. 2004; McKenney/Reeves 2012:8) den Wert dieses Vorgehens gerade in der externen Validität der Forschungsergebnisse. Sie verweisen auf das Potenzial, auch solche Theorien bzw. Gestaltungsprinzipien zu formulieren, die weit über den begrenzten Kontext hinausweisen, in dem sie entstanden sind.
Diese beiden Interpretationen zur Reichweite der Theoriebildung bei Entwicklungsorientierten Forschungsprojekten schließen sich bei genauerer Betrachtung allerdings nicht aus. Es muss vielmehr von einem Kontinuum an Möglichkeiten ausgegangen werden.3 Sie sind mithin eher ein Zeichen für die Variabilität des Ansatzes. Sowohl bei den Zielsetzungen als auch bei den Gegenständen und den beteiligten Personen bieten sich verschiedenartige Konstellationen an (Cobb et al. 2003:9f; van den Akker 2013:62ff).
So kann diese Art von Forschung beispielsweise eingesetzt werden, um theoretische Prinzipien in ein konkretes Umfeld zu überführen. Diese Variante findet sich beispielsweise dann, wenn – wie bereits eingangs dieses Kapitels erwähnt – Entwicklungsorientierte Forschung in die Ausbildung angehender Lehrender integriert wird (z.B. Gess et al. 2017; Grünewald et al. 2014; Prediger 2018). Der Ansatz erfüllt in solchen Fällen in erster Linie die Funktion, den Studierenden die Relevanz wissenschaftlicher Konzepte für Belange des Unterrichtsalltags näher zu bringen und damit ihren Professionalisierungsprozess zu unterstützen.
Eine ganz andere Situation ergibt sich, wenn es zu Kooperationen zwischen Akteuren aus der Wissenschaft und der schulischen Praxis kommt, wenn also Lehrende oder auch Schulverwaltungen nach Lösungen für ein bestehendes Problem in ihrem lokalen Kontext suchen und dabei auf akademische Expertise zurückgreifen (z.B. Sloane 2014:116). Nicht nur die Zielsetzung der Entwicklungsorientierten Forschung verschiebt sich dadurch, sondern vor allem auch die Rollenverteilung der Beteiligten. Dass letztlich die Definition der Rollen aller Beteiligten auch in der Entwicklungsorientierten Forschung ein entscheidendes Moment darstellt, wie Euler (2014b:20) hervorhebt, tritt an dieser Stelle besonders deutlich zum Vorschein. So spricht prinzipiell nichts dagegen, dass Lehrende diesen Forschungsansatz selbstverantwortlich anwenden, ohne zusätzlich externe Forschende als Experten hinzuzurufen. Gerade wenn sich die Untersuchung auf die Praxis des Hochschulunterrichts selbst bezieht, liegt diese Variante natürlich besonders nahe und sie wird im Bereich der Fremdsprachendidaktik der letzten Jahre auch zunehmend praktiziert (Aguado et al. 2013; Egbert et al. 2015; Hung 2017; Moreno/Kilpatrick 2018).
Allerdings verdeutlicht diese Tendenz auch einmal mehr, wie schwierig es ist, die Entwicklungsorientierte Forschung von der Aktionsforschung abzugrenzen.4 Für die vorliegende Studie lässt sich aus diesen Überlegungen der Schluss ziehen, dass sie an der Grenze dieser beiden Forschungsansätze anzusiedeln ist. Wie ich im vorangegangenen Abschnitt zeigte, folgt sie einerseits einem aktionsforschenden Impetus. Ich wollte als Lehrer der betreffenden Klassen in Erfahrung bringen, was eigentlich die Interaktion in meinem Unterricht ausmacht und welche typischen Muster sich erkennen lassen. Es ging also zunächst um das Verstehen, Erklären und Verbessern einer konkreten unterrichtlichen Situation. Andererseits untersucht dieses Forschungsprojekt aber nicht nur, was ist, sondern auch, was sein könnte, um eine prägnante Definition Entwicklungsorientierter Forschung von Schwartz et al. (2005:2) aufzugreifen. Damit schließt sie sich deren Anspruch an, auch Vorhersagen über Lehr- und Lernprozesse zu treffen und Designprinzipien zu formulieren (Bakker 2018:8).
Die Studie macht sich somit die Synergieeffekte nutzbar, die sich durch die Grenzgänge zwischen Forschungsansätzen ergeben. Den Prinzipien der Entwicklungsorientierten Forschung folgend, bindet sie Theorien an einen konkreten Kontext, sie beschreibt, wie auf dieser Basis Innovationen entwickelt wurden und begleitet deren Umsetzung aus verschiedenen Perspektiven. Die Untersuchung soll effektive praktische Lösungen für die Integration fachorientierter Materialien in den Anfängerunterricht und für die Organisation dialogischer Lernprozesse finden. Sie soll Aufschluss darüber erbringen, in welcher Weise dieses Design in der Unterrichtspraxis wirkt. Und nicht zuletzt soll sie einen Beitrag leisten zur Theoriebildung im Bereich des fach- und sprachintegrierten Unterrichts. Und in all diesen Zielsetzungen spiegeln sich die methodischen Prinzipien Entwicklungsorientierter Forschung, wie ich sie in diesem Abschnitt nachgezeichnet habe.
2.2.5Evaluationsforschung
Es klang bereits mehrfach an, dass noch ein weiterer Forschungsansatz Beachtung finden muss, wenn man den Charakter der vorliegenden Studie umfassend beschreiben möchte: die Evaluationsforschung1. In jener Spielart jedoch, wie sie in diesem Forschungsprojekt eingesetzt wird, gestaltet sich die Abgrenzung zu den zuvor besprochenen Forschungsansätzen als schwierig.
Der Begriff der Evaluation steht hier für eine Forschungsmaßnahme, die das untersuchte Programm über viele Jahre hinweg begleitet und dabei Erkenntnisse für dessen kontinuierliche Weiterentwicklung hervorbringt. Sie trägt also – ebenso wie die Aktionsforschung oder die Entwicklungsorientierte Forschung – deutlich iterative Züge (vgl. Gess et al. 2014). Und da die drei Forschungsansätze zugleich die große Vielfalt an möglichen methodischen Vorgehensweisen teilen, bietet sich einmal mehr der Blick auf die Rollen der Akteurinnen und Akteure an, um sie voneinander zu unterscheiden: evaluierende Forschende bewerten zwar ein Programm, aber sie sind im Unterschied zur Entwicklungsorientierten Forschung und auch zur Aktionsforschung nicht an dessen Gestaltung beteiligt. Mit dieser Definition ist zweifellos ein häufig anzutreffendes Wesensmerkmal von Evaluationen in pädagogischen Kontexten erfasst. Sie greift jedoch für die vorliegende Studie zu kurz, weshalb ich in diesem Abschnitt unser Verständnis der Evaluation und ihrer Funktion im Projekt vor dem Hintergrund der theoretischen Diskussionen zu diesem Forschungsansatz verdeutlichen möchte.
Zwei Prämissen sollten jeder Programmevaluation zugrunde liegen: Zum einen die Gewissheit, dass es kein objektives Maß für den Erfolg pädagogischer Unternehmungen geben kann – also keine „Qualität alles in allem“, wie Kromrey (2006:251) es beschreibt; und damit zum anderen das Wissen darum, dass jede Aussage über die Qualität eines Programms das Nachdenken über Sinn und Zweck der untersuchten Lehr- und Lernprozesse voraussetzt. Ohne engen Bezug zu curricularen Überlegungen fehlt einer Evaluation also der Dreh- und Angelpunkt.
Die in einem Curriculum festgehaltenen Bildungsziele entspringen pädagogischen Werturteilen, sind mithin also immer normativer Natur. Aus ihnen wird ersichtlich, welches Bild die für die Programmgestaltung Verantwortlichen von den Lernenden haben und welche Entwicklungen und Lernprozesse sie sich von ihnen erhoffen. Auch ihre Vorstellungen über die Natur des Unterrichtsgegenstandes und seine Bedeutung im Bildungsprozess werden deutlich. Nicht zuletzt lassen sich Rückschlüsse über ihre Annahmen von erfolgreichem und effektivem (Fremdsprachen)Lernen ziehen. Und selbst wenn das Curriculum eines Programms all diese Punkte ausspart und sich auf die Angabe von Unterrichtszeiten, Lerngruppengrößen, zu bearbeitenden Lehrwerken und Prüfungsformaten beschränkt, wie es im Fall des Deutschunterrichts an japanischen Universitäten häufig der Fall ist, kommen diese Werturteile implizit zum Vorschein und entfalten als Teil des hidden curriculum im Unterrichtsalltag ihre Wirkung (vgl. Jackson [1969] 2009). In Kap. 2.3 werde ich daher ausführlich auf die curricularen Grundlagen des untersuchten Unterrichts zurückkommen.
Gleichwohl entscheidet sich die Qualität eines Programms natürlich nicht daran, ob oder wie überzeugend und umfassend Bildungsziele und Bildungsprozesse curricular vorgezeichnet wurden. Ein Curriculum kann nie mehr darstellen als eine Hypothese, denn erst im Unterricht selbst, also im Zusammenwirken von Lehrenden, Lernenden, Materialien, Aufgabenstellungen und vielfältigen weiteren Kontextfaktoren nimmt es konkrete Gestalt an. Qualität entsteht immer auf der Ebene des praktischen Handelns und genau dort muss das kritische Nachfragen ansetzen. Ohne eine kontinuierliche Begleitung durch Evaluationsforschung, so die logische Konsequenz, laufen die im Curriculum niederlegten Qualitätsansprüche Gefahr, Luftschlösser zu bleiben oder von den Routinen des Unterrichtsalltags verformt zu werden. In diesem Sinne lassen sich Evaluationen – um es mit einer Metapher von Yang (2009:77) zu beschreiben – als das Herz eines Programmes verstehen, das alle anderen Elemente miteinander verbindet und ihnen die notwendige Energie zuführt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Evaluationsforschung innerhalb der internationalen Fremdsprachendidaktik zu jenen Forschungsansätzen gezählt werden muss, die sich derzeit eher am Rande der Aufmerksamkeit bewegen (vgl. Norris 2016:169).
Um die Funktion der Programmevaluation in diesem Forschungsprojekt zu verdeutlichen, möchte ich zunächst zwei unterschiedliche Zugangsweisen gegenüberstellen: den diagnostischen Ansatz und den explorativen Ansatz2. Ersterer rückt die summative, retrospektive Bewertung in den Vordergrund, fragt also nach dem zählbaren Ertrag von Bildungsprozessen. Die Studie von Pinheiro-Cadd (2018), in der die Auswirkungen einer grundlegenden Reform der Fremdsprachenausbildung an einer US-amerikanischen Universität anhand von Einschreibezahlen und erreichten Noten analysiert werden, ist hierfür ein anschauliches Beispiel. Der diagnostische Ansatz kann zugleich auf Theoriebildungsprozesse zielen, indem Aussagen über den Effekt bestimmter Maßnahmen (z.B. didaktischer Konzepte) getroffen werden. Zu diesem Zweck werden auf der Grundlage eines (quasi)experimentellen Designs komplexe Wirkungsmechanismen auf wenige Faktoren reduziert und ausgewählte Variablen nach Kausalzusammenhängen untersucht. Ein prototypisches Beispiel aus dem Bereich der Fremdsprachenforschung liefern Klapper/Rees (2003) mit ihrer Studie zum Grammatikerwerb bei variierenden Unterrichtsbedingungen.
Der explorative Ansatz hingegen trägt eher Züge einer formativen Evaluation. Die Lehr- und Lernprozesse im Programm begleitend sollen dessen Stärken und Schwächen aufgedeckt und Ansatzpunkte für Verbesserungen identifiziert werden (vgl. Scriven 1991:159; Stockmann/Meyer 2014:111ff).
Unbestritten ist natürlich, dass es der messbaren Erträge aus diagnostischen Evaluationen bedarf, um die Qualität eines Programms einschätzen zu können (vgl. Gräsel/Parchmann 2004; Helmke 2009). Doch gerade Bildungsziele, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung von Lernenden beziehen, volitionale Aspekte des Lernens ebenso berühren wie soziale, widersetzen sich einem Ursache-Wirkung-Denken und können nur langfristig und multiperspektivisch auf ihren Erfolg hin untersucht werden. Das diagnostische Modell von Evaluation tendiert hingegen dazu, Unterricht auf einen technologischen Akt zu reduzieren, der sich auf den Transfer von vermeintlich gesichertem Wissen oder von Kompetenzen richtet (vgl. die Kritik bei Schön 1983) und sich durch strukturelle Veränderungen steuern lässt. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass sich Bildungsprozesse vor allem durch die Komplexität des Geschehens auszeichnen, durch Widersprüche und Antinomien3. In den Hintergrund tritt die soziale Dimension von Unterricht, die Tatsache also, dass in pädagogischen Programmen Individuen mit ihren je eigenen Persönlichkeiten, Verhaltensweisen, Erwartungen und Interessen zusammenfinden. Im Miteinander bilden sich Beziehungen heraus, gemeinsame Routinen oder Rituale, die Breen (1985:142) als Kultur des Klassenraums beschrieben hat. Dieser besondere Charakter von Bildungsprozessen macht es nicht nur Lehrkräften unmöglich, Unterricht detailliert zu planen. Er erschwert es auch Forschenden erheblich, kausale Beziehungen in Lehr- und Lernprozessen aufzudecken.
Für die Evaluation von Programmen führen diese Überlegungen zu entscheidenden methodologischen und methodischen Konsequenzen: Da eine Fixierung auf ausgewählte Erträge und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge die Sicht auf die Vielfalt möglicher Faktoren verstellt, die den Programmalltag bestimmen, muss sie sich auch als ein „heuristisches Experiment von Forschung und Unterrichtspraxis“ (Heiner 1998:25) verstehen. Und genau diese Perspektive wird durch den explorativen Ansatz von Evaluation gestärkt; von Graves (2008:173) auch als illuminative evaluation bezeichnet. Er will nicht nur einzelne Erträge eines Programms beschreiben, sondern zugleich den Prozessen ihres Zustandekommens näherkommen (Wholey 2015).
Das Gelingen und Misslingen praktischen Handelns in sozialen Kontexten soll in seiner Vielschichtigkeit verstanden werden. Der explorative Ansatz beschränkt sich also nicht darauf zu untersuchen, was die Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt können oder wissen. Er schließt beispielsweise ebenso die Frage ein, wie sie selbst das Geschehen erleben und deuten. Und er lenkt die Aufmerksamkeit auf die im Programm ablaufenden Prozesse – etwa die Interaktion im Unterricht, die Veränderung von Einstellungen und Beziehungen oder die Etablierung von Handlungsmustern. Van Lier (2004) bezeichnet diesen umfassenden Blick auf die in Bildungsprogrammen wirkende Faktorenvielfalt als „ökologische Perspektive“. Ein Konzept, das sich in der Fremdsprachendidaktik in den letzten beiden Jahrzehnten als sehr inspirierend erwiesen hat.4 Explorative Evaluationen stellen eine Möglichkeit dar, eine solche ökologische Perspektive in konkretes Forschungshandeln zu übersetzen und damit die Weiterentwicklung eines einzelnen Programms in einem bestimmten zeitlichen und lokalen Kontext voranzutreiben.
Wie Beywl (2006) ausführlich diskutiert, kommt der Stellung der Werte im Gesamtkonzept von Evaluationen eine besondere Bedeutung zu. Der diagnostische Ansatz strebt in diesem Sinne nach Wertneutralität, liegt doch der Schwerpunkt auf der Gewinnung möglichst objektiver Informationen über das zu untersuchende Programm. Der explorative Ansatz dagegen bezieht den „personalen Faktor“ (Patton 2014) ein und muss mit Beywl (2006) als „wertpriorisierend“ bzw. „wertpositioniert“ bezeichnet werden. Er ist dadurch charakterisiert, dass die Entscheidung über die zu untersuchenden Gegenstände und Fragestellungen auf einem Aushandlungsprozess zwischen den beteiligten Personen (Stakeholdern) beruht. Deren pädagogische Wertvorstellungen prägen somit den Verlauf der Evaluation entscheidend mit. Gemeinsam wird zunächst geklärt, welche Aspekte des Programms untersuchungswürdig sind. Für den Bereich der Fremdsprachenforschung bieten die Studien von Towell/Tomlinson (1999) oder Yang (2009) anschauliche Beispiele für ein solches Vorgehen.
Wenn aber die unmittelbar involvierten Lehrenden selbst als Initiatoren der Evaluation auftreten, wie es auch in der vorliegenden Studie der Fall ist, stehen sie beständig vor der Herausforderung, eine „dialektische Bewegung zwischen Engagement und Distanzierung“ (Kardoff 2006:87) bewältigen zu müssen. In diesem Punkt weist die Evaluationsforschung deutliche Parallelen mit der Aktionsforschung auf. Um angesichts dieser Schwierigkeit nicht in eine „publikumswirksame Selbstprofilierung“ (Schnell/Kopp 2001:32) abzugleiten oder ihrer „Betriebsblindheit“ (Stockmann/Meyer 2014:88) zu erliegen, sind verschiedene Gegenmaßnahmen erforderlich.
Zum ersten kann es hilfreich sein, externe bzw. nicht unmittelbar mit dem Untersuchungsgegenstand befasste Forschende einzubeziehen, wie wir es auch in dieser Studie praktizieren.5 Zum zweiten sollte ein hoher Grad an Transparenz angestrebt werden. Mit unserer Projektseite versuchen wir, diesem Anspruch gerecht zu werden. Sie ermöglicht es, alle Forschungsinstrumente und Daten einzusehen und lädt ausdrücklich dazu ein, die Ergebnisse der Analysen nachzuvollziehen und zu hinterfragen. Zum dritten schließlich halte ich es für unabdingbar, die auf die Evaluation einwirkenden Wertvorstellungen zu thematisieren und damit der reflektierten Subjektivität als einem Kernkriterium für die Güte empirischer Forschung (Steinke 2008) nachzukommen. Die eigene Rolle im Forschungsprozess und das persönliche Verhältnis zum untersuchten Gegenstand sind daher Punkte, auf die ich immer wieder zurückkommen werde.
Die Diskussion zur Rolle der Werte zeigt, dass Evaluationen – ebenso wie die Gestaltung von Curricula – als politische Prozesse verstanden werden müssen, in denen normative Überzeugungen miteinander ringen. Aber gerade aus diesen Aushandlungsprozessen kann ein besonderer Mehrwert von Evaluationen für eine Institution erwachsen. Denn die gemeinsame Verständigung darüber, welche Kriterien bei der Bewertung einzelner Aspekte des Kurses herangezogen werden sollten, kann entscheidend zu einem Klima der Offenheit und Zusammenarbeit beitragen. Patton (2008) sieht in diesem „Prozessnutzen“ sogar einen der wesentlichen Effekte: Evaluativ zu denken, sich dabei der eigenen Werte bewusst zu werden und diese mit anderen zu diskutieren, hält er für eine notwendige Alternative zur verbreiteten „Outcome-Manie“ wertdistanzierter Evaluationen, bei der die normativen Grundlagen häufig hinter vermeintlich objektiven Leistungsmaßen versteckt würden.
Aber auch Patton möchte keineswegs auf die Erkenntnisse aus bewertenden, summativen Evaluationen verzichten. In seinem Modell einer „nutzenfokussierten Evaluation“ finden der diagnostische Ansatz und der explorative Ansatz in einer Synthese zusammen. Nach diesem Verständnis, das auch für die vorliegende Studie richtungsweisend ist, schließen sich die Beschreibung der Effektivität eines Programms und das Verstehen des Geschehens vor Ort mit seinen unterschiedlichen Einflussfaktoren nicht aus (vgl. auch Kiely 2009:32ff).
Somit steht der Begriff der Evaluation hier für einen Forschungsprozess, mit dessen Hilfe Informationen über die Struktur von Programmen und die Merkmale der in ihrem Rahmen ablaufenden alltäglichen Praxis gewonnen werden, über die Erträge und Auswirkungen des Unterrichts und nicht zuletzt über die Wahrnehmung des Geschehens durch die Beteiligten.
Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die Vielfalt an Kriterien, die sich diesem umfassenden Ansatz von Evaluation zufolge anbieten, um die Qualität eines Programms zu beschreiben. Anhand dieser Tabelle möchte ich die Forschungsschwerpunkte verdeutlichen, die wir für die vorliegende Studie gewählt haben.
Kriterien
Unterkriterien
Beispiele für zu untersuchende Aspekte
Strukturqualität
organisatorische Rahmenbedingungen
Klassengröße, Anzahl der Unterrichtsstunden, Prinzipien des Personaleinsatzes
Management und Qualitätssicherung
Grundsätze der Curriculumgestaltung, Lehrmethoden und -materialien, Führungssystem, Konzepte der Evaluation, Entwicklung und Dokumentation
Prozessqualität
Lernkultur/ Lernklima
Unterrichtsdesign, Leistungsanforderungen, Umgang miteinander, Kurs als Lebensraum, Formen der Beteiligung
Lernprozesse
Interaktionsprozesse im Unterricht, Sprechanteile von Lehrenden und Lernenden, Aufgabenverteilung im Unterricht, Gestaltung der Lernzeit außerhalb des Unterrichts
Professionalität der Lehrenden
berufliches Selbstverständnis, Verhalten gegenüber den Studierenden, Qualifikationsprofil, Fortbildung
Ergebnisqualität
Lernergebnisse
Arbeitsergebnisse der Lernenden, Fähigkeiten, Niveaustufen, Schlüsselqualifikationen, Abschlüsse/ Qualifikationen
Entwicklungsprozesse
Zufriedenheit, Persönlichkeitsbildung/ Selbstkompetenz, Engagement
Auswirkungen
Fluktuation/ Abbrecherquote, Vermittelbarkeit, Karrierewege
Aspekte von Qualität bei der Evaluation von Bildungsprogrammen (nach Ernst 2006:194; siehe auch Noris 2016:177; Scriven 1991:277ff; Rindermann 1996:241ff).
Zunächst erscheint es an dieser Stelle wichtig, noch einmal darauf zu verweisen, dass nicht das Intensivprogramm für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio in seiner Gesamtheit den Gegenstand der Untersuchung bildet. Im Fokus liegt vielmehr einer der Grundstufenkurse. Er wird jedes Jahr für Studierende des ersten Studienjahres angeboten und zeichnet sich durch seine konsequente Ausrichtung an den Prinzipien des fach- und sprachintegrierten und zugleich aufgabenbasierten Lernens aus. Es handelt sich also um eine, sich über zwei Semester erstreckende Abfolge von Unterrichtseinheiten, die hier als kohärentes Ganzes gesehen wird (vgl. Graves 2008:149), auch wenn der Kurs selbst wiederum in einem größeren curricularen Rahmen eingebunden ist (ausführlicher dazu Kap. 2.3).
Wie ich bereits weiter oben darstellte, geht es uns bei der vorliegenden Studie nicht um die Frage, ob dieses fach- und sprachintegrierte Konzept für die Grundstufe funktioniert. Dem Erkenntnisinteresse von nutzenorientierten Evaluationen folgend, wollten wir vielmehr wissen, was genau funktioniert, in welcher Weise, mit welchen Konsequenzen und warum – oder auch warum nicht (vgl. Patton 2014:48). Die Prozessqualität und die Ergebnisqualität liegen somit im Zentrum der Aufmerksamkeit.
An Tabelle 2.1 lässt sich jedoch leicht ablesen, dass wir angesichts der Vielzahl von Aspekten, die sich für eine Untersuchung anbieten, eine Auswahl treffen mussten. Die Studie wird sich daher hinsichtlich der Prozessqualität auf die Interaktion im Unterricht und auf die Lernkultur konzentrieren. Bei der Ergebnisqualität liegt die Aufmerksamkeit zum einen auf der Entwicklung der Lernersprache und zum anderen auf den Veränderungen der Selbstwahrnehmung der Lernenden, ihrer Einstellung zum Fremdsprachenlernen und ihren weiteren Lernwegen im Gesamtprogramm. Auch der Aspekt der Strukturqualität wird zur Sprache kommen, allerdings nicht als Gegenstand einer empirischen Analyse. Kap. 2.3 widmet sich in deskriptiver Form dem curricularen Rahmen und den Grundsätzen der Unterrichtsgestaltung im untersuchten Kurs.
2.2.6Zwischenbetrachtung
Nach der ausführlichen Darstellung der unterschiedlichen Forschungsperspektiven, die in dieser Studie verknüpft werden, bietet sich an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit an. Als eine erste Konsequenz aus den bisherigen Überlegungen zum Forschungsdesign lässt sich festhalten, dass wir uns an den Grenzlinien mehrerer Forschungsansätze bewegen. Aber was bedeutet das konkret für die Anlage der Studie? Aus der Aktionsforschung fließt in dieses Projekt neben den ursprünglichen Beweggründen für das Forschungsvorhaben (siehe Kap. 2.2.1) vor allem die Erkenntnis ein, dass es bedeutsam ist, mein eigenes Selbstverständnis als forschender Lehrer, meine persönliche Einbindung in das Projekt und meine Beziehung zum Gegenstand zu thematisieren.
Die Entwicklungsorientierte Forschung lenkt die Aufmerksamkeit auf die theoriegeleitete Konzeption des untersuchten Kurses. Zugleich verweist sie aber auch auf eine wichtige Zielsetzung dieses Projektes: Es will nicht nur im Sinne der Aktionsforschung konkrete Praxis verbessern, sondern strebt auch danach, einen Beitrag zur Generierung neuen theoretischen Wissens zu leisten. Die Ergebnisse unserer Analysen sollen also über den lokalen Kontext hinausweisen und damit die Entwicklung des fach- und sprachintegrierten Unterrichts im tertiären Bereich voranbringen.
Und auf die Evaluationsforschung schließlich geht der multiperspektivische Ansatz zurück, unser Bemühen also, dem Facettenreichtum von Lehr- und Lernprozessen gerecht zu werden. Die Studie bringt Forschende zusammen, die zu einem unterschiedlichen Grad in den untersuchten Kurs eingebunden sind und ihre je eigene Sicht auf das Geschehen beisteuern. Das wiederum führt zu einer in der Fremdsprachenforschung eher selten anzutreffenden Synthese: einerseits von unterschiedlichen Definitionen des Untersuchungsgegenstandes, vor allem dem Verständnis dessen, was Lernen oder Interaktion ausmachen; andererseits den sich daraus ergebenden Methoden der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse. Diese Art von Grenzgängen wird der folgende Abschnitt betrachten.
2.2.7Lernprozesse als Untersuchungsgegenstand
Im Verlauf der bisherigen Darstellung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass der Fremdsprachenunterricht – wie jede andere Form institutionalisierten Lehrens und Lernens – als ein von den Beteiligten gestalteter sozialer Prozess gedeutet werden kann und auch sollte. Die Relevanz einer solchen ökologischen Perspektive auf das Geschehen in Klassenräumen wird bereits seit den 1980er Jahren diskutiert und von Autoren wie (Block 2003), Breen (1985), Firth/Wagner (1997, 2007) Holliday/Cooke (1983), van Lier (1997), oder Tudor (2003) überzeugend dargestellt. Gleichwohl bilden empirische Studien, die sich konsequent diesem Ansatz verschreiben, nach wie vor eine Minderheit (Benson 2019:62). Das liegt vor allem an der starken Konkurrenz der psycholinguistisch orientierten Tradition, die mit ihren Themensetzungen und Vorgehensweisen die empirische Fremdsprachenforschung in den letzten Jahrzehnten dominierte. Sie lenkt das Forschungsinteresse eher auf die kognitiven Aspekte des Lernens, was wiederum mit der weit verbreiteten Vorstellung korrespondiert, dass sich Lernprozesse ausschließlich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler abspielten.
Dieser Fokus auf das Lernen als kognitiven Vorgang hat die Fremdsprachenforschung fraglos ein großes Stück vorangebracht. So wurde das Bewusstsein für die Bedeutung empirischer Untersuchungsdesigns geschärft und die Erkenntnisse konnten auch zur Weiterentwicklung didaktischer Konzepte beitragen, beispielsweise im Bereich der Aufgabengestaltung (vgl. Ellis 2018:256f; siehe dazu auch Kap. 2.5). Zugleich beflügelt die psycholinguistisch geprägten Perspektive mit ihrem grundlegenden Konzept des generalisierbaren Lerners (vgl. die Kritik bei Benson 2019:66) aber auch unrealistische Vorstellungen von den Möglichkeiten akademischer Forschung. Sie hält die in der Fremdsprachenforschung verbreitete die Annahme am Leben, Unterricht ließe sich kontextunabhängig und mit wissenschaftlich begründeten Methoden als ein potentiell vorhersehbarer und damit detailliert planbarer Prozess konzipieren.
Weshalb die Erwartungen an eine solche „Erzeugungsdidaktik“ (Arnold/Gómez Tutor 2007:178) unerfüllt bleiben müssen, wird deutlich, wenn man sich aus ökologischer Perspektive dem Fremdsprachenunterricht nähert. Die Lernenden können dann nicht mehr nur als typische Exemplare einer umfassenderen Population oder als Probanden gesehen werden. Sie sind zugleich Individuen, die in einem jeweils besonderen kulturellen, historischen oder politisch-ökonomischen Umfeld agieren. Das lernende Subjekt wird demnach in deutlicher Abgrenzung zur kognitiv orientierten Fremdsprachenforschung gedeutet. In beiden Fällen richtet sich zwar der Blick auf einzelne Lernende, aber aus ökologischer Perspektive werden diese nicht auf ihre mentalen Vorgänge reduziert. Benson schlägt deshalb vor, diesen Unterschied begrifflich deutlich zu fassen und er grenzt lernerzentrierte Ansätze von personenzentrierten Ansätzen ab.
Ob die Fremdsprachenforschung, wie Benson (2019) weiterhin argumentiert, tatsächlich gerade einen Epochenwechsel durchlebt, bei dem erstere durch letztere verdrängt werden, sehe ich als eine Prognose, die eher von der Hoffnung getragen wird als von nüchterner Analyse. Auffällig ist jedoch, dass der von Block (2003) nachgezeichnete social turn in den zurückliegenden Jahren viel Bewegung ins Forschungsfeld gebracht hat. Unter der Bezeichnung „soziokulturelle Ansätze“ ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die zu einem besseren Verständnis des komplexen Gegenstands Fremdsprachenunterricht beiträgt.
Die soziokulturellen Ansätze finden ihre theoretische Verankerung in den entwicklungspsychologischen Arbeiten von Wygotsky und Leontjev oder in den philosophischen Schriften Bachtins zum sozialen Charakter von Sprache. Die Bedeutung dieser argumentativen Verbindungslinien wurde bereits vielfach und ausführlich beschrieben (Lantolf et al. 2015; Zuengler/Miller 2006) und soll daher an dieser Stelle nicht vertieft werden. Für die vorliegende Studie sind die soziokulturellen Ansätze vor allem deshalb so inspirierend, weil sie die Rolle der Lerngruppe als eine miteinander und voneinander lernende Gemeinschaft betonen und damit die sozialen Aspekte des Lernens und der Wissensgenerierung ins Zentrum der Betrachtung rücken. Individuelle Entwicklungen werden als das Ergebnis einer Interaktion von Individuen mit ihrer kulturell geformten Umwelt gedeutet (siehe dazu auch Sloman/Fernbach 2017:107ff). Sprache ist folglich weitaus mehr als ein Input, der Lern- oder Denkprozesse auslöst. Vielmehr muss sie als eine Ressource gesehen werden, die es den Individuen ermöglicht, aktiv an einer Gruppe teilzuhaben. Mit Blick auf den Fremdsprachenunterricht ergibt sich daraus die Konsequenz, dass sich das Erlernen der Fremdsprache und ihre Verwendung nicht trennscharf voneinander scheiden lassen: „Learning is about mediated participation”, wie Lantolf/Pavlenko (2001:148) es beschreiben. Und auch bei Freeman (2016:36) findet sich dieser Gedanke:
“The conventional view that content is language with a social dimension needs to be recast. In the language classroom, the content is social processes, which have a language dimension. The social processes are fundamental to the classroom as a classroom; the new language fits into that ecology.”
Wichtig bei diesem Forschungsansatz ist, dass die Lernenden weder als „informationsverarbeitende Maschinen“1 noch als „defizitäre Versionen eines idealisierten, monolingualen Experten in Linguistik“2 gesehen werden. Sie sind aktiv und gemeinsam mit anderen an der Konstruktion von Wissen beteiligt. Das Ziel der Forschung besteht deshalb auch nicht darin, universelle Regeln des Fremdsprachenerwerbs zu formulieren, sondern die Bedingungen zu verstehen, die in einem konkreten Kontext das Lernen beeinflussen.
Vor dem Hintergrund der weiter oben erwähnten kognitiv geprägten Traditionen in der Forschung und auch in der schulischen Praxis muss die Vorstellung natürlich zunächst befremdlich wirken, das Lernen könne sich gleichsam zwischen den an einem Unterricht beteiligten Personen vollziehen, in ihrer Interaktion, dem gemeinsamen Ringen um Verstehen und dem Suchen nach Erklärungen und Lösungen. Und so ist die soziokulturelle Sicht bis heute weit davon entfernt als ein gleichwertiges Pendant zur kognitiven Perspektive anerkannt zu werden. Das mag auch an den Konsequenzen liegen, die sich aus ihr zwangsläufig ergeben. Unterricht müsste folgerichtig als eine „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold/Gómez Tutor 2007:178) gedacht werden, eine Abkehr von kleinschrittiger, eng führender Planung hin zum Schaffen von vielfältigen Lerngelegenheiten und Herausforderungen.3 Und Forschung müsste sich mehr auf den Facettenreichtum lokaler Kontexte einlassen, der Versuchung widerstehen, Komplexität vorschnell zu reduzieren und vor allem die Scheu vor idiosynkratischen Erkenntnissen überwinden.