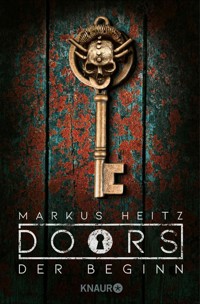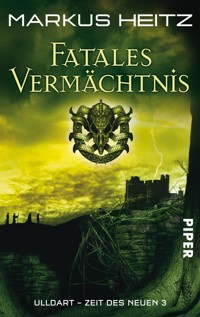
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Ereignisse auf dem Kontinent spitzen sich zu: Lodriks Tochter Zvatochna übt sich in der Magie der Nekromanten und versammelt ein Heer aus Seelen um sich. Doch nicht nur Lodrik, sondern auch Vahidin stellt sich ihr entgegen. Und die Qwor setzen ihren vernichtenden Feldzug fort. Es gibt nur eine Hoffnung: Ritter Tokaro und seine Gefährten begeben sich in Kalisstron auf die Suche nach der aldoreelischen Klinge und dem Amulett, dessen Macht allein Ulldart noch retten kann … Bestsellerautor Markus Heitz schickt die Helden seines »Ulldart«-Zyklus in die entscheidende Schlacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Markus Heitz
ULLDART – ZEIT DES NEUEN 3
Piper München Zürich
Sei unser Held! Mach mit und erlebe die Welt der Piper Fantasy.
Neugierig? Dann auf zu www.piper-fantasy.de!
Piper-Fantasy.deVollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Originalausgabe
6. Auflage Juli 2010
© Piper Verlag GmbH, München 2007
Umschlagkonzeption: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Umschlagabbildungen: Iacopo Bruno, Mailand (Landschaft) und Ciruelo, Barcelona (Emblem)
Karte: Erhard Ringer
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-492-95061-9
Da kommt sie, die Usurpatorin aus Tarpol.« Hariol, ein Mann von beinahe fünfzig Jahren, spähte durch den schmalen Spalt zwischen den fast geschlossenen Fensterläden. Unter ihm lag der glitzernde Repol, der in Donbajarsk nicht breiter als vier Speerlängen war und erst im Verlauf seiner Reise durch das Land an Breite und Mächtigkeit gewann, bis er zu einem gewaltigen Gewässer anschwoll.
Der warme Wind wehte den Geruch von frischem Backwerk und zarten, knospenden Frühlingsblüten in den Raum; die Gedanken der Versammelten hingegen waren weitaus weniger lebensfroh: Sie kreisten ausschließlich um den Tod.
Hariol sah die vier großen Prunkbarken flussaufwärts zur Anlegestelle am Großmarkt staken; auf den Brücken standen zahllose Bewohner und winkten Kabcara Norina zu. Er hob den rechten Arm und gab den hinter ihm wartenden fünf Männern und der Frau das erste Zeichen.
Sie trugen allesamt leichte Lederharnische und an ihren Schultern das Wappen Borasgotans; auf den Köpfen saßen geschlossene, einfache Helme aus mattiertem Eisen, die sowohl als Schutz in einem möglichen Gefecht als auch dazu dienten, ihre Gesichter unkenntlich zu machen. Sie reichten sich die Hände, schworen der fremden Kabcara noch einmal Verderben.
»Wir sind die Augen des Volkes«, besiegelte Pujlka, die einzige Kämpferin unter ihnen, ihre Worte. »Wir wachen über unser Land.«
»Seht sie euch an, die Verräter«, murmelte Hariol hasserfüllt hinter seinem Visier. Seine Wut richtete sich gegen die jubelnden Menschen. »Man sollte sie ebenfalls umbringen. Wie schnell sie unsere Herrscherin Elenja vergessen haben.« Er ließ die Barken nicht aus den Augen. »Haltet euch bereit. Noch geschätzte elf Speerlängen, dann sind sie genau vor uns. Die Kabcara ist auf der zweiten Barke, ihr müsst nicht einmal weit springen, um auf das Boot zu gelangen.« Er zog sein Schwert. »Für die Freiheit unseres Landes!«, rief er, und seine Mitstreiter stimmten ein.
Die Barken näherten sich langsam.
Die Herrscherin aus Tarpol drehte sich um und wandte sich den Jubelnden am Ufer sowie denen zu, die aus den Fenstern heraus winkten, dann grüßte sie die Menschen auf den Brücken.
Hariol gestand ihr zu, dass sie in dem schlichten dunkelbraunen Kleid gut aussah. Sie wirkte freundlich, die langen schwarzen Haare hatte sie hochgesteckt und mit goldenen Ranken geschmückt; es war das einzige Geschmeide an ihr.
Die Usurpatorin gab sich bescheiden, doch Hariol wusste es besser. Auf den borasgotanischen Thron gehörte eine Borasgotanerin, und alle Lügen, die in den letzten Wochen über Elenja verbreitet worden waren, änderten an seiner Ansicht nichts.
Hariol vermutete hinter den sich überschlagenden Ereignissen die Ränke aus Ulldarts Süden. Norina war eine Vertraute des dicken ilfaritischen Königs, der seine feisten Finger in zu vielen Töpfen hatte und sich in Dinge einmischte, die ihn nichts angingen. Wie zum Beispiel die Belange Borasgotans. Hariols Heimat durfte nicht zu einer heimlichen Kolonie von Ilfaris werden.
Die Barken waren noch sieben Speerlängen von ihnen entfernt.
»Gleich ist es so weit. Kommt zu mir«, sagte er angespannt und stellte den rechten Fuß auf den Schemel, von dem er sich abdrücken wollte, um zu springen. Er musterte noch einmal die jubelnde Menge. »Armselige Verräter«, murmelte er erneut. »Leere Versprechungen und ein hübsches Gesicht genügen, um euch zu täuschen.« Hariol schaute zur ersten Barke, und dabei streifte sein Blick das Haus gegenüber: Seine Fensterläden waren ebenfalls bis auf eine winzige Lücke zugezogen.
»Wenigstens einer, der sie ebenso missachtet«, bemerkte er, versöhnter mit den Städtern. Dann glaubte er in der Dunkelheit des Raumes gegenüber etwas aufblitzen zu sehen, und im nächsten Augenblick erhielt er einen Schlag gegen die Stirn. Seine Gedanken erloschen, die Welt verschwand in Schwärze.
Pujlka hörte den Einschlag, als der Pfeil mit einem metallischen Laut in den Helm fuhr, durch den Schädel jagte und aus Hariols Hinterkopf austrat. Das Geschoss besaß derart viel Wucht, dass es sich dem hinter Hariol stehenden Mann durchs Visier hindurch ins Gesicht bohrte. Es zertrümmerte Eisen und Knochen und perforierte sogar die Stirn eines dritten Mannes. Das zweite und dritte Opfer wurden durch den blutverschmierten Pfeil verbunden; gemeinsam stürzten sie auf die Dielen.
»Was …« Pujlka duckte sich rechtzeitig, um dem nächsten Angriff zu entgehen. Dieses Mal durchbrach das Geschoss den hölzernen Laden, traf den vierten Verschwörer am Hals und verletzte ihn schwer; leicht abgebremst setzte der Pfeil seinen Weg fort und tötete einen weiteren Krieger, indem er ihm durch die Rüstung ins Herz fuhr. Rot sprühte das Blut aus der Kehle und benetzte Pujlkas Rücken, während sie hastig zum Ausgang kroch.
»Fort«, rief sie dem letzten Verschwörer zu. »Wir sind verraten worden.«
Der Mann drehte sich zu ihr, machte zwei Schritte nach vorn und wollte sich ebenfalls auf den Boden werfen, da erwischte es ihn: Der Pfeil kam exakt durch das Loch gesirrt, welches das zweite Geschoss hinterlassen hatte – und schien den Mann verfehlt zu haben.
Er langte sich an den Hals und versuchte, das heraussprudelnde Blut aufzuhalten, doch der Strom intensivierte sich und quoll unaufhörlich durch die Finger. Keuchend und gurgelnd brach er zusammen, die Hand fiel kraftlos herab.
Pujlka sah, dass der Hals zu mehr als zwei Dritteln waagrecht aufgeschlitzt worden war, der Pfeil selbst steckte im Türrahmen, der stählerne Schaft zitterte leicht. Sie erkannte eine sichelmondförmige Spitze.
Hastig robbte sie hinaus und kroch die Stufen hinunter, bis sie sich sicher war, dass sie aufstehen und weglaufen konnte, ohne von einem weiteren tödlichen Geschoss getroffen zu werden. Pujlkas Verstand rang um Fassung, sie sah die toten Freunde auf dem Boden liegen und zwang sich dennoch, weiter an ihrem Vorhaben festzuhalten. Jetzt musste die Kabcara erst recht sterben, schon allein um Rache zu üben.
Wer sie verraten hatte, wusste sie nicht. Sie hätte niemals geglaubt, dass es einen Spitzel unter ihnen geben könnte, daher war sie entsprechend erschrocken und verwirrt durch die Geschehnisse. Nicht zuletzt spürte sie große Angst.
Pujlka zog den Helm ab, sodass ihre kurzen braunen Haare zum Vorschein kamen, schleuderte die blutige Rüstung von sich und wurde zu einer gewöhnlichen Bewohnerin Donbajarsks. Das Schwert verbarg sie unter ihrem Mantel.
Sie zwang sich zur Ruhe und lenkte ihre Schritte zum Marktplatz, wo sie einen zweiten Anlauf unternehmen wollte, Elenja und ihre Freunde zu rächen. Aber vielleicht durfte sie sich ihren Versuch ja sparen, und die anderen Verschwörer unter Achnovs Leitung besaßen den Beistand der Götter.
Pujlka blieb zuversichtlich, den borasgotanischen Thron verteidigen zu können, während sie sich durch die Menge schlängelte. Ganz wurde sie ihre Angst jedoch nicht los.
Norina freute sich unglaublich über den überschwänglichen Empfang, den sie so nicht erwartet hatte. Donbajarsks Brücken waren geschmückt, die Menschen winkten und jubelten.
Sie lächelte. Wäre Waljakov mitgekommen, hätte er aus Furcht vor Anschlägen jede einzelne Brücke sperren lassen. Doch Perdórs Spione hatten die Bedenken des Leibwächters zerstreut, der auf ihre Anordnung mit Stoiko im fernen Ulsar geblieben war. Donbajarsk galt nicht als Hochburg der Elenja-Anhänger, deren Zahl ohnehin verschwindend gering war. Als Herrscherin durfte sie keine Furcht zeigen, und ein Durcheinander im führungslosen Borasgotan musste vermieden werden, bis sich das Land aus eigener Kraft regieren konnte. Je schneller dies geschah, umso besser.
»Wir haben siebenundneunzig Brücken, hochwohlgeborene Kabcara«, sagte Gouverneur Rystin, der neben ihr in seiner schmucken, hellgrauen Uniform stand und den Reiseführer gab. Er war um die fünfzig Jahre und trug einen kurzen, schwarzen Bart; eine alte Narbe über dem linken Auge war das ewige Andenken an eine Schlacht, die vor langer Zeit geschlagen worden war. Perdór hielt ihn für einen ehrlichen Mann, der sich um die Menschen kümmerte anstatt um seine Reichtümer. Und so hatte sich Krutors Empfehlung, Donbajarsk zur neuen Hauptstadt zu machen, als exzellent erwiesen.
Auf ihrer Barke befanden sich die Stadtoberen und jede Menge Gardisten, die zum einen repräsentierten und zum anderen auf sie achtgaben. Norina verzichtete auch nicht auf eigene Leibwächter, die Waljakovs Schule durchlaufen hatten. Rystin seufzte zufrieden und sah zu den geschmückten Brücken. »Dabei sind die kleinen Überwege nicht eingerechnet. Alle sind zu Eurem Eintreffen beflaggt worden.«
»Ich danke Euch nochmals, Gouverneur«, erwiderte Norina mit einem Lächeln. Er hatte es ihr vor lauter Stolz bereits zum dritten Mal berichtet. Sie winkte den Menschen zu und ließ sich nicht anmerken, dass sie trotz aller Sicherheitsmaßnahmen Sorge in ihrem Herzen trug.
Die Vergangenheit hatte ihr gezeigt, dass es stets Personen gab, die Böses wollten. Stets.
So galten ihre Blicke nicht allein den vielen fröhlichen Menschen, sondern auch der eigenen Sicherheit; lediglich eine Gefahr schloss sie gänzlich aus: Elenja. Sie wurde von Lodrik gehetzt, weit weg von Donbajarsk und auf hoher See zwischen Rundopâl und Rogogard.
Rystin hob den Arm und deutete auf den Hügel, auf dem sich der Palast mit seinen vier Türmchen erhob. Er war nach der Tradition Borasgotans beinahe vollständig aus dunklem Holz erbaut worden; die Schnitzarbeiten hatten die Handwerker sicherlich über Jahre ihres Lebens beschäftigt gehalten. Blattgold und Silberbeschläge blinkten im Sonnenschein, Fahnen flatterten in einer sanften Brise. »Da oben werdet Ihr residieren, hochwohlgeborene Kabcara, über der Quelle des Repol. Wir haben den Palast im Innern umgestalten lassen, damit Ihr Euch mindestens so wohl fühlt wie in Ulsar.«
Norina sah zu einem Fenster, dessen Laden vor und zurück pendelte und in dem ein faustgroßes Loch prangte; die Ränder sahen zersplittert aus, als wäre etwas von außen hindurchgeflogen. Sie schauderte. Es wäre der ideale Ort, um einen Anschlag auszuführen. Ohne dass sie sich zu wehren vermochte, klopfte ihr Herz schneller. Die Erinnerung an die Geschehnisse in Amskwa und die Furcht, die Zvatochna ihr eingeflößt hatte, waren noch zu frisch, zu gegenwärtig. Sie lagen wie grau gefärbtes Glas über allem.
Rystin bemerkte ihren Blick. »Sorgt Euch nicht, hochwohlgeborene Kabcara«, meinte er. »Es droht keinerlei Gefahr. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass meine Anweisung, sämtliche Häuser für Eure Ankunft instand setzen zu lassen, nicht befolgt wurde. Dieser Bewohner wird noch von mir hören.« Er musterte das Loch genauer. »Das sieht freilich merkwürdig aus.« Rystin betrachtete die gegenüberliegende Fensterfront und beugte sich nach hinten, um seinen Begleitern Anweisungen zu geben. »Ich lasse das prüfen, hochwohlgeborene Kabcara.«
Norina winkte zur anderen Uferseite. »Lasst ihn nur in Frieden, werter Gouverneur, ich bitte Euch. So wie es aussieht, ist der Laden noch nicht lange beschädigt. Er wird keine Zeit mehr dazu gehabt haben, ihn herzurichten.« Sie sah ihn lächelnd an, die braunen Augen wirkten beschwichtigend. »Sendet ihm lieber ein paar Münzen, damit er das Geld hat, die Reparatur erledigen zu lassen. Richtet ihm meine besten Wünsche aus.«
Rystin schaute sie verblüfft an, dann verneigte er sich. »Ihr seid so weise, wie man es mir berichtet hat, hoheitliche Kabcara.« Dann wies er seine Leute an, die Umgebung noch genauer zu beobachten.
Norina hob den Arm und grüßte, obwohl ihre Schulter bereits schmerzte. Das Winken gehörte eben zu den Pflichten einer Herrscherin, vor allem wenn sie sich die Herzen ihrer Untertanen erst noch erobern musste. Bei erobern dachte sie ohne zu wollen an Gefechte, und ihre Augen zuckten für einen winzigen Moment zum schwingenden Laden hinauf. Ihr wurde erneut bewusst, wie leicht es ein Attentäter hatte. Waljakovs mahnendes Gesicht erschien vor ihr.
Der Palast wurde größer und größer und versprach ihr sicheren Schutz. Erst wenn sie sich hinter seinen Toren befand, würde sie sich wohler fühlen.
Dennoch überwog die Erleichterung, dass es keine Anzeichen für einen Anschlag gab. Sie wunderte sich, was ein pendelnder, beschädigter Fensterladen bei ihr auslöste. Manches Mal ist ein Fensterladen einfach nur ein Fensterladen, dachte sie und winkte weiter.
Achnov stand auf der Brücke, auf welche die Barken zusteuerten, und blickte hinauf zum Fensterladen, der vor und zurück schwang. Er trug die schlichte Kleidung eines einfachen Bauern: ein langes weißes Hemd, das über die hellbraune Hose hing; an den Füßen steckten flache Schuhe. Im wahren Leben war er Treidler, und das hatte ihm über die Jahre eine kräftige Statur eingebracht. Ein heller Bart bedeckte sein Gesicht, das lange Haar war zum Pferdeschwanz gebunden. Wo steckt er? Hariol zeigte sich nicht, und der passende Zeitpunkt, um in das Schiff der Herrscherin zu springen, verstrich mehr und mehr.
Achnov befand sich nicht allein auf der Brücke, sondern stand umgeben von zahlreichen Männern, Frauen und Kindern, die Norina willkommen heißen wollten. Er beabsichtigte genau das Gegenteil davon, und seine drei Begleiter, die in einfacher Kleidung verteilt um ihn herum warteten, würden ihn dabei unterstützen.
»Ich verstehe das nicht«, raunte Lovoc, der neben ihm lauerte, und schaute absichtlich auf den Repol, um die Aufmerksamkeit nicht auf das Fenster zu lenken. Der Blonde war im Gegensatz zu Achnov jung, ein Mann vom Land und ein leidenschaftlicher Nationalist. Die anderen Verschwörer waren Städter, teilweise von untadligem Ruf und hoch angesehen. Lovoc warf einen raschen Blick auf das Haus, wo sich noch immer nichts tat. »Es wäre…«
»Ich weiß«, unterbrach Achnov ihn missmutig. »Für so feige hätte ich ihn nicht gehalten. Hat seine Krämerseele letztlich doch über die Liebe zu Borasgotan gesiegt.«
Lovoc schnaubte, die Rechte ballte sich zur Faust. »Was nun?«
Er sah zu den Barken, klatschte leidlich begeistert und dachte fieberhaft nach. »Hier ist zu wenig Platz«, entschied er. »Sag den anderen, dass wir uns auf der großen Pelzbrücke treffen. Sie sollen die Wappen offen tragen, damit alle sehen, dass wir aufrechte Patrioten sind und keine gedungenen Attentäter.« Achnov löste sich vom Geländer. »Beeilt euch. Wir müssen vor den Booten dort sein.«
Lovoc nickte und eilte davon, so gut es in der Masse ging. Achnov schlug die andere Richtung ein und zwängte sich durch die Neugierigen. Dabei schaute er mehrmals nach dem Fenster, doch von Hariol fehlte jede Spur. »Feigling«, murmelte er erneut. Beim nächsten Treffen würde er den Ausschluss des Kaufmanns fordern, Geld hin oder her.
Entschlossen schob er sich vorwärts. Es durfte nicht sein, dass die Frau Kabcara von Borasgotan wurde. An das Märchen einer vorübergehenden Lösung, bis sich ein borasgotanischer Adliger gefunden hatte, um den Thron einzunehmen, glaubte er nicht, denn wenn sie erst einmal die Macht erlangt hatte, würde sie diese niemals mehr abgeben.
Die Erzählungen über die finsteren Pläne und angeblichen Verbrechen von Elenja betrachtete er als schiere Lügen. Leider befand er sich zusammen mit einer Handvoll Getreuen in der Minderheit, denn etliche fielen auf die Lügen herein.
Seiner Ansicht nach saß Elenja an einem geheimen Ort gefangen oder war bereits ermordet worden, damit die Tarpolerin freie Bahn hatte. Er würde die Augen seiner Landsleute mit Gewalt öffnen, und das begann damit, dass er die Thronbesetzung verhinderte.
Achnov hatte den Aufgang zur Pelzbrücke erreicht.
Sie wurde deswegen so genannt, weil Donbajarsks Kürschner sie gestiftet hatten; die farbigen Steine waren so angeordnet worden, dass sie das hellgrün gefleckte Fellkleid eines Serin-Rens nachempfanden; aus größerer Entfernung entstand der Eindruck, sie bestünde in der Tat aus dem kostbaren Pelz. Heute hingen Fahnen wie lange Vorhänge herab und schmückten sie zusätzlich; auf dem Geländer waren Vorrichtungen für ein Feuerwerk montiert worden.
Allerdings lief das normale Leben an dieser Stelle trotz der Ankunft der fremden Thronräuberin weiter. Fuhrwerke rollten auf beiden Seiten entlang, Vieh wurde vorwärtsgetrieben und machte die Wege auf der Brücke zu einem unfeierlichen Ort. Die Händlergilde hatte darauf gedrängt, das Geschäft nicht zu unterbrechen.
Achnov schlenderte hinauf. Es gab nicht mehr als zwei Dutzend Schaulustiger, die sich gegen die kopfhohe Brüstung drückten. Sie hatten sich Kisten und Schemel mitgebracht, damit sie überhaupt über die Mauer schauen konnten.
Er näherte sich ihnen und stellte sich neben eine Frau, die einen Korb mit losen Blütenblättern in der Armbeuge hielt. Ein sanfter, bunter Regen sollte auf die Fremde niedergehen. Nicht weit von ihnen entfernt standen zwei gerüstete Gardisten, welche mit argwöhnischen Blicken über die Zuschauer wachten. Achnov nickte den Männern zu und sah auf den Repol.
Die Barken befanden sich etwa dreißig Speerlängen von ihm entfernt.
Wenn ihr erstes Vorhaben scheiterte, wartete ein nicht ungefährlicher Sprung von drei Schritt in die Tiefe auf ihn. Hatte er diesen unverletzt überstanden, stand ihm der Kampf gegen die Leibgarde der Besatzerin bevor.
Neben ihm erschien Lovoc, er hielt ebenfalls einen Korb in der Hand, in dem Blüten lagen; sie dufteten herrlich. In seinem Mundwinkel klemmte eine rauchende Pfeife. »Die anderen stehen links von uns«, wisperte er dem Anführer zu und schob die Blätter ein wenig zur Seite. Darunter kamen faustgroße, eiserne Handbomben zum Vorschein. Sicherlich waren sie ebenso verboten wie der Einsatz von Feuerwaffen; aber es war auch verboten, eine Kabcara zu töten. Von daher spielte der Einsatz von höchst ungesetzlichen Mitteln keine Rolle.
»Sie sind sicher?«, vergewisserte sich Achnov und zog seine eigene Pfeife aus einem kleinen Beutel an seinem Gürtel. Sodann stopfte er sie und entzündete sie, indem er sich mit der Messerspitze glimmenden Tabak aus Lovocs Pfeife nahm.
»Ja. Wir haben eine davon gezündet, und sie ging hoch, wie sie sollte. Von den Barken und den Menschen darauf wird nichts bleiben.« Der Verschwörer paffte schneller, um die Glut am Leben zu erhalten. Sie wurde benötigt, um die Lunten der Handbomben zu zünden. Achnov und Lovoc rauchten und warteten. »Schujew und Chosopov kümmern sich um die Stadtwachen.«
»Hervorragend.« Achnov genoss die anregende Wirkung des Tabaks und beobachtete die Barken durch den weißlich-blauen Dunst. Seine Aufregung stieg, er wippte mit dem Fuß.
Keine elf Speerlängen mehr, und ihr Anschlag würde seinen Lauf nehmen.
»Bereithalten«, raunte er und langte in den Korb, warf eine Ladung Blütenblätter und hieß die Kabcara zum Schein mit lautem Rufen willkommen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Schujew und Chosopov den Wächtern näherten. Kurz darauf sanken die Gerüsteten erstochen zu Boden; mit einer heimtückischen Attacke gegen sich hatten sie nicht gerechnet. Kurzerhand wurden sie auf einen vorbeifahrenden Wagen geworfen.
Achnov atmete erleichtert auf: Keiner der Jubelnden bemerkte etwas, sie starrten johlend auf den Fluss und die Boote.
Etwas zischte knapp an seinem Gesicht vorbei, er spürte den Luftzug und eine leichte Berührung an seiner Wange. Es krachte und splitterte neben ihm, Lovoc ächzte auf.
»Was hast du getan?« Achnov sah zu seinem Begleiter und erschrak. Ein langer Pfeilschaft ragte aus dessen Mund, die Pfeife lag in viele Teile zersprengt auf den Steinen; einzelne glimmende Tabakfäden hatten sich auf dem Mantel des Mannes verfangen und versengten den Stoff.
Lovoc packte noch den Pfeilschaft, als wolle er ihn aus dem Fleisch ziehen – und brach tot zusammen. Der Korb fiel zu Boden, und unter den Blütenblättern rollten die Handbomben heraus.
Noch immer merkten die Neugierigen neben ihm nichts. Sie hielten ihre Aufmerksamkeit vollends auf die Kabcara gerichtet und gerieten beim ungewohnten Anblick eines gekrönten Hauptes in Verzückung. Das wiederum brachte den Verschwörern genügend Ablenkung.
»Verflucht!« Achnov bückte sich nach den Sprengkörpern und raffte sie an sich; währenddessen erklangen von der anderen Seite der Brücke laute Schreie, und er erkannte die Stimmen seiner Freunde. Der für ihn unsichtbare Bogenschütze hatte anscheinend seine Mitverschwörer unter Beschuss genommen.
Achnov lehnte sich mit eingezogenem Kopf an die Mauer, paffte hektisch und versuchte, die erste Lunte im Pfeifenkopf zu entzünden. Ein Fuhrwerk ratterte an ihm vorbei, und er erbleichte: Daran hing Schujew! Pfeile in Kopf, Brust und Schultern hatten ihn an die Seitenwand genagelt. Das Blut rann aus den Wunden an den Schuhen hinab und malte eine rote Linie auf die Straße.
Zischend zündete die Lunte. Achnov musste aus seiner Deckung gelangen, um nach den Barken zu sehen.
Die erste befand sich unmittelbar unter ihm, die zweite konnte er mit einem halbwegs guten Wurf erreichen.
Er holte aus und schleuderte die Handbombe – als sie eine Haarlänge von seinen Fingern entfernt von einem entgegenkommenden Geschoss getroffen wurde. Es durchbohrte den Sprengkörper, flog weiter und perforierte seinen Handteller. Ein heißer Schmerz fuhr durch seinen Arm.
Der schwere Pfeil besaß so viel Wucht, dass es Achnov nach hinten riss und er auf die Brücke fiel. Sein Kopf traf auf die Steine, er war für einige Lidschläge benommen.
Er vernahm, wie das Feuerwerk in Gang gesetzt wurde, als wäre nichts geschehen. Die Folter in seiner Hand war immens, und als er endlich wieder klar sah, blickte er auf die Handbombe, die durch den Pfeil mit seinem Fleisch verbunden war.
Die kurze Lunte sprühte noch immer.
»Nein!«, schrie er entsetzt. Während er den Pfeil herausreißen wollte, wanderte der entscheidende Funke in die Zündkammer und brachte sie zur Explosion.
Pujlka eilte am Aufgang der Pelzbrücke vorbei, als das Feuerwerk begann.
Es rumpelte und krachte, bunte Explosionen verzierten den klaren Himmel mit Leuchten und Qualmwolken; dann erklang eine lautere Detonation, die ihrem Empfinden nach nicht recht in die bisherigen Geräusche passte, und gleich darauf prasselten kleine, blutige Fleischstückchen um Pujlka nieder.
Sie wusste, was es bedeutete.
»Hat denn keiner der Götter ein Einsehen mit uns?«, klagte sie, als ihr Blick auf den vorbeiholpernden Wagen fiel, an dem der Leichnam Schujews hing, eines ihrer Mitverschwörer. Die schwarzen Pfeilschäfte, die als Nägel dienten, kannte sie zu gut.
»Bei Ulldrael«, keuchte sie und duckte sich, bog in eine Seitengasse ab und torkelte mehr als sie lief. Der Schreck und die Fassungslosigkeit fuhren ihr in die Beine. Die Spione des ilfaritischen Fettsacks hatten ganze Arbeit geleistet und sie auffliegen lassen. Anscheinend gab es keinerlei Geheimnisse mehr.
Pujlka verharrte und kümmerte sich nicht darum, dass sie mit beiden Füßen in der stinkenden Gosse stand. In ihr wuchs die Überzeugung, nicht mehr lebend aus Donbajarsk herauszukommen. Ja, sie würde nicht einmal den Fuß auf den Großmarkt setzen können, ohne von den Bogenschützen erkannt und erledigt zu werden! Ihr Leben war verwirkt…
Ihr Herz pochte rasend, sie sank voller Verzweiflung an der Hauswand herab, während die Menschen lachend vorübereilten, um die Kabcara zu sehen, Hochrufe für eine Besatzerin auf den Lippen. Pjulka senkte den Blick und starrte auf die Hosenbeine und Rocksäume. Spritzwasser traf sie.
Irgendwann wurden es weniger Menschen, bis sie den Eindruck hatte, ganz allein in der Gasse zu sein.
»Reiß dich zusammen, Pujlka«, sagte sie zu sich selbst und zwang sich auf die Beine. Sie atmete tief ein und aus, lauschte. Den Rufen nach befand sich die Usurpatorin auf dem Großmarkt.
»Jetzt oder nie«, sagte sie leise und machte sich auf den Weg. »Ich muss meinen Auftrag erfüllen.«
Ein Mann in einem dunkelbraunen Umhang zeigte sich ihr am Ende der Gasse; der Kopf wurde von einer Kapuze verborgen. In der Linken hielt er einen übergroßen Bogen, in der Rechten einen langschaftigen Pfeil mit schwarzen Federn daran.
Pujlka blieb nicht stehen, sondern rannte auf den Unbekannten zu und zog ihr Schwert. Es war Wahnsinn, doch eine andere Möglichkeit hatte sie nicht. Ihr Schicksal war der Tod, der sie lieber durch einen Pfeil als durch den Strang ereilen sollte.
Der Schütze legte den Pfeil auf die Sehne und spannte den Bogen mit einer ruckartigen, kraftvollen Bewegung; enorm muskulöse, lederbandgeschützte Unterarme kamen zum Vorschein. Die Kapuze bewegte sich leicht, und goldene Ohrringe leuchteten in der Dunkelheit auf. Das Gesicht jedoch blieb noch immer durch die Schatten verborgen.
Ein Blinzeln später ging das Geschoss mit der merkwürdigen Spitze auf seine kurze Reise.
Pujlka wurde an der Stirn getroffen, und ihre Kraft wich auf der Stelle. Die Finger ließen das Schwert los, es landete klirrend auf dem Pflaster. Sie brach zusammen und überschlug sich mehrmals, rollte um die eigene Achse und kam in der Gosse zum Erliegen.
Als die Stadtwache herbeieilte, fanden sie eine bewusstlose, gefesselte Frau, um deren Hals ein Band mit einem Brief befestigt war; einen Fingerbreit über der Nasenwurzel zeichnete sich ein münzgroßer, dunkelroter Fleck ab.
Auf dem Umschlag standen in geschwungener, klarer Schrift die Worte An die hochwohlgeborene Kabcara Norina zu lesen.
Darunter hatte der Absender notiert: Ergebenst, Hetrál.
Sehr gut.« Nech Fark Nars’anamm schaute sich um. »Es gefällt mir sehr gut! Wenn ich vorher gewusst hätte, wie schön es in Ilfaris ist, wäre es mir kaum in den Sinn gekommen, meine Ansprüche auf Kensustria zu beschränken.« Er stand auf der Anhöhe an der Spitze seiner verbliebenen Truppen und übersah die sanft geschwungenen Flussauen, die sich vor ihm ausbreiteten.
Es blühte in allen Farben, das Gras wuchs sattgrün, und die Bienen surrten um die Apfelbaumhaine. Dazwischen schlängelte sich ein kleines Gewässer, das gemächlich dahinzog und keine Eile hatte, den Landstrich zu verlassen; zwei Schlösschen standen verträumt inmitten der Bäume und zeigten deutlich, dass sie allein zur Zerstreuung und Erbauung der Besitzer errichtet worden waren. Es gab keine ausgewiesenen Verteidigungsanlagen, nicht einmal Wegezollkastelle. Die einzigen Soldaten, die Nech seit dem Grenzübertritt von Tersion nach Ilfaris gesehen hatte, waren seine eigenen.
»Das Land hat auf mich gewartet«, lachte er. Seine weiße Lederrüstung war vom Staub der letzten Marschtage bedeckt, doch sie wirkte als Kontrast zu der schwarzen Haut des selbsternannten Kaisers von Angor noch immer eindrucksvoll. Den weißen Helm trug er unter dem Arm, die andere Hand lag am Griff des angorjanischen Bogenschwertes. Wenn man ihn sah, konnte der Eindruck entstehen, er sei ein erfolgreicher Eroberer und kein Geschlagener auf dem Rückzug vor einer Übermacht. »Ich sollte es mir pflücken«, meinte er zu seinem Tai-Sal, der auf den Namen Arrant Che Ib’annim hörte. Es klang ernst gemeint.
Der Mann verneigte sich.Auch er trug die weiße Rüstung,doch sein Gesicht wirkte wesentlich gröber als das seines Herrn. Schweiß glitzerte auf der schwarzen Haut, sie waren schnell marschiert. »Allerhöchster Kaiser, es wäre den vierhundert Besten eine Ehre, Euch das Land zu geben.« Ib’annim sah zu den Kriegern, deren überlange Schilde und Speere einen wehrhaften Wald bildeten, dessen Spitzen metallisch glänzten. Auf dem Rücken trugen sie jeweils ein kurzes und ein langes angorjanisches Bogenschwert; das vordere Ende war schwerer geschmiedet und verlieh den Schlägen eine unbändige Wucht, die sich kaum parieren ließ und Schilde zerschmetterte. »Erteilt den Befehl, und wir legen es Euch zu Füßen.«
Nech räusperte sich, seine Kehle war trocken. »Noch sind wir nichts anderes als Gäste.« Er deutete auf das Schlösschen, das ihnen am nächsten lag und das sie in Kürze erreichen würden. »Laden wir uns dort ein.« Er stülpte sich den Helm auf die langen schwarzen Haare, in die weiße Perlen eingeflochten waren. »Lasst uns herausfinden, wie es um die ilfaritische Gastfreundschaft bestellt ist.«
Der Tai-Sal rief den entsprechenden Befehl, und die Einheit rückte vor.
Der Gleichschritt entfachte ein Grollen, das in die Idylle der Auen einbrach wie ein Sturm, und das Klirren der Schilde und Speere ahmte das helle Krachen von Blitzen nach. Vögel flogen aufgeschreckt davon, Hasen und Eichhörnchen flüchteten vor dem Lärm, den die Krieger schufen. Ein schwarz-weißer, bedrohlicher Strom schoss in die friedlichen Täler und ließ sich nicht aufhalten.
Auch im Schloss hatte man die Fremden bemerkt.
Nech sah, wie die Bediensteten aus dem Tor eilten und die Portale vor ihnen schlossen; als die angorjanischen Truppen vor dem Gebäude standen, waren die Eingänge sowie die bunten Läden verriegelt. Die Schutzmaßnahmen hatten jedoch höchstens sinnbildlichen Charakter: Die dicken Weinranken entlang der Fassade waren besser als jede Leiter.
Nech ließ anhalten, dann trat er zusammen mit Ib’annim und zehn Mann vor. »Ich grüße euch, Bewohner des Schlosses«, rief der Tai-Sal, und seine kräftige Stimme wurde mit Sicherheit hinter den Mauern vernommen. »Wir wollen euch nichts Böses. Eine Mahlzeit und etwas Ruhe, mehr möchten wir nicht. Es wäre eine Ehre für euch, den Kaiser von Angor bewirten zu können.«
»Verschwindet, angorjanische Brut«, schallte es auf sie nieder. Der Rufer hielt sich hinter den Zinnen verborgen. »Wir sind einhundert Mann, und wir haben Steine genug, um jeden einzelnen von euch zwanzigmal zu treffen! Ruht euch woanders aus!«
Nech hob langsam die Augenbrauen.
»Ich ersuche euch mit aller Freundlichkeit: Gewährt uns einen kühlen Trunk und eine Mahlzeit«, versuchte es Ib’annim nochmals und gab sich Mühe, nicht zu ergrimmt zu klingen. »Der Kaiser von Angor…«
»…soll es ein Schloss weiter versuchen.Wir haben leider schon den Kaiser von … was-weiß-ich-denn an der Tafel sitzen. Es ist kein Platz mehr für Gäste wie euch«, wurde er unterbrochen. »Zieht von dannen! Einen Trunk hält der Fluss bereit, und gegen den Hunger esst ihr am besten die Blüten. Die Äpfel sind leider noch nicht reif.«
Der Tai-Sal schickte zwei Männer zum Tor. Sie prüften die Beschaffenheit des Holzes, traten dagegen und lauschten auf den Klang, begutachteten die Scharniere und kehrten zu ihm zurück, um zu berichten. Die Schwachstellen waren rasch entdeckt.
Zwei kurze Befehle später wurden Stricke an den Scharnieren befestigt, während die vordere Reihe einen sichernden Schildwall bildete.
Kräftige Männerhände packten die Taue und zogen mit einem harten Ruck daran, dann rissen die Scharniere einfach aus der Mauer; die Holztore neigten sich nach hinten und fielen in den Innenhof, wo sieben bleiche, mit Degen bewaffnete Diener standen. Sie starrten durch die aufwirbelnde Staubwolke auf den Schildwall und die langen Spieße – und wichen langsam vor den waffenstarrenden Angorjanern zurück. Die Lakaien verschwanden rechts und links; rumpelnd fielen Türen ins Schloss.
»Man mag in deinem Schloss gut leben können, aber seine Tore taugen nichts«, rief Ib’annim amüsiert. »Wir haben nicht einmal geklopft, und schon fallen sie um.«
Auf den Zinnen zeigte sich ein zierlicher Mann in einer Art Morgenmantel, auf dem Kopf saß eine graue, sehr ausladende Perücke, deren Seitensträhnen bis auf die Brust reichten. »Ich bin Guedo Halain, der Herzog von Vesœur«, sagte er und bemühte sich um Haltung. »Ich ergebe mich und protestiere gleichzeitig gegen die Vorgehensweise. Ihr werdet für den Schaden am Tor und jeden weiteren, den Ihr meinem Schloss zufügt, bezahlen. Ebenso für jedes Leben eines meiner Diener.«
Tai-Sal Ib’annim gab den Soldaten den Befehl zum Einmarsch. »Erst wenn wir alle Bewohner gefunden haben und es sicher ist, werde ich Euch rufen lassen, mein Kaiser«, sprach er und eilte davon, um die Durchsuchung zu leiten.
Nech Fark Nars’anamm blieb mit einhundert Mann vor dem Schlösschen und lächelte glücklich. Er nahm sich die Zeit, die Umgebung erneut zu betrachten und den Duft der Apfelblüten einzuatmen. Einen derartigen Geruch gab es auf Angor nicht. Jedenfalls nicht im trockenheißen Süden, wo er seine meisten Gefolgsleute besaß.
Der ungewollte Gedankenschwenk verdarb ihm die Laune schneller, als ein Pfeil sein Ziel erreichte. Wegen seines Bruders, Farkon Nars’anamm, war ihm die Stadt Baiuga verloren gegangen, und ausgerechnet sie war sowohl wirtschaftlich als auch strategisch wichtig gewesen, ganz zu schweigen vom errungenen Ansehen, sie eingenommen zu haben. Seinetwegen hatte er Tersion aufgeben müssen.
»Wie hat er davon erfahren können?«, ärgerte er sich. All seine Pläne, Tersion samt Kensustria zu einem zweiten Imperium auszubauen und von dort aus einen Zweifrontenkrieg gegen seinen Bruder zu eröffnen, um die Alleinherrschaft auf Angor zu erlangen, waren so gut wie hinfällig.
Oder aber es fiel ihm etwas Besseres ein.
Ib’annim hatte indessen die Bewohner zusammengescheucht, trieb sie durchs Tor bis vor Nech und ließ sie vor ihm auf die Knie sinken. »Begrüßt den Kaiser von Angor«, befahl er ihnen. »Die Gesichter in den Staub, bis er euch erlaubt, ihn anschauen zu dürfen.« Die spitzen Lanzenenden überredeten den Schlossherrn, seine Frau, die vier Töchter und die schlotternden Diener in Windeseile, sich zu verbeugen.
»Ihr Räuber«, empörte sich der Herzog dennoch, auch wenn er in den Staub sprach. »Ihr benehmt Euch keinesfalls wie ein Mann von blauem Geblüt…«
»Blau?«, lachte ihn Nech aus. »Wenn überhaupt, müsste in meinen Adern schwarzes Blut fließen. Wie kommst du auf blau?«
»Es ist eine Redensart, hoheitlicher Kaiser«, antwortete ihm die älteste Tochter. »Unter bleicher, weißer Haut schimmern die Adern blau. Adlige arbeiten nicht auf den Feldern oder im Freien, daher bleiben sie blass. Blaues Blut.«
»Schweig!«, herrschte der Vater sie an. »Wir sprechen nicht mit Fremden, die uns angreifen.«
Nech fand ihre Unerschrockenheit bemerkenswert und betrachtete sie. Sie war nicht älter als er und trug ein hellgraues, schulterfreies Kleid, das mit grünen Bändern auf dem Rücken geschnürt war. An den Füßen steckten Sandalen. Die langen blonden Haare waren zu Zöpfen geflochten, die wiederum in einer kranzähnlichen Form auf dem Kopf miteinander verschlungen waren; kesse Löckchen baumelten von der Stirn. »Wie ist dein Name?«
»Amaly-Caraille, hoheitlicher Kaiser. Ich bitte Euch, meine Eltern und meine Geschwister sowie das Gesinde in Eurer unendlichen Güte und Gnade zu verschonen«, beschwor sie ihn ruhig. »Wir werden Euch unsere Vorratskammern öffnen und Euch versorgen, soweit es uns möglich ist, aber lasst uns das Leben und unser sonstiges Hab und Gut.«
»Schau mich an und erhebe dich, Amaly-Caraille«, erlaubte er ihr. »Erhebt euch alle, Herzog und seine Familie. Ich bin kein Unmensch, sondern ein Kaiser, der die Aufmerksamkeit für sich verlangt, die ihm zusteht. Oder würdest du König Perdór von deiner Schwelle weisen?«
»Perdór ist König von Ilfaris, Ihr dagegen seid ein schwarzer Kaiser von einem anderen Kontinent, von dem ich bislang nichts Gutes vernommen habe«, sagte der Herzog, während er aufstand und sich den Staub von den Beinkleidern streifte.
Einer der Wächter holte zum Schlag mit dem Speer aus, doch Amaly-Caraille fiel ihm mit einem Schrei in den Arm; abwartend sah der Krieger zum Tai-Sal, und Ib’annim wiederum schaute fragend zum Kaiser.
Nech legte die Hände auf den Rücken. »Ich hätte nichts unternommen, um meinen Soldaten davon abzuhalten, dich für deine vorlauten Worte zu bestrafen. Ganz im Gegenteil, ich hätte ihn zuschlagen und immer wieder zuschlagen lassen, bis ich das Krachen deiner Knochen gehört hätte. Dass du keinen einzigen Hieb zu spüren bekommen hast, verdankst du demnach deiner mutigen Tochter, Herzog.« Er lächelte böse. »Wäre ich so schrecklich, wie du glaubst, würde ich nun euch beide züchtigen lassen, bis ihr keine Haut mehr auf den Fußsohlen hättet.« Er schritt auf ihn zu. »Doch so bin ich nicht.« Nech drehte sich zu Ib’annim. »Tai-Sal, lass das Schloss abbrennen und hänge die Menschen oben an die Fahnenstangen. Es soll Abschreckung genug für die Bewohner des Landes sein. Ein gekröntes Haupt und der Stellvertreter des Gottes Angor muss gebührend behandelt werden, ganz gleich aus welchem Land man stammt.«
Der Herzog verlor seine aufrechte Haltung, die Frauen weinten und jammerten, reckten die Hände flehend; lediglich Amaly-Caraille sah ihn aus ihren blauen Augen erwägend an, als glaube sie ihm nicht.
Nech brachte die anderen mit einer Handbewegung zum Verstummen, dann lachte er laut. »Ein Scherz! Nichts weiter als ein Scherz.« Er hielt Amaly-Caraille seine Hand hin. »Niemandem wird ein Haar gekrümmt, das verspreche ich einer tapferen jungen Dame wie dir. Und wenn wir abziehen, werden wir das Tor an Ort und Stelle setzen, das schwöre ich.«
Fassungslos starrten die Adligen den Kaiser an, auch Amaly-Caraille benötigte drei Atemzüge, bis sie sich zu rühren vermochte.
Sie missachtete sämtliche Blicke ihrer Familie und hob langsam den Arm, um ihre Finger in die Hand des Fremden zu legen, der ihr imponierte und den sie anziehend fand. Amaly-Caraille schob es auf das exotische Äußere und die Macht, die er ausstrahlte; dass er ganz nebenbei einen Wuchs aufwies, der ihn allen jungen Adligen in der Region überlegen machte, tat sein Übriges dazu. Ein Krieger durch und durch.
»Darf ich mich Euch als Eure Führerin andienen, hoheitlicher Kaiser Nech Fark Nars’anamm?«, fragte Amaly-Caraille und machte einen formvollendeten Hofknicks. »Ich weise Euch das Schloss, wenn Ihr möchtet.«
Nech zeigte die weißen Zähne. »Ich bestehe darauf.« Er deutete auf den Eingang, und die junge Frau übernahm kaum merklich die Führung. »Tai-Sal, lass den Herzog und seine Familie frei, doch sorg dafür, dass sie auf dem Schloss bleiben.« Er schritt durch den Torbogen, die Augen auf Amaly-Carailles nackte Schultern geheftet und nicht auf die prächtige Fassade des Innenhofs.
Kontinent Ulldart, westliche Inseln des Königreichs Rundopâl, Frühling im Jahr 2 Ulldrael des Gerechten (461 n.S.)Noch mehr Tote.« Lodrik betrachtete die Hallig, an der sie in langsamer Fahrt vorbeiglitten, vom Schiffsdeck aus. Das Eiland beherbergte drei Häuser, ausnahmsweise kleine Gehöfte und nicht die Hütten von Fischern. Auf den grünen Grasflecken lagen die Leichen von dreißig Männern, Frauen und Kindern. »Zvatochna verbirgt nicht, dass sie hier war.«
Neben ihm flirrte die Luft, und Soscha erschien als geisterhaftes Abbild ihres menschlichen Äußeren. Die halblangen braunen Haare lagen dicht am Kopf und waren zu einem Zopf geflochten; sie hatte die tarpolische Tracht gewählt, wie sie Norina gerne trug. Lodrik stellte fest, dass sie immer besser darin wurde und sogar das Durchscheinende verlor. Bald würde man sie für einen echten Menschen und nicht für eine verlorene Seele halten. »Sie ist uns weit voraus, Bardri¢«, erstattete sie ihm Bericht. »Ich konnte sie nicht aufspüren.«
Er befahl dem Kapitän, Kurs auf die kleine Mole zu nehmen. »Ich will sehen, was sie angerichtet hat. Vielleicht finden wir einen Hinweis, wohin sie möchte oder was genau sie bezweckt.«
Die Wellenkamm, eine neue Variante der Handelskoggen mit zwei Masten sowie einer neuen Segelform, eng an die Bauweise der tarvinischen Dharkas angelehnt, ging längsseits zu der Hafenmauer; die Besatzung vertäute das Schiff und legte die Planke aus.
»Einen solchen Fehler würde sie nicht begehen«, widersprach Soscha.
»Jeder begeht Fehler.« Lodrik schritt voran, und der Saum seiner nachtblauen Robe schwang dabei weit vor und zurück. Die Kapuze bedeckte seine dünnen blonden Haare und schützte das fahle, knochige Gesicht vor dem kühlen Wind.
Soscha schwebte neben ihm her. Sie zeigte sich ganz offen und kümmerte sich nicht um die Seeleute. Schließlich hatte sie sich ihre Existenzform nicht ausgesucht.
Sie wechselten vom Schiff hinüber auf das Eiland, doch niemand begleitete sie. Die Mission war den Matrosen schon merkwürdig und gespenstisch genug.
Lodrik besah sich die ersten Toten, die sie fanden. »Aufgeschlitzte Arme und Hälse. Ihr ging es um das Blut, nicht um die Seelen«, stellte Lodrik fest. »Ihr Heer wird ordentlich Hunger haben. Zvatochnas Blut allein reicht nicht aus, um das Verlangen zu stillen.« Er ging achtlos an den Leichen vorüber.
Soscha schwieg und wich nicht von seiner Seite. Weil sie durch ihre eigene Dummheit an ihn gebunden war, blieb ihr nichts anderes übrig, als jedem seiner Schritte zu folgen – es sei denn, er sandte sie weg, um einen Auftrag zu erledigen.
Nur ein bisschen seines Blutes hatte sie getrunken, doch das genügte, um ihm Macht über sie zu verleihen. Sie hasste ihn seitdem noch mehr und dachte mindestens einmal am Tag darüber nach, wie sie ihn vernichten könnte – sobald seine untote Tochter nicht mehr auf Ulldart wandelte, sondern für immer ausgerottet war. Soscha würde ihm den Tod nicht leicht machen.
»Schon wieder in Gedanken dabei, mich umzubringen?«, sagte er ihr auf den Kopf zu.
Sie erschrak nicht und fühlte sich auch nicht ertappt. »Ja.«
»Dann versuche, dich zu gegebener Zeit daran zu erinnern. Ich werde es dir bald erlauben.« Lodrik umrundete ein Haus und betrat die Diele. Er sah eine junge Mutter, die mit ihrem Kind auf dem Arm auf dem dreckigen, von Matsch verschmierten Boden lag. Beiden waren die Adern geöffnet worden, aber von Blut fehlte jede Spur.
»Es ergibt keinen Sinn«, raunte er und ging neben den Leichen in die Hocke. Er betrachtete die entsetzten Züge der verstorbenen Mutter, der unsägliches Grauen das Leben aus der Brust gerissen hatte.
Soscha lachte bitter. »Sie mordet…«
»Nein, das ergibt Sinn. Sie benötigt das Blut«, unterbrach er sie. »Dass sie nach Westen flieht, das ergibt keinen Sinn.« Lodrik erhob sich. »Je mehr sie sich auf die Rogogarder Inseln zubewegt, desto schneller wird sie entdeckt werden.« Er schaute Soscha ins Gesicht. »Ich frage mich, warum? Was bezweckt sie?«
Sie wandte sich nicht ab, sondern sah in Lodriks blaue Augen, in denen die schwarzen Einschlüsse deutlicher sichtbar waren als sonst. Bald würde die Farbe getilgt sein, und er hätte die Wandlung zum Nekromanten abgeschlossen. »Es ist deine Tochter, Bardri¢. Du solltest es wissen.« Soscha betrachtete die Tote voller Mitleid. »Wie jung sie war. Es wird Zeit, dass wir dieses Monstrum in Frauengestalt aufhalten und auslöschen.«
»Da stimme ich dir zu.« Lodriks Blick fiel auf das Vorratsregal, auf dem Marmeladengläser standen. Welch süße Kostbarkeit, umgeben von salzigem Meer und plötzlich sinnlos geworden. Es gab niemanden mehr, der sich darüber freute. »Ich habe den Verdacht, dass sie sich mit ihrem Heer aus Seelen Rogogard erobern möchte. Nur dann ergibt das, was wir beobachtet haben, einen Sinn.« Er grübelte. Etwas an dieser Erklärung gefiel ihm nicht.
»Herr!«, schallte ein lauter Ruf über die Hallig. »Herr, kommt rasch!«
Lodrik und Soscha eilten ins Freie und sahen zur Wellenkamm, wo ein Mann hoch oben im Ausguck stand und winkte. »Sieh nach, was er will«, befahl er Soscha.
Sich zu sträuben brachte ihr ohnehin nichts. Sie erhob sich widerwillig, flog hinauf und landete vor dem verblüfften Mann. »Berichte«, wies sie ihn an.
Der Matrose stierte die sacht durchscheinende Frau an und schluckte. Keiner an Bord hatte sich an ihren Anblick gewöhnt, man mied sie, wo es nur ging. In einem Krähennest hoch oben am Ende eines Masts gab es jedoch reichlich wenig Möglichkeiten, dem Geist auszuweichen. Seine Finger packten das Amulett, ein einfacher Talisman aus Bronze mit dem Emblem Kalisstras darauf. »Leichen … Herrin«, sprach er zögerlich.
»Ich bin keine Herrin, das habe ich bereits gesagt«, verbesserte sie ihn und gab sich Mühe, freundlich zu klingen. Ihr Unmut sollte nicht den Falschen treffen. Er konnte nichts dafür, dass sie an den Nekromanten gefesselt war und sklavengleiche Dienste verrichten musste. »Was hast du entdeckt?«
Er deutete nach Osten. »Da treibt etwas im Meer.«
Sogleich flog Soscha zur angegebenen Stelle und entdeckte einen Frauenkadaver, der mit dem Gesicht nach unten in den Wellen schaukelte. Gelegentlich zuckte der Körper; um ihn herum schwammen Fische, die sich an den Überresten gütlich taten. Jedes Mal, wenn die Tiere Fleisch aus dem Leib bissen, bewegte er sich und erweckte den Anschein, als lebe die Frau noch.
Soscha stieg senkrecht auf und hielt erneut Ausschau. In einiger Entfernung erkannte sie einen hellen Fleck im Wasser. Ihre rasche Überprüfung brachte es an den Tag: noch eine Leiche, ein Mann. Er dümpelte rücklings, und sie sah die tiefen Schnittwunden, die für Zvatochnas Werk sprachen.
Rasch kehrte sie zu Lodrik zurück, der inzwischen die Mannschaft herbeigerufen hatte, um die Leichen in die größte Hütte schaffen zu lassen. Er beabsichtigte, die Toten zu verbrennen. Keiner der Seeleute wagte es, sich seinen Anweisungen zu widersetzen. Seine furchterregende Aura und sein totengleiches Äußeres erstickten sämtliche Widerworte in der vor Angst engen Kehle.
»Ich habe weitere Opfer deiner Tochter gefunden«, sagte Soscha. »Sie treiben von Osten auf uns zu.«
Lodrik dachte nach, dann winkte er einen Matrosen zu sich. »Die Meeresströmung in diesen Gefilden verläuft wie?«
Soscha sah genau, dass sich der Mann einen Schritt Abstand zu ihnen bewahrte; seine Haltung verriet, dass er sich vor dem Nekromanten fürchtete. Dabei hatte Lodrik bisher nicht einmal auf seine Kräfte zurückgegriffen. Zwei Untote auf einem Schiff ertrugen die Männer kaum.
»In diesen Monaten von Osten nach Westen, Herr«, antwortete er mit bebender Stimme. Seine Augen ruhten auf dem Boden, er sah Lodrik nicht an. »Sie bringt die ersten Fischschwärme aus dem Norden an die Küste Rundopâls.«
Lodrik wandte sich abrupt um. »Steckt das Haus an, sobald ihr alle Leichen hineingebracht habt, danach setzt Vollzeug und bringt uns nach Osten«, befahl er ihm und marschierte auf die Wellenkamm zu.
Soscha sah dem erleichterten Matrosen hinterher, der raschen Schrittes zu seinen Freunden zurückkehrte, dann heftete sie sich an Lodriks Fersen. »Ich habe sie aber beim letzten Mal nach Westen segeln sehen, Bardri¢«, entgegnete sie. »Und als ich ihr gerade so entkommen war, hatte sie den Kurs immer noch eingeschlagen.«
»Sicherlich. Damit wir wie die Narren einer falschen Spur folgen.« Lodrik stapfte die Planke hinauf und schritt auf den Kapitän zu, um ihm die neuen Anweisungen persönlich zu erteilen. Seine Stimme wirkte beflügelnd. »Zvatochna konnte sich denken, dass du mir von ihrer Route berichtest, und hat uns glauben lassen, sie wolle sich absetzen. Vielleicht hat sie ein paar lebende Soldaten mitgenommen und sie angewiesen, mit einem Boot die Halligen anzufahren und die Spuren für uns zu hinterlassen.« Er nickte nach Osten. »Dabei ist sie sicherlich seit geraumer Zeit nach Borasgotan unterwegs.«
»Warum sollte sie?« Soscha hielt den Gedanken für unsinnig. »Wir haben sie erst aus dem Land verjagt, und sie ist als Elenja vom Thron verstoßen worden. Sie besitzt keinerlei Rückhalt bei der Bevölkerung…«
»Wer benötigt das schwache Fleisch der Menschen, wenn er Seelen sein Eigen nennt?«, meinte Lodrik düster. »Zvatochna hatte in Nesreca einen perfekten Lehrmeister und wird auf vieles vorbereitet sein, was wir ihr entgegenwerfen. Ich nehme an, dass sich in Borasgotan etwas befindet, wo sie Zuflucht finden wird, ohne dass wir sie entdecken.« Er sah hinauf zu den Wanten, in denen die Matrosen kletterten und die Segel setzten. »Es wäre besser, wenn wir sie vorher aufspüren und auslöschen würden.«
Die letzten Seeleute kehrten auf die Wellenkamm zurück, während die Flammen aus der Tür und den Fenstern des Hauses mit den Toten schlugen. Man sah dem Qualm an, welche Nahrung das Feuer gerade verschlang, und als er rußig und fett aus den Öffnungen und den ersten Löchern im Dach drang, wussten alle auf der Kogge, dass die Leichen verbrannten.
Lodrik aber hatte keine Augen für die Hallig hinter ihnen. Er stand am Bug, das bleiche Antlitz nach vorn gerichtet.
Kontinent Kalisstron, an der Küste von Bardhasdronda, Frühling im Jahr 2 Ulldrael des Gerechten (461 n.S.)Als das Schiff unter seinen Füßen zerbrach und Tokaro ins eisige Wasser stürzte, glaubte er für wenige Lidschläge, dass sein Leben vor der fremden Küste zu Ende gehe.
Doch der Trotz erwachte in ihm, er trat und strampelte, bis er an die Oberfläche gelangte und eine leere Kiste zu fassen bekam, die ihm Halt gab. Wenn ich sterbe, will ich mein Schwert in den Fingern halten, dachte er grimmig. Wie es eines Ritters würdig ist.
Die Flut spülte ihn umgeben von Wrackstücken an den Strand. Er zog sich über das Geröll den weichen, dunklen Sand hinauf, bis er sich schwankend erhob und keuchend umschaute. Seine Linke fuhr unwillkürlich über den Schädel, der bis auf den bürstenkurzen braunen Haarstreifen obenauf kahl war, und wischte das Wasser heraus.
Vor ihm ragten schwarze Felsen in die Höhe, darauf standen die Überreste eines Turmes, aus dem schwache Qualmwolken aufstiegen; weitere dickere Rauschschwaden, die er bereits von Deck aus gesehen hatte, erhoben sich landeinwärts. Bardhasdronda stand in Flammen, und wenn er das Gebrüll vor dem Zerbersten des Schiffsrumpfes richtig vernommen hatte, traf die Qwor die Schuld daran.
Tokaro sah an sich hinab. Er trug nichts am Leib als seine Wäsche und einen wattierten Waffenrock. Seine kostbare Rüstung und alles, was er auf das Schiff mitgenommen hatte, lagen längst auf dem Grund des Meeres. Was mochte mit seinen Begleitern und mit Estra sein? Er weigerte sich zu glauben, dass er der einzige Überlebende war.
Bevor er sich weitere Gedanken machen konnte, brachten ihn ein lautes Wiehern und das Trappeln von Hufen dazu, sich nach rechts zu wenden. »Treskor!«, rief er freudig und sah den weißen Hengst auf sich zupreschen. »Wenigstens du bist mir geblieben.« Er ging dem Pferd entgegen, streichelte den nassen Hals und die weichen Nüstern, dann schwang er sich auf den Rücken. »Gehen wir nachschauen, was in der Stadt geschehen ist.« Treskor trabte los.
Tokaro glaubte fest daran, dort auf die Überlebenden des Schiffsunglückes zu stoßen. Der Grund dafür lag auf der Hand: Die Galeere war vorher schon verlassen gewesen, wahrscheinlich hatten sich die Matrosen mit den Beibooten abgesetzt, als sich die Kollision mit dem Riff abgezeichnet hatte. Ihn hatten sie einfach vergessen, sagte er sich.
Doch die Selbstlüge fiel ihm nicht leicht.
Unvermittelt sah er die veränderte Estra vor seinem inneren Auge, die über ihn hergefallen war. Er schauderte, als er sich an die leuchtenden Augen und die langen Zähne erinnerte. Ein Ungeheuer, wie einst ihre Mutter. »Es war ein Traum«, murmelte er und verdrängte die Erinnerung an das mit Blutspuren übersäte Deck. Estra durfte damit nichts zu tun haben.
Der Himmel über ihnen war schwarz, die Wolken wälzten umeinander, und in ihrem Inneren leuchtete es auf, ohne dass Donner ertönte. Dafür erklang gelegentlich ein weit entferntes Brüllen, das Tokaro einem Qwor zuordnete.
Kein auf Ulldart bekanntes Tier erzeugte ähnliche Laute, und am nervösen Ohrenspiel des Hengstes erkannte er, dass es auch ihm zu schaffen machte; bei aller Treue und Unerschütterlichkeit im Kampf waren dem Hengst die Geräusche nicht geheuer.
Sie näherten sich der Stadt, und die Ausmaße der Zerstörung wurden nun erst richtig ersichtlich. Ein Viertel der Gebäude brannte noch immer, andere wirkten, als seien sie von Giganten eingerissen oder achtlos zur Seite gefegt worden.
»Angor behüte uns. Welche Mächte besitzen diese Wesen? Jetzt müssen wir vorsichtig sein«, sagte Tokaro zu Treskor und lenkte ihn durch das Stadttor in das Gassengewirr hinein.
Schutt und Trümmer lagen auf dem Kopfsteinpflaster, die Steine zeigten glasige Riefen und Abdrücke, sogar die dicken Balken der Fachwerkhäuser waren zerbrochen.
Bei allem Durcheinander hatte Tokaro noch keine Leichen gesehen, anscheinend hatten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Hatte der Qwor deswegen derart gewütet, weil er kein Futter vorfand?
»Hallo?«, wagte Tokaro den Ruf. »Jemand da?«
Treskor schnaubte, die Nüstern blähten sich ohne Unterlass. Es war offenkundig, dass er die zerstörte Stadt verlassen wollte. Hier brachte ihm seine Geschwindigkeit nichts, falls sie vor einem Qwor flüchten mussten.
Tokaro erreichte das andere Ende Bardhasdrondas. In einem zur Hälfte zerschmetterten Turm erspähte er Waffen, Rüstungen und Schilde. Er rutschte zu Boden, warf sich ein knielanges Kettenhemd über, gürtete sich und nahm ein Schwert sowie Schild und Helm an sich; ein Speer machte sein Arsenal vollständig. Das Gewicht auf seinen Schultern und der Schaft in der Hand gaben ihm Sicherheit.
Etwas mehr wie ein Ritter ausgestattet, wenn auch nicht standesgemäß wie ein Tokaro von Kuraschka, setzte er die Erkundung fort.
Doch so sehr er suchte, er fand keine Menschenseele. Die Stadt war aufgegeben.
Für Tokaro bedeutete es, dass er weiterreiten musste. Er nahm er sich Kleider, Proviant und andere brauchbare Dinge, die man auf einer Reise benötigte, aus den Ruinen.
»Kehren wir zum Strand zurück«, sagte er zu Treskor und erlaubte sich, etwas von der Anspannung abzulegen, die jegliches Grübeln über seine Lage zurückgedrängt hatte. Kaum ließ sie nach, sah er wieder das schöne Gesicht seiner verzweifelten Geliebten vor sich, die seine Unterstützung gegen den Dämon in ihrem Inneren dringend benötigte.
Die Vergangenheit war lebendig geworden und wollte sich wiederholen. Nerestro von Kuraschka, sein Ziehvater, hatte Estras Mutter aufgegeben und sie alleingelassen. Im Stich gelassen. Tokaro hatte Estra jedoch geschworen, sie nicht aufzugeben, und daran würde er sich halten.
Sinnierend kehrte er an den Strand zurück und ritt in die andere Richtung.
Vielleicht hatte es die Mannschaft der Galeere angesichts der sterbenden Stadt vorgezogen, mit den Beibooten weiter zu rudern, bis sie in sicheres Gebiet gelangten. Aber gab es das noch? Die Rauchsäulen, die allerorten in den schwarzen Himmel wuchsen, sprachen dagegen.
Gegen Abend erreichte er eine Sackgasse.
Die schwarzen Klippen schoben sich vor bis zum Wasser, und unmittelbar zu deren Füßen fiel der Strand steil ab. Ein starker Wind erhob sich und peitschte das Meer auf; die Brandung erlaubte es ihnen nicht, das Hindernis zu umschwimmen.
Tokaro sammelte Treibgut ein und entfachte im Schutz eines Felsüberhangs ein Feuer, das ihm Wärme und Licht spendete; für ihn gab es ein karges Mahl aus Brot und Wasser, der Hengst fraß die spärlichen Halme, die er in der Nähe der Unterkunft fand – da hob er ruckartig den Kopf und schnaubte warnend.
»Wer da?« Tokaro packte Schild und Speer, stand auf und schaute in die Dunkelheit.
Ein riesiger Umriss trat in den Lichtschein und offenbarte sich. Gàn!
Die gewaltige Kreatur war unverwechselbar, erst recht in diesem Teil Kalisstrons, wo man Sumpfkreaturen nicht kannte. Seine weißen Augen mit den schwarzen Doppelpupillen waren auf den Ritter gerichtet, er wirkte unsicher.
Gàn hatte seine Rüstung angelegt, an der Algen wie große, feuchte Blätter hafteten, und trug seinen massiven, vier Schritt langen Speer. An der Seite seines Gürtels baumelte die geraubte aldoreelische Klinge. Demütig senkte er den Kopf, die beiden langen der insgesamt vier Hörner surrten leise, und langsam ging er auf die Knie.
Zuallererst freute sich Tokaro, den Nimmersatten lebend vor sich zu sehen. Erst nach einigen Lidschlägen wurde ihm wieder bewusst, dass er den Räuber seines Schwertes vor sich hatte, und er senkte seinen Speer nicht.
»Du weißt, was du mit deiner Tat angerichtet hast?«, sprach er düster zur Begrüßung. »Wegen dir sind Männer gestorben, ein Schiff ist gesunken, und nur Angor weiß, was sich in der Zwischenzeit auf Ulldart ereignet!«
»Meine Schuld ist groß«, nickte Gàn. »Doch hätte ich es nicht getan, würden die Qwor unaufhörlich über Kalisstron herfallen und es auslöschen. Niemand vermag ihnen Einhalt zu gebieten, und wie ich an Euren Spuren sah, habt Ihr Bardhasdronda bereits gesehen. Was sagt Ihr dazu, Herr Ritter?«
Tokaro behielt seinen ernsten Blick bei. Der Nimmersatte musste begreifen, dass er seinem Ziel, ein Ritter Angors zu werden, schwer geschadet hatte. »Du hast mich bestohlen und Estra niedergeschlagen, um an das Amulett zu gelangen. So handelt kein Ritter!«
Gàn senkte die Augen und löste die Befestigung der aldoreelischen Klinge am Gürtel, dann hielt er sie Tokaro hin. »Ich gestehe, dass ich nicht rechtmäßig gehandelt habe, doch ich tat es aus einer hehren Absicht heraus. Gleichzeitig müsst Ihr Euch den Vorwurf gefallen lassen, Schutzbedürftigen aus eigensüchtigen Gründen den Beistand verweigert zu haben. So handelt auch kein Ritter.« Er sagte es voller Überzeugung und Aufrichtigkeit.
Tokaro nahm sein Schwert und sah Gàn nachdenklich an. Die Worte beinhalteten eine schmerzende Wahrheit. »Wir beide haben Unrecht getan. Deines wiegt in meinen Augen schwerer: Durch den Raub der Amuletthälfte bringst du ganz Ulldart in Gefahr. Die Ničti erkennen Estra nur als ihre Gebieterin an, wenn sie den Schmuck in Gänze trägt, und nur dann werden sie ihren Befehlen gehorchen.« Er schob die Speerspitze unter das Kinn des Nimmersatten und schob es nach oben, um ihm in die leuchtenden Augen zu schauen. »Wir haben ein halbes Jahr, um ein Unglück abzuwehren, sonst bricht ein Sturm los.« Er reckte die Hand. »Gib mir das Amulett, und dann suchen wir Estra.«
Gàn atmete tief ein. »Ich habe es nicht, Herr Ritter«, sagte er gequält.
Tokaros Herz schlug schneller. »Was soll das heißen?«
»Ich habe es in der Brandung verloren. Ich musste mich entscheiden, das Schwert zu retten oder das Amulett …« Er stockte.
»Du lügst!«, schrie Tokaro, warf den Speer weg und zog die aldoreelische Klinge. »Erst ein Räuber, nun ein Lügner dazu! Gàn, sage mir auf der Stelle, was mit dem…«
Treskor schnaubte erneut, tänzelte rückwärts und rammte dabei den Nimmersatten, ohne ihn umwerfen zu können.
Sie vernahmen ein lautes, dunkles Grollen: Im Schein der Gestirne kam ein furchteinflößendes Wesen den Strand heraufgepirscht. Die enormen Pranken gruben sich tief in den Sand, und die schuppige schwarze Haut machte es nahezu unsichtbar. Verräterisch funkelten die diamantengleichen Augen in dem gestreckten Schädel, der es als Raubtier auswies.
Das Tier war sicherlich viermal so lang wie der Hengst und ragte zweifach über den Rist hinaus. Gàns Speer schien eine angemessene Waffe dagegen zu sein.
Der Nimmersatte erhob sich. »Was tun wir, Herr?«
»Ob es ein Qwor ist?« Er musste sich von der Überraschung erholen, schon jetzt auf eine der Kreaturen zu treffen, aber wenigstens besaß er seine aldoreelische Klinge. Sie gab ihm die notwendige Zuversicht. Lorins Schilderungen über die Macht der magiebegabten Wesen huschten durch seine Gedanken, und diese wiederum ließen nur einen Schluss zu: Ein rascher Sieg musste her. »Angreifen«, entschied er, das Schwert verstauend, und hob seinen Speer auf. Dann schwang er sich auf Treskor. »Schauen wir, was ein Qwor alles beherrscht.« Er preschte an dem Wesen vorbei, um ihm in den Rücken zu fallen, während Gàn sich dem Gegner frontal näherte. »Gib acht!«, rief er dem Nimmersatten zu. »Sei auf alles gefasst!«
Der Qwor entblößte seine zweifache Zahnreihe in der langen Schnauze und fauchte tief, sah zu dem Nimmersatten, dann zu Tokaro. Anscheinend versuchte er abzuschätzen, welcher der beiden Angreifer die größere Gefahr darstellte – und entschied sich für Gàn. Mit einem Brüllen hetzte er auf ihn zu.
Gàn senkte den Spieß, um ihn dem Wesen in den weit geöffneten Rachen zu stoßen. Tokaro lenkte den Hengst mit Schenkeldruck, damit er die Hände frei hatte, und galoppierte von hinten an den Qwor heran.
Das Wesen stemmte seine Pranken vor Gàn tief in den Sand und bremste seinen Lauf abrupt, sodass der Nimmersatte mit Sandkörnern überschüttet wurde. Sie raubten ihm die Sicht, doch er hielt die Spitze unbeirrt nach vorn gerichtet.
Da setzte der Qwor seine Magie ein.
Eine unsichtbare Macht traf Gàn gegen die Brust und schleuderte ihn fünf Schritt weit rückwärts durch die Luft. Erschrocken, erbost schrie er auf und fiel mitten in das kleine Feuer. Flämmchen umspielten ihn und leckten über die Rüstung, Funken stiegen auf. Lange durfte er nicht liegen bleiben, wollte er nicht bei lebendigem Leib geröstet werden.
Tokaro wollte es kaum glauben: Der Qwor rannte derart schnell, dass Treskor ihn nicht einzuholen vermochte! Die Geschwindigkeit galt Tokaro als eine späte Warnung, den Kampf nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dass die Magie ihm nichts anhaben konnte, bedeutete nicht, dass er vor den tödlichen Zähnen sicher war.
Er schleuderte den Speer, um das Ungeheuer von Gàn abzulenken, der sich aus dem Feuer befreien wollte. Doch die geschuppte Haut bot Widerstand. Mit vernehmbaren Klirren und einem Schaben glitt die eiserne Klinge von der Panzerung ab und fiel in den Sand.
»Schneller«, rief Tokaro dem Hengst ins Ohr und zog sein Schwert.
Der Qwor warf sich fauchend auf Gàn, wich dem emporgereckten Spieß aus und biss ihm in die Schulter. Dass sich beide noch im Feuer befanden, störte das Wesen nicht. Die Flammen beleuchteten das Schuppenkleid und brachten die Diamantaugen zu intensiverem Schimmern.
Der Nimmersatte brüllte wütend und voller Schmerzen. Er versuchte, die Kiefer des Angreifers zu packen.
Stattdessen schnappte der Qwor erneut zu, und es gelang Gàn gerade noch, die Arme wegzuziehen, sonst hätte er beide Hände zwischen den Zahnreihen verloren. Er drosch der Kreatur die geballten Fäuste auf die Augen und versuchte, ihr mit den Hörnern die Kehle aufzuschlitzen. Aber die Spitzen raspelten sich an den Schuppen ab, es roch nach verbranntem Horn.
Wenigstens zeigten die Attacken auf die Augen Wirkung; zischelnd sprang der Qwor zurück und blinzelte. Es war die bislang einzige Schwachstelle des Räubers.
Tokaro war endlich heran und holte auf dem Pferderücken zum Schlag mit der aldoreelischen Klinge aus. Einen besseren Zeitpunkt würde es so rasch nicht mehr geben. Und was er gesehen hatte, machte deutlich, dass ein Qwor tödlicher war als jeder andere Gegner: machtvolle Magie, unfassbare Geschwindigkeit und unglaubliche Kraft. »Stirb!«
Da löste sich ein blauer Blitz aus der Brust des Wesens und traf Treskors Hals; dem Hengst blieb nicht einmal mehr Zeit, einen Laut von sich zu geben. Die Vorderläufe knickten kraftlos ein, der Oberkörper senkte sich ruckartig, und Tokaro wurde durch die Luft geschleudert.
Während sich Treskor mehrmals im Sand überschlug, flog der Ritter einige Schritt weit und landete in der starken Brandung. Er bekam Salzwasser in den Mund, und die Kälte verdrängte die Benommenheit nach dem Sturz. Die Wogen wirbelten ihn trotz seines Gewichts nach oben und zurück an den Strand.
Prustend und voller Schmerzen im ganzen Körper richtete er sich auf. Tokaro ahnte, dass der Qwor seine Überlegenheit auskostete und sich mit ihnen einen Spaß erlaubte, bevor er sie töten wollte. Unbändiger Zorn erwachte in ihm.
Gàn spürte derweil, dass ihn unsichtbare Hände berührten und unter seinen Körper glitten. Gleich danach schoss er senkrecht nach oben, vorbei am Rand der Klippen, höher und höher, den Sternen entgegen. Er schrie vor Überraschung – und die Hände ließen ihn los!
Wie ein Stein stürzte er Hunderte Schritt nach unten, Richtung Strand. Der Qwor wich ihm aufreizend tänzelnd aus, um nicht versehentlich getroffen zu werden.
Gàn wusste, dass er einen solchen Aufprall nicht überleben konnte, trotz des weichen Sandes. Dann schoss er dicht an der Klippenwand vorbei und versuchte verzweifelt, sie mit den Fingern zu erreichen und sich festzuklammern.
Doch sein Flug änderte plötzlich die Richtung, und magische Kräfte trugen ihn weg vom rettenden Felsen. »Drecksvieh!«, brüllte er dem Qwor zu und erwartete den Aufprall.
»Angor steh mir bei!« Tokaro torkelte den Strand hinauf und rannte, sobald er trockenen Sand erreicht hatte. Das Schwert hielt er in beiden Händen, um einen gewaltigen Schlag zu führen, der dem Wesen die Seite aufschlitzen sollte. Er hörte Gàn von oben brüllen und sah ihn als mit Armen und Beinen rudernden, stürzenden Schatten.
»Das ist nicht würdig!«, rief Tokaro und schlug zu.
Der Qwor sprang zur Seite, ließ den Hieb damit fehlgehen und funkelte den Ritter an. Es sah sehr hämisch und nach Vorfreude aus.
Gleich darauf wusste Tokaro, weswegen.