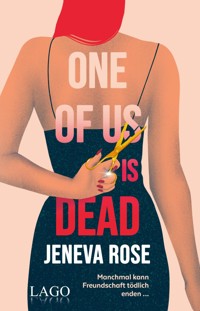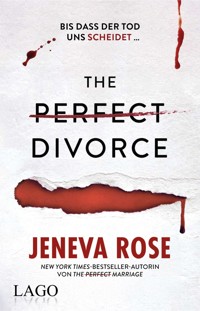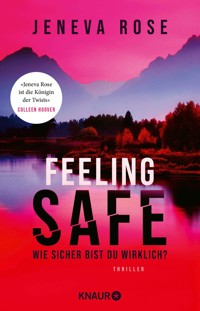
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein hochspannender Psychothriller rund um eine abgelegene Ranch, eine junge New Yorkerin auf der Suche nach Ruhe – und das mysteriöse Verschwinden einer jungen Frau. Wem kann sie trauen? Und wie sicher ist sie wirklich? Auf der Suche nach Ruhe und Entspannung reist die junge New Yorkerin Grace nach Wyoming, wo sie sich auf einer abgelegenen Ranch über Airbnb ein Zimmer gebucht hat. Hier gibt es weder Handynetz noch WLAN oder andere Ablenkungen. Nur ihren Gastgeber Calvin, mit dem sich Grace für die nächsten Tage das Haus teilen wird. Eine Affäre hatte Grace eigentlich nicht im Sinn, doch die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Allerdings beschleicht Grace seit ihrer Ankunft ein unangenehmes Gefühl. Und das bessert sich keineswegs, als plötzlich der Sheriff vor der Tür steht, auf der Suche nach einer vermissten Frau - die zuletzt das Zimmer auf der Farm gebucht hatte … Der geniale Thriller der New-York-Times-Bestsellerautorin Jeneva Rose - voller Twists und unvorhergesehener Wendungen, in dem nichts ist, wie es scheint. »Dieses Buch hat alles, was ich mir von einem Thriller wünsche. Es ist sexy, schockierend und spannend mit einem Ende, das ich nie im Leben erwartet hätte.« Colleen Hoover, Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jeneva Rose
Feeling Safe
Wie sicher bist du wirklich?
Thriller
Aus dem Englischen von Danielle Styron
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wem kann sie trauen?
Und wie sicher ist sie wirklich?
Auf der Suche nach Ruhe und Entspannung reist die junge New Yorkerin Grace nach Wyoming. Auf einer abgelegenen Ranch hat sie sich über Airbnb ein Zimmer gebucht, mitten in der Natur, und wie sich herausstellt, ohne Handynetz oder WLAN. Dafür mit dem äußerst attraktiven Gastgeber Calvin, mit dem sich Grace für die nächsten Tage das Haus teilen wird. Allerdings beschleicht Grace schon bei ihrer Ankunft ein merkwürdiges Gefühl. Und das bessert sich keineswegs, als der Sheriff vor der Tür steht, auf der Suche nach einer vermissten jungen Frau – die ebenfalls bei Calvin zu Gast war …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Tag eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Tag zwei
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Tag drei
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Tag vier
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Tag fünf
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Tag sechs
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Tag sieben
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Tag acht
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Tag neun
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Tag zehn
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
Tag elf
53. Kapitel
Dank
Für Dad.
Tut mir leid, dass dies kein Buch über Zombies geworden ist.
In Liebe – dein viertliebstes Kind.
(Obwohl, vielleicht bin ich mit dieser Widmung auch an die erste Stelle gerückt. Lass es mich wissen.)
Tag eins
1
Grace
Eigentlich wollte ich nicht haltmachen, aber als die Tankwarnleuchte auf dem Armaturenbrett anging, war mir klar, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Gunslinger 66 war die einzige Tankstelle, die ich die letzten vierzig Meilen gesehen hatte, und sie lag direkt am Highway 26. Man hätte meinen können, sie sei für immer geschlossen, wäre da nicht das Neonschild mit dem Wort »OPEN« gewesen – also eigentlich OPE, denn das N ging alle paar Sekunden aus. Das Gebäude war heruntergekommen und hatte trübe Fenster und Balken, die das Ganze kaum noch trugen. Ich seufzte erleichtert auf, als mein alter Mazda 2 Kombi stotternd neben einer Zapfsäule zum Stehen kam, und schüttelte die Hände aus, die schmerzten, weil ich das Steuerrad so fest umklammert hatte. Mit Müh und Not hatte ich es bis hierher geschafft, die letzte Meile nur noch mit einer Mischung aus Stoßgebeten und dem letzten Tropfen Benzin.
Ich schlug die Tür hinter mir zu, hängte mir meine Tasche über die Schulter und hielt sie gut fest. In beiden Richtungen war nichts zu sehen als der sich hinschlängelnde schwarze Highway, offene Felder und die Sonne, die schon langsam unterzugehen begann. In der Ferne machte ich die Berge aus. Von hier wirkten sie wie Ameisenhügel, aber ich wusste, dass sie aus der Nähe höher waren als die Wolkenkratzer, an die ich gewöhnt war. Ein Steppenläufer wehte über die Straße. Ehrlich gesagt, hätte ich so etwas nicht schon so oft in Filmen gesehen, ich hätte keinen Schimmer gehabt, wie diese vertrocknete Wüstenpflanze heißt.
Auf einem kleinen, abgeschabten Aufkleber an der Zapfsäule stand: »Nur Barzahlung. Wenden Sie sich bitte an das Personal.« Das war ja klar, stöhnte ich, band mir die Haare zu einem Pferdeschwanz und ging über den geschotterten Platz. High Heels waren hier vollkommen unbrauchbar, auf dem tückischen Untergrund knickten meine Knöchel ständig zur Seite weg. Die Tür quietschte, als ich sie aufzog. In der Ecke surrte ein Ventilator und verteilte den Geruch von Beef-Jerky und Benzin gleichmäßig im Raum. Die meisten Regale waren nur halb gefüllt. Ich vermutete, dass sie hier draußen nicht regelmäßig beliefert wurden. Hinter der Ladentheke stand ein Riese von einem Mann in einem schmutzigen Overall. Die Haut in seinem Gesicht bestand aus tiefen Falten, kraterförmigen Poren und breiten Narben, sie sah aus wie eine topografische Karte. Er drehte zwar den Kopf in meine Richtung, aber eines seiner Augen ging bei der Bewegung nicht mit. Dann stieß er einen leisen Pfiff aus.
»Na, du kommst aber nich von hier, Kleine?« Der Ton des Mannes war zuckersüß, doch der Blick, mit dem er mich fixierte, wirkte alles andere als harmlos.
Ich hob das Kinn und ging zwei große Schritte auf ihn zu. Meine Absätze knallten auf den Holzboden.
»Woran merkt man das denn?«, fragte ich und legte den Kopf schief.
Sein eines Auge musterte mich von Kopf bis Fuß, während das andere auf die Eingangstür gerichtet blieb. Er griff sich ans Kinn, fuhr sich kurz über die Wangen und dann durch den struppigen Bart, der in Zotteln bis über den Adamsapfel herunterhing.
»Na, daran, wie du zurechtgemacht bist, daran sieht man’s.« Er zwirbelte seinen Bart.
»Gut. Also, ich will für sechzig Dollar tanken«, sagte ich, zog drei Zwanzigdollarscheine aus meinem Geldbeutel und schob sie über die Theke.
Einen Moment stand er nur da und glotzte mich an, als versuchte er zu bestimmen, woher eine Frau wie ich kommen könnte.
»Chicago?« Er schnappte sich das Geld und tippte auf ein paar Tasten einer alten eisernen Registrierkasse herum.
»New York.«
Mit einem Klingeln sprang die Lade auf.
»Da bist du aber weit weg von zu Hause, Miss.«
»Das ist mir klar«, antwortete ich und verfolgte jede seiner Bewegungen.
Er legte das Geld hinein und schob die Lade zu. »Du kannst jetzt tanken.«
Ich nickte ihm kurz zu und verließ den Tankshop, behielt ihn aber im Auge, bis ich draußen war. Auf dem geschotterten Parkplatz beschleunigte ich meine Schritte. Ich spürte seinen Blick auf mir, als ich die Zapfpistole in die Tanköffnung steckte. Mit einem Klicken liefen die Zahlen auf der Anzeige weiter, langsam, viel zu langsam. Ich fischte die Sonnenbrille aus meiner Tasche, setzte sie auf und schaute noch einmal zum Tankshop rüber. Es dauerte keine Sekunde, bis ich ihn entdeckt hatte, denn der Mann klebte förmlich mit dem Gesicht an der Scheibe. Jetzt erinnerte seine verlebte Haut an rohes Hackfleisch. Als ich mein Smartphone herausholte, stellte ich fest, dass ich keinen Empfang hatte. Nutzlos.
Die Anzeige der Zapfmenge sprang auf sechs Gallonen. Es war, als verginge die Zeit langsamer. Ich trommelte mit meinen langen roten Fingernägeln an den Wagen, um mich irgendwie zu beschäftigen. Klick. Klick. Klick. Quietsch. Die Tür des Tankshops ging auf. Der Mann stand leicht schief, als wäre eines seiner Beine länger als das andere. Mit kurzen, unsicheren Schritten kam er auf mich zu. Für sechzig Dollar hätte ich volltanken können, aber einen vollen Tank brauchte ich nicht unbedingt. Ich hatte noch etwa hundertfünfzig Meilen vor mir, würde also mit einer halben Füllung auskommen. Der Mann sagte kein Wort, als er über den Platz auf mich zukam. Auch ich schwieg. Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißtropfen, die an der tiefsten Falte entlang herunterrannen. Seine dicke Zunge glitt über die Oberlippe und leckte den Schweiß weg. Mein Blick wechselte hektisch zwischen ihm und der Zapfsäule hin und her. Mach schon. Mach schon.
Klick, klick, klick machte die Zapfsäule.
Bum, bum, bum kam es aus meiner Brust.
Und plötzlich war da noch ein zusätzliches Geräusch. Ein Klirren. In seiner Tasche. Münzen klimperten, schlugen gegeneinander. Die Muskeln in meinen Beinen und Armen begannen zu zittern, machten sich instinktiv zur Flucht bereit.
Als die Gallonenanzeige auf die Sieben sprang, riss ich die Zapfpistole aus der Tanköffnung und schleuderte sie zur Seite. Benzin tränkte meine High Heels und den Boden unter mir. Ich rannte um das Auto herum, warf mich auf den Fahrersitz und schlug die Tür zu.
Der Mazda schleuderte Schotter hoch, als ich das Gaspedal durchtrat und in Richtung Berge davonraste. Im Rückspiegel sah ich ihn im aufgewirbelten Staub husten. Er schlug sich mit der flachen Hand gegen das Bein und stampfte auf, dabei brüllte er irgendetwas, das ich nicht verstand und auch gar nicht hören wollte. Ein paar Meilen weiter auf dem Highway kurbelte ich das Fenster herunter und sog die frische Luft ein. Durch die Nase einatmen und dabei bis vier zählen, bis sieben den Atem anhalten und auf acht durch den Mund wieder ausatmen. Die Luft roch jetzt anders, schmeckte anders. Wahrscheinlich, weil sie tatsächlich anders war. Nach drei Runden Atmen hatte ich mich beruhigt. Mein Herzschlag wurde wieder normal, und die Muskeln in Armen und Beinen entspannten sich – waren nicht mehr in Alarmbereitschaft, nicht mehr auf eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion eingestellt.
Die Straße vor mir wand sich, so weit das Auge reichte, wie eine schwarze Schlange durch flache Felder. Ich streifte den benzingetränkten Schuh von einem Fuß und warf ihn in den Beifahrerfußraum. Während mein nackter Fuß das Gaspedal durchtrat, zog ich schnell auch den anderen Schuh aus und warf ihn ebenfalls zur Seite. Dann machte ich das Radio an in der Hoffnung auf einen Popsong, irgendetwas, das meine Laune heben würde, aber es war nur Rauschen zu hören. Auf jedem Sender statisches Rauschen wie das Zischen der schwarzen Schlange, auf deren Rücken ich ritt und die mir damit sagte, sie wisse, dass es mich gibt. Das hatte etwas seltsam Tröstliches. Bis zur Tankstelle Gunslinger 66 war die Fahrt ereignislos gewesen. Zeitweise war es mir vorgekommen, als sei ich allein auf der Welt, so selten kreuzten andere Fahrzeuge meinen Weg. Die Einsamkeit war sowohl schön als auch beängstigend. Sie gab einem das Gefühl, einmalig und zugleich vollkommen unbedeutend zu sein.
Wyoming war ein Bundesstaat, an den ich bisher keinen Gedanken verschwendet hatte, was ich jetzt, da ich ihn in all seiner Schönheit erlebte, fast bedauerte. Als ich mich meinem Ziel näherte, begann sich die Landschaft zu verändern. Und je weiter ich nach Westen kam, desto dramatischer wirkte sie. Bald wurden aus den flachen, eintönigen Feldern sanft geschwungene Hügel mit hohen Kiefern, Moosen und Gräsern in wechselnden Schattierungen, und mitten hindurch bahnten sich reißende Wasserläufe ihren Weg; ein Mosaik der Farben auf einem noch feuchten, im Entstehen begriffenen Gemälde. Die majestätischen Rocky Mountains wachten über das Land und boten allen, die sich näherten, Schutz. Auf den Ebenen streiften Büffel und Elche umher, es war eine Landschaft, die ihnen immer gehört hatte und weiterhin gehören würde, einer der wenigen Orte, wo das noch galt. Alles war in einem so grandiosen Maßstab gehalten, dass es einem schwerfiel, die wirkliche Größe zu begreifen. Etwas Vergleichbares hatte ich nie zuvor gesehen, es war wie ein fremder Planet in meinem eigenen Land – eine Art Mikrokosmos –, und ich war froh, dass ich ihn ausgewählt hatte.
Es war nach sieben, und die Sonne schickte die letzten Strahlen, bevor die Nacht anbrach.
»Sie erreichen Ihr Ziel nach dreihundert Metern«, verkündete das Navi, und ich schaltete es aus, denn die Ranch tauchte schon hinter dem nächsten Hügel auf. Umgeben von Wald, direkt am Wind River gelegen, sah das Anwesen aus, als sei es einem Bilderbuch entsprungen. Ein großes, rustikales Haupthaus mit umlaufender Veranda und hohen Erkerfenstern, dazu ein Schuppen und eine Scheune. Auf einer eingezäunten Weide mit einem großen Teich in der Mitte liefen Enten, Hühner, Schafe, Kühe und Pferde frei herum. Die Schotterauffahrt war lang, und ich fuhr sie langsam hoch.
Gerade als ich aussteigen wollte, sah ich ihn. Er stieß die Eingangstür mit dem Fliegengitter auf und hielt sich die Hand über die Augen, um sie gegen das letzte Sonnenlicht abzuschirmen. Er trug Jeans, Cowboystiefel und ein weißes T-Shirt, also genau das, was ich erwartet hatte. Mit wenigen großen Schritten überquerte er die Veranda und kam dann lässig auf mich zugeschlendert, groß, mindestens eins fünfundachtzig, braun gebrannt und muskulös. Muskeln, die eindeutig von körperlicher Arbeit stammten und nicht vom Training in einem Fitnessstudio wie bei so vielen Trotteln in der Stadt.
Bevor ich ausstieg, schlüpfte ich noch schnell in meine Schuhe. Sie stanken nach Benzin, und ich hoffte, er würde es nicht bemerken oder mich wenigstens nicht darauf ansprechen. Nachdem ich mir die Handtasche über die Schulter geworfen hatte, richtete ich mich auf und schob die Sonnenbrille in die Haare. Beim Näherkommen erkannte ich kleine Besonderheiten an ihm, etwa die rosafarbene Narbe über der linken Augenbraue. Sie war zwei bis drei Zentimeter lang, und die Farbe verriet, dass er sie noch nicht lange hatte. Aber wir alle trugen ja Narben, und jede von ihnen hatte ihre eigene Geschichte. Ich überlegte, welche Geschichte wohl hinter seiner steckte. Er hatte einen stoppeligen Dreitagebart, der nicht gewollt wirkte, sondern eher so, als hätte er einfach keine Zeit zum Rasieren gefunden. Seine Kieferpartie war kantig und scharf geschnitten, und er hatte grüne Augen, so grün wie die Weide, auf der die Kühe und Schafe grasten. Ich schloss den Mund und presste die Lippen fest aufeinander, um sicherzugehen, dass ich nicht aussah wie ein sabbernder Hund beim Anblick von einem schönen Stück Fleisch.
»Sie müssen Grace Evans sein«, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. Seine Stimme war tief, sein Händedruck kräftig.
»Stimmt. Freut mich, Sie kennenzulernen.« Ich klang etwas unsicherer als sonst, nicht ganz so autoritär und bestimmt, wie die Kollegen im Büro es von mir gewohnt waren. Mein Händedruck fiel etwas schwächer aus, nur aus dem zierlichen Handgelenk kommend, nicht mit der Kraft des ganzen Arms. Flirtete ich etwa mit ihm? Oder kam das nur daher, dass mir die Begegnung mit dem unheimlichen Tankwart noch in den Knochen steckte? Ich war mir nicht sicher, zog meine Hand aber unwillkürlich zurück.
»Ich bin Calvin Wells, und das Vergnügen ist ganz meinerseits.« Als er lächelte, kam eine Reihe gerader weißer Zähne zum Vorschein, und auf der rechten Wange entstand ein Grübchen.
»Wie war die Fahrt?«, fragte Calvin und hakte die Daumen in die Gürtelschlaufen seiner Jeans. Mehrere dünne, lange Kratzer verunzierten die Innenseite seines rechten Unterarms.
»Bis zur Gunslinger 66 gut.« Ich stieß einen Seufzer aus und musterte ihn von oben bis unten. Er hatte etwas von einem Kunstwerk, passend zur Landschaft um ihn herum. Man konnte gar nicht anders, als ihn sich ganz genau anzusehen. Schon da war mir klar, dass er mir als willkommene Ablenkung dienen würde.
Mit der Augenbraue schnellte auch die rosafarbene Narbe hoch.
»Dieser unheimliche alte Tankwart dort … er hat mich regelrecht verfolgt. Deshalb konnte ich nicht mal zu Ende tanken.« Ich verzog den Mund.
»Ach, Mist. Das tut mir leid. Geht’s Ihnen gut?«
Ich nickte. »Ja, jetzt schon. Es kam nur so unerwartet.«
»Über so etwas müssen Sie sich hier keine Sorgen machen. Sie stehen hier unter meinem persönlichen Schutz, Grace«, sagte Calvin und lächelte.
Ich stieß ein kurzes Lachen aus und schüttelte den Kopf.
»Was ist daran so komisch?«, fragte er, weiterhin lächelnd.
»Ach, nichts. Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich mich wie eine Prinzessin anhöre, die auf ihren Retter wartet.«
»Das fand ich überhaupt nicht«, sagte er und lachte gutmütig. »Ich nehme mal Ihr Gepäck und zeige Ihnen das Zimmer.« Er ging zum Kofferraum.
»Ach, das ist nicht nötig.« Ich mochte es eigentlich nicht besonders, wenn andere meine Sachen anfassten.
»Quatsch.« Er drückte auf den Knopf unter dem Nummernschild, der Kofferraum sprang auf.
»Sie halten mich wohl doch für eine Prinzessin?«, scherzte ich.
»Nein, Grace, aber Gastfreundschaft ist mir sehr wichtig.«
Nachdem er beide Koffer aus dem Wagen gewuchtet hatte, warf er sich einen über die Schulter und trug den anderen in der Hand. »Ich werde Sie gut umsorgen«, sagte Calvin. »So gut, dass Sie hier gar nicht mehr wegwollen. Das ist nämlich mein Motto«, fügte er hinzu, lächelte noch breiter und stapfte die Einfahrt hoch Richtung Haus.
Ich warf einen letzten Blick auf den alten, verbeulten Wagen, mit dem ich gekommen war, schaute dann wieder zu Calvin und zögerte einen Augenblick. Ich hatte ein ungutes Bauchgefühl und fühlte mich einen kurzen Moment wie im freien Fall. Aber so schnell, wie das Gefühl gekommen war, verschwand es auch wieder, noch bevor ich überhaupt eine Chance hatte, darüber nachzudenken oder mich zu fragen, was das gewesen war. Ich schluckte schwer und gab mir einen Ruck, ihm zu folgen. Einen Schritt nach dem anderen.
2
Calvin
Ich stellte Graces Koffer neben das französische Bett. »Das ist Ihr Zimmer«, erklärte ich und wies auf den Raum.
Grace kam nach mir herein, sie hatte eine Tragetasche und ihre Handtasche dabei. Mit ausdrucksloser Miene sah sie sich um, musterte jeden Winkel und jeden Quadratzentimeter. Es war schwer zu sagen, ob sie enttäuscht war oder nicht. Als ich anfing, Zimmer über Airbnb zu vermieten, hatte ich kurz erwogen, alles zu renovieren, aber dann brachte ich es doch nicht übers Herz. Meine Mutter hatte das Haus selbst eingerichtet, mit einem Mix aus selbst gemachten und gebrauchten Dingen. Zuletzt war hier in den Siebzigern neu tapeziert worden, aber der Stil war wohl gerade wieder angesagt, zumindest behauptete meine Nachbarin das.
Grace legte ihre Taschen auf das Bett und zögerte kurz, bevor sie sich wieder zu mir umdrehte. Ihr Blick wanderte langsam von meiner Taille hoch bis zum Gesicht. Sie roch nach einer Mischung aus Gänseblümchen und Benzin, was seltsam war, aber ich sagte nichts. Das wäre unhöflich gewesen. Ihr Haar war goldblond und reichte ihr bis zur Mitte des Rückens, ihre Augen waren vom blausten Blau, das ich je gesehen hatte, so intensiv, dass die Farbe beinahe künstlich wirkte. Sie trug einen engen schwarzen Rock, hochhackige Schuhe und eine Bluse aus einem irgendwie gerafften Stoff. Ich bin sicher, da, wo sie herkam, war das der letzte Schrei, aber hier trugen die Frauen so etwas nicht. Ihre weichen Züge standen in direktem Kontrast zu diesem schwarzen Outfit, und ich konnte gar nicht anders, als ständig auf ihren Schmollmund zu starren, während ich darauf wartete, dass sie etwas sagte.
»Es ist perfekt.« Sie lächelte, aber ihre Stimme klang etwas unsicher.
Ich atmete erleichtert aus, und sie lachte.
Dann hob sie eine Augenbraue. »Hatten Sie befürchtet, es könnte mir nicht gefallen?
»Na ja«, ich trat von einem Fuß auf den anderen, »normalerweise habe ich so gut wie keine weiblichen Gäste, und ich war mir nicht sicher, ob ein Stadtmensch wie Sie sich an einem solchen Ort wohlfühlen würde.«
»Wenn ich es mir in New York zwischen Ratten und Kakerlaken gemütlich machen kann, dann schaffe ich das überall.« Sie hob ihren Koffer mit einem Schwung auf das Bett. Also Kraft hatte sie wohl, denn das Ding wog mindestens fünfundzwanzig Kilo.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte ich.
Das war immer der eher unangenehme Teil bei der Betreuung von Gästen, denn man konnte nie wissen, ob sie wollten, dass man blieb und sich mit ihnen unterhielt, oder ob sie lieber in Ruhe gelassen werden wollten. Bei Grace war ich mir zwar ziemlich sicher, dass Letzteres zutraf, aber ich fühlte mich jetzt schon zu ihr hingezogen wie eine Motte zum Licht oder wie die verdammten Kojoten zu meinen Hühnern. Also war bereits klar, dass ich jede Gelegenheit nutzen würde, Zeit mit ihr zu verbringen.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Geht schon«, sagte sie nüchtern, griff ihre schwarze Ledertasche, bückte sich und schob sie so weit wie möglich unter das Bett.
»Streng geheim?«, witzelte ich und kratzte mich im Nacken.
Sie richtete sich auf und schaute mich mit zusammengezogenen Brauen an. »Nur Arbeitsunterlagen für Notfälle. Wenn ich die nicht außer Sichtweite schaffe, werde ich unweigerlich anfangen, E-Mails zu beantworten oder ans Telefon zu gehen, aber ich bin ja zum Entspannen hier, nicht zum Arbeiten.« Mir schien es, als versuche sie eher, sich selbst davon zu überzeugen als mich. Offenbar hatten wir mehr gemeinsam, als sie ahnte, denn ich musste auch immer etwas zu tun haben. Müßiggang ist aller Laster Anfang, so sagt man doch.
»Ich kann die Sachen auch im Keller wegschließen, wenn Sie möchten.«
»Die Idee hat was, aber das wird wohl nicht nötig sein.« Grace öffnete den Reißverschluss ihres großen Koffers und schlug den Deckel zurück, sodass ein Stoß Bücher und der perfekt gepackte Inhalt zum Vorschein kamen. Dass sie gern las, wusste ich schon, denn es stand in ihrem Airbnb-Profil, und ich vermutete, dass sie einen Großteil ihrer Zeit hier mit der Nase in einem Buch verbringen würde. Alle Sachen waren in einzelne Packwürfel sortiert. Grace öffnete einen und ließ einen Haufen Spitzen-BHs und Seidenhöschen auf die geblümte Tagesdecke fallen. Sie warf mir einen kurzen Blick zu, und dann widmete sie sich wieder ihrer Aufgabe. Ich verstand das als Zeichen, dass sie jetzt ihre Ruhe wollte.
»Dann störe ich mal nicht weiter.« Ich tippte mit dem Zeigefinger an meinen imaginären Hut und ging ein paar Schritte Richtung Flur.
Sie schaute schnell zu mir, und ihr Mund öffnete sich langsam. »Zeigen Sie mir doch erst mal alles. Auspacken kann ich ja auch später noch.«
»Sehr gern. Fangen wir doch gleich mit dem Kühlschrank an, denn ich könnte jetzt ein Bier brauchen.« Ich grinste in mich hinein.
Auch über Graces Gesicht huschte ein Lächeln. »Und ich erst«, sagte sie.
Ich hätte sie gar nicht als Biertrinkerin eingeschätzt und konnte mir ein weiteres Grinsen nicht verkneifen.
Bevor sie mir folgte, streifte sie noch ihre Schuhe ab, wackelte mit den Zehen und stieß ein erleichtertes Seufzen aus. Ihre Zehennägel waren im gleichen dunklen Rot lackiert wie die Fingernägel.
In der Küche holte ich zwei Budweiser Light aus dem Kühlschrank und öffnete sie mit einem gezielten Schlag an der Kante der schweren Holztheke. Ich reichte ihr eins. »Wollen wir uns nicht duzen?«
Grace nickte mit einem Lächeln und nahm einen Schluck. Der Rand der Flasche ruhte auf ihren vollen Lippen, und als sie getrunken hatte, stieß sie einen genüsslichen Seufzer aus. Ich starrte sie beeindruckt an.
Grace drehte die Flasche zweimal hin und her, als wollte sie das Etikett lesen. Ich nahm einen langen Zug. Das Bier perlte auf meiner Zunge und wärmte mich augenblicklich von innen.
»Das hier ist also die Küche«, sagte ich.
»Ja, das habe ich mir fast gedacht«, frotzelte sie.
Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem breiten Grinsen. Ich versuchte, mir meine Begeisterung nicht anmerken zu lassen, aber mein Körper hörte nicht auf mein Gehirn. Ich war sicher, dass ich auch noch rot geworden war.
Grace sah sich um.
Die Küche war aus dem gebaut, was uns in dieser Gegend zur Verfügung stand. Schränke und Arbeitsflächen waren aus mehr oder weniger unbehandeltem Holz, sodass der Raum wie das Innere eines Baumes aussah. Da ich allein hier lebte, war alles funktional und weniger auf Design ausgerichtet. Weder stand unnötiger Krempel herum, noch gab es Sachen, die nur der Dekoration dienten, wie etwa von Regalen baumelnde Kupfertöpfe. Nur eine einfache Küche aus Holz mit einem Messerblock, einer Kaffeekanne, der Spüle und ein paar Küchengeräten. In meinen Augen perfekt, aber vielleicht ging es nur mir so.
»Schlicht, minimalistisch. Gefällt mir sehr«, lobte Grace.
»Danke. Sie passt eigentlich nicht zum Rest des Hauses, weil, na ja …« Ich verstummte. Das war etwas, worüber ich nicht gern sprach, und ich hoffte, sie würde nicht nachhaken. Dann führte ich sie ins Wohnzimmer. »Das hat noch meine Mutter eingerichtet, deshalb passt es vom Stil her auch zu deinem Zimmer.«
In einem Zeitungsständer standen alte, ungelesene Zeitschriften von Verlagen, die es schon lange nicht mehr gab. Neben dem Kamin lag ein Stapel gehäkelter Decken, und an den Wänden hingen, wild zusammengewürfelt, Bilder von alten Freunden zwischen Schnappschüssen aus dem Leben meiner Mutter. Bei einigen der Fotos hätte ich nicht mal sagen können, wer oder was auf ihnen abgebildet war, deshalb dachte ich mir zu ihnen lieber eigene Geschichten aus.
Grace ging zu dem hohen Bücherregal und strich mit den Fingern über die Buchrücken.
»Liest du gern?«, fragte sie und schaute zu mir hin.
»Ja«, antwortete ich mit einem Nicken.
»Ich auch.« Sie lächelte.
Fast wäre mir herausgerutscht, dass ich das schon wusste, aber ich konnte mich gerade noch bremsen. Ihr Blick wanderte zu den ausgestopften Tierköpfen, die eigenwillig und ohne Konzept an den Wänden des Wohnzimmers verteilt waren. Das war die Handschrift meines Vaters. Ein Hirsch, ein Elch, ein Wolf, ein Dickhornschaf und ein Berglöwe. Egal, wo man in dem Raum stand, überall verfolgten einen die Blicke ihrer schwarzen Marmoraugen. Man merkte es Grace an, dass sie ihr nicht gefielen. Sie verzog das Gesicht und betrachtete argwöhnisch jeden Einzelnen. Vielleicht fürchtete sie, eines der Tiere könnte ihr von der Wand entgegenspringen.
»Die beißen nicht«, sagte ich lachend.
»Das ist mir schon klar.« Sie biss sich auf die Lippe. »Es scheint nur ein bisschen … ungewöhnlich.«
»Hier in der Gegend ist das kein ungewöhnlicher Anblick. Allerdings kommst du ja auch nicht von hier.« Ich schaute sie an, und mein Blick glitt von ihren Füßen bis hoch zu den Augen. Was hatte eine solche Frau an einem Ort wie diesem zu suchen? »Ich kann sie auch runternehmen?«, bot ich an.
Grace wirkte wie eine Außerirdische, die gerade auf einem neuen Planeten gelandet ist. Sie schüttelte den Kopf. »Oh nein. Natürlich nicht.«
»Sicher?«
»Ganz sicher.«
»Du wirst dich an sie gewöhnen«, sagte ich. Und das stimmte ja auch. Man kann sich an fast alles gewöhnen.
Sie nickte zögernd, sagte aber nichts weiter.
Wir gingen den Flur entlang, und ich zeigte ihr das Badezimmer, das dritte Schlafzimmer und die Tür zu meinem Zimmer. Ich erklärte ihr auch, wo der Wäscheschrank mit den Handtüchern und zusätzlichen Decken und Kissen war. Sie schwieg, schaute zu und ließ alles auf sich wirken. Auf dem Weg zurück durch den Flur blieb sie stehen.
»Was ist das hier?«, fragte sie und deutete auf die Tür mit dem Vorhängeschloss.
»Ach, da geht’s in den Keller. Er ist noch im Rohbau, da darf keiner runter. Aber das willst du auch gar nicht, es gibt ohnehin nur Spinnen und Gerümpel, und es riecht modrig.« Schnell winkte ich sie weiter. »Hier lang.«
Als ich sie mir nicht folgen hörte, drehte ich mich um. Sie war vor der Tür stehen geblieben und starrte sie an. Mir war klar, dass sie alles tun würde, um herauszufinden, was sich dahinter verbarg. Wenn man jemandem etwas untersagt, will er oder sie es um jeden Preis erst recht tun. Die Neugier siegt immer, und genau deshalb hatte ich das Vorhängeschloss auch angebracht. Grace muss meinen Blick gespürt haben, denn sie schaute schnell in meine Richtung und lächelte unsicher.
»Sollen wir?«, fragte sie mit schriller Stimme. Ich fand den veränderten Ton etwas merkwürdig, aber ich kannte sie ja gar nicht, lernte sie gerade erst kennen – so gesehen war alles an ihr ungewohnt.
Wieder in der Küche, zog ich die Schiebetür zu der großen Holzterrasse auf, die ich im letzten Sommer gebaut hatte. Es war ein schöner Platz zum Sitzen mit mehreren Outdoor-Sofas, Stühlen und Beistelltischen. Am Geländer standen ein Gas- und ein Holzkohlengrill nebeneinander.
»Wunderschön«, sagte sie und bewunderte die Aussicht.
Es war die perfekte Kulisse mit allem, was Wyoming zu bieten hat. Eine Weide mit Schafen und Kühen, dahinter der Fluss, der die Grenzlinie des Grundstücks bildete. Jenseits des Flussufers dichte Kiefernwälder und in der Ferne die Berge, die über der ganzen Szenerie aufragten. Das war so ungefähr das Einzige, was mir daran gefiel, wieder in Wyoming zu sein. Hier ist nicht viel los, und es gibt auch kaum Leute in meinem Alter, aber schön ist es hier schon. Das muss ich zugeben.
»Ja, das ist es wirklich«, antwortete ich mit einem Blick zu Grace. Nun schaute auch sie mich an, lächelte erneut und leerte ihr Bier mit einem langen Zug. Gerade wollte ich sie fragen, warum sie sich Dubois in Wyoming als Urlaubsziel ausgesucht hatte, doch sie kam mir zuvor.
»Ich gehe jetzt fertig auspacken.« Damit drehte sie sich um und ging zur Schiebetür.
»Gib mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.«
»Ich bin schon ein großes Mädchen. Ich komme allein klar.« Ihre Stimme klang, als wollte sie mit mir flirten, zumindest kam es mir so vor. Ohne ein weiteres Wort verschwand sie nach drinnen, und ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Grace hatte etwas an sich, etwas ganz Besonderes. Aber ich war noch nicht so weit, wieder Jagd auf eine Frau zu machen. Es war noch zu früh.
3
Grace
Ein paar nicht zueinanderpassende Drahtbügel stießen klirrend aneinander, als ich meine Kleider in den Schrank hängte. Meine Schuhe reihte ich auf dem Boden vor dem Fenster auf. Als ich die oberste Schublade der Kommode aufzog, entdeckte ich mehrere Sets Damenunterwäsche und einen Sport-BH. Gute Marken: Lululemon und SKIMS. Seltsam. Ich hielt einen Tanga in Größe S hoch. Die Sachen mussten von einem früheren Gast hier liegen geblieben sein, oder vielleicht hatte Calvin eine Freundin. Ich legte alles in die Schublade zurück und schloss sie. Die darunter war leer, also brachte ich meine eigene Unterwäsche, die Badeanzüge und Shorts darin unter.
Als Nächstes trug ich meinen Stoß Bücher zum Tisch und stellte sie in der Reihenfolge auf, in der ich vorhatte, sie zu lesen. Ich bin Schnellleserin und ging davon aus, dass ich in der Zeit hier locker alle fünf schaffen könnte.
Anfangen würde ich mit einer netten Strandlektüre, die sich schnell verschlingen ließe. Ich mochte solche Bücher, weil sie einem nichts abverlangten. Danach wollte ich etwas Trauriges lesen, und das hier würde mich garantiert zum Weinen bringen – zumindest versprach das der Klappentext. Ich fand, ich brauchte noch etwas, aus dem ich etwas lernen konnte, also hatte ich einen Selbsthilferatgeber eingepackt, der sich mit dem Ändern von Gewohnheiten beschäftigte. Ich hatte einige schlechte Angewohnheiten, die ich loswerden musste, und jede Menge gute, die ich stärken wollte. Gewohnheiten konnten einen davor bewahren, Fehler zu begehen. Der mitgebrachte Horrorroman versprach, einem das Blut in den Adern gefrieren zu lassen, aber das glaubte ich erst, wenn ich es sah. Es brauchte schon einiges, um mir Angst einzujagen. Und als Letztes hatte ich einen Thriller dabei. Dieser lockte mit der Ankündigung einer vollkommen unerwarteten Wendung. Allerdings versprach das heutzutage praktisch jeder Thriller, und nur wenige lösten das Versprechen auch ein.
Nachdem ich meine Schminktasche, die Haar-Utensilien und sämtliche Toilettenartikel ausgepackt hatte, schaute ich aus dem Erkerfenster über der großen Kommode. Ein langer Riss verlief von der unteren linken Ecke hinauf bis zur Mitte. Ich fuhr ihn mit dem Finger nach. Die scharfe Kante der zerbrochenen Scheibe schnitt mir in die Haut. Au. Ich steckte den verletzten Finger in den Mund und lutschte daran. Der Schmerz verging schnell. Übrig blieb nur eine Blutspur, die sich ein paar Zentimeter über das Glas zog und die Landschaft dahinter zersplittert aussehen ließ und rot einfärbte. Es erinnerte mich an das Bild, das ich von der Stadt hatte. Ich war weit gereist, um die Welt in anderem Licht zu sehen, aber irgendwie schien sie doch immer gleich. Die Sonne versank hinter den Bergen und überließ das Feld der Dunkelheit. Einer Dunkelheit, wie ich sie nicht mehr kannte, denn in der Stadt erlebt man sie nicht – zu viele Lichter.
Mir fiel ein, dass ich versprochen hatte, zu schreiben, sobald ich angekommen war, und ich nahm mein Smartphone aus der Tasche. In der oberen rechten Ecke standen die Worte Kein Netz. Ich spürte einen Stich in der Magengrube und schluckte heftig. Das war ein Anblick, an den ich nicht gewöhnt war.
Als ich in die Küche kam, stand Calvin am Herd und brutzelte etwas, das nicht besonders gut roch – ein erdiges, fleischiges, süßliches Aroma. Er rührte mit einem Holzlöffel im Topf, dazu trank er entspannt sein Budweiser Light.
»Hi«, sagte ich.
Calvin fuhr herum, und als er mich sah, begann er zögernd zu grinsen. »Haie gibt es nur im Meer.«
Ich rang mir ein Lächeln ab. »Hast du vielleicht ein Pflaster für mich?«
Er legte den Löffel auf ein gefaltetes Stück Küchenpapier. »Natürlich. Hast du dir wehgetan?«
Ich hielt meinen Finger hoch, und ein Blutstropfen rann aus dem Schnitt. Es blutete noch immer. »Kampfverletzung von deiner kaputten Fensterscheibe.«
»Ach, Mist. Das tut mir leid.« Er verschwand im Flur und kam gleich darauf mit einem kleinen Verbandskasten zurück. »Ich wollte das schon längst repariert haben. Nicht alle meine Gäste sind auch gute Gäste.«
Calvin zog einen Stuhl heran und bedeutete mir, Platz zu nehmen. Er setzte sich mir schräg gegenüber, machte den Verbandskasten auf und nahm Salbe, Watte, Desinfektionsmittel und ein Pflaster heraus. Mit dem Versorgen von Wunden kannte er sich offensichtlich aus.
»Schade um das Fenster«, sagte ich.
»Mach dir keinen Kopf. Der Gast hat dafür bezahlt.« Er riss die Ecke der Verpackung mit den Zähnen auf und zog ein kleines gefaltetes Tuch heraus.
»Werden deine Gäste oft grob?« Ich hielt ihm meinen Finger hin. Blut tropfte auf den Küchentisch. Es versickerte sofort in dem unbehandelten Holz und hinterließ einen Fleck. Calvin schien das entweder nicht zu bemerken, oder es war ihm egal. Er wischte einen Tropfen weg und widmete sich wieder meiner Wunde.
»Nur die schlechten Gäste«, sagte er und schaute kurz zu mir hoch.
Als er einen mit Desinfektionsmittel getränkten Wattebausch auf die Wunde drückte, zuckte ich zusammen, aber das Brennen ließ schnell nach.
»Ist es nicht unbehaglich, Fremde im Haus zu haben?«, fragte ich.
Calvin hielt kurz inne, um mir in die Augen zu schauen. »Fremde sind sie ja nur zu Beginn«, antwortete er mit ernstem Ausdruck, bevor er mir schließlich ein Pflaster um den Finger wickelte und festklebte.
»Bitte schön. So gut wie neu.« Lächelnd packte er alles wieder zusammen.
»Danke.«
Nun ging er zurück zum Herd und rührte langsam im Topf.
»In der obersten Schublade meiner Kommode liegt übrigens Damenwäsche. Ich habe sie einfach drin gelassen, aber ich dachte, ich sage dir Bescheid.«
Er erstarrte für einen Moment, und es schien, als versteiften sich seine Schultern, aber ich war mir nicht sicher. Dann drehte er sich um. »Die muss noch von meiner Ex sein, von Lisa.« Er presste die Lippen zusammen und fing wieder an, im Topf zu rühren.
Mir lag etwas auf der Zunge, ich zögerte kurz, aber dann sprudelte es einfach heraus. »Du weißt ja, was es bedeutet, wenn eine Ex nach einer Trennung absichtlich etwas dalässt. Damit hat sie einen Grund, zurückzukommen.«
»Na, ich hoffe, das ist hier nicht der Fall.«
»Warum das denn?«, fragte ich.
»Weil sie tot ist«, erwiderte er.
Ich schluckte und bekam einen Hustenanfall. Calvin nahm schnell ein Glas aus dem Schrank und füllte es mit Wasser. Ich verstand, weshalb er es in so sachlichem Tonfall gesagt hatte, denn so ist der Tod. Entweder lebst du, oder du bist tot. Dazwischen gibt es nichts. Er reichte mir das Glas, und ich trank es fast leer.
»Alles in Ordnung?«, fragte er und klopfte mir leicht auf den Rücken.
»Ja.« Ich räusperte mich. »Hab mich nur verschluckt.«
Er nickte und kehrte an den Herd zurück.
»Das mit deiner Ex tut mir sehr leid.«
Calvin schaltete die Herdplatte aus und trank einen Schluck Bier.
»Darf ich fragen, wie sie gestorben ist?«, fügte ich hinzu.
»Autounfall … Ist ungefähr ein Jahr her.« Er drehte die Flasche in den Händen, als überlegte er, ob er noch mehr sagen sollte. »Wir hatten uns an dem Abend getrennt, aber ich bin davon überzeugt, dass wir wieder zusammengekommen wären. So war es immer.« Er sah mich nicht an, während er sprach, sondern starrte auf die weiße Wand, als wäre dort etwas Wichtiges zu sehen.
»Das tut mir sehr leid, Calvin.« Ich wusste nicht, was ich sonst noch hätte sagen können, in solchen Dingen war ich nicht gut. Dem Tod war ich in meinem Leben zwar schon oft begegnet, aber mit ihm konfrontiert zu sein und darüber zu sprechen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
Sein Blick kehrte zu mir zurück.
»So ist das Leben, nehme ich mal an.« Er zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf, als stünden seine Gedanken und Gefühle auf einer Art Zaubertafel, von der er sie einfach abwischen konnte. »Noch ’n Bier?«
Themenwechsel.
Ich nickte. Er holte eins aus dem Kühlschrank und machte es auf.
»Gibt es hier kein Netz?« Als er mir das Bier reichte, hielt ich mein Handy in die Höhe.
»Nein. Dafür muss man in die Stadt, aber ich hab einen Festnetzanschluss, falls du telefonieren musst.« Er deutete auf ein blassgrünes Telefon, das an der Wand hing. Ein langes Spiralkabel verband den Hörer mit der Station, es baumelte praktisch bis auf den Boden, als wäre irgendwann einmal zu fest daran gezogen worden.
»Ach, ich wollte nur schnell einer Freundin schreiben, dass ich gut angekommen bin. Gibt es hier denn auch kein WLAN?«
»Gab es mal. Aber jetzt brauche ich einen neuen Router.« Er lehnte sich gegen die Küchentheke und nahm einen weiteren Zug aus der Flasche.
Ich verschluckte mich und hatte kurz das Gefühl zu ersticken. Schnell trank ich noch einen Schluck. In der Beschreibung war nicht erwähnt gewesen, dass es keinen Handyempfang gab. Man sollte doch meinen, dass diese Info wichtig ist, aber vielleicht war das hier draußen auch einfach normal. Kein WLAN zu haben nervte mich auch, aber vermutlich war ich einfach zu sehr daran gewöhnt, ständig erreichbar zu sein.
»Alles gut?«, fragte er. Seine Miene war sehr besorgt.
Ich nickte. »Ja, klar.«
Es war nicht der richtige Zeitpunkt, um wegen des fehlenden Handyempfangs und WLANs ein Riesenfass aufzumachen. Ich war gerade erst angekommen und eigentlich auch hier, um mich zu erholen. Außerdem tat es mir sicher gut, mal eine Weile für niemanden erreichbar zu sein.
4
Calvin
»Was kochst du da?«, fragte Grace.
Jetzt, da sie über meine Ex Bescheid wusste, sah sie mich wohl mit anderen Augen. Der Tod veränderte immer die Sicht auf die Welt und auf das Gegenüber. Ich hoffte, dass es kein Fehler gewesen war, ihr davon zu erzählen.
»Meine Spezialität. Gebackene Bohnen mit Speck und Würstchen«, sagte ich lächelnd.
Sie verzog keine Miene. Von meinen Kochkünsten war Grace offensichtlich nicht beeindruckt. Hätte ich geahnt, wie hübsch mein Gast war, hätte ich etwas Vornehmeres gemacht, aber ihr Profilbild auf der Website war bestenfalls als verschwommen zu bezeichnen.
»Möchtest du was davon?«, bot ich ihr an. Verpflegung war im Preis inbegriffen, wenn gewünscht, aber die meisten Gäste nutzten die Ranch nur zum Übernachten. Sie verließen das Haus früh am Morgen und kehrten erst spätabends zurück. Es war schön, jemanden zum Abendessen dazuhaben.
Sie rümpfte ganz kurz die Nase und schüttelte dann den Kopf. »Ich wollte eigentlich in die Stadt und dort etwas essen und will dir auch keine Umstände machen.«
»Ach, Quatsch. Du machst mir keine Umstände. Außerdem ist es schon ein bisschen spät, um auf den Straßen hier herumzufahren. Nachts kommen jede Menge wilde Tiere raus.« Ich holte zwei tiefe Teller aus dem Schrank und füllte sie.
»Du bist doch keine von diesen Vegetarierinnen, oder?«, fragte ich und stellte einen Teller mit einem Löffel vor sie hin.
Grace schaute erst das Essen an und dann mich. »Nein, gar nicht. Aber … also … so was esse ich eigentlich nicht.«
Ich nahm meinen Teller und das Bier, setzte mich neben sie und begann sofort zu löffeln. Die Süße der Bohnen und das deftige Aroma von Würstchen und Speck vermischten sich bei jedem Bissen.
Sie sah mir mit aufgerissenen Augen zu und hielt sich die Bierflasche vor den Mund, als wollte sie ihre Reaktion vor mir verbergen.
»Versuch’s doch wenigstens mal.« Ich lächelte. »Ich garantiere dir, dass es dir schmecken wird, und falls doch nicht, dann ess ich deine Portion auch noch auf.«
Grace stellte ihr Bier ab und zögerte noch einen Moment, bevor sie schließlich nach dem Löffel griff. Sie pickte eine einzelne Bohne heraus.
»Du musst auch vom Speck und den Würstchen nehmen.«
Sie schaute mich an und tauchte ihren Löffel ins Essen. Dann hielt sie ihn vor sich hin und starrte ihn an. »Augen zu und durch!«
Sie schloss die Augen, hielt sich mit der anderen Hand die Nase zu und steckte den Löffel in den Mund. Sie übertrieb ganz schön, aber von einer Frau wie ihr war das wohl nicht anders zu erwarten. Auch beim Kauen hielt sie sich noch die Nase zu und die Augen geschlossen. Als die Geschmacksnuancen sich so vermischten, wie ich es vorhergesehen hatte, riss sie plötzlich die Augen auf und ließ die Nase los.
»Das schmeckt ja wirklich richtig gut.« Munter belud sie ihren Löffel aufs Neue.
»Hab ich doch gesagt. Du musst mir schon vertrauen.« Ich schmunzelte. Ein paar Minuten aßen wir schweigend weiter. Das einzige Geräusch war das Klappern unserer Löffel.
»Du hast gesagt, du isst solche Sachen nicht. Was isst du denn sonst?«, fragte ich und brach damit das Schweigen.
»Na, normale Sachen eben.«
»Aha, dann bin ich also nicht normal?«, witzelte ich.
Lachend sagte sie, so hätte sie es nicht gemeint.
»Ich zieh dich doch nur auf«, gab ich grinsend zurück.
Wieder herrschte ein paar Minuten lang Schweigen. Es war, als wüssten wir beide nicht recht, was wir sagen sollten, oder als wollten wir mit unseren Worten vorsichtig sein.
»Erzähl mir mehr von dir, Grace«, begann ich schließlich und lehnte mich auf meinem Stuhl zurück.
Sie trank einen Schluck Bier und schaute dabei mit ihren blauen, blauen Augen direkt in meine. Anders konnte ich ihre Augen nicht beschreiben: die blausten Augen der Welt.
»Was willst du denn wissen?«
»Alles, aber fangen wir doch damit an, was du beruflich machst.« Ich verschränkte die Arme.
»Ich bin in der Finanzwirtschaft tätig«, sagte sie nüchtern.
»Beeindruckend.« Ich nahm noch einen Schluck, und sie nickte.
»Jetzt bist du dran. Erzähl mal, Calvin Wells. Womit verdienst du deine Brötchen?« Sie neigte den Kopf zur Seite.
Es gefiel mir, dass sie meinen vollen Namen verwendete. »Ach, so einiges. Ich kümmere mich um die Farm, mache Airbnb, Gartenarbeit, hin und wieder Gelegenheitsjobs. Alles, was mich in Bewegung und die Ranch am Laufen hält.«
Sie lehnte sich zurück, nahm also die gleiche Haltung ein wie ich und trank von ihrem Bier. »Lobenswert.«
»Warum Wyoming?«, fragte ich.
»Warum nicht?«, erwiderte sie achselzuckend.
Ich zog eine Augenbraue hoch, um anzudeuten, dass ihre Antwort nicht ausreichte. Ihr Mundwinkel zuckte.
»Der Grund ist eigentlich total albern«, sagte sie.
»Ich mag albern. Schieß los.«
Grace trank, und als unsere Blicke sich wieder trafen, fing sie an zu sprechen. »Jedes Jahr werfe ich blind einen Dartpfeil auf eine Karte der Vereinigten Staaten. An dem Ort, den er trifft, mache ich dann Urlaub.« Sie wurde rot, als wäre ihr das peinlich.
»Das ist überhaupt nicht albern. Das heißt, das Schicksal entscheiden lassen.« Ich lächelte ihr kurz zu. »Aber warum machst du das? Warum suchst du dir nicht einfach einen Ort aus, an den du wirklich fahren willst? Ich meine, du könntest jetzt in Kalifornien oder auf Hawaii sein und mit einer Piña Colada am Strand liegen, statt mit mir in Dubois, Wyoming, Bohneneintopf zu essen.« Ich musste lachen.
Sie lachte mit, wurde dann aber ernst. Ihre blauen, blauen Augen funkelten, und sie seufzte.
»Mein Leben besteht nur aus Routinen. Alles ist geplant und noch mal durchgeplant, jede Minute des Tages festgelegt. Da befreit mich so etwas in gewisser Weise.« Und wieder neigte sie den Kopf zur Seite.
Ich trank einen Schluck und nickte. »Das verstehe ich. Bevor ich die Ranch übernahm, hatte ich diese Art von Freiheit auch, aber jetzt trage ich für alles, was hier lebt, die Verantwortung.«
»Warum hast du deine Freiheit aufgegeben?«, fragte sie.
Das war eine Frage, die ich nicht beantworten wollte. Ich sprach nicht gern über die Gründe, die mich wieder hierhergeführt hatten, aber ich nahm an, Grace war die Sorte Frau, die nicht lockerließ, bis sie ihre Antwort bekam.
»Es blieb mir nichts anderes übrig. Meine Eltern sind gestorben, deshalb bin ich vor anderthalb Jahren zurückgekehrt, um die Ranch zu übernehmen.«
Grace setzte ihre Flasche an. Was ihr wohl gerade durch den Kopf ging? Noch keine Stunde war vergangen, und sie wusste schon, dass drei mir nahestehende Menschen gestorben waren. Und alle hatten auf dieser Ranch gelebt. Man könnte meinen, dieser Ort sei verflucht, zumindest erzählten sich das die Leute. Ich an Graces Stelle hätte mich schleunigst aus dem Staub gemacht, bevor dieser Flecken Erde auch mich verschlang.
»Das muss hart gewesen sein«, sagte sie und presste die Lippen zusammen.
»Ja, schon.«
Ein paar Minuten saßen wir wieder schweigend da. Grace und ich, wir fühlten uns offenbar beide in der Stille wohl. Den meisten Leuten ging es anders. Sie hatten den Drang, sie mit Worten zu füllen. Was sie dabei nicht ahnten, war, dass man mit Schweigen so viel mehr ausdrücken kann als mit Worten. Grace nahm einen Schluck, und als sie die Flasche absetzte, gab es einen hohlen Ton, was hieß, dass ihr Bier alle war. Ich überlegte kurz, ob ich ihr noch eins anbieten sollte, aber es war schon spät, und es schien mir besser, Schluss zu machen, bevor ihr noch weitere Fragen zu meiner Familie oder meiner Vergangenheit einfielen.
»Eins muss ich noch wissen: Hast du meine Ranch nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, oder hast du auch auf die Airbnb-Website einen Dartpfeil geworfen?«, fragte ich in scherzhaftem Ton, aber es war mir ernst. Ich wollte herausfinden, ob diese Entscheidung vom Schicksal vorgegeben war oder nicht. Oder war sie möglicherweise Teil des Fluchs?
»Nein«, sagte sie mit einem angedeuteten Lächeln. »Ich habe mir diesen Ort ausgesucht, Calvin.«
Ich lächelte zurück, nahm beide Teller und trug sie zur Spüle. Es freute mich, dass Grace sich bewusst entschlossen hatte, hierherzukommen. Es gibt so viele Dinge, die für uns entschieden werden. Wir können nicht wählen, wo wir geboren werden, wie unsere Eltern uns großziehen, welche Werte sie uns vermitteln oder wie lange sie ein Teil unseres Lebens bleiben. Ich hasse diesen Aspekt des Lebens, dass man so gar keine Kontrolle darüber hat. Das Schicksal schlägt zu, wann immer es ihm danach ist, und von dir wird erwartet, dass du den Schlag einsteckst und einfach weitermachst.
Während ich das restliche Geschirr abwusch, schaute ich zu Grace hinüber. Sie wirkte erschöpft und starrte zur Terrassentür, fast als wäre sie in Trance oder so.
Ich drehte das Wasser ab und trocknete meine Hände.
»Also, ich muss früh raus. Die Kühe melken sich nicht von allein.«
Grace stand auf und warf ihre leere Flasche in den Mülleimer.
»Morgen früh wartet frischer Kaffee auf dich, und ich lasse das Brot und die Erdnussbutter draußen stehen, falls du ein bisschen was essen willst.«
»Danke, Calvin.«
»Brauchst du noch was, bevor ich mich verziehe?« Ich ging in Richtung Flur. Sie schwankte ein bisschen, verlor das Gleichgewicht und stolperte in meine Richtung. Mein Arm streifte sie, und ich spürte einen kleinen Stromschlag zwischen uns. Ein Funke sprang über, wie wenn man einem Auto Starthilfe gibt. Die zwei Kabel. Sie sind elektrisch geladen. Mein Herz schlug schneller, und ich musste tief durchatmen, um mich zu beruhigen. Für so etwas ist es noch zu früh, ermahnte ich mich. Ganz egal, wie sehr ich mich zu dieser ungewöhnlichen Frau hingezogen fühlte, ich war dafür noch nicht bereit.
Ich schaute sie an und wartete auf eine Antwort. Bevor ich zu Bett ging, musste ich sicher sein, dass sie alles hatte, was sie brauchte.
Grace schüttelte den Kopf. »Alles gut. Danke fürs Abendessen.«
»Jederzeit wieder, Miss Grace. Schlaf gut.« Ich nickte und ging weiter den Flur entlang zu meinem Schlafzimmer. Es kostete mich alle Kraft, nicht kehrtzumachen.
Tag zwei
5
Grace
So gut hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschlafen. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung zu entspannen, aber ich bin ja nicht wie die meisten anderen. Auf mich hat das Unbekannte eine beruhigende Wirkung, und die Abgeschiedenheit der Ranch gab mir das Gefühl, dort sicher und gut aufgehoben zu sein. Das Zirpen der Grillen, das Heulen des einen oder anderen Tiers und der Ruf einer Eule vor meinem Fenster hatten mich in einen tiefen Schlaf gewiegt. Es war das genaue Gegenteil von dem, was heulende Sirenen und hupende Autos in der Stadt bei mir bewirkten. Zu wissen, dass es hier nichts gab, wofür ich wach bleiben musste, hatte sein Übriges getan.
In einen schwarzen Seidenpyjama gehüllt, schlüpfte ich aus dem Bett und wagte einen Blick vor die Tür meines Zimmers. Alles war ruhig. Ein knarzendes Geräusch irgendwo in einem weit entfernten Winkel des Hauses durchbrach die Stille, aber es war schwer zu sagen, woher es kam. Das Haus hatte alte Knochen, und alte Knochen knarzten und ächzten nun einmal. Ich huschte schnell in die Küche, dem Duft des frischen Kaffees folgend, den Calvin mir versprochen hatte. Für mich war es ein seltener Luxus, so spät am Tag aufzustehen, und ich genoss es in vollen Zügen. Er war sicher irgendwo draußen unterwegs und kümmerte sich um die Tiere oder tat das, was Jungs vom Land eben so tun. Ich nahm mir den Kaffeebecher, den Calvin für mich hingestellt hatte, es war eine Kuh darauf abgebildet, und darunter stand: Wyoming, ein kuhles Fleckchen Erde. Ich schmunzelte über den doofen Spruch und schenkte mir Kaffee ein. Gerade als ich wieder in mein Zimmer zurückkehren wollte, öffnete sich quietschend eine Tür.
Durch das Zuschlagen der Fliegengittertür kurz darauf wirkte Calvins Erscheinen geradezu inszeniert. Sein Oberkörper war nackt, und, liebe Güte, ohne Hemd sah er ja noch umwerfender aus, als ich es mir ausgemalt hatte. Es war, als hätte ein Künstler jedes Detail seines Sixpacks sorgfältig herausgemeißelt und die Brustpartie perfekt modelliert. Oberkörper, Hals und Stirn waren von Schweißperlen benetzt. Fast wäre mir bei diesem Anblick der Becher aus der Hand gefallen. Calvin musterte mich von oben bis unten, atmete mit geröteten Wangen schwer aus und schien meinen Anblick ebenfalls förmlich in sich aufzusaugen.
»Tut mir leid«, murmelte er schließlich und schaute weg. Er trat unruhig von einem Fuß auf den anderen, als hätte er verlernt, ruhig zu stehen.