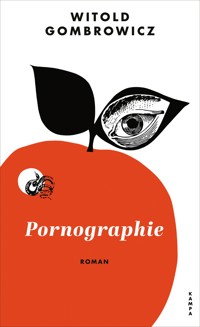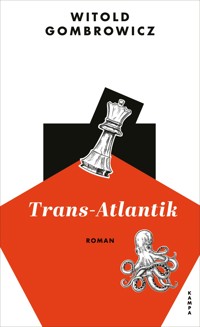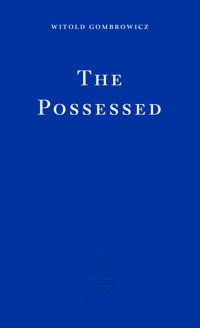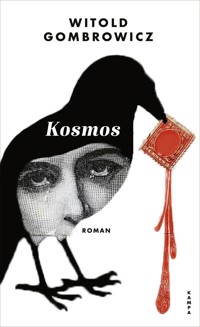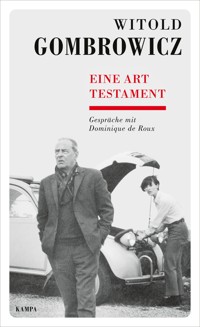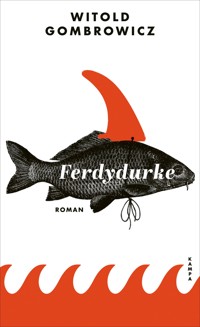
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der dreißigjährige Josi Kowalski hat ein Buch mit dem Titel Memoiren aus der Epoche des Reifens geschrieben, aber niemand nimmt ihn für voll. Da steht eines Nachts ein Geist in Josis Zimmer: ein Doppelgänger - und doch auch wieder nicht. Josi fühlt sich seiner Identität beraubt, verscheucht den Geist und beschließt, umgehend etwas wirklich Eigenes zu verfassen, »mit mir identisch, direkt aus mir hervorgehend«. Da steht schon der nächste Besucher in der Tür, Herr Pimko, Philologe aus Krakau. In Pimkos Anwesenheit wird Josi zu einem unreifen siebzehnjährigen Rotzbengel. Er findet sich in einer Schule für verkleinerte Erwachsene wieder, dann im Haus der sehr aufgeklärten Familie Jungmann und schließlich bei sehr vornehmen Adligen auf dem Land. Als Teenager hat Josi endlich die nötige Distanz, um sich über die »Reife« seiner Umgebung zu mokieren - und dastut er mit Leidenschaft und Wortwitz. Witold Gombrowicz stellt in seinem Rückentwicklungsroman alles auf den Kopf, was nicht nur im Polen der zwanziger und dreißiger Jahre als heilig galt - Nation, Religion, Familie. Gleich bei Erscheinen 1937 war Ferdydurke eine Sensation, ein Skandal und dann wie alle Werke Gombrowiczs jahrzehntelang in Polen verboten. Heute gilt seine Ode an die Unreife als Meisterwerk der europäischen Moderne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Witold Gombrowicz
Ferdydurke
Roman
Aus dem Polnischen von Rolf FieguthMit einem Vorwort von Susan Sontag und einem Nachwort des Übersetzers
Kampa
Vorwort von Susan Sontag
Beginnen wir mit dem Titel. Der bedeutet … nichts. Keine Figur im Roman heißt Ferdydurke. Und das ist erst ein Vorgeschmack auf weitere Frechheiten.
Der Autor war dreiunddreißig Jahre alt, als er mit Ferdydurke Ende 1937 sein zweites Buch veröffentlichte. Der Titel des ersten, Memoiren aus der Epoche des Reifens (1933), hätte wunderbar für diesen Roman des großen polnischen Schriftstellers gepasst. Vielleicht entschied Gombrowicz sich gerade deshalb für ein Phantasiewort.
Das erste Werk, dessen Titel die Warschauer Kritiker aufspießten, als hätte Gombrowicz versehentlich ein peinliches Bekenntnis abgegeben, war eine Sammlung von Erzählungen, die er ab 1926 in Zeitschriften publiziert hatte. In den nächsten beiden Jahren erschienen weitere Erzählungen, unter anderem das Duo »Philidor mit Kind durchsetzt« und »Philibert mit Kind durchsetzt«, die Gombrowicz später als Einlagen in Ferdydurke einfügte und mit kapitellangen Pseudovorworten ergänzte, sowie das erste Theaterstück Ivonne die Burgunderprinzessin. Ab Frühjahr 1935 nahm Gombrowicz dann seinen Roman in Angriff. War der Titel des Bandes phantastischer Geschichten »schlecht gewählt« (seine Wortwahl) gewesen? Erst jetzt provozierte Gombrowicz ja wirklich – indem er ein förmliches Epos zur Verteidigung der Unreife schrieb. Gegen Ende seines Lebens erklärte er: »Unreife – was für ein kompromittierendes, unangenehmes Wort! – wurde mein Schlachtruf.«
Unreife (nicht: Jugend), darauf beharrt Gombrowicz, denn das Wort repräsentiert etwas Unattraktives, etwas Niedriges – ein anderes seiner Schlüsselwörter. Die Sehnsucht, die sein Roman beschreibt und vertritt, will nicht wie Faust die köstlichen Tage der Jugend wiedererleben. Was dem Dreißigjährigen widerfährt, als er eines Morgens aufwacht, ein Gefühl der Nichtigkeit seines Lebens und all seiner Projekte ihn aufwühlt und ein Lehrer ihn in eine grünschnabelige Pennälerwelt entführt, ist eine Demütigung, ein Absturz.
Von Anfang an, so schrieb Gombrowicz später, hatte er sich einen »phantastischen, exzentrischen und bizarren Ton« an der Grenze zu »Manie, Wahnsinn, Absurdität« angeeignet. Irritieren ist erobern, hätte Gombrowicz sagen können. Ich denke, also widerspreche ich. Als junger Anwärter auf Ruhm im literarischen Warschau der 1930er Jahre war Gombrowicz in den Schriftstellercafés mit seinen Narrengrimassen, Attitüden und Posen bereits legendär. Beim Schreiben suchte er nach einer ebenso vehementen Beziehung zum Leser. Grandios und doof, ein Werk unermüdlichen Anredens.
Als Gombrowicz seinen Roman begann, wusste er höchstwahrscheinlich noch nicht, wohin der Weg gehen sollte. »Ich kann mich gut erinnern«, erklärte Gombrowicz 1968, ein Jahr vor seinem Tod (erinnerte er sich? oder knetete er seine Legende?), »als ich mit Ferdydurke anfing, wollte ich nicht mehr als eine beißende Satire schreiben, um mich in eine höhere Position gegenüber meinen Feinden zu bringen. Aber meine Worte waren schnell davongewirbelt in heftigem Tanz, packten das Ding zwischen die Zähne und galoppierten in einen grotesken Wahnsinn hinein mit einer Geschwindigkeit, dass ich den ersten Teil des Buches umschreiben musste, damit er dieselbe groteske Intensität bekam.« Aber das Problem war weniger (vermute ich), dass die ersten Kapitel eine weitere Zufuhr von Wahnsinnsenergien benötigten, als vielmehr, dass Gombrowicz das Gewicht seiner Konzeption nicht vorhergesehen hatte – seiner Auffassung von der Natur des Eros, der Kultur (speziell der polnischen Kultur), der Ideale –, die seine Erzählung schließlich zu tragen hatte.
Ferdydurke setzt ein mit der traumartigen Entführung in eine absurde Welt, in der das Große klein und das Kleine monströs groß wird: Riesenpoppos am Himmel. Im Gegensatz zu der Landschaft, die Lewis Carrol für ein präpubertäres Mädchen beschwor, brodelt Gombrowiczs Wunderland mit seinen Schwankungen zwischen Riesig und Klein und seinen ständig wechselnden Formen vor Lust.
Wucherung. Aufblähung. Aufblähung in der Schwärze. Aufbauschung, Ausweitung in Verbindung mit Verkrampfung und Straffung, ein Ausweichen und ein allgemeines und besonderes Entkernen, erstarrende Anspannung und angespanntes Erstarren, ein Hängen an dünnem Faden sowie eine Umformung, Umarbeitung, Verarbeitung zu etwas, und weiter – ein Hineingeraten in ein System der Kumulierung und Auftürmung, und dies gleichsam auf einem schmalen Brettchen, das auf die Höhe des sechsten Stockwerks gehievt wird, mit Erregung aller Organe. Und ein Kitzeln.
In Alices Geschichte gerät ein Kind in eine asexuelle Unterwelt, in der eine neue, phantastische, aber unerbittliche Logik regiert. In Ferdydurke entdeckt der in einen Schuljungen verwandelte Erwachsene neue, puerile Freiheiten zu provokativen Grenzüberschreitungen und zum Eingeständnis schmählichen Begehrens.
Es setzt ein mit einer Entführung und endet mit einer Entführung. Die erste (durch Professor Pimko) versetzt den Helden zurück auf die Bühne des wahren, d.h. nicht zu bändigenden, Fühlens und Begehrens. Die zweite Entführung zeigt den Helden auf einem zeitweiligen Rückflug in die sogenannte Reife.
Wenn jemand mich hier auf dem Korridor im Dunkeln entdeckt, kann ich ihm den Sinn meiner Eskapade erklären? Auf welchen Wegen gelangt man auf die krummen und anomalen Wege? Die Normalität ist der Seiltänzer über dem Abgrund der Anomalie. Wie viel heimlichen Wahnsinn enthält die normale Ordnung – du weißt selbst nicht, wann und wie der Gang der Ereignisse dich zur Entführung des Jungknechts und zur Flucht ins Freie bringen wird. Eher sollte man Sophie entführen. Wenn ich schon jemanden entführen sollte, dann Sophie, normal und richtig wäre die Entführung Sophies aus dem ländlichen Gehöft, wenn überhaupt, dann Sophie, Sophie und nicht den blöden, idiotischen Jungknecht.
Ferdydurke ist eines der erregendsten, direktesten Bücher über sexuelles Begehren – ohne eine einzige Szene sexueller Vereinigung. Hier sind die Karten klarerweise von Anfang an zugunsten des Eros gemischt. Wer würde nicht beipflichten, dass dieses soziale Lallen durch das Geräusch von Pobacken, Schenkeln, Waden zum Schweigen gebracht werden sollte? Der Kopf befiehlt oder wünscht es. Die Poppos regieren.
Später bezeichnete Gombrowicz seinen Roman als Pamphlet. Er nannte ihn auch Parodie einer philosophischen Fabel in der Art Voltaires. Gombrowicz ist einer der Super-Disputierer des zwanzigsten Jahrhunderts – »widersprechen, auch in kleinen Dingen, ist oberste Notwendigkeit heutiger Kunst«, erklärte er – und Ferdydurke ist ein brillanter Ideenroman. Die Ideen verleihen dem Buch Gewicht und Flügel zugleich.
Gombrowicz tollt und donnert, tyrannisiert und spottet, aber sein Projekt der Umwertung, seine Kritik der hohen »Ideale« sind von hohem Ernst. Ferdydurke ist einer der wenigen mir bekannten Romane, die Nietzscheanisch genannt werden könnten; mit Sicherheit ist es der einzige komische Roman, auf den dieses Attribut zutrifft. (Im Vergleich dazu ist die Phantastik von Hesses Steppenwolf mit Sentimentalität durchsetzt). Nietzsche beklagte die durch das Christentum geförderte Idealisierung von Sklaven-Werten, verlangte den Sturz überkommener Ideale und forderte neue Formen von Autorität. Gombrowicz, der das »menschliche« Bedürfnis nach Fehlerhaftigkeit, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit … Jugend vertritt, erklärt sich selbst zum Spezialisten für Minderwertigkeit. Die Pubertät mit ihren Schweinereien ist vielleicht ein drastisches Mittel gegen blasierte Reife, aber genau das ist von Gombrowicz gemeint. »Erniedrigung wurde mein ewiges Ideal. Ich vergötterte den Sklaven.« Es ist noch immer ein Nietzscheanisches Projekt, das Entlarven, das Ausstellen, der fröhliche Satyrtanz der Dualismen: reif gegen unreif, Ganzheiten gegen Teile, bekleidet gegen nackt, Heterosexualität gegen Homosexualität, vollkommen gegen unvollkommen.
Gombrowicz verwendet frohgemut viele Verfahren der hochliterarischen Moderne, die unlängst als »postmodern« umetikettiert worden sind und gegen die traditionellen Schicklichkeiten des Romanschreibens verstoßen: namentlich das Verfahren des geschwätzigen, aufdringlichen Erzählers, der in seinen eigenen widersprüchlichen Gefühlszuständen schwimmt. Burleske Abrutscher ins Pathos. Wenn er sich nicht auftakelt, ist er erbärmlich; wenn er nicht den Clown macht, ist er verletzlich und voller Selbstmitleid.
Ein unreifer Erzähler ist auch ein Erzähler voller naiver Offenheit, vor allem wenn er mit etwas protzt, was sonst verheimlicht wird. Jedenfalls ist er kein »aufrichtiger« Erzähler, denn Aufrichtigkeit gehört zu den Idealen, die in der Welt der Unverblümtheit und Provokation keinen Sinn ergeben. »In der Literatur führt Aufrichtigkeit zu nichts … je künstlicher wir sind, desto näher kommen wir der Offenheit. Künstlichkeit ermöglicht es dem Künstler, peinliche Wahrheiten anzugehen.« Und zu seinem gefeierten Tagebuch sagt Gombrowicz: »Haben Sie je ein ›aufrichtiges‹ Tagebuch gelesen? Das ›aufrichtige‹ Tagebuch ist das verlogenste Tagebuch … Und, auf die Dauer, wie langweilig ist Aufrichtigkeit! Sie bringt nichts. Was dann? Mein Tagebuch sollte aufrichtig sein, aber es konnte nicht aufrichtig sein. Wie konnte ich das Problem lösen? Das Wort, das lockere, gesprochene Wort, hat eine tröstliche Eigenschaft: es ist nahe der Aufrichtigkeit, nicht in dem, was es beichtet, sondern in dem, was es zu sein beansprucht und worauf es abzielt. Ich musste also vermeiden, dass mein Tagebuch zur Beichte wurde. Ich musste mich selbst ›in Aktion‹ zeigen, in meiner Absicht, mich dem Leser gewissermaßen aufzuerlegen, in meinem Wunsch, mich selbst zu erschaffen, und jeder schaut dabei zu. ›So möchte ich für Sie sein‹, und nicht ›So bin ich‹.«
Aber so kapriziös die Handlung von Ferdydurke auch ist, kein Leser wird den Helden und seine Sehnsüchte als etwas anderes betrachten denn als Transposition der eigenen Personalität und Pathologie des Autors. Wenn also Gombrowicz Joey Kowalski [so ist der polnische Name des Ich-Erzählers im Englischen wiedergegeben] zum Schriftsteller macht – und zum Autor eines erfolglosen, viel verlachten Erzählbandes unter dem Titel, jawohl, Memoiren aus der Epoche des Reifens, verlangt er vom Leser eben gerade, nicht an den Mann zu denken, der den Roman geschrieben hat.
Ein Schriftsteller, der seine Freude an der Phantasievorstellung hat, seine Identität und ihre Privilegien aufzugeben. Ein Schriftsteller, der eine Flucht in die Jugend imaginiert, die er als Entführung darstellt; die Absage an ein Schicksal, das man bei einem Erwachsenen erwartet, dargestellt als Herausbeförderung aus einer Welt, in der man einen kennt.
Und dann wurde die Phantasie Wirklichkeit. (Bei wenigen Schriftstellern hat das Leben so deutlich die Form eines Schicksals angenommen.) Im Alter von fünfunddreißig Jahren, wenige Tage vor dem Schicksalsdatum des 1. September 1939, wurde Gombrowicz in ein unverhofftes Exil geworfen, fern von Europa, in die »unreife« Neue Welt. Dieser in seinem realen Leben stattfindende Wechsel war ebenso brutal wie die imaginierte Verwandlung des Dreißigjährigen in einen Schuljungen. Ohne Mittel für den Lebensunterhalt gestrandet an einem Ort, wo nichts von ihm erwartet wurde, weil nichts über ihn bekannt war, bot sich ihm die göttliche Gelegenheit, sich selbst zu verlieren. In Polen war er der wohlgeborene Witold Gombrowicz, ein prominenter »Avantgarde«-Autor, Verfasser eines Buches, das viele (darunter sein Freund Bruno Schulz, der andere große polnische Schriftsteller der Zeit) als Meisterwerk ansahen. In Argentinien, schreibt er, »war ich nichts, konnte also alles machen«.
Heute ist es unmöglich, sich Gombrowicz ohne seine vierundzwanzig Jahre in Argentinien (viele davon in Armut verbracht) vorzustellen, in einem Argentinien, das er sich passend machte für seine eigenen Phantasien, seine Provokationen, seinen Stolz. Polen verließ er als relativ junger Mann; nach Europa (jedoch nie nach Polen) kehrte er im Alter von bald sechzig Jahren zurück, und sechs Jahre später starb er in Südfrankreich. Die Trennung von Europa machte Gombrowicz keineswegs erst zum Schriftsteller: der Mann, der zwei Jahre zuvor Ferdydurke veröffentlicht hatte, war bereits vollauf ausgeformt als literarischer Künstler. Wohl aber war sie die glückhafteste Bestätigung von allem, was sein Roman weiß, und vermittelte seinen wunderbaren späteren Werken Richtung und Biss.
Das Gottesurteil der Emigration – und für Gombrowicz war es ein Gottesurteil – schärfte seinen kulturellen Kampfeswillen, das wissen wir aus seinem Tagebuch. Das Tagebuch – auf Englisch umfasst es drei Bände und ist alles andere als ein »persönliches« Tagebuch – kann als eine Art freie Fiktion gelesen werden, postmodern avant la lettre, das heißt, beseelt von programmatischem Verstoß gegen die Anstandsregeln, ähnlich wie bei Ferdydurke. Ansprüche des Autors auf umwerfende Genialität und intellektuelle Schärfe wetteifern mit einem fortlaufenden Bericht über seine Unsicherheiten, Fehlleistungen und Peinlichkeiten und mit dem herausfordernden Geständnis barbarischer, tölpelhafter Vorurteile. Vom lebendigen literarischen Milieu im Buenos Aires der späten 1930er Jahre fühlte er sich missachtet und lehnte es daher prompt ab; er war sich bewusst, dass dieses Milieu mit Borges einen unbestreitbar großen Schriftsteller enthielt – und Gombrowicz erklärte sich sogleich als dessen »Antipode«. »Er ist tief in der Literatur verwurzelt, ich im Leben. In Wahrheit bin ich Anti-Literatur.«
Gleichsam in – seichtem – Einklang mit Gombrowiczs völlig selbstbezogenem Kampf mit der Idee von Literatur betrachten heute viele das Tagebuch und nicht Ferdydurke als sein größtes Werk.
Niemand kann den berüchtigten Anfang des Tagebuchs vergessen: »Montag Ich. Dienstag Ich. Mittwoch Ich. Donnerstag Ich.« Nachdem das klargestellt war, brachte Gombrowicz unter Freitag eine subtile Reflexion über Dinge, die er in der polnischen Presse gelesen hatte.
Gombrowicz erwartete, dass er mit seiner Egozentrik beleidigen würde: ein Schriftsteller muss ständig seine Grenzen verteidigen. Doch ein Schriftsteller muss auch Grenzen überschreiten, und da ist Egoismus, nach Gombrowiczs Argumentation, die Vorbedingung für geistige und intellektuelle Freiheit. In dem zitierten »ich … ich … ich … ich« hört man den einsamen Emigranten ein »wir … wir … wir … wir« verspotten. Gombrowicz hat ständig mit der polnischen Kultur gestritten, mit ihrem unausrottbaren Geisteskollektivismus (»Romantik« geheißen) und mit der Besessenheit der polnischen Schriftsteller von nationalem Märtyrertum und nationaler Identität. Die gnadenlose Intelligenz und Energie seiner Betrachtungen zu kulturellen und künstlerischen Themen, die Relevanz seiner Provokation polnischer Pietät, die Bravour seiner Kontroversen haben ihn schließlich zum einflussreichsten Prosaautor des vergangenen halben Jahrhunderts in seinem Geburtsland gemacht.
Die polnische Empfindung, für die europäische Kultur und für westeuropäische Interessennahmen während generationenlanger Fremdherrschaft marginal zu sein, hatte den glücklosen Emigrationsautor besser als vielleicht gewünscht darauf vorbereitet, seine Verurteilung zu vielen Jahren der Isolation als Schriftsteller zu überstehen. Mit großem Mut stellte er sich der Aufgabe, aus der Ungeschütztheit seiner Situation in Argentinien einen tiefen, befreienden Sinn zu filtern. Das Exil stellte seine Berufung auf die Probe und erweiterte sie. Es verstärkte seine Abneigung gegen nationalistische Pietät und Selbstbeweihräucherung und machte ihn zum vollendeten Bürger der Weltliteratur.
Mehr als sechzig Jahre nach dem Abschluss von Ferdydurke bleibt von den spezifisch polnischen Zielscheiben Gombrowiczscher Verachtung nur wenig übrig. Sie sind zusammen mit jenem Polen verschwunden, in dem er aufwuchs und geprägt wurde – vernichtet von den zahlreichen Kriegsschäden, der Nazibesetzung, der Sowjetdominanz (die ihn an einer Rückkehr hinderte), und dem Wohlstandsethos nach 1989. Fast ebenso altmodisch ist seine Annahme, Erwachsene beanspruchten immer, reif zu sein: »In unseren Beziehungen zu anderen Leuten möchten wir kultiviert, überlegen, reif sein, sprechen daher die Sprache der Reife und reden, zum Beispiel, von Schönheit, Güte und Wahrheit … Aber in unserer eigenen vertrauten, intimen Wirklichkeit empfinden wir nichts als Minderwertigkeit und Unreife …«
Diese Äußerung wirkt wie aus einer anderen Welt. Wie unwahrscheinlich wäre es heute, dass Leute ihre noch so peinlichen Unzulänglichkeiten hinter hochtrabenden absoluten Idealen wie Schönheit, Güte oder Wahrheit verstecken. Die europäisch geprägten Ideale von Reife, Kultiviertheit und Weisheit haben mehr und mehr der amerikanisch geprägten Vergötterung der Ewigen Jugend Platz gemacht. Dass Literatur und andere Ausdrucksformen der »Hochkultur« als elitistisch oder lebensfeindlich diskreditiert werden, ist ein Hauptprodukt der neuen, von Unterhaltungswerten regierten Kultur. Indiskretion über unkonventionelle sexuelle Vorlieben ist heute ein gängiger, ja sogar obligatorischer Beitrag zur öffentlichen Unterhaltung. Wer heute vorbrächte, das »Niedrige« zu lieben, würde überhaupt bestreiten, dass dieses das Niedrige sei; vielmehr sei es das Höhere. Kaum eine der hochgeschätzten Ansichten, gegen die Gombrowicz ankämpfte, ist heute noch hochgeschätzt.
Kann an Ferdydurke also noch etwas beleidigen? Noch empörend wirken? Außer dem giftigen Frauenhass des Romans wahrscheinlich nichts. Wirkt er immer noch extravagant, brillant, verstörend, kühn, komisch … wunderbar? Ja.
Als eifriger Sachwalter seiner eigenen Legende sagte Gombrowicz die Wahrheit und nicht die Wahrheit, wenn er behauptete, erfolgreich alle Formen von Größe vermieden zu haben. Aber egal, was er hierzu dachte oder von uns verlangte zu denken, dass er dachte – das konnte keiner schaffen, dem ein Meisterwerk gelungen war, das schließlich auch noch als solches anerkannt wurde. In den späten 1950er Jahren wurde Ferdydurke (durch großzügige Förderung) ins Französische übersetzt, und Gombrowicz war endlich »entdeckt«. Nichts hatte er mehr gewollt als diesen Erfolg, diesen Triumph über seine Gegner und Verleumder, die wirklichen und die eingebildeten. Aber der Autor, der seinen Lesern von allem Selbstausdruck abrät und sie auffordert, gegen alle ihre Überzeugungen und ihre Gefühle misstrauisch zu sein und vor allem sich nicht mehr mit dem zu identifizieren, was sie definiert, konnte gar nicht anders als darauf zu bestehen, er, Gombrowicz, sei nicht dieses Buch. Tatsächlich musste er niedriger sein als dieses Buch. »Das Werk, in Kultur transformiert, schwebte gen Himmel, während ich unten blieb.« Wie der große Poppo, der sich am Ende des Romans hoch über den halbherzigen Flug des Helden ins Normale erhebt, so ist Ferdydurke in den literarischen Himmel emporgestiegen. Lang lebe sein erhabener Spott über jeden Versuch, das Begehren … und die Ausmaße großer Literatur auf Normalformat zu bringen.
Aus dem Englischen von Rolf Fieguth
1Entführt
Am Dienstag erwachte ich um jene Zeit ohne Seele und Inhalt, wenn die Nacht schon so gut wie vorbei ist, die Morgendämmerung aber noch nicht ganz eingesetzt hat. Jäh erwacht, wollte ich per Taxi zum Bahnhof hetzen, denn mir schien, ich verreiste, erst in der nächsten Minute sah ich mühsam ein, für mich stand kein Zug am Bahnhof, keine Stunde hatte geschlagen. Ich lag da in trübem Licht, mein Körper hatte unsägliche Angst und umklammerte mir den Geist, der Geist umklammerte vor Angst den Körper, und jede kleinste Fiber verkrampfte sich in der Erwartung, dass nichts geschehen, nichts sich ändern, nichts je eintreten würde, und dass man anstellen konnte, was man nur wollte, es würde nichts und wieder nichts losgehen. Es war die Angst vor dem Nichtsein, die Furcht vor der Nichtexistenz, die Unruhe vor dem Unleben, der Schrecken vor der Unwirklichkeit, der biologische Schrei aller meiner Zellen angesichts der inneren Zerrissenheit, Zerstäubung und Zerpulverung. Die Angst vor der unanständigen Winzigkeit und Kleinteiligkeit, das Grausen vor dem Konzentrationsverlust, die Panik vor dem Bruchteil, die Angst vor der Vergewaltigung, vor der, die ich in mir hatte und vor der, die von außen drohte – aber am schlimmsten war ein Etwas, das ständig bei mir war und keinen Schritt wich, ein Etwas, das ich die Selbstempfindung eines inneren, wechselseitigen Nachäffens und Verhöhnens zwischen den Teilchen nennen könnte, eines inzüchtigen gegenseitigen Auslachens zwischen den entfesselten Teilen meines Körpers und den analogen Teilen meines Geistes.
Der Traum, der mich heimgesucht und aufgeweckt hatte in der Nacht, war Ausfluss dieser Angst. In einer Rückwendung der Zeit, die der Natur verboten sein müsste, erblickte ich mich so, wie ich mit fünfzehn oder sechzehn war – in die Jugend versetzt; ich stand da im Wind, auf dem Stein, gleich bei der Mühle am Fluss, sagte etwas, hörte mein längst begrabenes Hähnchenstimmlein piepsen, sah, wie die Nase unausgewachsen auf dem unausgeformten Gesicht saß, wie die Hände zu groß waren – spürte die unangenehme Konsistenz dieser Entwicklungsphase des Dazwischen und des Übergangs. Ich erwachte in Gelächter und Angst, denn mir kam vor, dass ich so, wie ich heute bin, über dreißig, mit meiner Art dauernd den Grünschnabel nachäffe und auslache, der ich gewesen war, und dass wiederum er mich nachäfft – mit gleichem Recht –, und dass wir beide unser ständiges gegenseitiges Nachäffen sind. Oh unglückliches Gedächtnis, du gibst uns gebieterisch Bescheid, auf welchen Wegen wir zu unserem gegenwärtigen Zustand gelangt sind! Und weiter kam es mir im Halbschlaf, nach dem Erwachen, vor: mein Körper ist nicht einheitlich, manche Teile sind noch knäbisch, mein Kopf verlacht und verspottet die Wade, die Wade den Kopf, der Finger foppt das Herz, das Herz das Hirn, die Nase das Auge, das Auge brüllt vor Lachen über die Nase – und alle diese Teile vergewaltigen einander wie wild in einer Atmosphäre allumfassender und umgreifender Allverspottung. Und als ich wieder ganz bei Bewusstsein war und hin und her über mein Leben sinnierte, verminderte sich die Angst um kein Jota, sondern wurde noch mächtiger, obwohl hie und da ein kleiner Lacher sie unterbrach (oder verstärkte), dem meine Lippen nicht widerstehen konnten. Als ich auf halbem Wege meines Lebens stand, befand ich mich in einem dunklen Walde[1]. Und schlimmer noch, der Wald war grün.
Denn im Wachen war ich genauso unfestgelegt und zerrissen wie im Traum. Vor Kurzem hatte ich den Rubikon der unvermeidlichen dreißig überschritten, den Meilenstein passiert und sah nach Geburtsdatum und Anschein aus wie ein reifer Mensch, war es aber nicht – denn was war ich schon? Ein dreißigjähriger Bridgespieler? Ein beliebig belangloser Kollege, der kleine Lebensfälle bearbeitete und manchmal Gerichtstermine hatte? Und meine Situation? Ich klapperte Cafés und Bars ab, traf Leute, mit denen ich Worte wechselte und manchmal sogar Gedanken, aber die Situation war ungeklärt, und ich wusste selbst nicht, war ich Mensch oder war ich Grünschnabel; und so war ich an der Wende der Jahre weder das eine, noch das andere – ich war nichts –, und die Altersgenossen, die manchmal schon geheiratet hatten und klar bestimmte Stellungen einnahmen, dem Leben gegenüber wie auch in verschiedenen staatlichen Einrichtungen, hegten mir gegenüber ein begründetes Misstrauen. Meine Tanten, diese zahlreichen angehängten, angeflickten, aber aufrichtig liebenden Viertelsmütter, versuchten schon lange auf mich einzuwirken, ich möge mich als ein Jemand stabilisieren, als Advokat oder als Beamter – meine Unbestimmtheit war ihnen sehr peinlich, sie wussten nicht, wie sie mit mir reden sollten, und da sie nicht wussten, wer ich war, mümmelten sie höchstens etwas.
»Josi«, sagten sie zwischen dem einen und dem anderen Gemümmel, »höchste Zeit, liebes Kind. Was werden die Leute sagen? Wenn du kein Arzt sein willst, sei wenigstens ein Frauennarr oder ein Pferdenarr, aber dass man es weiß … dass man es weiß …«
Und ich hörte, wie die eine der anderen zuflüsterte, ich sei in Gesellschaft und im Leben unbeholfen, danach verfielen sie wieder in ihr Mümmeln, gequält von der Leere, die ich in ihrem Kopf anrichtete. Tatsächlich, dieser Zustand konnte nicht ewig dauern. Die Zeiger auf dem Zifferblatt der Natur standen unerbittlich und entschieden. Da mir die letzten Zähne gewachsen waren, die Weisheitszähne, hätte man meinen sollen, die Entwicklung sei abgeschlossen, die Zeit des unvermeidlichen Mordes gekommen, der Mann müsse das untröstlich trauernde Knäblein töten, müsse gleich dem Schmetterling emporfliegen und die Puppenleiche zurücklassen, mit der es vorbei war. Aus Nebel, Chaos, trüben Wassern, Wirren, Sirren, Strömungen, aus Schilf, Röhricht und Fröschequaken heraus hatte ich mich unter klare, kristallisierte Formen zu versetzen – mich zu kämmen, zu ordnen, in das Gesellschaftsleben der Erwachsenen einzutreten und mit ihnen zu plappern.
Sicherlich! Probiert und mich bemüht, das hatte ich schon – doch ein kleiner Lacher schüttelte mich, wenn ich an die Ergebnisse dachte. Um mich zu kämmen und nach Möglichkeit zu klären, hatte ich ein Buch verfasst – seltsam, aber mir schien damals, mein Eintritt in die Welt könne nicht ohne Erklärung auskommen, obwohl man noch keine Erklärung gesehen hat, die nicht Verdunkelung wäre. Ich wollte mich durch das Buch zuerst einmal in ihre Gunst einkaufen, dann würde ich bei der ersten persönlichen Begegnung schon einen bereiten Boden vorfinden, und hätte – so mein Kalkül – in ihren Seelen erfolgreich eine positive Vorstellung von mir eingepflanzt; dann würde diese Vorstellung wiederum mich formen, und auf diese Art und Weise würde ich nolens volens reif werden. Warum aber hat mich meine Feder bloßgestellt? Warum erlaubte mir eine heilige Scham nicht, einen notorisch banalen Roman zu schreiben und aus Herz und Seele hohe Motive zu filtern; die bezog ich stattdessen aus den unteren Körperabzweigungen, wobei ich Frösche, Beine, lauter unreife und vergorene Sachen in den Text setzte, die ich einzig durch kalten und beherrschten Stil, Stimmklang und Tonfall auf dem Papier isolierte, um zu beweisen, dass ich die Gärung hinter mich bringen wollte? Warum habe ich, gleichsam entgegen meinen eigenen Absichten, dem Buch den Titel Memoiren aus der Epoche des Reifens gegeben? Umsonst hatten die Freunde mir geraten, einen solchen Titel ja nicht zu wählen und mich überhaupt vor jeder kleinsten Anspielung auf Unreife zu hüten. »Tu das nicht«, sagten sie, »unreif ist ein drastischer Begriff; wenn du dich selbst für unreif erklärst, wer soll dich denn dann für reif erklären? Begreifst du denn nicht, die erste Bedingung für Reife, ohne die gar nichts läuft, verlangt, dass man sich selbst für reif erklärt?« Aber mir schien, dass es sich einfach nicht gehörte, den Rotzbengel in mir so schnell und so billig auszutreiben, dass die Erwachsenen zu schlau und scharfsichtig waren, um sich betrügen zu lassen, und dass einer, dem sein Rotzbengel ständig auf den Fersen ist, sich in der Öffentlichkeit nicht ohne Rotzbengel sehen lassen kann. Zu ernst nahm ich wohl den Ernst und überschätzte auch die Erwachsenheit der Erwachsenen.
Erinnerungen, Erinnerungen! Mit dem Kopf im Kissen, den Beinen unter der Decke, geschüttelt bald von Lachen, bald von Angst, zog ich die Bilanz meines Eintritts in die Erwachsenenwelt. Zu oft verschweigt man die privaten, inneren Mucken und Macken dieses Vorgangs und seine unweigerlichen Nachwirkungen. Die Literaten, diese Menschen mit ihrem gottgegebenen Talent für die entferntesten und gleichgültigsten Themen, zum Beispiel für das Seelendrama Kaiser Karls des Kahlen ob der Heirat Brunhildens, schrecken zurück vor dem wichtigsten Thema – wie sie selbst sich zum öffentlichen, gesellschaftlichen Menschen verwandelt haben. Offenbar hätten sie gern, dass jeder dächte, sie seien Schriftsteller von göttlichen und nicht etwa menschlichen Gnaden und seien vom Himmel auf die Erde gefallen samt ihrem Talent; sie genieren sich davor, offenzulegen, mit welchen persönlichen Konzessionen, mit welcher persönlichen Niederlage sie das Recht erkauft haben, sich über Brunhilde oder wenigstens über das Leben der Imker auszulassen. Nein, über das eigene Leben kein Wort – nur über das Leben der Imker. Sicherlich kann man zwanzig Bücher über das Leben der Imker zusammenschreiben und sich dadurch zum Denkmal machen – aber wo bleibt dann der Zusammenhang, wo die Verbindung des Imkerkönigs mit seinem privaten Mann, des Mannes mit dem Jüngling, des Jünglings mit dem Jungen, des Jungen mit dem Kind, das man doch einst gewesen ist, und was überhaupt soll euer Rotzbengel von eurem König haben? Ein Leben, das diese Verbindungen nicht beachtet und die eigene Entwicklung nicht in ihrem Gesamtverlauf verwirklicht, ist wie das Haus, das vom Dach her gebaut wird und muss unweigerlich in schizophrener Ichspaltung enden.
Erinnerungen! Es ist ein Fluch der Menschheit, dass unsere Existenz auf dieser Welt keine bestimmte und beständige Hierarchie erträgt, dass vielmehr alles ständig fließt, überfließt und sich bewegt, jeder muss von jedem erfühlt und bewertet werden, und uns Dunkle, Beschränkte und Dumme zu verstehen ist nicht weniger wesentlich, als die Gewandten, Erleuchteten und Subtilen zu begreifen. Denn der Mensch steht in tiefster Abhängigkeit von seinem Abbild in der Seele des anderen Menschen, auch wenn diese Seele kretinös wäre. Entschieden widerspreche ich der Einstellung und der aristokratischen, erhabenen Haltung, die so manche meiner Schriftstellerkollegen gegenüber den Meinungen der Dummen einnehmen, unter der Devise odi profanum vulgus[2]. Was ist denn das für eine billige, simple Manier, sich der Wirklichkeit zu entziehen, welch’ miserable Flucht in erlogene Erhabenheit! Ganz im Gegenteil, behaupte ich, je dümmer und engstirniger eine Meinung ist, desto gewichtiger und brennender ist sie für uns, genauso wie ein zu enger Schuh sich peinlicher bemerkbar macht als ein gut passender. Oh, diese Leutemeinungen, dieser Abgrund von Urteilen und Meinungen über deinen Verstand, Herz, Charakter, über alle Einzelheiten deines Körper- und Wesensbaus, dieser Abgrund, der sich vor dem Frechling auftut, der seine Gedanken auf Druckpapier unter die Leute gebracht hat, oh, Papier, Papier, Druck, Druck! Und ich will hier gar nicht von den allerherzlichsten, liebevollsten Familienurteilen unserer Tanten reden, sondern von den Meinungen anderer Tanten – der Kulturtanten, dieser zahlreichen Viertelautorinnen und angekoppelten Halbkritikerinnen, die ihre Meinungen in allen Zeitschriften zum Besten geben. Denn auf die Weltkultur hat sich ein Schwarm von an die Literatur angehängten und angeflickten Weibsbildern gesetzt, die unglaublich gut Bescheid wissen über die geistigen Werte, unglaublich ästhetisch orientiert, mit zumeist eigenen Ansichten und Reflexionen begabt und zu dem Bewusstsein gelangt sind, Oscar Wilde habe sich überlebt und Bernard Shaw sei ein Meister des Paradoxons. Ach, sie wissen bereits, sie müssen als Frau unabhängig, entschieden und tiefer sein, und deshalb sind sie in der Regel unabhängig, tiefer und entschieden, ohne Übertreibung und voller Tantengüte. Tante, Tante, Tante! Oh, wer nie auf den Arbeitstisch der Kulturtante geraten und dort durch ihre trivialisierende, dem Leben alles Leben nehmende Mentalität stumm und ohne Schmerzenslaut präpariert worden ist, wer nie in der Zeitung das Tantenurteil über sich gelesen hat, der kennt die Kleinheit nicht, der weiß nicht, was die Kleinheit in der Tante ist.
Doch nehmen wir dazu noch die Urteile der Gutsherren und Gutsherrinnen, die Urteile der Gymnasiastinnen, die kleinlichen Urteile der kleinen Beamten und die bürokratischen Urteile der höheren Beamten, die Urteile der Provinzadvokaten, die übertriebenen Urteile der Schüler, die arroganten Urteile der Opas sowie die Urteile der Publizisten, die Urteile der Ehrenamtlichen sowie die Urteile der Arztgattinnen, schließlich die den Elternurteilen abgelauschten Kinderurteile, die Urteile der Stubenmädchen, Mägde und Köchinnen, die Urteile der Kusinen, die Urteile der Gymnasiastinnen – das gesamte Meer der Urteile, und jedes fixiert dich im anderen Menschen und erschafft dich in seiner Seele. Als entstündest du in tausend zu engen Seelen! Aber meine Lage war noch schwieriger und heikler, weil mein Buch schwieriger und heikler war als eine normale, reife Lektüre. Zwar trug es mir einen Kreis von nicht unbedeutenden Freunden ein, und könnten die Kulturtanten sowie andere Vertreter des großen Haufens hören, wie ich in dem Kreis der Anerkannten und Vorzüglichen, der ihnen nicht einmal im Traum zugänglich ist, mit Vorzüglichkeit und Anerkennung gefüttert werde und intellektuelle Gespräche auf den Gipfeln führe, so würden sie wohl flach vor mir niederfallen und mir die Füße lecken. Doch andererseits muss etwas Unreifes in meinem Buch gewesen sein, etwas, das zu Vertraulichkeit ermächtigte und Wesen zwischen Fisch und Fleisch anzog, diese Schreckensschicht der Halbgebildeten – die Periode des Reifens reizte die Halbwelt der Kultur. Möglich, dass es für dumme Geister zu subtil ist, aber für eine Allgemeinheit, die nur auf die äußeren Anzeichen des Ernstes anspricht, ist es nicht erhaben und geschwollen genug. Manchmal, wenn ich aus heiligmäßigen und vorzüglichen Räumen, wo ich angenehm und mit Respekt gefeiert wurde, auf die Straße trat, begegnete ich einer Ingenieursgattin oder einer Gymnasiastin, die mich vertraulich wie ihresgleichen ansprachen, einen unreifen Kumpel oder Landsmann, mir auf die Schulter klopften und riefen: »Servus, Josek, du Dummer, du – Unreifer du!« Und so war ich den einen weise, den anderen dumm, den einen bedeutend, den anderen kaum wahrnehmbar, den einen gewöhnlich, den anderen aristokratisch. Ausgestreckt zwischen Höher und Niedriger, mit beidem in vertrautem Kontakt, respektiert und geringgeschätzt, stolz und verachtet, talentvoll und untalentiert, wie es sich fügte, je nach Situation! Mein Leben gestaltete sich von da an zerrissener als damals in der Stille des häuslichen Heimes. Und ich wusste nicht, zu wem ich gehörte – zu denen, die mich schätzen, oder zu denen, die mich nicht schätzen.
Doch das Schlimmste war – zwar hasste ich in feindseligem Hass das gemeine Volk der Halbgebildeten, wie sie wohl noch niemand gehasst hat, aber mit dem gemeinen Volk ging ich mir selbst fremd, stellte mich gegen Elite und Aristokratie und floh vor ihren freundschaftlich ausgebreiteten Armen in die Pfoten von Flegeln, für die ich der Grünschnabel war. Tatsächlich ist es die allerwichtigste, für die Weiterentwicklung entscheidende Frage, in Bezug worauf der Mensch sich aufstellt und organisiert – ob er zum Beispiel handelnd, redend, phantasierend, schreibend bloß Erwachsene und Fertige, bloß eine Welt klarer, kristallisierter Begriffe meint und voraussetzt, oder ob ihn nicht unaufhörlich auch eine Vision des gemeinen Volks und der Unreife verfolgt, eine Vision der Schüler, Gymnasiastinnen, der Grundbesitzer aus Land und Dorf, der Kulturtanten, Publizisten und Feuilletonisten, die Vision der verdächtigen, trüben Halbsphäre der dreiviertelmenschlichen Leute, die da irgendwo auf dich lauert und dich langsam grün überwuchert wie Schlingpflanzen, Lianen und andere Gewächse in Afrika. Nicht eine Minute konnte ich die mickrige Dreiviertelwelt der dreiviertelmenschlichen Leute vergessen; gewiss fürchtete ich mich panisch, ekelte mich entsetzlich, kriegte das Zucken, wenn ich mir ihr schlammiges Grün schon nur vorstellte, schaffte es aber nicht, mich davon loszureißen und war gebannt wie das Vögelein beim Anblick der Schlange. Als ob ein Dämon mich zur Unreife verführte! Als ob ich widernatürlich der niederen Sphäre zugetan wäre und sie liebte – weil sie mich als Grünschnabel bei sich festhält. Ich brachte es keine Sekunde über mich, weise zu sprechen, wenigstens so weit es bei mir reicht, weil ich wusste, irgendwo in der Provinz hält ein Arzt mich für dumm und erwartet von mir lediglich Dummheiten; und ich konnte mich in Gesellschaft einfach nicht anständig und seriös benehmen, weil ich wusste, dass ein paar Gymnasiastinnen von mir bloß lauter Unanständigkeiten erwarteten. Wahrlich, in der Welt des Geistes findet eine ständige Vergewaltigung statt, wir sind nicht wir selbst, wir sind nur die Funktion anderer Menschen, wir müssen sein, wie sie uns sehen, und meine ganz persönliche Niederlage war es, dass ich mich mit ungesunder Lust am liebsten von den Halbwüchsigen, Dreiviertelwüchsigen und Heranwachsenden sowie von den Kulturtanten abhängig machte. Ah, ständig, ständig die Tante auf dem Hals haben – naiv sein, weil ein Naiver meint, du seist naiv – dumm sein, weil ein Dummer dich für dumm hält – grün sein, weil ein Unreifer dich in sein eigenes Grün taucht und dich darin badet – ah, verrückt könnte man werden, wäre nicht das Wörtchen ›ah‹, das einen irgendwie leben lässt! Fühlung aufnehmen mit der höheren und erwachsenen Welt und nicht hineinkommen, einen Schritt entfernt bleiben von Distinktion, Eleganz, Verstand, Ernst, von reifen Urteilen, wechselseitiger Anerkennung, Hierarchie und Wert, und nur durch die Glasscheibe an diesen Bonbons lecken können, keinen Zugang zu diesen Dingen haben, außen vor bleiben. Mit den Erwachsenen umgehen und immer noch, wie mit sechzehn, den Eindruck haben, dass man den Erwachsenen nur spielt? Schriftsteller und Literat spielen, den Literaturstil und die reifen, gewählten Wendungen parodieren? Als Künstler vor der Öffentlichkeit ein unbarmherziges Endspiel um das eigene ›Ich‹ durchfechten und dabei unter der Decke zu den eigenen Feinden halten?
Oh ja, gleich beim Eintritt in das öffentliche Leben hatte ich die halbherrlichen Weihen empfangen und wurde reich gesalbt durch die niedrigere Sphäre. Und was die Sache noch komplizierter machte, mein Auftreten in Gesellschaft ließ gleichfalls viel zu wünschen übrig und war gegenüber den halbherrlichen Weltmenschen ganz trübe, dürftig, vage und wehrlos. Etwas wie ein Unvermögen, aus Trotz, vielleicht aus Furcht, hielt mich davon ab, mich in eine Reife einzuspielen, und es ist mehr als einmal vorgekommen, dass ich vor lauter Angst die Person einfach gezwickt habe, die mit ihrem Geist schmeichelnd an meinen Geist herantreten wollte. Wie beneidete ich jene bereits in der Wiege sublimierten und ersichtlich zu Höherem prädestinierten Literaten, deren Seele wie in den Hintern gestochen unaufhörlich emporfunktionierte – jene ernsthaften Schriftsteller, deren Seele sich ernst nahm und die mit angeborener Leichtigkeit, unter großer Schaffensqual, im Reich derart wolkenhoher und ein für alle Mal geheiligter Begriffe schalteten und walteten, dass Gott selbst für sie etwas fast Gewöhnliches und wenig Edles war. Wieso darf eigentlich nicht jeder noch einen Roman über die Liebe schreiben oder in schwerer Schmerzlichkeit eine soziale Wunde aufkratzen und Kämpfer für die Sache der Unterdrückten werden? Oder Gedichte schreiben und Dichter werden und an die ›leuchtende Zukunft‹ der Dichtung glauben? Talent haben und mit dem eigenen Geist die breiten Massen der Talentlosen nähren und emporheben? Ach, welche Lust, sich zu geißeln und zu martern, sich zu weihen und zu opfern, aber immer im höheren Bereich, immer in so emporsublimierten – so erwachsenen Kategorien. Sich zur eigenen oder fremden Befriedigung dank tausendjähriger Kulturinstitutionen so sicher auszuleben, als zahlte man sein Sümmchen bei der Sparkasse ein. Aber ich war leider ein Grünschnabel, und das Grünschnabelige war meine einzige Kulturinstitution. Doppelt eingefangen und begrenzt war ich – einmal durch die eigene Kindheitsvergangenheit, die ich nicht vergessen konnte, und dann durch die Kindshaftigkeit der Vorstellungen, die die Leute von mir hatten, durch die Karikatur von mir, als die ich in ihren Seelen festsaß – melancholischer Sklave des Grüns, im dichtesten Dickicht verhaktes Insekt.
Eine peinliche, aber auch bedrohliche Situation. Denn die Reifen ekeln sich vor nichts mehr als vor Unreife, und nichts ist ihnen verhasster. Ein Angriff auf die Ordnung kann noch so heftig und erbittert sein, sie können ihn leicht hinnehmen, solange er im Rahmen der Reife geführt wird; es schreckt sie kein Revolutionär, der das eine reife Ideal im Namen des anderen reifen Ideals bekämpft und etwa die Monarchie zugunsten der Republik stürzt oder umgekehrt die Republik durch Monarchie ansticht und frisst. Im Gegenteil, sie sehen es gern, wenn es Bewegung gibt in ihrem reifen, sublimierten Geschäft. Doch sollten sie an jemandem Unreife wittern, den Grünschnabel und Rotzbengel an ihm wittern, dann würden sie sich auf ihn werfen und ihn tothacken wie Schwäne die Ente – ihn abmurksen durch Sarkasmus, Ironie und Spott, nicht zulassen, dass ein Balg aus einer Welt, die sie lange hinter sich gelassen haben, ihnen das Nest beschmutzt. Wie wird es also enden? Wie weit werde ich kommen auf diesem Weg? Auf welchem Boden (dachte ich) erwuchs bei mir diese Unfreiheit aus Unausgeprägtheit, dieser Selbstverlust im Grün – lag es vielleicht an meiner Herkunft aus einem Land, das besonders reich gesegnet ist mit ungelenken, minderwertigen, unausgegorenen Wesen, wo keinem der Kragen sitzt, wo Weh mit Unheil, Dödel mit Dämel über die Felder ziehen und ihren Singsang jaulen? Oder vielleicht daran, dass ich in einer Epoche lebte, die alle fünf Minuten neue Schlachtrufe und Grimassen hervorbringt und konvulsivisch ihr Antlitz verzerrt, so sehr sie nur kann – in einer Übergangsepoche? … Bleiches Morgengrau sickerte durch die beiseitegeschobenen Vorhänge, mich aber übergoss die Schamesröte, als ich so die Bilanz meines Lebens zog, ein unanständiger kleiner Lacher riss mich in meinen Laken hoch – und ich brach in ein unwillkürliches, animalisches Gelächter aus, ein Lachen so mechanisch und beinig, als würde mir die Sohle gekitzelt, als ob nicht mein Gesicht, sondern mein Bein sich vor Lachen schüttelte. Das musste schnellstens aufhören, Schluss mit der Kindheit, her mit einer Entscheidung, neu anfangen – etwas anfangen! Endlich ab ins Vergessen mit den Gymnasiastinnen, ab ins Vergessen! Schluss mit der Liebe zu Kulturtanten und Landfrauen, ab ins Vergessen mit den kleinen, drastischen Beamten, ab ins Vergessen mit dem Bein und der eigenen schändlichen Vergangenheit, Verachtung für Rotzbengel und Grünschnabel – dafür harte Konsolidierung auf erwachsenem Boden, ach, endlich die äußerste aristokratische Haltung annehmen und verachten, verachten! Nicht wie bisher die Unreife anderer durch Unreife wecken, reizen und locken, sondern – im Gegenteil – Reife aus mir hervorbringen und sie durch Reife zur Reife wecken, mit Seele zur Seele sprechen! Mit Seele? Aber darf man das Bein vergessen? Mit Seele? Aber wo bleibt das Bein? Darf man die Beine der Kulturtanten vergessen? Und weiter – was wird geschehen, wenn es trotz allem nicht gelingt, das Grün zu überwinden, das von überall heransprossende, pulsierende, wuchernde Grün (es wird fast sicher nicht gelingen), was wird geschehen, wenn ich ihnen reif komme, sie mich aber wie bisher unreif empfangen, wenn ich ihnen mit Weisheit nahe, sie aber mir mit Dummheit? Nein, nein, dann will lieber ich den Anfang machen, und zwar mit Unreife, will meine Weisheit nicht ihrer Dummheit aussetzen, sondern lieber meine Dummheit gegen sie einsetzen! Aber das will ich ja gar nicht, will ich nicht, will lieber mit ihnen, ich liebe, liebe die Knospen, die Keime, die Büsche des Grüns, da! – ich spürte, wie sie mich wieder in ihre Liebesumarmungen packten und zogen; erneut brach ich in mechanisches, beiniges Gelächter aus und stimmte ein unanständiges Liedchen an:
In Skolimowo, Villa Preziose,
In der Kammer der Bonne[3], Mamsell Rose
Steckten im Schrank zwei Kerls in Hose
… als mir plötzlich der Mund bitter und die Kehle trocken wurde – ich bemerkte, ich war nicht allein. Es war außer mir noch jemand da, in der Ecke, beim Ofen, wo das Tageslicht noch nicht hinkam – ein zweiter Mensch war im Zimmer.
Die Tür war aber abgesperrt. Also kein Mensch, sondern eine Erscheinung. Erscheinung? Teufel? Gespenst? Toter? Zugleich spürte ich, kein Toter, sondern ein lebendiger Mensch war da, und sofort sträubte sich mir über und über das Fell – ich witterte den Menschen wie ein Hund den Hund. Und wieder trockener Mund, Herzklopfen, angehaltener Atem – da am Ofen stand ich selbst. Diesmal war es kein Traum – wirklich stand am Ofen mein Doppelgänger. Ich merkte aber, er fürchtete sich noch mehr als ich; er stand da mit gesenktem Kopf, mit gesenktem Blick, die Arme hingen ihm an den Seiten herunter – seine Angst verlieh mir Mut. Verstohlen unter der Decke hervor spitzte ich gleichsam zu nicht-mir hin und sah das Gesicht, das meines war und nicht meines. Es stieg empor aus tiefem, dunklem Grün, war selbst aus hellerem Grün – war das Antlitz, das ich auf mir trug. Meine Nase … mein Mund … meine Ohren, mein Zuhause. Seid mir gegrüßt, vertraute Winkel! Und wie vertraut! Wie vertraut war mir der verzogene Mund, der die Angstanspannung maskierte. Die Mundwinkel – das Kinn – das Ohr, das mir Bolek einmal eingerissen hatte – die Zeichen und Symptome doppelter Einflüsse, das Gesicht, das zwischen zwei Kräften, einer äußeren und einer inneren, zugerichtet worden war. Das alles da war das Meinige – war ich das auch, oder war das ein Fremdes – und trotzdem war das alles ich.
Plötzlich kam es mir unwahrscheinlich vor, dass das da ich sein sollte. Wie wenn wir uns unvermutet im Spiegel erblicken und einen Moment nicht sicher sind, ob wir das sind, so verwunderte und beleidigte mich die erstaunliche Konkretheit dieser Gestalt. Mit komisch geschnittenem und gekämmtem Haar, mit Lidern, in Hosen, mit Hör-, Seh- und Atmungswerkzeugen – war das ein Präparat von mir, oder war ich das? Präzisiert – deutlich konturiert und in den Einzelheiten definiert und detailliert … zu deutlich. Er musste merken, dass ich seine Einzelheiten sehe, denn er genierte sich noch mehr, lächelte undeutlich und machte mit der Hand eine unsichere, ins Dunkel zurückweichende Bewegung.
Aber das Licht vom Fenster her wurde stärker, und die Gestalt trat immer aufreizender hervor – schon waren die Finger an den Händen und die Nägel zu sehen – und ich sah … und der Geist sah, dass ich sah, krümmte sich ein wenig zusammen, schaute nicht her und gab mir Handzeichen, ich sollte nicht schauen. Ich konnte nicht aufhören zu schauen. Also so war ich beschaffen. Wahrhaftig, so seltsam wie die Madame de Pompadour, und so zufällig. Warum so und nicht anders? Eintagsfliege. Schwachstellen und Fehler traten ihm ans Tageslicht, er aber stand zusammengekrümmt da wie ein Nachtgeschöpf, von plötzlichem Licht getroffen – wie eine Ratte, die mitten im Zimmer erwischt wird. Und die Einzelheiten traten immer besser, immer schlimmer hervor, überall erwuchsen ihm Körperteile, einzelne Teile, und diese Teile waren genau bestimmt, konkretisiert … bis an die Grenzen schändlicher Deutlichkeit … bis an die Grenzen der Schande … Ich sah den Finger, die Nägel, die Nase, das Auge, den Schenkel und den Fuß, alles an die Oberfläche gebracht – von diesen Einzelheiten wie hypnotisiert stand ich auf und ging einen Schritt auf ihn zu. Da zitterte er und machte eine Handbewegung – als wollte er sich bei mir für sich entschuldigen und sagen, macht doch nichts, ist doch egal – gestatte, verzeih, lass mal … aber die Geste, als Abwehr begonnen, endete irgendwie niederträchtig – ich ging auf ihn los, konnte meine ausgestreckte Hand nicht mehr zurückhalten und schlug ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Weg! Weg! Nein, das bin überhaupt nicht ich! Das ist etwas Zufälliges, Fremdes, Aufgezwungenes, ein Kompromiss zwischen der äußeren und der inneren Welt, das war überhaupt nicht mein Körper! Er jaulte und verschwand – haute ab. Und ich blieb allein zurück, aber eigentlich nicht allein – denn ich war nicht da, ich fühlte nicht, dass ich da war, und jeder Gedanke, jeder Reflex, Tat, Wort, alles kam mir nicht als Meines vor, sondern war irgendwo außer mir festgelegt, für mich gemacht – und ich bin eigentlich ein anderer! Und da ergriff mich eine schreckliche Empörung. Ach, die eigene Form schaffen! Über sich hinausspringen! Sich ausdrücken! Meine Gestalt soll aus mir hervorgehen und mir nicht gemacht werden! Die Empörung treibt mich ans Papier. Ich ziehe Papier aus der Schublade, und da wird es Morgen, Sonne ergießt sich in mein Zimmer, das Dienstmädchen bringt den Morgenkaffee und die Brötchen, und inmitten glänzender und ziselierter Formen beginne ich die ersten Seiten meines eigenen Werks zu schreiben, eines Werks genau wie ich, mit mir identisch, direkt aus mir hervorgehend, eines Werks, das souverän mein eigenes Recht gegenüber allem und allen geltend macht, da ertönt plötzlich die Klingel, das Dienstmädchen öffnet, und in der Tür erscheint T. Pimko, Doktor und Professor, aber eigentlich Lehrer, Kulturphilologe aus Krakau, zierlich, klein, mager, kahl, mit Kneifer, gestreiften Hosen, Jackett, die Fingernägel lang und gelb, die Gamslederschühchen gelb.
Kennt ihr den Professor?
Ist er euch bekannt, der Professor?
Der Professor?
Holla, holla, holla, holla, holla! Beim Anblick dieser entsetzlich nichtssagenden, durch und durch banalisierten Form warf ich mich über meine Texte und verdeckte sie mit dem ganzen Körper, doch er setzte sich hin, da musste ich mich auch setzen, und sitzend stattete er mir sein Beileid zum Tod eines Tantchens ab, das schon ziemlich lange verstorben war und das ich völlig vergessen hatte.
»Das Gedenken der Verstorbenen«, sprach Pimko, »ist die Lade des Bundes zwischen neuen und alten Jahren, so wie das Volkslied (Mickiewicz[4]). Wir leben das Leben der Verstorbenen (A. Comte[5]). Ihr Tantchen ist gestorben, und dies ist ein Grund, dass man ihm ein Kulturgedenken widmen kann und sogar muss. Das verstorbene Tantchen hatte seine Fehler (er zählte sie auf), aber auch seine Vorzüge (er zählte sie auf), denn es war der Allgemeinheit nützlich, alles in allem kein schlechtes Buch, das heißt, ich wollte sagen, eher drei plus – also letztlich war, kurz gesagt, das verstorbene Tantchen ein positiver Faktor, die Gesamtnote fiel positiv aus, und ich hielt es für meine angenehme Pflicht, Ihnen dies zu sagen, ich, Pimko, der ich auf der Wacht der Kulturwerte stehe, zu welchen ohne Frage auch das Tantchen gehört, insbesondere weil es gestorben ist. Im Übrigen«, sagte er nachsichtig, »de mortuis nihil nisi bene[6], also warum, auch wenn dies und jenes noch zu bemängeln wäre, nicht einen jungen Autor ermutigen – Verzeihung, einen Neffen … Aber was ist das?«, schrie er, als er auf dem Tisch das angefangene Manuskript erblickte. »Also nicht nur Neffe, sondern auch Autor! Ich sehe, wir erproben unsere Kräfte auf diesem Felde? Putt putt putt, Autor! Will es mir gleich durchsehen und ermutigen …«
Und sitzend griff er über den Tisch nach den Papieren, setzte sich dabei seinen Kneifer auf und saß da.
»Nein doch … ist doch nur …«, stammelte ich dasitzend. Die Welt brach plötzlich zusammen. Tantchen und Autor hatten mich umgeworfen.
»Nu, nu, nu«, sagte er, »putt putt Hühnchen.«
Das sagte er, indem er sein Auge rieb, dann eine Zigarette hervorholte und sie, während er sie mit zwei Fingern der linken Hand hielt, mit zwei Fingern der Rechten flachdrückte; zugleich nieste er, denn der Tabak kitzelte ihn in der Nase, und dasitzend begann er zu lesen. Und saß weise da und las. Und mir, wie ich sah, dass er las, wurde schwach. Meine Welt brach zusammen und war plötzlich auf der Basis des klassischen Paukers organisiert. Mich auf ihn stürzen konnte ich nicht, denn ich saß da, und ich saß da, weil er dasaß. Mir nichts, dir nichts war das Dasitzen in den Vordergrund gerückt und zum größten Hindernis geworden. Daher ruckelte ich beim Dasitzen herum, denn ich wusste nicht, was tun und wie mich verhalten, ich fing an mein Bein hin und her zu bewegen, die Wände entlangzuschauen und an den Fingernägeln zu knabbern, doch diese ganze Zeit saß er konsequent und logisch da und hatte sein Dasitzen durch den lesenden Pauker organisiert und erfüllt. Das dauerte furchtbar lange. Die Minuten zogen sich hin wie Stunden, die Sekunden weiteten sich, und ich fühlte mich unangebracht wie ein Meer, das jemand durch ein Röhrchen austrinken will. Ich stöhnte:
»Bei Gott, bloß nicht der Pauker! Nicht per Pauker!«
Der eckige, steife Pauker machte mich fertig. Doch er las, ganz Pauker, weiter und assimilierte meine vitalen Texte ganz typisch Pauker, indem er das Papier dicht vor den Augen hielt, und jenseits des Fensters stand ein Mietshaus, zwölf Fenster breit und lang. Traum?! Wachen? Wozu war er hier? Wozu saß er da, wozu saß ich da? Wie konnte es sein, dass alles, was zuvor da war, Träume, Erinnerungen, Tanten, Qualen, Geister, ein angefangenes Werk – zusammenfloss im Dasitzen des banalen Paukers? Die Welt schrumpfte zum Pauker. Das wurde langsam unmöglich. Er saß da mit Sinn (denn er las), und ich saß da ohne Sinn. Ich machte krampfhaft den Versuch aufzustehen, doch gerade in dem Moment sah er mich unter seinem Kneifer nachsichtig und plötzlich an – ich wurde kleiner, das Bein wurde Beinchen, die Hand – Händchen, die Person – Persönchen, der Mensch – Menschlein, das Werk – Werklein, der Körper – Körperchen, er aber wuchs empor, saß da, indem er mich anschaute und mein Skript von Ewigkeit zu Ewigkeit amen las – saß da.
Kennt ihr die Empfindung, wenn ihr klein werdet in jemandem? Ach, kleinwerden in einer Tante ist etwas hochsonderbar Unanständiges, aber kleinwerden in einem großen banalen Pauker, das ist der Gipfel unanständiger Kleinheit. Und ich bemerkte, wie der Pauker sich an meinem Grün weidete wie eine Kuh. Ein hochsonderbares Gefühl – der Pauker grast dein Grün auf der Weide, aber doch in der Wohnung, indem er auf dem Stuhl dasitzt und liest – und trotzdem grast und weidet er. Etwas Fürchterliches geschah mit mir, was aber nach außen etwas Dummes, etwas schlicht Irreales war. »Geist!«, schrie ich. »Ich! Geist! Kein Autorchen! Geist! Voll lebendig! Ich!« Doch er saß da, und saß im Dasitzen da und saß dasitzend irgendwie so da, war so eingesessen in sein Dasitzen, war so absolut in seinem Dasitzen, dass sein völlig dummes Dasitzen dennoch zugleich übermächtig war. Und er nahm den Kneifer von der Nase, wischte ihn mit einem Tüchlein und setzte ihn wieder auf die Nase, und die Nase war etwas Unüberwindliches. Diese Nase war nasig, trivial und banal, paukerhaft, ziemlich lang und bestand aus zwei Röhrchen, die waren parallel und endgültig. Und er sagte:
»Was denn schon wieder für ein Geist?«
Ich schrie:
»Mein eigener!«
Da fragte er:
»Der angestammte? Vaterländische?«
»Kein angestammter, sondern mein eigener!«
»Der eigene?«, fragte er gutmütig. »Reden wir vom eigenen Geist? Aber kennen wir wenigstens den Geist von König Ladislaus?« – und saß da.
Welcher König Ladislaus? Ich war wie ein Zug, der plötzlich auf das Nebengleis König Ladislaus umgeleitet wurde. Ich bremste und öffnete den Mund, denn ich vergegenwärtigte mir, dass ich den Geist von König Ladislaus nicht kannte.
»Und den Geist der Geschichte, kennen wir den? Und den Geist der hellenischen Zivilisation? Den Geist der gallischen Kultur, den Geist des Maßes und des guten Geschmacks? Und den Geist des ausschließlich mir bekannten Idyllenschreibers des 16. Jahrhunderts, der als Erster den Ausdruck ›Nabel‹ verwendete? Und den Geist der Sprache? Heißt es richtig ›gewinkt‹ oder ›gewunken‹?«
Die Frage überrumpelte mich. Hunderttausend Geister würgten meinen Geist, ich stotterte, ich wüsste es nicht, er aber fragte, was ich vom Geist Kasprowiczs[7] und von seiner Einstellung zu den Bauern wüsste, worauf er mich noch nach der ersten Liebe von Lelewel[8] fragte. Ich räusperte mich und lugte verstohlen auf meine Nägel – die Nägel waren sauber, ein Spickzettel war nicht da. Dann schaute ich mich um – als ob ich erwartete, dass jemand mir vorsagte. Aber hinten war doch niemand. Der Traum ist ein Mahr, aber Gott ist wahr. Was geschieht? Gott! So schnell es ging, brachte ich meinen Kopf in die richtige Haltung und sah Pimko an, aber mein Blick war nicht der meinige, sondern ein Blick aus gerunzelter Stirn, kindisch und voller Pennälerhass. Mich ergriff das unangemessene und anachronistische Gelüst, dem Lehrer ein Papierkügelchen direkt auf die Nase zu schnalzen. Da ich merkte, dass es nicht gut um mich stand, gab ich mir einen krampfhaften Ruck und wollte Pimko im Gesellschaftston fragen, was es denn Neues in der Stadt gab, aber statt meiner normalen Stimme brachte ich eine piepsende, heisere Stimme hervor, als ob ich wieder im Stimmbruch wäre, und schwieg; Pimko aber fragte mich ab nach meinem Wissen über Umstandswörter, hieß mich deklinieren mensa, mensae, mensae und konjugieren amo, amas, amat, verzog das Gesicht und sagte: »Nun ja, daran wird ein bisschen zu arbeiten sein«, nahm sein Notizbuch heraus und trug eine schlechte Note für mich ein, wobei er dasaß, und sein Dasitzen war endgültig und absolut.
Was? Was? Ich wollte schreien, ich sei kein Schüler, hier liege ein Irrtum vor, und wandte mich schon zur Flucht, doch etwas hielt mich von hinten wie mit Zangen fest und nagelte mich an meinen Sitzplatz – der kindliche, infantile Poppo hatte mich gepackt. Mit dem Poppo konnte ich mich nicht rühren, der Pauker aber saß weiter da und drückte in seinem Dasitzen eine derart perfekte Paukerhaftigkeit aus, dass ich, statt zu schreien, zwei Finger hochhob, wie es die Schüler in der Schule tun, wenn sie sich melden wollen. Pimko verzog das Gesicht und sagte:
»Bleiben Sie sitzen, Kowalski. Schon wieder aufs Klo?«
Und ich saß da im irrealen Nonsens wie in einem Traum, geknebelt, eingepaukert, zugepaukert, saß da auf meinem Kinderpopöchen – er aber saß da wie auf der Akropolis und trug etwas in sein Notizbuch ein. Schließlich sagte er:
»Na, Josi, komm, wir gehen in die Schule.«
»In was für eine Schule?!«
»In die Schule von Direktor Federfukski. Erstklassige Wissenschaftsanstalt. In der sechsten Klasse sind noch Plätze frei. Deine Erziehung – ist vernachlässigt, und es müssen vor allem die Lücken aufgearbeitet werden.«
»Aber in was für eine Schule?!!?«
»In die Schule von Direktor Federfukski. Fürchte dich nicht, wir Lehrer lieben das Kleinzeug, putt putt putt, lasset die Kindlein zu mir kommen.«
»In was für eine Schule?!«
»In die Schule von Direktor Federfukski. Direktor Federfukski bat mich, ihm alle freien Plätze zu besetzen. Eine Schule muss funktionieren. Ohne Schüler keine Schule, ohne Schule keine Lehrer. In die Schule! In die Schule! Dort in der Schule werden sie aus dir schon einen Schüler machen.«
»Aber in was für eine Schule?!!!«
»Eh, bitte, mach keine Geschichten! In die Schule! In die Schule!« Er rief das Dienstmädchen, befahl ihr, mir den Mantel zu reichen, die Magd, die nicht verstand, warum ein fremder Herr mich entführte, brach in lautes Lamento aus, aber Pimko kniff sie – als gekniffene Dienstmagd konnte sie nicht länger lamentieren, sondern brach mit offenem Mund in das Gelächter der gekniffenen Dienstmagd aus – er nahm mich an der Hand und entführte mich aus dem Haus, und auf der Straße standen Häuser und gingen Leute!
Polizei! Zu dämlich! Zu dämlich, um wahr zu sein! Unmöglich, weil zu dämlich! Doch zu dämlich, um Widerstand zu leisten … Ich konnte nicht an gegen den belanglosen Pauker, der ein banaler Pauker war. Ganz wie wenn jemand euch zu belanglos und banal anmacht und ihr dann nicht könnt, genauso konnte ich jetzt auch nicht. Idiotischer, infantiler Poppo lähmt mich und nimmt mir jede Möglichkeit eines Widerstandes; eilig trippelnd neben dem Kolossalen, der in großen Schritten voranging, konnte ich, bei dem Poppo, überhaupt nichts mehr. Leb wohl, Geist, leb wohl – begonnenes Werk, leb wohl, du eigene und wahre Form, sei gegrüßt, sei gegrüßt, du schreckliche, infantile, grüne, unausgemauserte Form! Banal eingepaukert tripple ich neben einem Riesenpauker einher, der bloß plappert: »Putt putt Hühnchen … Voller Rotz das Näschen … Ich liebe, eh, eh … Menschlein, Kleiner, Kleiner, putt putt puttiputt, Josi, Josi, Josilein, Josichen kleines kleines, putt putt, Poppolein, Poppolein, lein …« Vor uns führte eine elegante Dame ein Pinscherlein an der Leine, der Hund knurrte, stürzte sich auf Pimko und zerriss ihm ein Hosenbein, Pimko schrie, gab dem Hund und der Halterin eine schlechte Zensur, richtete sein Hosenbein mit einer Sicherheitsnadel, und wir gingen weiter.
2Gefangengenommen und weiter verkleinert
Und hier nun vor uns – nein, nein, ich traue meinen Augen nicht – das Gebäude, ziemlich flach, die Schule, in die Pimko mich am Händchen zieht trotz meiner Tränen und Proteste und in die er mich durch das Pförtchen hineinschiebt. Wir kamen gerade während der großen Pause an, auf dem Schulhof spazierten Zwischenwesen im Kreis, von zehn bis zwanzig Jahren, und aßen dabei ihr zweites Frühstück, bestehend aus Brot mit Butter oder Käse. Im Zaun um den Schulhof herum waren Lücken, und durch diese Lücken lugten Mütter und Tanten, die nie genug von ihren Lieblingen bekommen konnten. Pimko sog den Schulgeruch mit Wonne in seine rassigen Nasenröhren ein.
»Putt putt putt«, rief er aus. »Kleiner, Kleiner, Kleiner …«
Und zugleich hinkte ein Bildungsträger, sicher der Aufsichtshabende, mit großer Unterwürfigkeit gegenüber Pimko zu uns her.