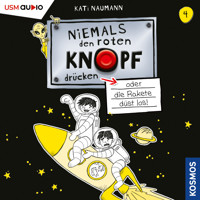Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Harper Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Astoria ist das älteste seetüchtige Kreuzfahrtschiff der Welt. Seit über siebzig Jahren trägt es die Menschen übers Meer und hat schon unzählige Schicksale bestimmt. Nach einer Kollision mit dem Luxusschiff Andrea Doria wurde es an die DDR verkauft und fortan für Urlaubsreisen eingesetzt. Auf seinen Fahrten bis in die Karibik geraten das Schiff und seine Passagiere auch zwischen die Fronten des Kalten Krieges.
Die Stewardess Simone und der Matrose Henri haben sich vor vielen Jahren auf diesem Schiff kennengelernt. Heute treten sie noch einmal eine Kreuzfahrt mit der Astoria und damit auch eine Reise in ihre Vergangenheit an. Denn sie begegnen dabei der Schwedin Frida, die als Kind die Schiffstaufe erlebt hat und deren Geschichte ebenfalls ganz eng mit der des Schiffes verbunden ist.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kati Naumann
Fernwehland
Roman
HarperCollins
Sämtliche Personen sind frei erfunden. Nicht alle Details entsprechen den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Nicht alle Reisetermine der Schiffe stimmen mit den tatsächlichen überein.
Originalausgabe
© 2025 by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von Susan Fox / Trevillion Images
E-Book Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749908028
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberin und des Verlags bleiben davon unberührt.
1. Die Ankunft
April 2019 in Poole (England)
Henri konnte das Meer spüren, lange bevor er es sah oder hörte. Als er das Fenster in dem stickigen Zugabteil hinunterdrückte, drang schwere Luft herein. Sie schmeckte salzig und vertraut.
Er tauschte einen Blick mit Simone, die ihm gegenübersaß. Sie schien die Sehnsucht in seinen Augen falsch zu deuten und reichte ihm eine gut gefüllte Brotdose. Für jeden Abschnitt ihrer langen Reise hatte sie vorgesorgt.
Sie waren von Kötzschenbroda im oberen Elbtal mit dem Bus zum Dresdner Flughafen gefahren, um die enormen Parkgebühren zu vermeiden. Von dort war es weiter Richtung London gegangen. Nun befanden sie sich auf der dritten Etappe in einem Zug der South Western Railway, der sie an die Küste im Süden Englands bringen sollte.
Ein Zugbegleiter rumpelte mit seinem Servierwagen durch den Gang und bot Erfrischungen an. Henri schüttelte abwehrend den Kopf und spürte gleichzeitig, wie sein Hals trocken wurde. Wegen der Sicherheitsbestimmungen hatten sie ihre Getränke im Aufgabegepäck verstauen müssen. Während des Flugs waren die Thermobehälter durch den niedrigen Luftdruck ausgelaufen. Die erste Hälfte der Zugfahrt hatten sie damit verbracht, ihre nasse Wäsche von der trockenen zu separieren.
Henri nahm die Thermosflasche vom kleinen Klapptisch und trank den kläglichen Rest. Es fühlte sich unangenehm an, so knauserig zu sein. Dabei hatte es Zeiten gegeben, in denen er nicht auf die Mark sehen musste. Aber die waren vorbei, und es war nicht sein Geld, das sie hier ausgaben. Er hatte das Gefühl, sparsam damit umgehen zu müssen.
»Meinst du, uns wird dabei langweilig?«, fragte er unvermittelt. »Wir haben dort überhaupt nichts zu tun.«
Simone, die gern las, hatte sich einige Bücher eingepackt. Er dagegen beschäftigte sich seit Wochen mit dem Umbau einer Simson S51. Die hatte er schlecht mitnehmen können.
Sie lächelte ihn zuversichtlich an, und die kleinen Fältchen in ihren Augenwinkeln vertieften sich. »Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. Wir haben ja uns.« Sie holte einen Block aus ihrer Tasche und schlug ihn auf.
»Was ist das?«, wollte er wissen.
»Eine Liste von allen Dingen, die ich noch mit dir machen will.«
Henri warf einen Blick darauf. An oberster Stelle stand: Fahrt mit der V1.
In Poole stellten sie ihr Gepäck in einem schäbigen Hotelzimmer unter. Im Bad war zwar keine Seife, aber dafür lagen zwei Äpfel auf dem Nachttisch. Ihre klammen Sachen hängten sie über die Stuhllehnen. Als Henri seinen Koffer fast geleert hatte, entdeckte Simone darin das Messer.
»Wieso in aller Welt hast du das mitgenommen?«, fragte sie bestürzt.
Es war ein altes Matrosenmesser mit Holzgriff. Er klappte die Klinge heraus. In den fleckigen Stahl war ein räudig aussehender Löwe eingeprägt. Henri nahm einen Apfel und schnitt ihn auf. »Das hab ich doch immer dabei«, sagte er achselzuckend und begann zu essen. Im Aufgabegepäck für den Flug hatte es niemanden interessiert.
»Aber du kannst doch heutzutage kein Taschenmesser auf ein Kreuzfahrtschiff mitnehmen!« Sie schien sich ernsthaft Sorgen zu machen. »Womöglich nehmen sie es dir weg!«
Er versicherte, dass er sich die Vorschriften genau durchgelesen habe. Die Klinge war nicht feststehend und besaß eine erlaubte Länge. Er klappte das Löwenmesser wieder zusammen, schob es in seine Hosentasche und reichte Simone ein Apfelstück.
Kurz darauf schlenderten sie durch die abendliche Altstadt, vorbei an georgianischen Herrenhäusern, gebaut von Kaufleuten, die durch den Stockfischhandel reich geworden waren. Die Schaufenster der kleinen Läden in der High Street wurden durch Holzsprossen unterteilt. Dadurch wirkten die Auslagen dahinter, Töpferwaren, handgemachte Seife und pulsierende Lavalampen, wie ein nachlässig zusammengesetztes Puzzle.
Sie fanden einen Pub, der aussah, als wäre er die Stammkneipe des gnadenlosen Piraten Blackbeard gewesen, und aßen eine Suppe mit Herzmuscheln.
Später liefen sie den alten Kai entlang und beobachteten, wie Boote hinter der Halbinsel auftauchten und in den Hafen zurückkehrten. Auf den Schwimmdocks saßen Angler. Das Licht der gusseisernen Straßenlaternen spiegelte sich in schillernden Ölschlieren, die aus einem alten Schiffsmotor heraussickerten. Eine kleine weiße Motoryacht legte an. Am Bug flatterte die Flagge von Poole mit dem grimmigen Delfin auf schwarzgelb wogenden Balken, gekrönt von drei Muscheln.
Für die beiden Reisenden war dieser Ort voll von vertrauten Gerüchen und Geräuschen. Und doch konnte Henri nichts davon genießen. Es schien ihm, als würden all die kleinen Pubs und Läden, die malerischen Häuser und schnittigen Boote nur von ihrem eigentlichen Ziel ablenken.
Als hätte sie seine Gedanken erraten, fragte Simone: »Willst du lieber zurückgehen?«
Er nickte. Im Schlaf verging die Nacht schneller.
Henri erwachte in der Dunkelheit ohne jedes Zeitgefühl. Das betraf nicht nur die Stunde, sondern auch das Jahr. Im Dämmerschlaf grübelte er, auf welcher Route sie sich eigentlich befanden. Waren sie rechtsrum oder linksrum gefahren? Ging es die rote Route nach Kaliningrad? Oder waren sie auf dem Weg in den Westen? Allmählich sickerte die Erkenntnis zu ihm hindurch, dass er nicht im harten Doppelstockbett seiner Zweimannkabine lag. Die monotonen Verdrängungsgeräusche des Wassers und die schwankenden Bewegungen fehlten. Er wollte sich aufsetzen, aber die durchgelegene Matratze gab nach.
Neben ihm flammte der kleine Bildschirm eines Telefons auf und tauchte Simones Gesicht in bläuliches Licht. Henri erkannte das schäbige Hotelzimmer. Es war fünf Uhr, und sein Puls raste.
»Kannst du nicht schlafen?«, fragte sie gähnend und streckte sich. Er brummte etwas Unverständliches vor sich hin. Sie legte die Hand auf seine Wange, und die Wärme beruhigte seinen Herzschlag. Prüfend blickte sie ihn an und musste lachen. »Na los«, sagte sie. »Lass uns aufstehen. Wir gehen zum Hafen.«
Wenig später verließen sie das Hotel. Es war noch dunkel und kalt. Sie hatten Ferngläser dabei, und Simone zog fröstelnd den Reißverschluss ihrer Wetterjacke höher. Sie setzten sich auf eine Bank am Kai und beobachteten, wie der blassrote Streifen am Horizont breiter wurde. Der Himmel zerfloss in Grautönen. Inzwischen konnten sie die Umrisse der Insel erkennen, die mitten in dem alten Naturhafen aus dem Wasser wuchs. Ein Schwarm kreischender Uferschnepfen stob aus den Baumwipfeln hoch. Brandseeschwalben fingen im Sturzflug unsichtbare Insekten.
Allmählich erwachte hinter ihnen der kleine Ort zum Leben. Mit metallischem Rattern wurden Rollläden hochgezogen, Radfahrer verschafften sich klingelnd Platz, und ein Motorrad knatterte vorbei. Ein junger Angestellter zerrte Blechstühle vor ein Straßencafé.
»Willst du frühstücken?«, fragte Simone. »Soll ich uns einen Kaffee holen?«
Henri schüttelte den Kopf. Gebannt starrte er zur Hafenmündung, als wäre er ein Zauberer, der allein mit der Kraft seiner Gedanken das Schiff zum Erscheinen bringen könnte. Ab und zu kehrte ein Fischerboot zurück, das in der Nacht Krabben gefangen hatte.
Und dann tauchte in der Ferne ein dunkler Schatten auf, verschwommen und flimmernd, wie eine Fata Morgana. Das war keine von den kleinen Yachten.
Vor Aufregung ging Simones Atem schneller. Der Schatten wurde größer, und seine Umrisse waren nun deutlicher zu erkennen. Henri zog das Fernglas unter der Jacke hervor und blickte hindurch.
»Das ist sie!«, rief er, und die Stimme des kräftigen Mannes, der wirkte, als könnte ihn nichts erschüttern, klang plötzlich brüchig.
Das Schiff, das sich gemächlich näherte, war die Astoria, das älteste noch fahrende Passagierschiff der Welt. Inzwischen gehörte es zur Flotte einer britischen Reederei. Unter so vielen Namen war sie gefahren, aber für Simone und Henri würde sie immer die Völkerfreundschaft bleiben, das erste Kreuzfahrtschiff der Deutschen Demokratischen Republik. Vor über vierzig Jahren hatten sie sich darauf kennengelernt. Es war ihr Schiff. Und es hatte ihr Schicksal bestimmt.
Seit Ewigkeiten sparte Henri auf diese Kreuzfahrt. Er hatte sich genau ausgerechnet gehabt, was er jeden Monat zurücklegen musste, um sich diesen Luxus leisten zu können. Er hatte aufgehört zu rauchen, nur noch gelegentlich und in Gesellschaft Bier getrunken, auf Süßigkeiten verzichtet und den Sportkanal gekündigt. Nach seiner Berechnung wäre es im Jahr 2020 so weit gewesen. Und dann war sein Vater gestorben und hatte ihm etwas Geld hinterlassen. Nicht viel, aber genug, um deutlich früher als gedacht zu dieser Reise aufbrechen zu können.
Begleitet von einem Lotsenboot bewegte sich die Astoria auf den South Quay zu, einen langen Tiefwasserkai. Allmählich fanden sich weitere Schaulustige ein, die das größte Kreuzfahrtschiff sehen wollten, das bisher in den Hafen von Poole eingelaufen war.
Fast konnte man meinen, dass die Astoria auf dem Wasser stillstand. Ihr schlanker Körper, der dunkelblaue Rumpf und der weiße Decksaufbau verliehen ihr eine zeitlose Eleganz. Mit ruhiger Gelassenheit näherte sie sich, wie eine Hoheit, die es nicht nötig hat, sich abzuhetzen.
Henri hatte das Schicksal dieses Schiffes immer verfolgt. Er wusste all seine verflossenen Namen und Eigner und kannte sämtliche Bilder der zahlreichen Umbauten. Nun aber sah er es unmittelbar vor sich mit all den Veränderungen, deren Sinn ihm nicht einleuchten wollte und die ihm nichts als die Außenhaut unter der Farbe gelassen hatten. Am wenigsten störten ihn die beiden riesigen weißen Kugeln auf dem obersten Deck, die Radar und Satellitenantennen verbargen. Modernste Navigationstechnik musste sein. Aber die überproportional großen Aufbauten zerstörten die ursprüngliche Harmonie. Zudem hatten sie den plumpen Heckwulst notwendig gemacht, ohne den sein Körper nicht mehr genug Auftrieb entwickeln konnte.
Der Anblick des Schiffes erschreckte Henri und löste doch gleichzeitig ein seltsames Gefühl von Vertrautheit aus. Das war noch immer die Völkerfreundschaft. So, wie die ältere, kräftige Frau neben ihm noch immer Simone war. Auch wenn sie nicht mehr aussah wie die junge Stewardess in der schmucken Uniform, die ihre Filzkappe mit der Kokarde der Deutschen Seereederei immer ein wenig schief auf die in einem Dutt versteckte Hippiemähne gesetzt hatte.
Henri legte den Arm um sie und grinste. »Wir drei haben uns gewaltig verändert.« Sie gab ihm einen empörten Stoß in die Rippen und lachte.
Die Astoria war nun ganz nah. Schon hörten sie das Rauschen des Wassers, das vom Bug zur Seite gedrängt wurde. Das mächtige Schiffshorn dröhnte dreimal, um sie zu begrüßen. Sturmvögel jagten über sie hinweg.
»An den Entenschwanz kann ich mich nicht gewöhnen«, stellte Simone fest. »Der schlanke Schornstein war auch schöner. Und Weiß stand ihr besser.« Sie dachte kurz nach und setzte hinzu: »Aber sie wird uns wie damals hinaus in die Welt bringen.«
Ein seltsames Ziehen lief durch Henris Magen. Er kannte dieses Gefühl. Er hatte es immer gespürt, wenn er nach hundert Tagen auf See für drei Wochen zu Hause in Radebeul sein musste.
Und als er nicht mehr zur See fahren durfte, mied er seinen Heimatort erst recht. Dort bestand die Gefahr, der Person über den Weg zu laufen, die dafür gesorgt hatte, dass sein Seefahrtsbuch eingezogen worden war. Dadurch hatte er alles verloren, was ihm wichtig war und ihn ausmachte. Besonders von großen Familienfeiern hatte er sich seitdem ferngehalten. Seine Eltern hatte das immer betrübt, aber das war ihm egal gewesen.
»Ich hätte meinen Vater öfter besuchen müssen«, sagte Henri unvermittelt.
Simone blickte ihn überrascht an. Er starrte aufs Wasser. Am Ende hing alles mit seinem Vater zusammen. Er hatte das Schicksal dieses Schiffes beeinflusst und damit Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu führten, dass Henri nun hier war, mit Simone, die ihn verstand wie kein anderer Mensch.
»Dass wir beide uns begegnet sind, verdanken wir bloß meinem Vater«, erklärte er.
Sie zog ein ungläubiges Gesicht. »Wie kommst du denn darauf?«
»Weil es dieses Schiff ohne meinen Vater gar nicht mehr geben würde.«
Simone warf ihm einen skeptischen Blick zu. Das schien sie für eine Legende zu halten. Aber er war felsenfest davon überzeugt. Ohne seinen Vater wäre dieses Schiff vor vielen Jahren nicht gerettet worden. »Vermutlich hätte ich auch einen anderen Beruf gelernt und wär nie zur See gefahren.«
Diesmal nickte Simone. »Ja«, sagte sie nachdenklich. »Damit hast du wohl recht.«
Henri dachte an die abenteuerlichen Erinnerungen, von denen ihm sein Vater Erwin erzählt hatte, während sie Rindenschiffe auf die Elbe setzten, die bis ins unerreichbare Hamburg hinter der Grenze treiben sollten. Es waren Geschichten von Schwimmern, die sich ans Steuerruder des Dampfers gehängt hatten und die Erwin, der Bootsmann, mit dem Teerpinsel bewarf. Oder vom Krieg zwischen Decksaffen und Schwarzhälsen, wie die kohleverdreckten Heizer genannt wurden. Sie lagen in ständiger Rivalität mit dem schmuck uniformierten Deckspersonal, zu dem Erwin gehörte. Und dann die vielen Reisebücher und Atlanten, die Henri von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Vermutlich war der Band Völkerkunde für jedermann mit seinen Schwarzweißbildern von tätowierten Gesichtern, Lippentellern und Giraffenhalsfrauen der Auslöser für seine Sehnsucht nach der Ferne gewesen.
Und nun hatte Henri ein allerletztes Geschenk von Erwin bekommen, die Kreuzfahrt mit der Astoria, die auf einen Schlag alles verschlang, was sein Vater von der mageren Rente gespart hatte.
»Meinst du, das ist richtig, was wir machen?«, fragte Henri verunsichert. »So viel Geld für nichts.«
»Natürlich ist es richtig«, versuchte ihn Simone zu beruhigen. »Für das Geld deines Vaters kann es gar keine bessere Verwendung geben!« Ihre Stimme hatte einen so überzeugten Klang, dass er ihr glaubte. Und schließlich war an das Erbe nur eine einzige Bedingung geknüpft worden.
In seinem Testament hatte Henris Vater Erwin einen Wunsch an ihn gerichtet. Er hoffte, dass sein Sohn dieses Geld nutzen würde, um sich mit seiner Vergangenheit auszusöhnen.
Und genau das hatte Henri vor.
2. Weißer Dampf und schwarzer Qualm
Juni 1938 in Kötzschenbroda (Deutschland)
Aus der Ferne ertönte der melancholische Klang einer Dampfpfeife. Erwin sprang auf und hätte beinahe den Schemel umgeworfen. Erwartungsvoll blickte der Junge seine Großmutter an.
»Wir sind noch nicht fertig«, erinnerte sie ihn. Enttäuscht sank er zurück auf seinen Platz.
Die Fenster in den dicken Lehmwänden waren schmal wie Schießscharten und ließen nur wenig Licht in die Küche. Die Luft darin fühlte sich feuchtwarm an, und es roch nach Kernseife. Mit dem Handrücken wischte sich die alte Frau ein paar graue Strähnen aus der Stirn. Sie nahm die Teekanne vom Küchenbuffet und trank aus der Tülle. Auf diese Weise sparte sie sich etwas Abwasch.
Als Erwin aus der Schule gekommen war, hatte sie wie immer Wäsche geglättet. Es lief jeden Tag gleichermaßen ab. Zuerst musste sich der Junge die Hände schrubben, damit er das frische weiße Leinen nicht verdarb. Danach sagte sie: »Jetzt darfst du mir helfen.« Sie ließ es immer so klingen, als hätte er eine Wahl. Aber diese Arbeit war wichtiger als Hausaufgaben oder Spiel. Der Großvater, der für den Kohlen-Huhle in der Meißner Straße säckeweise Kohlen schleppte, brachte nur einen schmalen Lohn nach Hause. Die Großmutter verdiente ein Zubrot, indem sie für die Stadtapotheke in der Bahnhofstraße die Kittel wusch und bügelte.
Unruhig kippelte Erwin auf seinem Schemel. Er musste hinunter zum Fluss, doch sie streckte ihm den Holzgriff des Bügeleisens entgegen. »Erst mal hol mir die Plätte.«
Mit gesenktem Kopf trottete der Junge zum Küchenofen. Zwischen den Ritzen der runden Eisenplatten leuchtete Kohlenglut hindurch. Als er den Griff in das Unterteil des Satzeisens einklinkte, spürte er die aufsteigende Hitze. Nach jedem zweiten Apothekerkittel war das Eisen so weit erkaltet, dass es neu aufgeheizt werden musste.
Mit grimmigem Nachdruck glättete Erwins Großmutter auf dem Bügelbrett die Ärmel. Den Kragen spreizte sie mit ihren knorrigen Fingern, die mittlerweile so abgehärtet waren, dass sie nicht einmal zuckten, wenn das heiße Eisen sie berührte.
Immer wieder blickte Erwin unruhig zur Uhr. Der Korb unter dem Tisch leerte sich nur schleppend, es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sie endlich den letzten Kittel erreichten. Äußerst sorgfältig und öfter als nötig fuhr Erwins Großmutter mit dem Eisen über den Rücken. Vor und zurück, unter der Lasche hindurch und noch einmal kreuzweise. Der Junge beobachtete sie dabei, und mit einem Mal schien es ihm, als ob sie die Prozedur absichtlich in die Länge zog.
»Wie spät ist es denn?«, fragte er bang.
Sie fixierte ihn aufmerksam durch ihre Brillengläser. »Weißt du die Uhr noch immer nicht?«
Beschämt schüttelte er den Kopf. Dabei hatte er schon zwei Zahnlücken und besuchte seit Ostern die Volksschule in der Harmoniestraße. Und obwohl die von allen nur die Uhrschule genannt wurde, weil ein riesiger Zeitmesser den Ostturm schmückte, war Erwin noch immer nicht hinter das Geheimnis der kreisenden Zeiger gekommen. Aber eines wusste er genau: Wenn der Personendampfer Diesbar am Nachmittag elbaufwärts vorbeischnaufte, war es fünfzehn Uhr fünfundfünfzig. Und zu dieser Zeit musste er unbedingt unten an der Anlegestelle sein.
Die Großmutter warf einen Blick auf die Küchenuhr. Es war sieben Minuten vor vier. »Das ist noch lange hin«, behauptete sie.
»Darf ich trotzdem los?«, flehte Erwin mit heiserer Kinderstimme. Seine Nase begann zu laufen, weil er die Tränen zurückhielt.
Die alte Frau seufzte. »Jeden Tag dasselbe Theater. Wenn ich nur wüsste, was du davon hast.« Sie holte ein ausgiebig benutztes Schnupftuch aus der Tasche ihrer Kleiderschürze, fuhr ihm damit übers Gesicht und brummte: »Na geh schon, du Schlawiner.«
Erwin rannte hinaus, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Er schwang sich auf einen hölzernen Holländer, der im Gärtchen vor dem Haus auf ihn wartete, und gab dem Gefährt einen Schubs. Mit der ganzen Kraft seiner mageren Arme drückte er die Deichsel nach vorn und zerrte sie zurück, immer wieder, wie ein Ruderer. Die Kurbelschwinge setzte die Hinterräder in Bewegung, der Wagen nahm Fahrt auf. Der Junge raste die Uferstraße entlang, vorbei an Feldsteinmauern und krummen Holzzäunen. Steinchen spritzen gegen seine Waden, Staub wirbelte hinter ihm auf, der Fahrtwind zerrte an seinen weißblonden Haaren.
Ganz nah ertönte nun der Zweiklang der Dampfpfeife. Noch schneller ruderte der Junge und erreichte den abschüssigen Weg zur Anlegestelle. Unten im Wasser lag ein leuchtend weißer Seitenraddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrt.
Doch Erwin kam zu spät. Die Ankömmlinge waren schon ausgestiegen und zerstreuten sich. Die Ausflügler drängten zu den Wanderwegen, und die Ansässigen, die den Dampfer als Fähre von Niederwartha herüber genutzt hatten, strömten in die Elbstraße. Längst waren die neuen Passagiere eingestiegen. Die Bootsleute hatten die Leinen gelöst, und die Holzstaken, die das Schiff in Position gehalten hatten, waren eingeholt worden. Aus dem sanft geneigten, schlanken Schornstein quoll braunschwarzer Rauch zum Himmel. Die Messingpfeife stieß eine weiße Wolke aus und ließ wieder ihr Pfeifen ertönen. Die Schaufelräder begannen sich zu drehen, unter dem Radkasten schäumte das Wasser auf.
Erwin wedelte mit seinem Taschentuch und sprang in die Höhe, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein paar Sommerfrischler winkten fröhlich zurück, aber er meinte nicht sie.
Der Dampfer war voll besetzt, und es herrschte ohrenbetäubender Lärm. Dieses günstige Nahverkehrsmittel nutzten unter der Woche vorwiegend Einheimische, die sich gern und laut über alles aufregten. An Deck drängten sich Hausierer mit ihren Bauchläden. Ein Imker, der seine Bienenstöcke auf der anderen Seite der Elbe stehen hatte, hockte auf einem Honigfass. Ein Schreiner war mit einer klobigen Kommode unterwegs zu seinem Kunden in Cossebaude. Überall türmten sich die Kisten und Koffer der Händler. Die Leiter eines Arbeiters versperrte allen den Weg und wurde vom Schiffsjungen auf das Beiboot ausquartiert. Erwin suchte die bunte Menschenmenge mit den Augen ab. Und dann – der Dampfer nahm schon Fahrt auf – entdeckte er sie! Dora stand am Heck, ihre mit Klemmen zurückgesteckten Haarwellen flogen im Wind, und sie winkte ihm mit einem Geschirrtuch zu.
»Mutti«, schrie Erwin glücklich. Winkend rannte er über die Elbwiesen, dem Dampfer hinterher. Für einen Moment waren sie gleichauf. Seine Mutter Dora warf ihm Luftküsse zu und rief seinen Namen. Er stürmte hoch auf die Mühlhabe, eine Steinmole, hinter der die Anlegebrücke im Winter Quartier bezog. Von hier oben hatte er den besten Blick auf den davonfahrenden Dampfer. Bald ging das rhythmische Geräusch der Schaufelräder im Rauschen des Flusses unter, und das Geschirrtuch, das seine Mutter weiter in großem Bogen schwenkte, war nur noch ein tanzender Punkt. Das Letzte, was Erwin von dem Dampfer sah, bevor dieser hinter den Bäumen der Biegung verschwand, war die flatternde Fahne mit dem Hakenkreuz am Heck.
Noch zweimal winken, dachte Erwin. Dann durften sie endlich für einen ganzen Tag zusammen sein.
Der Junge schlenderte zurück zu seinem Holzgefährt, setzte sich ans Ufer und streckte die Beine aus. Die Elbe täuschte trügerische Schläfrigkeit vor, doch er spürte, wie sie an seinen Füßen zog und zerrte.
Ein großer Frachtdampfer schnaufte auf seiner Route von Böhmen nach Hamburg hinter der Biegung hervor. Aus dem Schornstein quollen mächtige schwarze Wolken. Erwin versuchte, den Namen auf dem Radkasten zu entziffern. Seine Lesekünste waren noch dürftig, die tschechischen Buchstaben ergaben für ihn keinen Sinn, und viel zu schnell war das Schiff an ihm vorbei. Der Junge tröstete sich damit, dass es bald wieder zurückkehren würde, und dann konnte er noch einmal genauer hinsehen.
Erwin war überzeugt davon, dass die Elbe hinter Meißen aufhörte. Schon zweimal hatte er seine Mutter auf einer Fahrt begleitet. Und beide Male hatte der Dampfer in Meißen gedreht und war wieder zurückgefahren. Daraus schloss Erwin, dass es dort nicht mehr weiter ging.
Kurz vor der Eisenbahnbrücke in Niederwartha hörte der Schornstein des Frachters auf zu qualmen und wurde abgesenkt. Dann verschwand der Dampfer hinter der Biegung. Geduldig wartete Erwin, dass er wieder erscheinen würde. Stattdessen näherte sich der riesige Seitenraddampfer Württemberg. Hinter sich her zog er einen Schleppverband aus sieben Kähnen. Sie besaßen keinen Antrieb und hatten sich mit schwerer Fracht auf dem Elbstrom talwärts bis Hamburg treiben lassen. Nun musste der Schleppdampfer, der tonnenweise Steinkohle zum Verheizen gebunkert hatte, die leeren Kähne stromaufwärts zurück in ihren Heimatort im Böhmischen ziehen. Beinahe wäre er mit einem entgegenkommenden Floß aus dem Riesengebirge kollidiert. Obwohl sich das endlos scheinende Gefährt aus Fichtenstämmen gelenkig wie eine Schlange in die Kurve legen konnte, ließ es sich schwer steuern. Der Flößer hatte Mühe, es mit dem Steuerpaddel in der Strömung zu halten. Er krachte gegen einen Brückenpfeiler und trudelte dem Schlepper vor den Bug. Der Schiffer griff sich ein Kohlestück und warf es schimpfend nach dem Flößer. Der brüllte etwas Unverständliches zurück und schmiss im Gegenzug mit Tomaten, die ihr Ziel verfehlten und an den Radkasten klatschten. Erwin sprang vor Begeisterung auf und feuerte die beiden Kampfhähne an.
Plötzlich raste mit ohrenbetäubendem Lärm ein offenes Sturmboot vorbei, gesteuert von einem Ausbilder der Marine-HJ. Das Sperrholzboot war so leicht und schnell, dass es über die Elbe zu fliegen schien. Nur der Propeller des Maybach-Motors hing noch im Wasser. Flügelschlagend rettete sich eine Entenfamilie vor der Bugwelle.
Erst als sich der Oberdeckdampfer Mühlberg mit langgezogenem Pfeifen ankündigte, schrak Erwin auf. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sich eine Traube von Passagieren vor der Anlegestelle versammelt hatte. Schnell schwang er sich auf sein Gefährt. Er musste mit dem Handwagen die weißen Apothekerkittel ausliefern, bevor der Großvater den Kohlestaub von der Arbeit ins Haus brachte.
Am Sonntag stand Erwin mit dem ersten Hahnenschrei vom Bauernhof nebenan auf. Über der Waschschüssel machte er eine Katzenwäsche und zog die kurze Hose und ein frisch gebügeltes Hemd an, das ihm die Großmutter bereitgelegt hatte. Mit ihrem Schnupftuch, das sie für alle Gelegenheiten benutzte, fuhr sie über seine Schuhe. Sie kontrollierte den Inhalt seiner Hosentaschen und klebte zum Schluss seinen widerspenstigen Pony mit Spucke auf die Stirn.
»Nicht, dass deine Mutter denkt, wir kümmern uns nicht«, erklärte sie den Aufwand, den sie an einem gewöhnlichen Tag nicht betreiben würde.
Dass Erwin an einem Sonntagmorgen das Haus verlassen durfte, lag daran, dass sein Großvater keinen besonderen Wert auf den Kirchgang legte. Er ging lieber zum Kegelverein in den Bürgergarten. Dort rauchten die Männer Zigarren, tranken Bier und debattierten über die Aktion Arbeitsscheu Reich, durch die ihnen soeben ein jüdischer Kollege abhandengekommen war. Nun mussten sie zu ihrem Ärger dessen Arbeit mit erledigen.
Erwins Großmutter hatte von der Nachbarin eine Freikarte für die neuartigen Karl-May-Spiele auf der Felsenbühne in Rathen bekommen. Überall in der Gegend wurde mit bunten Plakaten dafür geworben.
»Eigentlich bin ich nicht für solchen Firlefanz«, behauptete sie, um schnell einzuschränken: »Aber ein Geschenk kann man ja nicht ablehnen.«
Da also beide Großeltern beschäftigt sein würden, durfte Erwin den Tag mit seiner Mutter Dora verbringen. Seit sein Vater, ein Schiffer, in reißender Strömung ertrunken war, musste Dora bei Verwandten arbeiten, um sich und ihr Kind zu ernähren. Sie waren Gastwirte und hatten sich in dieser Saison die Schanklizenz für den Passagierdampfer Diesbar erkämpft. Vom Beginn der Hauptsaison bis zu diesem Tag hatte Dora ohne Pause gearbeitet. Schließlich fuhr der Dampfer täglich und war besonders sonntags und an Feiertagen einträglich. Was die Wirtsfamilie im Sommer verdiente, musste über den Winter reichen. Erwin blieb in der Zwischenzeit bei Doras Schwiegereltern. Sie waren strenge Leute, und der Tod des einzigen Sohnes hatte sie nicht gerade weicher werden lassen. Und weil sie irgendjemandem die Schuld daran geben mussten, hatten sie sich entschieden, es Dora anzuhängen. Ganz sicher waren seine Gedanken im Moment des verhängnisvollen Fehlers nicht bei der Sache gewesen, sondern bei seiner aufgetakelten Frau aus der Großstadt. Ebenso beharrlich wie erfolglos versuchten sie, Erwin gegen seine Mutter aufzubringen. Aber bei aller Strenge hatten sie den Jungen gern und ließen ihn in ihrem Ehebett auf der Ritze schlafen.
Erwin hatte den Großeltern verschwiegen, dass der Dampfer Diesbar an jenem Morgen die obere Fahrstrecke nehmen würde und somit gar nicht bei ihnen vorbeikam. Es war ein Geheimnis zwischen ihm und seiner Mutter. Vor einer Woche, während des Passagierwechsels an der Station in Kötzschenbroda, hatte sie ihm nicht nur wie jeden Tag zugewinkt, sondern war kurz ausgestiegen. Hastig hatte sie erklärt, was er tun sollte, und ihm fünfunddreißig Reichspfennige sowie einen Zettel in die Hand gedrückt. Darauf hatte sie gemalt, wie die Zeiger der Uhr stehen würden, wenn er losgehen musste.
Bevor Erwin an diesem Sonntagmorgen das Haus verließ, gab ihm die Großmutter links und rechts einen schmatzenden Kuss. Das tat sie sonst nie. Und der Großvater brummte: »Sei nur wieder da heute Abend.«
Der Junge wusste, dass ihnen dieser Ausflug nicht behagte. Trotzdem wollte er so gern seine Mutter sehen. Rote Flecken breiteten sich auf seinem Gesicht aus. Die Tintenuhr auf dem Zettel in seiner schwitzigen Hand begann zu verlaufen. Verzweifelt suchte er nach einem Ausweg, damit ihn die Großeltern endlich gehen ließen.
»Ich bring auch was mit«, sagte er schließlich. Etwas Besseres fiel ihm nicht ein. Damit tröstete ihn manchmal seine Mutter, wenn er sie nicht weglassen wollte. Und es funktionierte auch in diesem Fall. Erwin durfte sich auf seinen Holländer schwingen und endlich aufbrechen.
Diesmal erreichte Erwin das Ende der Uferstraße rechtzeitig. Gegenüber der Anlegestelle, oben auf dem Elbdamm, befand sich die Restauration Dampfschiff. Ihr eckiger Turm ragte hoch auf, und die Spitze der Schieferhaube stach in den Morgenhimmel. Aus einem Bogenfenster neben der Eingangstür heraus verkaufte die Tochter der WirtinBilletts. Erwin tauschte seine Reichspfennige gegen einen Kinderfahrschein und drehte sich um. Er konnte über die Elbe zur anderen Seite sehen, von den hellen Zinnen des Weißen Schlosses in Cossebaude bis zu den gekreuzten Stahlgittern der Brücke in Niederwartha.
Hüpfend nahm er den Weg hinunter zur hölzernen Anlegestelle aus alten Schiffsrümpfen. Die schweren Ketten der Landungsbrücke wurden von Eisenringen gehalten, befestigt an in die Böschung eingelassenen Sandsteinen.
Inzwischen hatte sich eine Mengenmenge versammelt. Der Junge vergaß die Großeltern und freute sich auf das kommende Abenteuer. Neben ihm spie ein Mann eine braune Kautabakpfütze auf den Boden. Erwin tat es ihm gleich und spuckte ebenfalls aus. Mit einem Mal kam er sich sehr erwachsen vor und pfiff vergnügt durch seine Zahnlücken. Wie ein Echo ertönte aus der Ferne der Klang der Dampfpfeife.
Gemächlich schob sich der Schaufelraddampfer heran und legte sich mit dem Heck vor den Anleger. Am Bug stand ein Bootsmann und stach die Eisenspitze des langen Bundstakens in den Flussgrund. Das Schiff lief dagegen, und der Schiffsjunge warf die Leinen. Nun ging alles ganz schnell und mit großer Disziplin. Eine Planke flog über den Spalt zwischen Dampfer und Holzponton. Sofort eilten gut gelaunte Sommerfrischler darüber. Sie wollten sich im Licht-Luft-Bad Bilz vergnügen, in dem man es mit der Moral nicht allzu streng nahm. Kaum waren alle Ankömmlinge ausgestiegen, drängten die neuen Passagiere hinein.
Am Einlass stand der Kondukteur mit wichtiger Miene und schneidiger Uniform. Die goldenen Knopfreihen glänzten in der Morgensonne, die dunkelblaue Schirmmütze saß akkurat ausgerichtet auf seinem Schopf. An ihm kam nur vorbei, wer eine Fahrkarte vorzeigen konnte. Erwin ging mit gesenktem Kopf als Letzter an Bord. Noch nie war er allein mit dem Dampfer gefahren. Aber der Beamte warf nur einen prüfenden Blick auf sein Billett und mahnte zur Eile. Schon läutete die Glocke zum Ablegen. Der Kondukteur sah auf die Taschenuhr und zählte dem Kapitän mit den Fingern die Sekunden vor, damit exakt um sieben Uhr zwanzig abgelegt wurde. Man war schließlich bei der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrt, und dort herrschten Disziplin und Pünktlichkeit.
Eine knappe Stunde später stieg Erwin an der Endstation Dresden Altstadt aus, dem Sammelplatz der Weißen Flotte. Die hohen Mauern des Festungswalls und die monumentalen Gebäude darüber, mit all ihren Schnörkeln und furchteinflößenden Figuren, schüchterten ihn ein. Schnell drehte er sich zum Fluss um. An den Landungsstellen vor der Brühl’schen Terrasse lagen unzählige weiße Schaufelraddampfer, schmuck herausgeputzt mit bunten Wimpelketten und Fähnchen. Am Bug eines Oberdeckdampfers stand eine Musikkapelle und spielte den Prinz-Friedrich-August-von-Sachsen-Marsch.
Menschenmassen drängten sich vor der Anzeigetafel mit den Abfahrtszeiten, Zielen und Anlegern. Ein Dampfer fuhr los, der nächste legte an, und sofort schob sich ein weiterer in die zweite Reihe und wartete darauf, nachrücken zu können. Erwin fühlte sich verloren. Wie sollte er in diesem Durcheinander seine Mutter finden? Wie konnte er den Dampfer Diesbar erkennen, wenn der vielleicht ganz hinten an der Albertbrücke lag oder womöglich verdeckt war, sodass er den Namen am Radkasten nicht sehen konnte? Vor ihm erhob sich ein Meer von Schornsteinen mit blauem Anker auf grünweißer Schornsteinmarke. Bei ihrem Anblick fiel ihm die Rettung ein.
Erwin konnte alle dreiunddreißig Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrt allein an der Form ihres Schornsteins unterscheiden. Und dann entdeckte er, nicht weit entfernt, einen besonders schmalen, hohen. So einen hatte nur der Dampfer Diesbar!
Einen Moment später flogen sich Erwin und seine Mutter Dora in die Arme. Er sprang an ihr hoch und klammerte sich fest, und als er spürte, dass er ihr zu schwer wurde, zog er seine Beine an, damit sie ihn nicht absetzen konnte. Also schleppte sie ihren Jungen aufs Schiff, und diesmal brauchte er natürlich kein Billett.
Der Ausflugsdampfer für die Fahrt stromaufwärts nach Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz war voll besetzt. Der Heizer würde mehr Kohle aufwerfen müssen als wochentags, wenn das Schiff leichter war. Dora drängte sich mit ihrer Last durch die Menschenmenge, vorbei an Frauen in bunten Sommerkleidern, Herren mit Westen und ein paar vereinzelten Braunhemden.
An der Reling ließ Dora ihren Sohn herunter, klappte eine der Bänke nach unten, setzte sich und strich ihre weiße Trägerschürze glatt, bevor sie Erwin auf ihren Schoß hob. Sie nahm sein Gesicht in die Hände und konnte sich nicht sattsehen. Seine hellen Augen hatten winzige dunkle Sprenkel, über die Wange lief eine fast verheilte Schramme, und sie wusste nicht, was ihm da für ein Malheur passiert war. Mit den Fingern fuhr sie seine aufgeplatzten Lippen nach, es schien ihn zu kitzeln, denn er musste lachen.
»Du hast eine neue Zahnlücke.« Erstaunt zog sie die zu dünnen Linien gezupften Augenbrauen hoch.
Er prahlte: »Nu! Und lesen kann ich auch schon.«
Ihr wurde klamm ums Herz. Was würde sie noch alles versäumen? »Du bist eben pfiffig«, lobte sie ihn und zwang sich zu einem Lächeln.
Es war nur ein kleiner kostbarer Moment, den sie für sich ganz allein hatten. Dann wurde nach Dora gerufen, in einem Tonfall, der keine Verzögerung erlaubte.
»Ich bleibe bei dir«, versicherte Erwin und griff den Zipfel ihres Schürzenbandes. Ihre Hände würde sie gleich selbst brauchen.
Sie öffnete eine Tür aus genietetem Stahlblech, damit sie den Niedergang zum Salon hinabsteigen konnten. Oben ertönte das Läuten der Glocke, das die Abfahrt anzeigte.
Die Wände des Salons waren mit dunklem Holz vertäfelt, kunstvoll bemalte Kacheln aus Meißner Porzellan und Spiegel gaben dem Raum eine besondere Weite und Eleganz. Messingsäulen mit zierlichen Kapitellen stützten die Decksbalken, der hölzerne Boden war mit Ochsenblutfarbe gestrichen. In den mit weißem Leinen bezogenen Klappstühlen lehnten Fabrikanten und Funktionäre. Ihre Gattinnen hatten es sich auf den plüschgepolsterten Bänken an den Wänden bequem gemacht. An einem Tisch debattierte ein Damenclub, dessen Mitglieder sich wenig um die neue Rolle der Frau am Herd zu scheren schienen. Sie trugen Blusen mit einschüchternden Schulterpolstern und eng anliegende Oberteile mit tiefem Dekolleté, die im Nacken gebunden waren und einen Blick auf ihre milchweißen Rücken erlaubten.
Dora nahm Bestellungen und Wünsche entgegen, öffnete dem Damenclub das Schiebefenster, und für die Fabrikantengattinnen zog sie die Holzlamellen der Blenden zu, als Schutz vor der Sonne. Dann eilte sie mit Erwin am Schürzenzipfel ans andere Ende des Schiffes in den Rauchsalon, hinter dem sich die Küche befand.
Der Rauchsalon war schlichter eingerichtet, und es ging weniger vornehm zu. Dieser Raum wurde vom Biertresen in der Mitte beherrscht, zu dem eine Leitung vom Eisschrank auf dem Deck darüber hinabführte.
Erwin wurde in den Zapfhahn eingewiesen und schenkte mit großer Geschicklichkeit in gläserne Bierhumpen ein, die seine Mutter an die durstigen Raucher verteilte. Dann füllte sie ein Tablett mit Kaffeetassen und eilte die Treppe hinauf, um sie auf dem Deck anzubieten. Wie ein Hündchen trottete Erwin ihr hinterher.
Die Luft auf dem Oberdeck fühlte sich frisch an, und der Geruch nach Zigarren und Bier verflog. Gerade passierten sie in Pillnitz das Lustschloss der sächsischen Könige mit den patinagrünen Dächern, den Türmchen und der Treppe zur Elbe, die aussah, als hätte Aschenputtel hier ihren gläsernen Schuh verloren.
Inzwischen sammelte Dora die geleerten Gläser ein, und wieder blieb Erwin dicht bei ihr. Als sie die Küchentür öffnete, quoll ihnen eine riesige Dampfwolke entgegen. Dora riss den Jungen beiseite, hier konnte man sich schnell verbrühen. Der Wirt kochte mit dem Dampf vom Dampfkessel zeitsparend Unmengen von Kartoffeln.
In der Küche waren halbe Stahlblechbecken befestigt, deren Rückseite aus der Außenbordwand bestand. Darin befanden sich an dieser Stelle Löcher, und mit jeder Welle floss Elbwasser in die Becken herein und wieder hinaus. Hier spülte Erwin die Gläser ab, und Dora trocknete sie mit einem Leinentuch. Jedes Glas musste blitzsauber sein. Wenn sie einen Dreckschmierer darauf entdeckte, wanderte es zurück ins Spülbecken.
Als sie später eine neue Ladung Erfrischungen an Deck verteilten, bemerkte Erwin staunend, dass sich die Stimmung verändert hatte. Die Sonne war hinter den Wolken verschwunden, und sie fuhren durch das Elbsandsteingebirge.
Nebel stieg vom Fluss auf, der sich in den schroffen Wänden der alten Steinbrüche verfing. Die zerklüfteten Felsformationen rückten immer enger ans Ufer heran, Birken wuchsen an den steilen Hängen und verrenkten sich in seltsamen Formen, auf der Suche nach Halt. Die Ausflügler an Deck unterhielten sich nun flüsternd, und für einen Moment war nur das rhythmische Geräusch des Wassers zu hören, das die Schaufelräder erzeugten. Wie erstarrte Riesen kamen Erwin die frei stehenden Felsentürme vor, die hoch in den düsteren Himmel ragten. Der Junge sah hinauf und erschauerte vor dieser wilden Schönheit.
»Fürchtest du dich?«, fragte ihn seine Mutter.
Hastig schüttelte er den Kopf. Sie stellte sich hinter ihn und schlang die Arme um seinen mageren Körper. Vor ihnen wuchs jäh das Sandsteinriff der Bastei empor, durch das sich eine lange Felsenbrücke zog.
»Wohin kommt man, wenn man da drübergeht?«, wollte Erwin wissen.
Dora erzählte ihm von der alten Felsenburg am Ende der Brücke, die nur noch eine Ruine war und in der vor langen Zeiten Raubritter gehaust hatten. Sie flüsterte ihm die Sage von der zur Steinsäule erstarrten Jungfrau Barbarine ins Ohr, die dazu verdammt war, auf ewig in das Tal der Elbe zu blicken. Ein wohliger Schauer lief Erwin über den Rücken. Es schien ihm, als würde seine Mutter aus einem Märchenbuch vorlesen, dessen lebende Illustrationen an ihm vorbeigetragen wurden.
Der Bootsmann läutete die Glocke und kündigte die nächste Station an: »Bad Schandau!«
Während der Dampfer auf dem Fluss drehte und dabei geschickt die Strömung nutzte, brachte Dora, nur für Erwin, eine eigene Tasse Malzkaffee und ein Stück Eierschecke. Der Junge schlürfte mit seligem Lächeln und erklärte, dass er den Kuchen lieber für die Großeltern mitnehmen würde. Er machte sich Sorgen, weil er ihnen die Alleinfahrt nach Dresden verschwiegen hatte. Seine Mutter strich ihm über den Kopf. »Zu viel Ehrlichkeit bringt einen bloß in die Bredouille«, behauptete sie. Dann holte sie ein weiteres Stück Kuchen für ihre Schwiegereltern, eingewickelt in eine Seite des Fahrplans vom Vorjahr.
Während der Rückfahrt durfte Erwin, erschöpft von den vielen Eindrücken, in der Bettkammer des Maschinisten ruhen. Nun schuldete Dora dem Mann einen Gefallen, den er sicher in der folgenden Nacht einlösen würde. Im Dämmerschlaf hörte der Junge das Schnaufen der Maschine, das Aufgehen und Zuschlagen der Feuertüren und das rhythmische Geräusch des Wassers, das von den Schaufelrädern zerteilt wurde.
Die Kammer hatte eine Durchreiche zur Küche, durch die sonst der Maschinist auf bequeme Art sein Leichtbier bekommen konnte. Immer, wenn Dora an diesem kleinen Fenster vorbeiging, streckte sie ihre Hand hindurch und suchte tastend nach Erwins Kopf auf der Pritsche.
Als sie den Jungen weckte, weil er bald aussteigen musste, begann er zu weinen. Er machte sich steif, als wäre er wie die Barbarine in Sandstein verwandelt worden. Dora versprach: »Wenn du tapfer bist, habe ich ein Geschenk für dich.«
Erwin, der in seinem Leben noch nicht viel geschenkt bekommen hatte, ließ sich sofort bestechen. Er putzte seine Nase und guckte erwartungsvoll.
Aus ihrer Schürzentasche holte Dora ein Matrosenmesser. »Das hat einmal deinem Vater gehört«, erklärte sie.
Erwins Augen begannen zu glänzen. Sein Vater, mit dem er lediglich eine blasse Erinnerung verband, interessierte ihn nicht besonders. Aber das Messer! Es fühlte sich glatt an und hatte einen hölzernen Griff mit Stiften aus Eisen.
»Das Holz ist aus Afrika«, sagte seine Mutter.
Mit dem Fingernagel fuhr Erwin in die kleine Kerbe der Klinge und holte sie heraus. In den Stahl war ein liegender Löwe mit struppiger Mähne eingeprägt. Dora klappte das Messer wieder zusammen, ermahnte ihn, vorsichtig damit umzugehen, und legte es in seine Hände. Durch dieses kostbare Geschenk fiel Erwin der Abschied nicht mehr ganz so schwer.
Seine Mutter kaufte für ihn in der kleinen Blockhütte am Terrassenufer ein Kinderbillett und brachte ihn zu einem Raddampfer, der die untere Fahrstrecke talwärts nehmen würde.
»Vergiss bloß nicht, in Kötzschenbroda auszusteigen!«, schärfte sie ihm beim Abschied ein.
»Wär doch nicht schlimm.« Er winkte ab. »Dann fahre ich eben weiter bis Meißen. Von dort bringt mich der Dampfer ja wieder nach Kötzschenbroda.«
Sie schüttelte den Kopf: »Der kommt heute nicht zurück. Der fährt hinter Meißen weiter.«
Erwin riss verblüfft die Augen auf. »Es geht dahinter noch weiter?« Er konnte das kaum glauben.
»Natürlich. Der Dampfer fährt heute nach Riesa und dann weiter bis Torgau. Also verpass den Ausstieg nicht.« Scherzhaft fügte seine Mutter hinzu: »Sonst landest du noch in Hamburg.«
»Und was kommt nach Hamburg?«, fragte er abenteuerlustig. Schließlich hatte er ein Matrosenmesser in der Hosentasche.
Sie lächelte. »Von dort geht es weiter in die ganze große Welt, bis nach Afrika.«
Erwin verpasste den Halt in Kötzschenbroda nicht.
Als seine Großeltern fragten, wie ihm die Dampferfahrt gefallen habe, wusste er nicht, was er antworten sollte. Beschrieb er den Tag so, wie er gewesen war, in all seiner Herrlichkeit, würden sie traurig sein. Machte er den Ausflug schlecht, ließen sie ihn so etwas vielleicht niemals wiederholen. Also sagte er bloß mit kratziger Stimme: »Ich hab euch was mitgebracht«, und stellte den Kuchen auf den Tisch. Mehr bekamen sie nicht aus ihm heraus.
Mit dem Löwenmesser in der Hosentasche huschte Erwin aus der Küche und versteckte es bei seinen anderen Schätzen. Das waren kleine Kieselsteine, Angelhaken, Werbemarken und ein Perlmuttknopf. Der Junge besaß weder ein eigenes Fach und erst recht keinen Schrank ganz für sich allein. All seinen Besitz stopfte er in die Ritze zwischen den Matratzen seiner Großeltern, sodass er nachts darauf schlief.
Als er später im Bett lag, tasteten seine Finger in den Spalt unter ihm. Er spürte das Edelholz des Griffes, das aus dem fernen Afrika gekommen war. In diesem Moment beschloss Erwin, dass er und sein Löwenmesser eines Tages mit einem großen Schiff auf der Elbe bis Hamburg fahren würden. Und von dort weiter übers Meer in die Welt bis nach Afrika.
3. Reise in die Vergangenheit
April 2019 in Poole (England)
Henri hatte das Schiff zum ersten Mal als kleiner Junge an der Hand seines Vaters Erwin betreten. Und wie damals fürchtete er auch jetzt, irgendetwas könnte dazwischenkommen. Irgendjemand, der einen schlechten Tag hatte, könnte ihm die Reise am Ende noch verbieten.
Bei den Kontrollen und Sicherheitsüberprüfungen schwitzte er und überließ alles Simone. Sie scherzte mit den Beamten und gab anschließend ihr Gepäck erneut auf. Sein Löwenmesser war nicht beanstandet worden. Doch noch immer befanden sie sich nicht an Bord.
Sie liefen vom Terminal zum Kai. Auf der einen Seite ihres Weges schaukelten Yachten in der Marina. Auf der anderen versperrten ihnen Lagerhallen mit Blechwänden und Kiesberge die Sicht. Dahinter ragte ein Kran hervor, der ein angedocktes Containerschiff entlud. Das Dröhnen schwerer Maschinen mischte sich mit dem klagenden Geschrei der Möwen.
Auf tonnenschweren Stahlpfählen ragte der South Quay in das Hafenbecken hinein, wie eine Autobahn, die unvermittelt im Wasser endete. Dahinter lag die Astoria. Die Nachmittagssonne ließ die Konturen des scharf geschnittenen Eisbrecherbugs hervortreten. An ihrem Mast flatterte der Blaue Peter, die Signalflagge, die das baldige Auslaufen ankündigte.
Der Kraftstoff war gebunkert, die Trinkwassertanks aufgefüllt. Fünf Tonnen Fleisch und Fisch lagerten im Kühlraum. In den Laderäumen standen Kisten mit zwanzigtausend Eiern, Fässer mit dreitausend Litern Wein, ganze Paletten mit Mehl, Kartoffeln, Obst, Nudeln und allem, was man brauchte, um nahezu neunhundert Menschen mit verschiedenen Vorlieben fast zwei Wochen lang versorgen zu können.
Vor der Gangway des Kreuzfahrtschiffes warteten Passagiere in einer nach britischen Maßstäben geordneten Schlange. Die Abstände zwischen ihnen waren perfekt, nicht zu dicht und nicht zu locker. Henri überschaute die Reihe der Köpfe vor ihm und musterte schütteres graues Haar, Glatzen, weißes Kraushaar und einen bleistiftdünnen Herrenzopf. Ernüchtert beugte er sich zu Simone und flüsterte: »Das sind ja lauter Rentner.«
»Wir sind auch Rentner«, erinnerte sie ihn und amüsierte sich über sein verdutztes Gesicht.
Sie bat ihn, sich in Position zu stellen, und versuchte mit ihrem Telefon ein Foto zu machen, auf dem sowohl er als auch das Schiff vorteilhaft wirkten. Mit Blick auf den kleinen Bildschirm dirigierte sie ihn ein Stück zur Seite, dann schien sie zufrieden zu sein.
»Das muss ich den anderen zeigen«, sagte sie und veröffentlichte das Bild im Ehemaligenforum im Internet.
Über einen digitalen Stammtisch hielt sie die Verbindung zu früheren Besatzungsmitgliedern der Völkerfreundschaft. Längst waren sie in alle Winde zerstreut. Und doch trafen sie sich einmal im Jahr, um Erinnerungen an dieses Schiffauszutauschen, das so viel mehr als nur ein Arbeitsplatz gewesen war.
Nach wenigen Momenten zeigte Simones Telefon erste Reaktionen an. Ehemalige Matrosen und Stewardessen, Köche, Funker, Friseure, Kellner und Krankenschwestern kommentierten aus der Ferne das Bild von Henri vor der V1, wie sie die Völkerfreundschaft damals ironisch genannt hatten.
Die Warteschlange bewegte sich nur schrittweise vorwärts. Plötzlich griff Simone entsetzt nach seinem Arm. »Ich hab Coco vergessen!« Sie wirkte, als wäre sie kurz davor umzukehren.
Henri konnte sie beruhigen. »Der geht’s gut. Ich hab das Rollo hinter ihr oben gelassen, damit sie Licht kriegt. Und Wasser bekommt sie aus einer großen Flasche, die ich in die Erde gesteckt habe.«
Coco war eine Paradiesvogelblume. Henri hatte die Grünpflanze auf ihrer ersten gemeinsamen Fahrt mit diesem Schiff an einem Strand für Simone ausgegraben. Das war in den Siebzigern gewesen, und Coco besaß mittlerweile enorme Ausmaße.
Erleichtert dankte Simone ihm, und Henri winkte ab. »Ehrensache.« Manchmal fiel es ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Aber was zu tun war, wusste er immer.
Die Pforte für die Passagiere befand sich mittschiffs und nicht mehr achtern. Als sie endlich die Gangway erreichten und hinaufstiegen, zitterten die Metallstufen unter ihren Füßen. Die Erschütterung übertrug sich auf Henris Körper. Er blieb stehen, berührte den Handlauf und versuchte herauszufinden, ob dies die alte Gangway war. Hinter ihm wurde geduldig darauf gewartet, dass er weiterging.
Im Inneren erinnerte nichts mehr an das alte Oberdeck. Weißer und schwarzer Marmor, Messinggeländer und gedämpftes Licht aus Einbaustrahlern erzeugten den Eindruck eines prestigebemühten Hotels. Ein roter Teppich wies ihnen den Weg zur Rezeption, wo eine Reihe adrett uniformierter Stewardessen wartete.
Eine davon begleitete sie zu ihrer Kabine. Unterwegs erklärte sie, wo sich Restaurants und Bars befanden. Henri hörte nicht zu, er glaubte, sich auszukennen.
Die langen, engen Gänge waren mit Teppich ausgelegt, der ihre Schritte dämpfte. Henri fiel ein, wie er hier einmal das Linoleum mit Bohnerwachs hatte wienern müssen, weil er eine Verfehlung von Simone auf sich genommen hatte.
Sie schien sich ebenfalls daran zu erinnern, denn beim Blick auf den Fußboden sagte sie: »Nun braucht hier keiner mehr zu bohnern.«
Obwohl das Schiff von Grund auf umgebaut und verändert worden war, stießen sie immer wieder auf Spuren der Vergangenheit. Das Messinggeländer war an einer Wandseite abgeschraubt worden. Auf der anderen Seite glänzte es umso mehr als Relikt einer längst erloschenen Ära. Er legte seine Hand darauf und sagte feierlich: »Ich bin zurück.«
Ihre Kabine befand sich auf der Pacific-Ebene, dem ehemaligen A-Deck. Die Stewardess zeigte ihnen, wo die Rettungswesten lagen, und wies auf das Rauchverbot hin. Dann ließ sie sie allein.
Simone und Henri sahen sich um. Der beengte Raum war in Blau gehalten, und an der Wand hing der kitschige Kunstdruck eines griechischen Tempels. Es gab eine Klimaanlage, einen Fernseher, und die Betten wurden durch einen Nachttisch voneinander getrennt.
»Wenigstens ist es kein Doppelstockbett«, sagte Simone. Sie öffnete eine kleine Tür und stellte erfreut fest: »Wir haben ein eigenes Bad! Erinnerst du dich an unsere Gemeinschaftsklos? Die waren ständig verstopft.«
»Nur eure«, behauptete er. »Die von den Männern nie.«
Er räumte um und schob die beiden Betten nebeneinander. Simone zog eine Gardine zur Seite, durch die ein Lichtkreis hindurchschimmerte. Ein Bullauge kam zum Vorschein, und Sonnenlicht flutete herein. Henri fuhr mit dem Finger in eine der Metalllaschen. Er zog daran, und die Scheibe klappte nach oben weg. Die Details der alten Messingumfassung zeugten vom besonderen ästhetischen Sinn des Konstruktionszeichners.
Feuchte Luft drang in die Kabine, und sie blickten hinaus. Vor ihnen breitete sich der Upton Lake aus, der hinter Brownsea Island ins Meer mündete. Über den Bäumen der Insel sammelten sich Vogelschwärme wie kleine schwarze Wolken.
Aus dem Lautsprecher tönte eine freundliche Einladung ans Buffet im Panoramarestaurant. Simone verschloss das Bullauge wieder, und sie machten sich auf den Weg. Doch dort, wo in ihrer Erinnerung eine Treppe hätte sein müssen, ging es nicht weiter. Sie versuchten, sich an einer glänzenden Tafel aus Chrom und Plexiglas zu orientieren. Ihr einziger Anhaltspunkt war der Außenpool, der sich damals auf dem Oberdeck befunden hatte und jetzt auf der Calypso-Ebene verzeichnet war.
Der alte Treppenaufgang war durch ein Atrium ersetzt worden, in dessen Zentrum sich eine blau schimmernde Säule aus mundgeblasenem Glas befand. Helixförmige Treppen führten links und rechts hinauf zum Calypso-Deck. Der Aufgang mutete utopisch an, als würde er direkt in die Zukunft führen. Es war nicht das, was sich Henri erhofft hatte.
Die Kombüse hatte stilvolle Canapés mit Meeresfrüchten zubereitet. Vor Nervosität bekamen sie kaum etwas herunter und stellten ihre halbvollen Handteller bald wieder ab. Sie wollten lieber ins Freie und drängten sich durch die Menschenmassen hinauf zum Promenadendeck auf der Bugseite.
Henri drehte sich um und betrachtete das Schiff. »Ich glaube, die haben die Brücke versetzt«, stellte er fest.
An der Reling entlang liefen sie nach achtern. Sie betraten einen halbrunden Steg, den es früher nicht gegeben hatte und der über dem darunterliegenden Deck zu schweben schien. Unten aus dem Pool stiegen Dampfschwaden auf.
»Es ist schön geworden«, sagte Henri, aber er klang nicht überzeugt. Er vermisste den Charme, den das Schiff ausgestrahlt hatte, diese unverwechselbare Mischung aus skandinavischer Eleganz und pragmatischem Sozialismus.
Unter ihnen spielte die Bordkapelle in der Bar Sweet Dreams. Prüfend blickte er Simone an.
»Was ist denn?«, fragte sie und kontrollierte, ob die Knöpfe ihrer Jacke in der richtigen Ordnung geschlossen waren.
»Nichts weiter.« Er strich über das kleine Muttermal unter ihrem linken Auge. Henri hatte bei ihr nach Spuren gesucht, die ihn, wie das Messinggeländer und das alte Bullauge, an die Vergangenheit erinnerten.
Wolken zogen auf, und der Himmel dahinter leuchtete violett. Dreizehenmöwen segelten mit dem Wind über das Schiff hinweg. Ihre Flügelspitzen schienen in schwarze Tinte getaucht zu sein. Die Flut hatte ihren Höhepunkt erreicht.
Unten begannen die Vorbereitungen zum Auslaufen, und ein Hafenlotse kam an Bord. Die Leinen, die mit Winden festgezogen worden waren, wurden gelockert, damit sie von den Pollern gelöst werden konnten. Eine Durchsage kündigte das Ablegen an.
Simone blickte suchend auf den Kai. »Gibt es hier keine Hafenkapelle?«
In diesem Moment erdröhnte über ihnen das gewaltige Schiffshorn, und Vögel stoben auf. Die Astoria nahm Abschied vom Hafen.
Zu Henris Erstaunen fuhren sie ohne Schlepper los, nur begleitet vom Lotsenboot. Sie lehnten sich an die Reling und sahen hinab. Vor ihnen ragten die Spitzen von Stone Island aus dem Wasser, die von der Flut überspült wurden.
»Das wird nichts«, sagte Henri plötzlich. »Die Strömung ist zu stark. Die drückt uns auf die Felsen.«
Das Schiff schaffte das Eindrehen in den Kanal nicht, der aus dem Hafen hinausführte. Das Heck driftete quer zur Fahrrinne.
In nächsten Moment fiel am Bug der Backbord-Anker, die Eisenkette polterte mit gewaltigem Lärm aus dem Kettenkasten. Durch die Astoria ging ein Ruck, und lautes Knirschen und Schaben war zu hören.
»Hatten wir etwa Grundberührung?«, fragte Simone entsetzt.
Henri beugte sich über die Reling. »Der Anker hat nur den Kurs gestoppt. Wir werden gegen die Kette gedrückt.«
In diesem Moment tönte auch schon die beruhigende Stimme des Kapitäns aus den Lautsprechern. Es handele sich lediglich um ein Routinemanöver, und deshalb bestehe kein Grund zur Sorge.
Die Astoria trieb weiter und drehte sich, durch den Anker in Position gehalten.
Simone fächelte sich mit den Händen Luft zu. »Ich hatte gerade Panik, dass im letzten Moment etwas dazwischenkommt.« Sie sprach aus, was Henri dachte.
Noch immer versuchte das Schiff, den Kurs zu ändern. Er lehnte seinen Körper nach backbord, als könnte er dadurch die Bewegung des stählernen Riesen beeinflussen.
Die Astoria hörte auf, sich zu drehen, und fuhr mit gesenktem Anker vorwärts, um den Kurs weiter zu korrigieren.
Dann wurde der Anker gehievt, und sie verließen endlich den Hafen, vorbei an der Halbinsel Sandbanks. Dort hatte das Manöver zahlreiche Schaulustige angezogen. Nun, wo das große Kreuzfahrtschiff die Drehung geschafft hatte und aufs offene Meer hinausfuhr, jubelten sie.
Die Passagiere winkten zurück. Übermütig beugte sich Simone über die Reling und schrie: »Wir sind frei!«
Zum ersten Mal seit Beginn dieser Reise lächelte Henri. So lange hatte er auf diesen Moment gewartet.
Innerhalb kurzer Zeit verloren sie das Land aus den Augen. Es verschmolz mit der Dämmerung und löste sich darin auf. Sie liefen an der Reling entlang zum Bug und blickten nach Westen. Am Horizont war nur noch ein blutroter Schimmer zu sehen, der sich in den Wolken spiegelte. Vor ihnen breitete sich Dunkelheit aus, und die Kugellampen über dem Promenadendeck flammten auf. Sie waren ebenfalls neu und gehörten nicht hierher.
Allmählich wurde es kalt und windig, doch sie blieben an der Reling stehen und konnten sich von diesem Anblick nicht losreißen. Das Meer unter ihnen hatte sich in eine schwarze wogende Masse von furchteinflößender Schönheit verwandelt, mit all den verborgenen Kreaturen in der Tiefe.
»Mein Vater hatte ein Buch«, erzählte Henri, »darin waren Riesenkraken abgebildet, die ganze Schiffe umklammerten.«
»Die sind uns zum Glück nie begegnet«, sagte Simone. »Nur kleine Tintenfische. Und für die war ich das Seemonster.« Instinktiv roch sie an ihren Händen, aber sie dufteten nach der Magnolienseife aus ihrer Nasszelle.
Ein Steward ging mit einem Tablett voller Cocktailgläser herum und lud sie auf ein Begrüßungsgetränk ein. Sie griffen zu, schließlich war es im Preis inbegriffen.
»Auf meinen Vater«, sagte Henri.
Simone ließ ihr Glas gegen seines klingen. »Auf Erwin, der das Meer und dieses Schiff auch so geliebt hat.«
4. Eisberg in Sicht
August 1939 in Kötzschenbroda (Deutschland)
Erwin umklammerte die eiserne Reling. Das Schiff, auf dem er stand, war leuchtend rot mit einem gelben Wellenstrich auf dem Rumpf. Der Junge neigte sich nach vorn. Wie von einer riesigen Woge wurde er in die Höhe getragen. Er schloss die Augen und stellte sich vor, inmitten wilden Wassers zu sein. Er konnte die Freiheit riechen. Sie duftete nach Würstchen, Zuckerwerk und Honigkuchen. Als die Schiffsschaukel zurückschwang, jauchzte er vor Freude. Seine Jubelrufe gingen im Lärm der Vogelwiese unter.
Erwin fühlte sich unermesslich reich. In seiner linken Hosentasche klimperten ein paar Groschen, die ihm seine Mutter Dora zugesteckt hatte. Der Wind fuhr unter sein Hemd und blähte es auf. Immer stärker holte er Schwung, noch höher schaukelte er. Dann schellte ein Glöckchen, und die Fahrt mit der Schiffsschaukel war vorüber.
Benommen kletterte er aus der Gondel. Unten wartete sein Freund Klaus, der im Haus schräg gegenüber wohnte. Abenteuerlustig hielt er nach einem weiteren Vergnügen Ausschau. »Los! Zur Berg-und-Tal-Bahn!«
Neben dem Bootshaus am Elbufer rasten Wagen mit kreischenden Insassen in halsbrecherischem Tempo über ein Holzgerüst.
»Tut mir leid«, sagte die Frau hinter dem Kassenhäuschen bedauernd. »Das ist nur für Große.«
»Wir sind groß!«, entrüstete sich Klaus.
Erwin bestätigte mit wichtiger Miene: »Wir sind schon fast acht.« Aber es nützte ihnen nichts.
Sie drängten sich durch die Menschenmassen, vorbei an bunten Zelten und Ständen. An einer Losbude konnte man an Bindfäden gebundene Gewinne ziehen. Der Duft von fein gesponnener Watte aus Zucker mischte sich mit dem Kohlequalm eines Dampfkarussells, um dessen Schornstein sich rotgolden glänzende Holzpferde drehten. Ein Ausschreier wollte ihnen Hosenträger aufschwatzen, dudelnde Blechmusik konkurrierte mit der Schützenhauskapelle, und eine kratzige Lautsprecherstimme pries saure Gurken an. Und während Klaus eine spitze Tüte, gefüllt mit grünen Maiblätterbonbons, kaufte und jedes Fahrgeschäft vom russischen Riesenrad bis zum Hippodrom ausprobierte, blieb Erwin der Schiffsschaukel treu. Wenn er hinaufschwang, stellte er sich vor, gleich in Afrika anzulegen. Sobald es abwärts ging, bildete er sich ein, auf dem Rückweg nach Kötzschenbroda zu sein.
Als das Glöckchen wieder das Ende der Fahrt ankündigte, kletterte er benommen aus der Gondel.
Klaus teilte ihm mit: »Ich bin pleite.«
Auch Erwin blieb nur ein kläglicher Rest. Den wollte er aber nicht für eine Vergnügung oder eine Tüte mit Naschwerk ausgeben, sondern für etwas Unvergängliches. Sein Blick fiel auf ein Regal mit Gewinnen hinter dem Glücksrad. Und plötzlich wusste er genau, was er von diesem herrlichen Tag mit nach Hause nehmen wollte.
Er gab sein letztes Geld der Frau am Glücksrad, in deren Mundwinkel eine qualmende Salem klemmte. Mit seinem ganzen Gewicht hängte sich Erwin an den Drehgriff, der Lederzeiger knatterte an den Metallstäben vorbei und blieb auf einem blauen Feld stehen.
Die Alte schwenkte ihre Handglocke. »Und schon wieder haben wir einen Gewinner!«, plärrte sie über den Platz. Sie deutete auf das Regalfach hinter sich. »Such dir was aus.«
»Nimm die Knallbüchse!«, drängte Klaus und zeigte auf eine vernickelte Spielzeugpistole mit Zündplättchen.
Aber Erwin hatte etwas viel Besseres in diesem Sammelsurium aus Holzschiffchen, kleinen Massefiguren und Blechautos entdeckt.
»Das da!«, rief er aufgeregt und zeigte auf eine leuchtend rote Mohnblume zum Anstecken.
Klaus guckte ihn entgeistert an. »Was willst du denn mit so einem Mist?«
»Die bring ich meiner Mutti mit«, erklärte Erwin.
Zwei Tage und damit eine Ewigkeit dauerte es, bis Erwin seiner Mutter die Ansteckblume endlich schenken konnte.
An diesem Tag hatte der Dampfer einen etwas längeren Aufenthalt in Kötzschenbroda. Die Bootsleute mussten Speditionsgut an Bord bringen, und Dora konnte für ein paar Minuten aussteigen.
Erwin lief ihr auf der Landungsbrücke entgegen und versteckte das kostbare Geschenk hinter dem Rücken. Sie merkte seinem angespannten Gesicht sofort an, dass etwas anders war als sonst.
»Was hast du denn?«, fragte sie bang.
Mit einer Bewegung, die er sich bei einem Magier in der Schaubude abgeguckt hatte, holte er die Blume hervor. »Ich hab dir was von der Vogelwiese mitgebracht.«
Vor Überraschung stieß seine Mutter einen kleinen Schrei aus und drückte ihn fest an sich. Inzwischen hatte er genau die Größe erreicht, bei der sein Ohr auf ihrer weichen Brust lag. Er konnte ihr Herz vor Aufregung wild schlagen hören.
Sie löste sich von ihm und nahm die Mohnblume mit zitternden Fingern entgegen. »Ich habe noch niemals so etwas Schönes bekommen«, flüsterte sie.
Andächtig betrachtete sie Erwins Geschenk. So täuschend echt sah die Blüte aus, dass sie unwillkürlich daran roch. Aber sie bestand aus Seide und Draht, mit kunstvoll eingeprägten Blattadern und filigranen Staubgefäßen.
»Steck sie mal an«, forderte Erwin.
Als die Blume den Ausschnitt ihrer Schürze zierte, strahlte er. Seine Schneidezähne waren ungleich lang und viel zu groß für das Kindergesicht. Dora entdeckte winzige Sommersprossen auf dem Nasenrücken, hervorgelockt von der heißen Sonne der letzten Tage.
»Warum hast du denn Geld für mich ausgegeben?«, sagte sie vorwurfsvoll. »Du solltest doch selbst recht viel Spaß auf der Vogelwiese haben.«
»Ich hatte viel Spaß!«, versicherte Erwin und berichtete von seiner wilden Fahrt mit der Schiffsschaukel.
Dora staunte. »Hat dir das gar nichts ausgemacht? War dir nicht schwindelig dabei?«
Stolz schüttelte er den Kopf. »Nee! Das war ein Heidenspaß!«
Sie strich ihm durchs Haar und stellte fest: »Aus dir wird einmal ein furchtloser Seemann.«
In diesem Moment läutete die Schiffsglocke. Das Stückgut war verstaut. Dora nahm ihren Jungen bei den Ohren und beugte sich zu seinem Gesicht herab.
»In der kalten Saison, wenn der Sommer vorbei ist, werden wir jeden Tag beisammen sein«, versprach sie. »Dann machen wir uns eine herrliche Zeit.«
Sie küsste ihn zum Abschied auf die rissigen Lippen und eilte über die Planke, die weggezogen wurde, kaum dass ihre Füße das Deck erreicht hatten.
Erwin beobachtete, wie der Schiffsjunge unter dem kritischen Blick des Bootsmannes versuchte, das Hanfseil vom Poller zu lösen.
»Was muss man denn lernen, um Schiffsjunge zu werden?«, rief Erwin ihnen zu.
Der Bootsmann grinste. »Knoten musste können«, lautete die spöttische Antwort.
Rauch quoll aus dem schlanken Schornstein des Diesbar, und die Schaufelräder wirbelten das Wasser auf, sodass es gurgelte und schäumte. Der Dampfer reihte sich vor einen Äppelkahn ein, der sich mit der Apfelernte eines böhmischen Obstbauern bis Hamburg treiben ließ.
Erwin rannte auf den Elbwiesen ein Stück neben dem Dampfschiff her und winkte. Dora beugte sich über die Reling und streckte die Arme nach ihm aus. Wie ein blutroter Fleck leuchtete die Mohnblüte in ihrem Dekolleté.
Nachdem der Dampfer durch das Talfahrerjoch der Niederwarthaer Brücke verschwunden war, wartete Erwin, bis sich die dunklen Kohlequalmwolken aufgelöst hatten. Dann trottete er zurück, vorbei an der Restauration Dampfschiff, an deren Terrassenspalier die Trauben reiften. Er blickte hinauf zur Eiche über der Anlegestelle, ob nicht schon ein gelbes Blatt den Herbst ankündigte. Er konnte das Ende dieses Sommers kaum erwarten.
Als er zu Hause in den Garten kam, spannte seine Großmutter eine Leine zwischen den Wäschepfählen. Erwin machte sich nützlich und reichte ihr Holzklammern zu. Gemeinsam hängten sie die gestärkten Apothekerkittel auf, die von der Sonne gebleicht werden sollten. Kurz darauf begann die Großmutter in der Küche Stachelbeeren einzukochen.
Erwin schlich hinter ihrem Rücken in die Schlafstube. Aus der Bettritze fischte er sein Löwenmesser und schmuggelte es nach draußen. Zuerst schnitzte er am Weißdorn herum und ritzte unten in den Stamm ein M, wie Mutti. Dann säbelte er das vom Wäschepfahl herabbaumelnde Ende der Leine ab. Für den Rest des Nachmittags übte er im Schatten des alten Baumes Fantasieknoten und testete deren Haltbarkeit.
Am Abend, als die Großmutter erst die Wäsche und dann die Leine abnahm, bemerkte sie den ausgefransten Zipfel. Grimmig machte sie einen Knoten hinein und schlug Erwin mit dem Seilende auf das Hinterteil. Er biss die Lippen zusammen und tat zerknirscht, aber im Geheimen bereute er nichts. In seinen Augen hatte er einen passablen Seemannsknoten zustande gebracht. Damit war er seinem großen Ziel wieder ein Stück näher.
An einem trüben Freitagnachmittag im September, kurz bevor die Hauptsaison für die Elbdampfer endete, saß Erwin in der Küche bei den Schulaufgaben. In seinem Bauch breitete sich das beängstigende Gefühl aus, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Lehrer hatten auf den Gängen getuschelt, und seine Großmutter hatte ihn beim Heimkommen mit einem ungewöhnlich milden Blick bedacht.
Seitdem saß sie an der Nähmaschine und sagte keinen Ton. Mit grimmigem Nachdruck bewegten ihre Füße das Schwungpedal. Die auf und nieder tanzende Nadel stanzte Linien in schwarze Stoffbahnen.