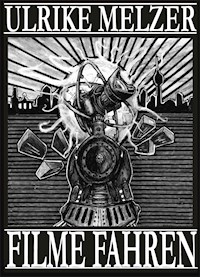
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Filme fahren
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1996 begegnen sich in Berlin sechs Menschen unterschiedlicher Generationen. Die gemeinsame DDR-Vergangenheit wirkt als verbindendes Element zwischen den jeweils sehr speziellen Charaktere,noch wichtiger ist der Wunsch der Protagonisten nach einem selbstbestimmten Leben. Hauptfigir ist die 17jährige Rena, die mit ihren Freunden auf der Suche nach kreativer Selbstverwirklichung und Liebe ist. Der Leser begleitet die Protagonisten bei ihrer Reise durch das Berlin der späten 1990er: Technoclubs und Kreuzberger Bars, WG-Küchen und Lesebühnen, Sekten und Hip-Hop-Jams, verschiedene Subkulturen, Liebeskummer und Drogenerfahrungen, hin zur eigenen Geschichte und Identität. Ob das Leben einem Film gleicht, den wir selbst oder andere für uns drehen, ist die zentrale Frage des Romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Melzer
Filme fahren
Eine urbane Odyssee zur eigenen Identität
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Feiern - Prolog
Feiern - Kapitel 1
Feiern - Kapitel 2
Feiern - Kapitel 3
Feiern - Kapitel 4
Feiern - Kapitel 5
Feiern - Kapitel 6
Feiern - Kapitel 7
Feiern - Kapitel 8
Feiern - Kapitel 9
chillout - Kapitel 1
chillout - Kapitel 2
chillout - Kapitel 3
chillout - Kapitel 4
chillout - Kapitel 5
chillout - Kapitel 6
chillout - Kapitel 7
chillout - Kapitel 8
chillout - Kapitel 9
chillout - Kapitel 10
chillout - Kapitel 11
chillout - Kapitel 12
chillout - Kapitel 13
chillout - Kapitel 14
chillout - Kapitel 15
chillout - Kapitel 16
chillout - Kapitel 17
Runterkommen - Kapitel 1
Runterkommen - Kapitel 2
Runterkommen - Kapitel 3
Runterkommen - Kapitel 4
Runterkommen - Kapitel 5
Runterkommen - Kapitel 6
Runterkommen - Kapitel 7
Runterkommen - Kapitel 8
Runterkommen - Kapitel 9
Runterkommen - Kapitel 10
Runterkommen - Kapitel 11
Runterkommen - Kapitel 12
Runterkommen - Kapitel 13
Runterkommen - Kapitel 14
Runterkommen - Kapitel 15
Runterkommen - Kapitel 16
Runterkommen - Kapitel 17
Runterkommen - Kapitel 18
Runterkommen - Kapitel 19
Runterkommen - Kapitel 20
Runterkommen - Kapitel 21
Runterkommen - Kapitel 22
Runterkommen - Kapitel 23
Runterkommen - Kapitel 24
Runterkommen - Kapitel 25
Runterkommen - Kapitel 26
Runterkommen - Kapitel 27
Runterkommen - Kapitel 28
Runterkommen - Kapitel 29
Runterkommen - Kapitel 30
Runterkommen - Kapitel 31
Runterkommen - Epilog
Impressum neobooks
Feiern - Prolog
In letzter Zeit stelle ich mir immer vor, wie es wäre, bei einem Anschlag zu sterben.
Beim Einkaufen, im Kino, oder während ich, so wie jetzt, im Café sitze und Latte Macchiato trinke, oder Moccacino, oder ein anderes, albernes Getränk, das so tut, als wäre es Kaffee.
Während ich meine Freundin Rebecca treffe, die ich jede Woche zur gleichen Zeit im immer gleichen Café sehe, mit der ich Floskeln austausche, die sich nicht ändern.
Jeder Exzess geplant, jede Geste berechnend.
Ich berichte von meinem spannenden Leben.
Ein Anschlag, ein Attentat, ein Amoklauf, während ich ihr erzähle, was ich noch so plane und vorhabe und mich frage, ob ich meine unzähligen Kräutertöpfe gegossen habe.
Ich schwärme ihr vor, von diesem netten Job, bei diesem neuen Magazin.
Irgendwie Musik, Kunst, Lifestyle.
Ob es nächstes Jahr noch existieren wird, wissen wir nicht.
Und dass ich noch meine Anlage für Selbstständige ausfüllen muss, lasse ich weg. Hartz vier ist was für die Assis aus Erfurt Nord, also die aus den ehemaligen Arbeiterintensivhaltungen, der Platte.
Alle "stocken" auf, die Studenten, die keinen Job gefunden haben, doch sie reden nicht darüber, hier am Anger mit Blick auf den Dom.
Ich rede von meinem netten Freund Phillip, der irgendwas mit Medien studiert hat, mir ständig von einem neuen Plan erzählt.
Ich höre nie hin, nicke nur und gebe ihm Bestätigung, das scheint ihm zu genügen. Jedenfalls wird er bald durchstarten, sicher.
Und ich nehme noch einen Schluck vom Latte, der jetzt lauwarm ist, so wie mein Leben, und weiß, so wie meine Bluse, die so tut, als wäre sie ein Kleid.
Ich lächele ins Leere und dann explodiert alles.
Dieses Leben, das ich seit 2003 in dieser mittelgroßen Stadt gelebt habe, hat keine Richtung, keine Aussage.
Meine Vorstellung von Leben war mal anders.
Ich weiß nicht, woher meine Begeisterung für Filme kam.
Schon als Kind stellte ich mir vor, meine Augen wären eine Kamera, mit der ich alles filme.
Die Pioniernachmittage, den Fahnenappell, die fanatischen Augen von Frau Möller.
Sogar die eigene Angst davor.
Sie hatte mich gefragt, ob ich dazugehören möchte, zum Kollektiv.
Einfach diese Szenen rausschneiden, dachte ich, das wär's gewesen.
Mit 17 fand ich Milosch, der all das kannte.
"Rena, das ist dein Film", sagte er. "Da kann dir niemand reinquatschen."
Er sagte, am Ende müsse ein guter Satz stehen, eine einzige Szene, die so gut ist, dass sie all den Schmerz, der vorher war, erklärt.
Milosch hat mir eine Facebook-Nachricht geschrieben.
Ich habe mich nur bei Facebook angemeldet, um von ihnen gefunden zu werden.
Von Milosch, Karen und all den anderen Gleichgesinnten, die plötzlich alle auf einmal da waren, wo vorher nur Einsamkeit gewesen war.
Wenn ich diese Geschichten höre, von der ersten Liebe, dann weiß ich nie, was ich sagen soll. Bei mir ging es nicht um eine Person. Es ging um 6 Menschen, und irgendwie auch um Berlin. Es ging um Freunde, eine selbstgewählte Familie.
Wenn ich diese Geschichten höre, denke ich trotzdem an einen ganz bestimmten Menschen.
Der, mit dem alles anfing. Ich denke an Niko.
Er hat Erfurt 1979 verlassen, ich wurde 1979 geboren. An einem Montag ist er losgefahren, hatte sich das Auto seines Bruders Walter geschnappt, den alle nur Wladi nannten.
Der brauchte es jetzt nicht mehr, denn er war im Stasiknast.
Wie hatte es so weit kommen können?
Diese verdammte Neugier war schuld, Neugier auf den echten Vater, einen russischen Offizier. Die Neugier auf das ganze Leben.
Das konnte man doch hier nicht haben.
Niko wusste das. Ihm war der russische Vater egal, doch er wollte weg von der Mutter Anna und dem falschen Vater Horst.
Sein Leben begann in Berlin. Dort redete er mit neuen Freunden. Er betete.
Niko wollte nicht mehr heimlich Joy Division Platten hören.
Der Staat eine dunkle Wolke, das Leben ein Traum, zur Passivität verdammt.
Das lag hinter ihm, das war vorbei, in Berlin begann etwas Neues.
Walter saß in der Dunkelzelle und Niko wollte wach bleiben für ihn.
Er hörte seine Mutter. "Kerzen anzünden, was soll das denn bringen?"
Horst guckt die aktuelle Kamera. Wischt sich den Bierschaum vom Bart.
Niko wollte nicht mehr zurück, nie mehr.
In Berlin war er der erste Mensch gewesen, der mir dieses seltsame, vertraute Gefühl gegeben hat, das ich bis dahin nicht kannte. Sein Blick war die Eintrittskarte in eine neue Welt gewesen.
Und jetzt schreibt er auf eine Facebook-Pinnwand.
Milosch hat uns eingeladen, zur Abschiedsparty unseres Clubs, dem Palace.
Wir haben dort gefeiert, Niko hat da gearbeitet.
Alina wird ein Konzert geben, Nikos Halbschwester.
"Alina hat es tatsächlich geschafft", schreibt er jetzt, als Antwort auf die Einladung.
Er schreibt nur als Gast. Leute die bei Facebook sind, sagt Niko, sind Selbstdarsteller.
Niko ist kein Selbstdarsteller, Niko ist Networker. Niko ist bei Xing.
Fassungslos ist er nun, dass sie es tatsächlich geschafft hat, seine verrückte Schwester, die zu MTV wollte. Ihre Videos laufen bei VIVA, na immerhin.
Im Sommer 1996 schien alles möglich, doch wenn man diese Möglichkeiten nicht zu schätzen weiß, verschwinden sie. Ich ging zurück nach Erfurt, Karen kam in die Psychiatrie, Milosch ins Gefängnis. Niko habe ich nicht wiedergesehen.
Ich war mir so sicher gewesen, sie alle nicht wiederzusehen.
Jetzt kommt mir alles so leicht vor. Ich müsste mich nur in den Zug setzen.
Wer sagt, dass ich zurück muss? Zurück zu Phillip, den ich nicht liebe, der mich nicht liebt. Er mochte mich, ich mochte ihn.
Ich mochte dieses Leben und wie einen zu großen Pullover ziehe ich es einfach aus.
Ich dachte, wir hätten uns verändert. Die ganze Welt hat sich verändert, doch wir nicht.
Wir waren nie cool. Wir waren Außenseiter, dabei, doch niemals drin, wir gehörten nicht dazu, wir saßen am Rand.
Ich könnte einfach gehen, mich in den Zug setzen und mich daran erinnern, wer ich einmal war.
Feiern - Kapitel 1
Ich saß im Zug und sah Eva nach. Sie wurde immer kleiner, verblasste. Ich hatte keine Angst, obwohl ich nicht wusste, was ich da tat. Eva und ich wollten den Sommer in Berlin verbringen, doch ich wusste, dass mir ein Sommer nicht reichen würde. Eva wollte Spaß, Party, Drogen. Ich wollte weg. Ich war bereit, ein Rucksack mit Geld von Oma Alicia unter dem Bett, denn wenn ich beim Feiern mit Eva die Leute treffen würde, die mich endlich wegbringen könnten aus dieser Stadt, die für mich nur ein großes Dorf war, wäre ich bereit. Kein Getratsche mehr, kein Rumhängen in Bars, keine halbe Rebellion durch Nirvana-Hören, Lucky-Strikes-Rauchen und Pseudo-Raves im Wald mit Steve und Alex.Keine halbe Liebe mit lieb haben, toll finden, sich gegenseitig zu Tode analysieren. Kein Kinderzimmer und Erinnerungen an Pioniertücher. Ich liebte meine Eltern.Trotzdem musste ich woanders sein. Ich sah aus dem Fenster, Eva war nicht mehr zu sehen.Zum ersten Mal saß ich allein in einem Zug.17 Jahre hatte ich nur mit anderen verbracht: Mit meinen Eltern, Eva, Steve und Alex.Dabei immer das Gefühl, das Leben, mein Leben, hätte noch gar nicht begonnen.Filme, in denen ich Nebenrollen spielte: Als Kind immer daran gewöhnt, nicht zu sagen, was ich dachte. Unser Klassenlehrer erzählte uns vom baldigen Krieg mit dem Klassenfeind, Frau Meier machte sich lustig, weil meine Eltern in die Kirche gingen und ich das blaue Tuch nicht wollte. An „besonderen“ Tagen Fahnenappell, der Pioniergruß: All das hatte nichts mit mir zu tun.Eine graue Decke hing über uns.Lager wurden gebaut, Umerziehungsheime für Christen und andere Staatsfeinde.Meine Eltern waren Christen, sie mochten den Staat nicht.Zuhause konnte ich reden, in der Schule war Schweigen das Beste.Einfach Augen zu und aushalten, später drüber lachen, draußen wartete die graue Decke auf mich.Doch ich merkte, wie sich die Decke immer mehr lockerte. Und als die Mauer fiel, konnte ich wieder atmen.Wir wollten leben, über alles sprechen, über das Banale und das Wichtige, die Jungs und Musik, Drogen, Nietzsche und Techno.Zigaretten mit Eva, in Bars abhängen mit Eva. Acid-House hören, allein.Freitags die HR3 Clubnight. Die Loveparade in Berlin. Berlin überhaupt: Da passierte etwas, das mit mir zu tun hatte, nur mit mir. Ich konnte das nicht erklären.Da war die Freiheit, das Leben, das ich suchte, was Eva nicht verstehen würde, niemand.Sie redeten alle immer davon, endlich rauszukommen aus Erfurt, manche trampten für ein Wochenende nach Berlin und kamen zurück, als wäre nichts passiert, als hätten sie dort nichts gesehen, das sie veränderte. Ich konnte mir das nicht vorstellen – wie konnte man zurückwollen in unsere enge Welt?Gut, wir hatten jetzt Graninisaft und Fernseher mit allen Programmen. Doch in meiner Klasse waren immer noch die gleichen autoritätsgläubigen Idioten.Eva hatte jetzt ihre wilde Phase.Wir hatten gleichzeitig den ersten Freund, wir machten all den Standardjugendscheiß, den auch schon unsere Eltern gemacht hatten: Nächte durchmachen, tanzen, trinken.Nur, um später auch ein Haus und Kinder zu haben.Steve sprach von Heirat und Kindern. Ich war gerade 17 geworden, Steve 18. In zwei Jahren würden wir studieren, sollte ich dann noch immer so sein – mit einer Sehnsucht nach Rebellion, mit der Vorstellung davon, wie ich sein wollte, meine Seele war irgendwo, doch sie schlief und schien auf etwas zu warten.Ich wollte nach Berlin in den Sommerferien mit Eva.Mit Steve war seit drei Monaten Schluss.Zwei Wochen Berlin, zwei Wochen in eine andere Welt, doch ich wollte mehr.Frei sein, von all dem Bekannten, Vertrauten.Es überraschte mich nicht, dass Eva absagte. Sie wollte Alex noch mal eine Chance geben. Und überhaupt, am Wochenende is ne Drum ’n’ Bass-Party im „Keller“ … ob ich nicht auch bleiben wolle. Doch ich wollte nicht. Ich war nicht enttäuscht, fast erleichtert. „Vielleicht komm ich noch nach“, sagte Eva, doch wir beide wussten, sie würde nicht kommen. Mit 14 Jahren hatten wir Nirvana gehört und sind mit Karohemd und zerrissenen Jeans durch Erfurt gelaufen, mit 15 die Doors entdeckt, mit 16 Techno.Doch mir fehlten die Erlebnisse, das Gefühl, lebendig zu sein. Jetzt, im Zug, hatte ich keine Angst, ich fühlte mich lebendig, befreit von den Erwartungen, dem Leben, das mir aufgedrückt wurde, befreit von jedem Satz aus jedem Buch, das ich gelesen und doch nicht verstanden hatte.Ich sah aus dem Zugfenster, war nicht müde, saß nur da, voller Erwartungen. Wir kamen an am Bahnhof Zoo, ich stieg aus, ging einfach weiter. Ich wusste nicht wohin, eigentlich sollte ich mit Eva bei Christoph Merker übernachten. Bei dem perfekten Christoph und seiner perfekten Frau Ute. Und seinem perfekten, braven Sohn Vincent. Die Merkers waren Studienkollegen meiner Eltern. Christoph und Ute, die mit meinen Eltern geträumt hatten von einem anderen Kommunismus. Dann wurde sein Ausreiseantrag bewilligt, er wurde Dozent für Theologie. Nun ist Christoph Professor und lebt in Charlottenburg. Mit Vincent und seinem Adoptivsohn, den ich noch nie gesehen hatte. Er war immer unterwegs und wurde in den Rundbriefen nie erwähnt. Nur Vincent, dessen Karriere genauso geradlinig verlief, wie die seines Vaters. Ute tat nichts, sah nur schön aus, auf ihrem weißen Sofa, ein Glas Sekt in der Hand. Ich wollte nicht in ihr Berlin. Ich wollte das Berlin der Hinterhöfe und illegalen Clubs. Ich wollte endlich mal keinen Plan haben. Ich ließ mich einfach treiben. Ostbahnhof, und dann weiter zum Alex, niemand beachtete mich. Ich wusste nicht mal die Uhrzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich lief, merkte nur, dass es dunkel wurde.
Ich lief einfach weiter, folgte Menschen in den Keller eines alten Hauses, es wirkte wie ein ehemaliges Bürogebäude. Ich fühlte mich weniger fremd, ging zur Bar, bestellte mir ein Wodka-Redbull. Das Mädchen an der Bar fiel mir auf, sie schien hier ebenfalls nicht hinzugehören: schwarze Locken, ein schwarzes Top, Jeans, kein Makeup. „Ich weiß nicht, warum die alle damit angeben müssen, aus Berlin zu kommen, was ist schon Besonderes daran? Manche kommen aus Hannover, andere aus Berlin. Und? Du kommst nicht aus Berlin, oder?“ … „Merkt man das?“ „Keine Ahnung, aber du bist die Einzige, die mir zuhört.“ Sie lachte: „Ich bin Karen.“ „Und woher kommst du?“ „Aus Berlin.“ Sie lachte erneut. „Aber Charlottenburg. Berlin ist ja jetzt nur noch der Osten. Sorry, kommst du ausm Osten?“ „Ist das wichtig?“ „Nee.“ Die Musik, die anfangs zu laut war, mich schockte, war jetzt wie ein Ausdruck meiner Gefühle und für jeden hier schien sie die Sprache zu sein. Sie tanzten, das war ihre Sprache. Sie gaben sich Zeichen. „Du kannst dir deinen eigenen Film drauf fahren“, sagte Karen. „Was?“ „Naja, deinen Film halt. Egal, an was du gerade denkst, du kannst es mitnehmen.“ Ich verstand nichts von dem, was sie sagte, doch es faszinierte mich. „Filme fahren was soll das sein?“ „Jeder hat doch seinen eigenen Film am Laufen, oder? Übrigens,…du fällst hier jemandem auf. Der Typ da starrt dich die ganze Zeit an.“ „Wer?“ „Da drüben.“ Sie deutete auf einen Typen, den ich schon an der Garderobe gesehen hatte. Jetzt hatte er wohl Pause. Er stand einfach da und sah mich an. Ich blickte mich um, meinte er wirklich mich?Er stand da und sah nur mich an, alles andere, die Menschen, die ausflippten, interessierten ihn nicht. Kurze dunkle Haare. Grünblaue Augen. Schwarzes T-Shirt und Jeans, Sandalen. „Der hat sie wohl nicht mehr alle“, sagte ich zu Karen. „Der guckt immer noch“, sagte Karen. „Mann, ich krieg ja langsam Angst.“ Sie lachte. Für Karen war das alltäglich. Für mich nicht. Nichts war alltäglich, alles neu und Teil von etwas Neuem, von dem, was jetzt zu mir gehörte. Ich wusste nicht, was ich von dem Starrer halten sollte. Er nervte mich, ja ich beschloss, er nervte mich. Ich sah hin und er sah mich noch immer an, ohne Veränderung. „Oh nein, er kommt her“, sagte Karen, „einfach nicht beachten.“ Und sie redete, von dem Typen, der sie gestern anmachen wollte. Sie habe sich das natürlich nicht gefallen lassen. „Klar“, sagte ich. Lachte über ihre Witze, hörte ihr zu, verstand nichts, denn heimlich beobachtete ich ihn. Er bestellte ein Becks, sah mich dabei die ganze Zeit an. Stellte sich an die Bar, sah mich an. „Sieh ihm doch mal in die Augen, dann sieht er weg, dann biste ihn los“, flüsterte Karen. Ich sah ihm in die Augen, er war jetzt direkt vor mir. Er sah nicht weg. Ich auch nicht. Ich spürte einen Schmerz, so als würde gewaltsam in meiner Seele eine Tür aufgebrochen. Seele, wo ist die eigentlich dachte ich, im Bauch. So fühlte es sich an und er sah alles. Alles, was da war in meiner Seele, all der Kram, der sich da angesammelt hatte, all der peinliche Kram, er sah sich alles an, jedes Stück und sagte: „Es ist gut, es ist schön, du bist schön, du kannst den Kram behalten, der ist auch schön, ich habe auch sowas", und ich sagte: „Echt?“, und er sagte: „Echt.“ „Schön, dass du endlich da bist, Bruder“, sagte ich und er sagte: „Jetzt sind wir vollständig", und ich fühlte, wie der Verlust, den ich immer empfunden hatte, verschwand, wie der amputierte Arm wieder angeschraubt wurde. Eine Viertelstunde hatten wir uns in die Augen gesehen, er sah noch immer nicht weg. Ich ging auf die Tanzfläche und wir waren alle eins, eine Familie. Ich fühlte mich befreit und mir fiel ein Junge auf, der wilder tanzte als die anderen, er sah auch anders aus. Lederjacke, Jeans, schwarze Haare, braune Augen. Er sah mich, lachte und ich lachte und wir tanzten und ich merkte, dass wir beide den gleichen irren Tanzstil hatten. „Komm, ich geb dir einen aus“, sagte er und legte den Arm um mich, als wären wir schon immer Geschwister, Seelengeschwister. „Und wir machen jetzt Party, oder?“ „Klar, ich hab jetzt frei“, sagte Karen. Und wir drei gingen zusammen los, so, als wäre das selbstverständlich. Als wäre das schon immer so gewesen. Die Sonne ging gerade auf. Wir liefen durch Berlin und erzählten uns unsere Lebensgeschichten, unzusammenhängend und verwirrt, so als hätten wir nicht viel Zeit. Milosch hieß mein neuer Seelenbruder. Er lebte bei Adoptiveltern, die er nicht mochte, hatte vorher im Kinderheim gelebt und dort Schlimmes erlebt. Was, wollte er nicht sagen. Und davor hatte er eine schöne Kindheit gehabt. Seine Eltern gehörten zu den sogenannten „Verschwundenen". Sie hatten einen Ausreiseantrag gestellt, waren engagiert in einer Kirchengemeinde, die bekannt war für ihre Friedensgebete. Milosch wurde ihnen weggenommen, wegen angeblich „asozialer" Verhältnisse. Nach vergeblichen Versuchen, ihn aus dem Heim zu holen, wurden beide verhaftet, kamen nach Hohenschönhausen. Danach hörte man nie wieder was von ihnen. Fragenstellen war nicht gut, das lernte ich. „Wir leben jetzt“, sagte er. „Jetzt, begreifst du das?“
Wir gingen in eine Kneipe, er bestellte drei Wodka und sang laute Lieder in einer Fantasiesprache. Karen erzählte mir, dass sie aus einer Charlottenburger Arztfamilie kam. Dass sie auch Ärztin werden sollte. Dass sie nie zur Schule ging, sitzen blieb, stattdessen im Palace abhing. Sie war 18 und hatte schon eine kleine Wohnung in der Kastanienallee am Prenzlauer Berg. Und dann gingen wir zu McDonalds. „Das ist unser Ritual“, sagte Milosch. „Französisches Frühstück bei Mäcces.“Wir tanzten auf den Tischen. Wir redeten über Gott. Milosch glaubte an Gott. Karen an Buddha. Oder Energie. Die beiden stritten, ob Gott eine Person oder eine Energie war. „Schwachsinn, Energie“, sagte Milosch. „Wozu ist denn dann Jesus gekommen? Der war Gott in Menschengestalt.“ Ein Typ neben uns starrte uns an. Weißer Fishbone-Pullover, blondgefärbte Haare, NewBalance-Turnschuhe. Milosch setzte sich neben ihn. „Was glotzte so blöd, wir sind Theologiestudenten. Glaubste nicht, was?“ „Zitier was aus der Bibel, dann glaub ich dir." „Und wir werden sein wie Kinder, spielend verloren in Illusionen der Unschuld.“ „Und wo steht das?“ meldete sich der Loser misstrauisch. „Na in der Offenbarung des Petrus. Das Buch wird von der Kirche unter Verschluss gehalten, denn wenn wir wüssten, was da drin steht, hätten wir alles, das Heilmittel gegen jede Krankheit."Er starrte uns an. „Ist das wahr?“, wandte er sich jetzt an Milosch. „Echt wahr, Alter.“„Was macht ihr denn dann um diese Zeit bei Mäcces?“ „Na, unsere Vorlesung fängt in zwei Stunden an und wir bereiten uns hier schon mal vor“, meldete sich jetzt Karen. Er starrte weiter. „Respekt, echt Respekt.“ Dann kam er zu uns und schüttelte jedem die Hand. „Sorry noch mal.“ Milosch klopfte ihm auf die Schulter: „Schon gut Mann. Du bist in Ordnung.“ „Ich hab mir nämlich überlegt, Gott gibt’s vielleicht doch." „Weißt du was, mein Sohn?“ Milosch legte beide Arme auf seine Schultern. Der Loser sah ihn erwartungsvoll an. „Du bist total besoffen!“ Der Loser lief rot an: „Ihr habt mich verarscht, oder?“ Ich konnte nicht mehr und fing an zu lachen, Karen lachte auch und der Loser schmiss seine kalten Pommes nach uns. Wir rannten nach draußen.Karen sagte: „Ich hau mich mal hin.“„Ok“, meinte Milosch, „dann laufen wir noch ein bisschen rum, oder?“Ich hatte nichts dagegen, ich war müde, aber es fühlte sich so angenehm an, leicht berauscht.Ich folgte Milosch, der mir die schönste Stelle Berlins zeigen wollte. Er schien völlig selbstsicher, nicht wie ein Siebzehnjähriger. Ich fühlte mich sicher bei ihm. „Was war das für ne Sprache?“ „Romanes. Ich weiß aber nicht mehr viel. Meine Eltern waren doch Sinti.“ „Siehst du deine Verwandten manchmal?“ „Ja, schon, ich bin bei jedem Fest dabei. Aber ich gehör nicht richtig dazu. Ich war doch die ganze Zeit im Heim. Egal.“Egal, das sollte ich noch lernen, bedeutete bei Milosch immer, er wollte nicht mehr über das Thema reden. „Der Spruch vorhin, war das von dir?“ „Klar, ich schreib immer. Gedichte oder keine Ahnung, halt Texte. Kann dir mal was zeigen.“ Die Oberbaumbrücke war für ihn die schönste Stelle Berlins. „Hier geht’s vom Osten in den Westen. Guck mal runter.“Es sah gewaltig aus und gleichzeitig wie Heimat.Ich bin zuhause, dachte ich.
Feiern - Kapitel 2
Als ich erwachte, schien die Sonne und ich war glücklich. Einfach so, glücklich.Wir saßen in der Küche, tranken Espresso. „Wer ist dieser Typ?“, fragte ich. „Wer?“ „Na, der Typ von gestern. Der an der Garderobe arbeitet.“ „Der Starrer“, sagte Karen. „Das ist doch der Bruder von Wladi“, sagte Milosch. „Echt, der hat ‘n Bruder?“ „Ja, der ist schon anders als Wladi, viel ruhiger. Komischer Typ.“ „Wieso komisch?“, fragte ich. „Naja, man weiß nie, was er denkt. Arbeitet an der Garderobe vom Palace und fährt Taxi, nur so Nebenjobs in diesem Alter.“ „Wie alt ist er denn?“ „Keine Ahnung, älter als wir auf jeden Fall. Warum willste das wissen?“ „Weil er sie den ganzen Abend angestarrt hat.“
„Ja ist doch gut. Kannst du doch so stehenlassen.“
„Komisch, ich muss den doch kennen“, sinnierte Karen.
„Ich kenn alle.“
„Na, wer mit der irren Margit abhängt...“
„Echt jetzt?“
„Wer ist die irre Margit?“, fragte ich.
„Ach“, Karen winkte ab. „Ich muss dir mal in Ruhe die ganze Belegschaft vorstellen. Jetzt ist erstmal Kreuzberg dran.“
„Wieso? Soll ich ihr jetzt Wladis Adresse geben, oder was?“
„Und wer ist Wladi?“
Milosch holte Zettel und Stift, schrieb was auf.
„Also, das ist Wladis Adresse. Er ist Nikos Bruder und wohnt in Kreuzberg.“
„Und Niko ist...“
„Genau. Der Starrer.“
Walter Goretzki, Oranienstraße 32 stand da, kaum leserlich auf eine alte Rechnung gekritzelt. Kippen und Redbull.
„Warum nennt ihr den Wladi?“
„Sein Vater war Russe.
Hör mal Renalein, willste das wirklich machen?
Du kennst dich doch gar nicht aus in Kreuzberg.“
„Ist es da so gefährlich?“
„Ja schon.“
„Keine Ahnung. Ist irgendwie wichtig“.
„Ich bring dich noch zur Bahn.“
Er ging traurig neben mir, eine Zigarette nach der anderen rauchend. Was war nur mit dem mutigen Milosch passiert? Ist das der Kater? Machte er sich wirklich Sorgen? Dunkel ahnte ich etwas. Dass es nicht so leicht werden würde, wie ich es mir vorstellte, dass wieder mal der Film in meinem Kopf nichts mit dem Film in seinem Kopf zu tun haben würde. Jetzt kommt etwas auf mich zu, dass ich nicht vorausahnen, vorausfühlen kann. Vielleicht ist es zu viel, doch ich wusste auch, wenn ich jetzt umkehren, der Angst nachgeben würde, könnte ich nie mehr zurück. Milosch sah mir nach, an seiner Camel ziehend. Und wieder wurde ein Mensch kleiner.
Ich lernte, Berlin besteht aus vielen Welten. Und diese Welten sollten nie aufeinandertreffen.
Feiern - Kapitel 3
Zuerst merkte ich es nicht, war überzeugt davon, dass Berlin doch eine große Ansammlung von Häusern sein müsste, ein homogenes Etwas. Ich merkte es erst, als ich aus dem Fenster sah. Frauen mit Kopftüchern in schwarz, Punks, Junkies, Alkis.
Ein Meer von Menschen, eine andere Luft, eine neue Welt.Das konnte ich nicht vergleichen, es gab nichts zu vergleichen hier. Kreuzberg schien eine fremde Welt zu sein zu der ich eigentlich keinen Zutritt hatte, doch ich wurde aufgenommen, ich war ja nun einmal da. Alles war mir vertraut, die Gemüseläden, die Cafés.Hier war ich nun, auf der Suche nach einem Mann, den ich nicht kannte. Ich blieb kurz stehen. Doch stehenbleiben in der Oranienstraße war keine gute Idee. Ich wurde einfach weitergeschoben.
Wladi wohnte in der Oranienstraße, doch die war lang. Die Nummer konnte ich nicht finden. Ich ging einfach weiter, so wie gestern. Irgendwann würde ich ankommen. Fast hätte ich dieses kleine, abgefuckte Café übersehen, hätte mich nicht ein Mädchen angesprochen. Sie trug einen Nasenring, eine Patti-Smith Frisur, ein 70er Jahre-Blumenkleid und Doc Martens. „Hey, kann ich dir helfen? Du siehst so suchend aus.“
„Ja, tatsächlich. Ich suche einen Walter Goretzki. „Wladi? Na klar, da bist du hier richtig, komm rein.“
Noch nie hatte ich etwas Vergleichbares gesehen: In diesem Café, genannt „Wohnzimmer“, gab es keine Stühle oder Sessel. Matratzen, niedrige Tische mit Sitzkissen, Tücher, Antiquitäten, Bücherregale, Kerzen, Filmplakate. Die Musik wechselte zwischen orientalischem Techno und Aaliyah zu Chopin und Bach. Der Tee, den mir Judith - so hieß das Pattismithmädchen - anbot, war stark, süß und wurde in kleinen Gläsern serviert.Sie sah mich prüfend an. „Ich hab dich hier noch nie gesehen.“„Ich war noch nie hier. Ich komm nicht aus Berlin.“Sie lachte. „Woher kennst du denn dann Wladi? Der kommt doch nie aus Kreuzberg raus.“Jetzt bemerkte ich den kitschigen Perlenvorhang, der den kleinen Verkaufsraum von einem Café trennte. Ein Typ mit langen schwarzen Haaren, Tattoos und Eyeliner kam dahinter hervor. Er war groß, im Gegensatz zu der Frau, die seine Schwester zu sein schien: „Kommst wohl ohne mich nicht klar, Schwesterchen?“ Finster grummelte er: „Wer isn das?“
„Das ist die Rena und die trinkt jetzt mit uns nen Tee! Und Rena, das ist Felix, mein Bruder."Wir tranken Tee, Judith plapperte, Felix schaute mich weiter böse an. In dieser Welt verlor man das Zeitgefühl, ich vermutete, dass es schon spät sein musste, ich hatte den halben Tag verschlafen. „Ich kann das nicht lesen“, sagte Judith. Sie versuchte das Gekritzel auf meinem Zettel zu entziffern. „Wer hat das geschrieben?“ „Milosch.“ „Wer?“ „Ein Freund von mir. Milosch Böhm, oder Böhmer glaub ich."„Sag deinem Freund, er soll mal ordentlich schreiben. Warum kann er das nicht?“Ich grinste. „Hat Wichtigeres zu tun.“„Milosch Böhmer, der Name kommt mir doch bekannt vor." Sie starrte in die Luft, überlegte. „Aah, ja! Das war mein Kindheitsfreund! Wir haben zusammen Vampir gespielt! Is ja krass...“
„Kanntest du seine Eltern?“
„Ja, klar! Meine Eltern haben gegenüber gewohnt, wir waren jeden Tag da. Die waren Pfarrer in der Gemeinde wo auch Milosch´s Eltern hingegangen sind. Was macht er denn jetzt?“
„Er schreibt. Gedichte.“
„Cool! Bring ihn doch mal mit. Ich zeig dir mal, wo Wladi wohnt, das ist echt schwer zu finden. Komm mal mit.“Judith ging durch den Perlenvorhang, ich folgte ihr.Hinter dem Vorhang begann eine neue Welt: Teppiche, Sitzkissen, niedrige Tische, Kerzen, Tücher. Doch niemand saß dort. „Warum habt ihr keine Gäste?“„Keine Ahnung, die kaufen nur was zum Mitnehmen. Aber die richtigen Leute wissen schon Bescheid, keine Sorge.“„Und wer sind die Richtigen?“„Na, die nicht fragen und sich einfach hinsetzen.“Sie öffnete die Tür. Ein Berliner Hinterhof, gegenüber ein altes Haus.„Da, ganz oben unterm Dach wohnt Wladi. Auf der Klingel steht nichts, aber is ja die einzige Tür, also ganz easy.“Dann war ich ganz allein im alten, modrig riechenden Hausflur.Jetzt erst bekam ich Angst vor meinem Mut, das ganze Vorhaben erschien mir jetzt lächerlich, sinnlos. Was sollte ich sagen, was, wenn ich Niko tatsächlich begegnen würde?Ich wusste nichts mehr, alles leer im Kopf. Trotzdem ging ich weiter, ich wollte es wissen.Ich klingelte. Mein Herz klopfte, ich wollte gehen, dann öffnete sich die Tür so schnell und heftig, dass ich stehen blieb. Vor mir stand ein Riese. Ein dicker Riese. Eine Gestalt mit Vollbart, halblangen schwarzen Strähnen. Er trug eine Sonnenbrille, ein riesiges goldenes Kruzifix, ein schwarzes Iggy Pop-T-Shirt und eine Jeans mit Löchern. Er war barfuß. „Jetzt schicken die schon ihre Kinder los, na gut, her mit dem Wachturm und tschüss.“„Ich bin nicht von den Zeugen Jehovas.“„Ja, ja.“Er ließ die Tür offen und ging in die Wohnung, ich folgte ihm, nicht wissend, ob ich reinkommen durfte. Diese Wohnung ähnelte dem „Wohnzimmer“: Orientteppiche, antike Kerzenleuchter und Bücher lagen kreuz und quer durcheinander. Ein Plattenspieler, eine Kochplatte. Darauf stand ein Topf in dem er ein dunkles Gebräu kochte. „Trink nen Çay mit mir.“„Was ist Çay?“„Türkischer Tee.“Er goss den Tee in kleine Gläser wie im „Wohnzimmer“ und sah mich jetzt richtig an, ohne die Sonnenbrille abzunehmen. „Du bist nicht von den Zeugen, oder?“„Auch nicht von Scientology. Ich bin Rena, ne Freundin von Milosch.“„Miloschowitsch? Hat der Junge jetzt endlich ein Mädchen?“„Nee, nur eine gute Freundin.“„Ach, ihr Kinder heutzutage. Na schön, jetzt wird die Familie größer.“Er legte eine Platte auf: Iggy Pop: The Passenger. „Hör mal hin“, sagte er und schleifte mich zum Fenster. „Siehste, er singt von uns, von heute Nacht, er singt davon.“Und ich begriff jedes Wort, das Lied war eine Hymne und es schien mir so, als hätte dieser Fremde erkannt, was ich hier wollte, ohne groß Fragen zu stellen.„Marvin Gaye!“ Wladi legte „What´s going on” auf.„Er ist der Gott.“Ich sagte ihm, dass ich das auch kannte, Musik hören nach Stimmung, als Soundtrack, ich sang mit, so wie immer. „Was suchst du, du suchst doch was.“„Ja, ich suche jemanden, doch ich weiß nichts von ihm.“„Denkst du ernsthaft, du lernst jemanden jemals richtig kennen?“Er stellt die richtigen Fragen, dachte ich. Nicht das Übliche, wer bist du, was willst du hier, was habe ich damit zu tun, wo kommst du her?
„Jesus, ich kenne meine Frau immer noch nicht und wir sind schon seit 8 Jahren verheiratet.Du liebst also jemanden, den du nicht kennst. Interessant.“ „Na ja, lieben … ist vielleicht zu viel, ich kenn ihn ja nicht.“ „Ach ja, lieben kommt erst nach dem Verlieben, nach dem Kennenlernen und Bewältigen des gemeinsamen Alltags … Bullshit! Ich hab meine Frau vom ersten Moment an geliebt, obwohl ich wusste, das geht nicht, sie ist Russin, versteht kein Wort Deutsch … alles völlig unrealistisch. Doch da war nichts zu machen. Gar nichts.“„Was? Du hast ne Russin geheiratet? Wie hast du sie denn kennengelernt?“„Jeder hat mir gesagt, bist du verrückt, das geht nicht, bla, bla…Wenn du immer nur darüber nachdenkst, was verboten und erlaubt ist, hast du schon verloren. Ich dachte auch, ich spinne. Hab mich bereden lassen. Von meinem Vater. Ich soll mich schämen, hat er gesagt. Dabei war er nicht mein Vater. Das mit dem Geheimnis liegt in der Familie.“ Er lachte. „Meine Mutter war ein Russenliebchen. Hat sich nur geschämt, ihr ganzes Leben lang. Ein russischer Offizier namens Sergej. Zwei Söhne hat sie als Abschiedsgeschenk bekommen, mich und Nikolas.Ich hab nach meinem Vater gesucht, ich wusste auch nichts von ihm. Ihn hab ich nicht gefunden, aber seine Frau Ulyana, mein Halbschwesterchen Alina, die hat mich Wladi genannt, deshalb... Und nebenan wohnte Tamara.“ Er lächelte weggetreten.
„Es war nicht einfach. Ich konnte ja nicht ohne Grund in die Ukraine fahren, so als Tourist. Obwohl ich nie in die FDJ eintreten wollte, habe ich`s dann doch gemacht. Meine Band hat dann linientreue Lieder gespielt...die Texte! Oh Mann...wir haben die nur verarscht aber...hat keiner kapiert. Wir haben dann ein Konzert organisiert, um die Freundschaft mit der Sowjetjugend zu stärken - was als braver Jungpionier schon immer mein Ziel war. Ich hab mir die Haare geschnitten und ein Hemd angezogen. Und dann war ich da.“„Das war sehr mutig von dir.“„Irgendjemand musste ja mal die Eier haben in dieser Schisserfamilie. Wenn du nicht mehr an dich selbst glaubst, dann kriegen sie dich. Auch dass die Mauer fällt, hab ich immer gewusst.“„Ich auch.“„Wundert mich nicht, Kinder wissen immer die Wahrheit. Du warst nur ein Kind, sie haben über dich gelacht. Ich kam dafür in den Stasiknast.“„Nach Erfurt? Ich komme auch aus Erfurt.“
Wladi reagierte nicht. Nach ein paar Minuten sagte er: „Und? Sagt dir was, Stasiknast, oder?“
„Klar!“„Tja, der Stasiknast war berühmt.“„Was ist aus Tamara geworden?“„Als ich aus dem Knast kam, kurz vor der Wende, wurde mir die Ausreise in den Westen angeboten. Ich bin nach Kreuzberg gezogen, in diese Butze und bin Sozialarbeiter geworden. Da habe ich Tamara dann wieder gesehen. Das ist wie in nem kitschigen Film...einerseits war ich überrascht, andererseits war alles so klar. Als wäre es nun mal so vorherbestimmt. Und nach langem Hin und Her, haben wir dann geheiratet. Ich habe eins daraus gelernt, Rena:
Glaub dran, andere werden das nicht für dich tun.“
„An was?“
„An was auch immer. Ist nicht wichtig. Such´s dir aus.“
Langsam wurde es hell. Ich hörte einen Schlüssel in der Tür. „Mein Bruderherz. Der ist Taxifahrer, der kann dich mit in die Stadt nehmen.“Da stand er: Niko. Ich hielt ihn für eine Halluzination, ausgelöst durch fehlenden Schlaf, Çay und Wladis irre Lebensgeschichte. Niko sah mich an mit dem Ausdruck absoluten Schocks, die Pupillen geweitet. Das war ein Anderer, als der, den ich gestern gesehen hatte. Wladi fragte: „Kennt ihr euch?“ Niko sah jetzt völlig unbeteiligt aus, ein Trick von ihm, diese Fähigkeit, von einer Sekunde zur anderen, vollkommen gleichgültig und kalt zu wirken. „Nee.“ „Na Brüderchen, was treibt dich zu mir?“„Ich wollte dich fragen ob du heute Nachmittag auf Lisa und Tobi aufpassen kannst?“„Geht klar, ich oder Tamara. Willste gleich wieder los, oder trinkst du noch´n Tee?“„Keine Zeit, ich muss weiter.“„Na, dann nimm die junge Dame ein Stück mit.“Niko sagte nichts, nahm nur die Autoschlüssel und ging.Wladi sah mich entschuldigend an. „Mein Bruder, nimm ihn nicht ernst.“„Hau rein, Wladi.“„Du auch und komm mal wieder rum.“Ich folgte Niko und stieg in sein Auto. Er sagte nichts, sah mich nicht an, legte nur ein Tape ein: „Live forever“ von Oasis. Ich weiß nicht genau, woran es lag, an dieser verrückten Nacht, am Singen mit Wladi, oder daran, dass ich jetzt in diesem Auto saß. Ein Auto voller Kassetten, Zeitungen und Tabakkrümel. Niko zündete sich eine Zigarette an, Gauloises rot. Er rauchte nie was anderes. Und ich sang. Er sang auch. „Ich hab noch nie eine Frau getroffen, die Oasis hört und die „Live forever“ auswendig kann.“„Ich hab auch noch nie einen Mann getroffen, der das kann.“„Was studierst du?“„Was?“„Du bist doch sicher Studentin. Irgendwas mit Musik?“Sein Blick war jetzt wieder offen und klar und ich dachte, es wäre so einfach. Ich müsste dieses Spiel nur mitspielen. bin 17.“Er sagte nichts, noch war er lustig. „Was hast du gesagt, ich hab dich nicht verstanden.“ Was war los mit mir, früher hatte ich oft gelogen, früher, als ob es ein früher gäbe. „Ich studiere nicht, ich bin 17.“„17“, wiederholte er.„Und wie alt bist du?“
„35.“„35“, wiederholte ich jetzt. Ich sah einen Ring an seinem Finger. „Bist du verheiratet?“„Ja und ich hab zwei Kinder“, sagte er jetzt in normalem Ton. Ich fragte mich, ob ich mir das doch alles eingebildet hatte, jemand hatte mir Ecstasy in den Drink gemischt, alles einer Berlindrogenfantasie entsprungen. „Du kannst mich hier raus lassen.“Er hielt an, obwohl man doch nicht einfach so mitten auf der Straße anhalten kann, auch nicht in Kreuzberg. Er verabschiedete sich nicht, reagierte nicht auf mein: „Mach´s gut, danke fürs Mitnehmen.“ Ich stand auf dem Kottbusser Damm, 7.Juli 1996.Einfach laufen, dachte ich. Bewegung ist gut, dann verschwinden die Träume, die Illusionen, der ganze Scheiß, die Lügen vom Paradies. Hier ist nicht das Paradies, das ist Kreuzberg.Ich bin 17 Jahre alt, was weiß ich vom Leben? Warum liegen 18 Jahre zwischen uns? Als hätte Gott einen Fehler gemacht und mich zu spät in die Welt geschickt und Niko zu früh.
Feiern - Kapitel 4
Kreuzberg ist ruhig, hatte Milosch gesagt, doch ich fand das gar nicht. Kreuzberg war laut, dreckig, und obwohl es wirklich ruhiger war als im Ostteil der Stadt, lag hier etwas Unkontrolliertes, Unkontrollierbares, das Angst machen konnte, aber auch Kraft und Energie gab. Hierher verirrte sich niemand aus dem Palace, kein Technokind aus der Provinz. Der Wrangelkiez ist gefährlich, sagte Milosch, die Oranienstraße ist gefährlich und doch fühlte ich mich nicht bedroht. Nur jetzt, an diesem Montag 12 Uhr mittags, machte mir Kreuzberg Angst. Der Strom an Menschen schien einfach nicht abzureißen. Ich lief immer schneller und versuchte nachzudenken, Gedanken zu ordnen, doch es ging nicht. Nur Stichworte, unzusammenhängend und wirr. Dann war ich auf einer Brücke, ließ mich mitreißen vom Strom zu einem Markt. Ich fand eine Telefonzelle. Milosch anrufen, dachte ich. Milosch und der Gedanke an ihn gaben mir Sicherheit. Ich sah ihn vor mir, Milosch wird eine Lösung haben, ich kann wieder sprechen, wenn ich ihn sehe.Er war sofort dran. „Ich komm rüber, wir treffen uns im Wohnzimmer.“Ich versuchte, mir irgendwie einen Weg zurück zu bahnen. Die Oranienstraße hochzulaufen. Und dann wieder Wohnzimmer. Judith und Felix, diese Namen hatte ich mir gemerkt. „Na, haste Wladi gefunden?“, fragte Judith. „Klar.“ Ich setzte mich. „Ist das immer so leer hier?“





























