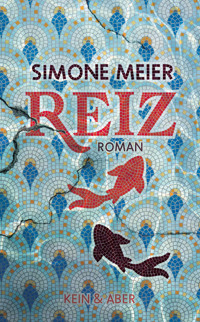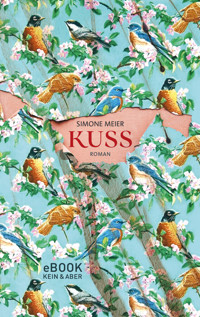12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna und Max, beide Mitte vierzig, sind miteinander zur Schule gegangen und viel später aus Bequemlichkeit ein Paar mit langweiligen Paarfantasien geworden. Doch dann verliebt sich Anna, geplagt von allen Begleiterscheinungen des Älterwerdens, zum ersten Mal in eine Frau, die 27-jährige Lilly. Und Max verliebt sich in Lillys Mitbewohnerin Sue, die aber nur gegen Geld mit ihm ins Bett geht. Lilly wiederum muss sich um ihren kleinen Bruder kümmern, der sowohl Eltern als auch Lehrer zur Verzweiflung treibt, doch Anna ist ihr keineswegs entgangen. Psychoterror und Wahnsinn schleichen sich in die Geschichte, doch Simone Meier peilt ein Happy End an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Dank
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
SIMONE MEIER, geboren 1970 in Lausanne, ist Autorin und Journalistin – früher bei der Wochenzeitung und beim Tages-Anzeiger, heute bei watson – in Zürich. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Ihr Romanerstling Mein Lieb, mein Lieb, mein Leben erschien im Jahr 2000. Simone Meier lebt glücklich von Liebe, Fleisch und Fernsehen. Und vom Schreiben.
ÜBER DAS BUCH
Ein lustvoller, lustiger Liebesroman über Menschen, die mit dem Jungsein und dem Älterwerden kämpfen. Und damit, dass ihre Fantasie die Realität um Längen schlägt. Doch dann geschehen Dinge, die hätten selbst sie sich niemals vorgestellt.
»An diesem Roman gefällt mir alles – die spannenden Figuren, der Humor und die ergreifende pansexuelle Liebesgeschichte.«
Viktor Giacobbo
»Simone Meier kann genau schauen und kennt die modernen Menschen mit ihren fluiden Orientierungen, ihren Leidenschaften und Sehnsüchten. Ein sehr appetitliches Buch!«
Doris Knecht
für dj
NOVEMBER
1
Der Mann sah aus wie eine geschälte Kellerassel, und sie fragte sich: Wieso sind Schönheitschirurgen nie schön? Er sagte: »Dann machen Sie sich untenherum mal frei.« Sie ließ ihren Slip fallen und starrte auf den falschen Marmor-Giebel über der Türe, auf die rosa Adern auf weißlichem Grund, die aussahen wie die Besenreiser auf ihren Beinen. Der Mann nahm eine Polaroidkamera, beugte sich auf ihre Gesäßhöhe hinunter und drückte ab. Von hinten. Von der Seite. Dann sagte er: »Gut«, kritzelte Nummern auf die Fotos, nahm eine Mappe aus dem Regal und mischte die Bilder unter drei Dutzend andere. Unter Bilder von Frauenhintern mit Dellen, Rundungen am falschen Ort, Cellulite, Pigmentstörungen, Narben. Und mit Fett, viel Fett. Manche auch ohne. Manche schienen fast perfekt, jedenfalls so, dass Anna sich gerne einen davon ausgesucht hätte.
Der Arzt nahm ein Skalpell zur Hand und tippte damit auf eines der Bilder: »Das sind Sie.« Es gehörte zu den schlimmeren. Den schlimmsten. Man erkannte noch knapp, dass es sich um einen Hintern und um den einer Frau handeln musste, doch insgesamt sah das aus wie ein Kartoffelsack, den man sieben Stunden lang in kochendes Wasser getaucht und danach gegen eine Wand geschlagen hatte. »Entweder treiben Sie jetzt jeden Tag mehrere Stunden Sport, was ich mir bei Ihnen nicht vorstellen kann, oder wir operieren. Das kostet um die 10’000. Perfekt ist es am Ende natürlich nicht, dazu haben Sie viel zu lange gewartet.« Natürlich. Und mein nächster runder Geburtstag ist der fünfzigste, dachte sie, und von 10’000 kann ich sechs Monate in Thailand leben.
Vor dem Fenster dämmerte die Stadt in den anbrechenden Abend hinein, Laternen glühten auf, Menschen rannten grau und nervös über die Straße. Der Kopf des Arztes war im Vergleich zu Annas Hintern plötzlich von ausnehmender Wohlgestalt.
Sie sagte: »Nein.«
»Was wir unten absaugen, können wir oben ins Gesicht spritzen!«
»Nein.« Sie zog sich an und ging, rannte durch den Flur und die Treppe hinunter, vorbei an verspiegelten Wänden, die ihr zuschrien: »So! Nicht!«
Sie sah, wie sich ihr Gesicht in den Spiegeln verkrampfte, wie es sehnig wurde und alt, wie sie sich in eine jener Frauen verwandelte, die alle gleich aussahen, erloschene, fahle Schrumpfköpfe mit kurzen Haaren auf vernachlässigten Körpern. Die Frauen selbst nannten sich uneitel. Anna fand sie bloß hässlich. Und Anna hasste sich selbst. Aber nicht so sehr, um sich von der geschälten Assel demütigen zu lassen. Sie ging über die Straße, betrachtete nur kurz ihre unbefriedigende Silhouette im Schaufenster, betrat das überteuerte Bistro und gönnte sich zum Trost eine warme Brioche. Mit einer Scheibe Foie gras und einem Glas Crémant. Die Kellnerin, deren nächster runder Geburtstag der dreißigste sein würde, freute sich. Sie fand, dass Anna eine attraktive Frau sei. Genau so hatte ihre Lieblingsschauspielerin Jean Seberg kurz vor ihrem Tod mit 40 Jahren ausgesehen.
Neben Anna saß ein Paar. Ein nicht so junger Mann mit schulterlangen grauen Haaren, mit einem zerknitterten Schal, überhaupt war alles an ihm überaus zerknittert und enorm teuer, auch sein Gesicht, dessen verlebter Faltenwurf von kostspieligen Trekking-, Safari- und Ski-Touren und wiederholten Autofahrten quer durch Amerika erzählte. Wahrscheinlich war er aber bloß ein Werber, der wusste, wie man Mann war.
Die Frau hatte Geburtstag. Sie konnte höchstens 24 geworden sein. Alles an ihr war dunkel, dünn, gerade. Gewiss modelte sie. Anna nahm einen extragroßen Bissen Foie gras. Das Model sah sie erschreckt und mit einem sehnsüchtig offen stehenden Mund an. Der Mann reichte dem Model ein Paket, darauf stand der Namen eines dänischen Designers. Im Paket lag eine Sonnenbrille. Anna sah sofort, dass die Brille und das Model zueinandergehörten. Das Model setzte die Brille auf, drückte schnell auf die Spiegel-Funktion ihres iPhones und war nicht zufrieden.
»Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.«
»Ich finde, sie steht dir großartig«, widersprach der Mann. Finde ich auch, dachte Anna und hasste das Model.
»Ehrlich?«
»Ganz ehrlich. Sieht fantastisch aus mit deinem schmalen Gesicht.«
»Nicht zu katzenhaft?«
»Überhaupt nicht. Sonst tauschst du sie einfach um.«
»Und du lügst mich nicht an?«
»Wunder-, wunderschön!«
Anna betrachtete Messer und Gabel, dachte an das Skalpell des Arztes und an die Möglichkeit einer chirurgisch nicht ganz so professionellen Gesichtsverwüstung auf Kosten des Models. Und sie fragte sich, wie es dem Werber wohl so ging in dieser Affäre. Ob er das wirklich wollte? Eine wandelnde Unsicherheit immerzu bestätigen? Ob er sich nicht jetzt gerade nach seinen Surfer-Kumpels und viel Bier sehnte oder nach einer einsamen Hütte irgendwo in einem finnischen Wald, wo er Holz hacken, Fleisch grillen, Knausgård lesen und sich selbst tagein, tagaus für Gottes geilstes Teil halten konnte? Männer konnten so was, Models offenbar nicht. Obwohl sie es, rein körperlich gesehen, doch eigentlich waren: Elementarteilchen der Vollkommenheit.
Anna stand auf und ging zur Auslage, sie liebte das Bistro mit integriertem Delikatessengeschäft, es war alt und man konnte keine Cupcakes kaufen. Cupcakes waren für sie der Anfang einer niedlichen Verblödung. Sie hasste junge Frauen, die sagten: »Ich hab da so einen süßen kleinen Cupcakes-Laden in der Altstadt. Ich mach gern Experimente, zum Beispiel Kokos mit Kochbanane, Kartoffeln und Caramel au beurre salé. Wenn so was dann schmeckt, bin ich total glücklich.«
Im Fernsehen lief eine Sitcom über exakt diese Exemplare von Cupcakes-Experiment-Mädchen, und eines davon war, was Anna in ihrer Jugend gewesen war: an den richtigen Orten mit schönen, weichen, weißen Rundungen gesegnet. Jetzt war alles anders, jetzt hatten sich die Rundungen verflacht, doch das Gewicht war das gleiche geblieben. Ihre Körpermasse war als teigiger Klumpen auf ihre Hüften und Schenkel gerutscht. Das Gesicht: hager. Der Hals: mager. Als würden die kleinen Fettmoleküle, die sich auf ihrer Hüfte wahrscheinlich kichernd versammelten, denen weiter oben zurufen: Kommt runter, hier gibt es tollen Gruppensex! Sie hasste das Vergnügen ihres eigenen Fettes und die Figur, die sich daraus ergab. Nicht grundsätzlich. Hätte die Figur einer andern Frau gehört, so wäre sie ihr gar nicht aufgefallen, denn die Frau wäre unauffällig normal gewesen. Was sie störte, war die Differenz der Jahre, das Missverhältnis zwischen ihrem jetzigen und früheren Selbst. Dass sie im Spiegel nicht mehr sich selbst erkannte, sondern andere Frauen: ihre Mutter, ihre Tante, ihre Großmutter, ja sogar die Urgroßmutter. Die plötzlich alle von ihr Besitz ergriffen. Von ihrem Gesicht, ihren Brüsten, ihrer Mitte, ihren Beinen. Sie wollte wieder sich selbst sein, die frühere Anna. Nicht innerlich, nicht beruflich, nur äußerlich. Und wenn sie schon nicht mehr die alte Anna sein konnte, dann wollte sie eine andere sein. Und dazu musste sie ihr Fett loswerden.
Deshalb war sie zum Schönheitschirurgen gegangen, zu diesem hässlichen Mann, der allen Frauen jeden Rest von guter Laune und Selbstvertrauen versaute, bevor er zur Operation schritt. Sie hatte sich vorgestellt, dass er wenigstens selbst schön war und mit den Frauen, deren Schönheit er aus ihrem maroden Fleisch meißelte, anschließend gern die eine oder andere Affäre hatte. Und dass die Frauen dies genossen, denn schön und schön, so dachte sie sich, genießt sich gern. Ein kurzer Blick auf den Arzt hatte genügt, und sie hatte gewusst, dass das einzig Anziehende an ihm sein Geld war. Wenn überhaupt.
Anna fragte sich, wie sie einem Vegetarier die Genialität von Foie gras erklären sollte. Am besten gar nicht. Der Vegetarier würde sie wahrscheinlich lynchen. Sie hatte all die schlimmen Filme über das Elend französischer Stopfgänse auch gesehen, aber es hatte sie einfach nicht berührt. Wissen und Genuss kamen einander in Anna drin nicht in die Quere. Es gab in ihr ein paar gut funktionierende Kreuzungen, von Kultur, Kritik, Gewissen und Politik, aber alles, was mit Essen zu tun hatte, bewegte sich auf einer weiten, geraden Autobahn ohne Ausfahrten und Ampeln. Da ließ sie sich gehen, da gönnte sie sich vieles, an einem frustrierenden Tag wie diesem gern auch zu viel, denn nach der kurzen Erholung im Bistro war sie mit Cédric verabredet, und diese Verabredung würde unweigerlich zu einem schönen Entrecôte Café de Paris mit Pommes Allumettes und viel Wein führen.
Sie freute sich auf das Fleisch und fragte sich kurz, ob das, was sie da mit Cédric trieb, was sie beide regelmäßig miteinander trieben, nicht ein Ersatz für Sex war. Ob es nicht ehrlicher wäre, wenn sie zu ihm sagte: »Lass uns einfach ein Hotelzimmer nehmen.« Ob das nicht auch kalorienmäßig viel vernünftiger wäre. Aber erstens war Cédric schwul, zweitens war sie am Fleisch des Tiers viel mehr interessiert als am Fleisch von Cédric, drittens lebte sie ja, trotz Teighüfte, in einer Art Beziehung. Die sie weder glücklich noch unglücklich machte. Es handelte sich dabei in keiner Weise um die Liebe ihres Lebens, aber um einen Begleitfreund, den sie nicht aushalten musste, wie all die Bohemien-Modelle ihrer Vergangenheit, und mit dem sie in der Öffentlichkeit niemals so dämliche Diskussionen führen müsste wie das Paar am Nebentisch. Das sich jetzt allerdings an den Händen hielt und über den Tisch hinweg küsste. Die Sache mit dem Begleitfreund war keine große Sache, aber sie war nice to have, eine Einrichtung, die Anna im sozialen Leben schon vor vielen peinlichen Leerstellen bewahrt hatte. Ein Freund eben, der sie kannte und sich mit ihr auskannte. Und jetzt gerade hätte sie ihn eigentlich ganz gerne bei sich gehabt. Sie war, das merkte sie durch ihre Foie-gras-Betäubung hindurch, doch einigermaßen aufgewühlt, ja geradezu aufgeschürft von der Begegnung mit dem Arzt.
Anna flüchtete sich in ihren Lieblingstraum: Sie saß darin auf dem Beifahrersitz eines verblichen türkisfarbenen Cabriolets, mit einem gepunkteten Seidentuch im Haar, aus dem Autoradio sang France Galle oder eine andere Französin, ihr Kleid bauschte sich leicht über ihren Knien, der Himmel war gelb vor Hitze. Am Steuer saß eine Frau, sie trug wie Anna eine riesige Sonnenbrille, ihre Lippen waren rot, an ihren Ohren baumelten goldene Creolen – Anna liebte das Wort Creolen –, und außer dem gelben Himmel und einer gelben Landschaft gab es nichts, gar nichts in diesem Traum. Nur diese ewig lange Autofahrt neben der Frau mit den roten Lippen. Und: Sie waren beide jung. So jung.
Sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen, sie blinzelte, schaute hoch und blickte in das Gesicht der Kellnerin, die strahlend ein neues Glas Crémant vor sie hinstellte: »Geht aufs Haus.« Anna wusste, dass sie in diesem Moment aussah wie die Allegorie der Verzweiflung in Gestalt einer dürren Mumie. Eine dürre Mumie mit feuchten Augen. Auch die Kellnerin sah eine Frau mit feuchten Augen, allerdings eine mit klarer, weißer, fast faltenloser Haut, und mit Augen blau wie der Himmel über Rio de Janeiro, dem Ort mit dem wissenschaftlich erwiesenen blausten Himmel der Welt. Und mit den Wangen, Haaren und Hüften von Jean Seberg. Die Kellnerin war hingerissen.
Anna versuchte, die Kellnerin anzulächeln. Die Kellnerin war eins dieser Mädchen, die aussahen wie ein Grashalm mit Gesicht und wahrscheinlich gar nie dort Kleider kauften, wo Anna Kleider kaufte, weil sie mit so was Abartigem wie Annas Kleidergröße in ihrem Leben noch nicht in Berührung gekommen waren. 38, sagte sich Anna. Ich trag doch bloß Kleidergröße 38. Das war in meiner Jugend schlank.
2
Der Begleitfreund hieß Max, und Max hatte auch keinen guten Tag. Er hatte im Fußball verloren und hatte sich entliebt. Zuerst hatte er sich ein ganzes Jahr lang gefragt, ob er denn überhaupt verliebt war, dann war ihm die Fragerei zu blöd geworden, und jetzt, zwei Jahre später, war er sich sicher, wirklich nicht mehr verliebt zu sein. Wenn er es denn jemals gewesen war.
Wahrscheinlich hatte ihn Anna bloß beeindruckt. In jener Nacht, als sie sich nach gut fünfzehn Jahren bei einem Klassentreffen wiedersahen. Fast alle waren gekommen, nur Thomas nicht, der saß im Gefängnis, und Caroline nicht, die war nach Indien ausgewandert und arbeitete in einer Krankenhausküche in Kalkutta, und Lena wartete in der Psychiatrie darauf, dass sich all die Jahre in einer Sekte endlich auszahlten und Gott sie in einen weiblichen Jesus verwandeln würde. Drei fehlten also, die andern vierzehn waren da, und Max schaute verwundert in die Runde, denn ihm schien, dass alle Frauen einigermaßen schön geblieben und alle Männer ziemlich aus der Form geraten waren. Zudem hatten die Frauen allesamt noch volles Haar, die Männer nicht. Außer ihm selbst. Und das, obwohl er weder genügend Eitelkeit noch genügend Geld besaß, um sich übermäßig um sich selbst zu kümmern. Max war Lehrer, und die Tage eines Lehrers waren nun wirklich von ganz anderen Dingen besetzt als von Fragen der Äußerlichkeit.
Trotzdem fiel ihm der Unterschied auf. Und er bemerkte, dass er auch Anna auffiel. Und dass sie weit und breit die Einzigen ohne Kinder waren, dass Anna sich langweilte, als von den Smartphones der andern ein Stroboskopgewitter aus strahlenden Babygesichtern, hübsch gekleideten Kindern und frühreifen Teenagern losging. Und natürlich waren die Mensch gewordenen DNA-Stränge der andern alle besonders gelungen, besonders geliebt und so begabt, dass ihnen eigentlich keine Schule und schon gar kein Lehrer jemals gerecht werden könnten. Er spürte, wie ihn alle anschauten und sich dachten, dass der früher so undurchschaubare Max für ihr eigenes Wunderkind auf jeden Fall eine pädagogische Zumutung darstellen würde. Er sah, wie Anna sich langweilte und ekelte angesichts der Babyfotos, und plötzlich wusste er, dass sie an die drei Ks dachte: Kacke, Kotze, Kreischen. Er packte sie am Arm, zog sie nach draußen, in den dunklen Restaurantgarten, sie atmeten gleichzeitig laut aus, schüttelten lachend die Köpfe und fühlten sich frei und weit, weit weg von den andern. Wie früher. Als sie während eines gemeinsamen Semesters an der Uni zusammen bei ihm zu Hause für ein Gender-Studies-Seminar Pornofilme geschaut und analysiert hatten. Ganz sachlich, ganz freundschaftlich. Die Mutter von Max hatte im Nebenzimmer gebügelt.
Sie waren sich damals einig, dass es Menschen gab, mit denen man Sex hatte, und andere, mit denen man Pornos schaute. Und dass beides miteinander zu tun haben konnte, aber nicht musste. Dass es beim gemeinsamen Pornoschauen durchaus bei einer körperlichen und emotionalen Nüchternheit, einem wissenschaftlichen Interesse bleiben konnte. Damals hatten sie sich wunderbar abgeklärt und intellektuell gefühlt, heute musste er sich gestehen, dass sie wahrscheinlich zwei recht bornierte Kinder gewesen waren.
Das dachte sich Max, als er mit Anna im verregneten Restaurantgarten saß und krampfhaft versuchte, das aufsteigende Sodbrennen nach dem Essen zu unterdrücken, denn er wollte genauso entspannt und souverän wirken wie Anna. Die Einzige von allen, die direkt nach dem Gymnasium in die große Stadt gezogen war und sich danach keine Sekunde lang sentimental umgedreht hatte. Die andern waren fast alle in die Dörfer oder in die Nähe ihrer Kindheit gezogen, hatten das Geschäft der Eltern übernommen, den Bauernhof, die Bäckerei, das Bauunternehmen, und redeten noch immer über die gleichen Menschen wie früher. Er fragte sich, ob es nicht eigentlich der Zweck einer Existenz sein sollte, nach den Jahren im Nest in die Welt hinauszugehen, sich ihr auszusetzen und sie sich anzueignen. So wie Anna. Jedenfalls schien sie ihm enorm mondän, wie sie da unter einer tropfenden Platane stand, rauchte und ihre letzten Jahre für ihn zusammenfasste: »Studium in Berlin, Zürich, Wien« – daran konnte er sich noch erinnern, »ein Semester in Chicago. Immer gejobbt, in Fabriken, auf Messen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seither Dramaturgin, Journalistin, Kulturförderung, alles nicht so wichtig, Hauptsache, es hat mit Kultur zu tun. Eine kleine Karriere. Kinder, mein Gott, bin ich froh, dass ich das nie haben wollte. Und du?«
»Kinder? Hab ich in der Schule genug. Und alle Eltern dazu.«
»Poor you. Und sonst?«
»Dreh ich Pornos.«
»Never! Aber hast du noch mit dem Milieu zu tun?«
»Bitte? Ich bin Lehrer!«
»Tu nicht so heilig …«
»Also wirklich. Mit dem Milieu hatte ich bloß bis Mitte des Studiums zu tun.«
»Was hast du damals noch gleich gemacht? Computer gewartet in Puffs? Gegen Naturalien?«
»Softwarelösungen nennt sich das. Und ich wurde bezahlt.«
»Aha, wie die Prostituierten.«
»Genau. Wie die Prostituierten.«
»Waren die nett?«
»Die Prostituierten? Total.«
»Hm.«
Sie schwieg unter der schweren Platane, er schaute sie an, und sie sah unter all ihrer Weltläufigkeit noch genauso traurig aus wie früher. Aber auf eine glückliche Art traurig. Als wäre die Trauer ein Aggregatzustand, in den sie sich gerne und bewusst fallen ließ. Und er dachte sich, dass es schön sein müsste, mit Anna in ihre Traurigkeit zu fallen. Dass es wahrscheinlich sowieso schön sein müsste, sich mit Anna fallen zu lassen.
Noch in derselben Nacht nahmen sie sich ein Hotelzimmer und fielen einander in die Arme. Zunächst ganz freundschaftlich, ganz sachlich, dann dankbar. Weil es passte, weil sie sich wiedererkannten, weil sie sich wieder jung fühlten. Schließlich hatte diese Frage nach der ersten gemeinsamen Nacht schon vorher im Raum gestanden, spätestens als sie gemeinsam Pornos schauten. Die Erleichterung, einander endlich zu haben, war überraschend und groß. Und schnell wieder vorbei. Denn Erregung schwang in dieser Erleichterung nicht gerade viel mit, das bemerkte Max schon in jener ersten Nacht, in die er all die Jahre immer mal wieder eine leise Hoffnung gesetzt hatte. Nicht, dass Anna ihm irgendein Zeichen gegeben hätte aus Zürich, Wien, Berlin, Chicago oder sonst woher, im Gegenteil, sie schien ihn ganz einfach und schmerzlos vergessen zu haben. Aber er vergaß sie nicht. Nie. Je weiter sie sich von ihm entfernte, desto größer wurde sie als Versprechen.
Er versuchte, die Frau im Hotelzimmer mit dem Mädchen aus dem Gymnasium und der Studentin zusammenzubringen. Die Stimme war noch dieselbe, erstaunlich jung. Die Augen riesig. Das Lächeln traurig. Die Haare trug sie jetzt sehr blond, nicht mehr hennarot. Das Gesicht war schmaler. Die Figur ähnlich. Die Kleider ganz anders. Ihr Duft fremd.
Der Sex war irgendwie gar nichts. Max kam, Anna nicht. Er entschuldigte sich, ihr war das peinlich. Er fragte sich, ob sie sich jetzt fragte, wieso er mit all seinen einstigen Milieu-Kontakten kein besserer Liebhaber war. Wieso er von den Nutten mit den kaputten Computern so absolut nichts gelernt hatte. Und er kam sich vor wie ein einziger, ekelhafter, zusammengeschrumpfter Penis. Um fünf Uhr früh packte sie ihre Sachen zusammen, sagte: »Ich nehm dann mal den ersten Zug, Geld fürs Zimmer liegt auf dem Tisch, ich meld mich.« Das wars. Die erste Nacht von Max und Anna.
Nach drei Wochen schrieb sie ihm eine Mail, in der stand:
Max, mon cher, was für eine exorbitante Freude das doch war, dich neulich zu sehen. Und auch was dann noch geschah … Es musste ja … Oder? Sag, ich hab da so einen Gesellschaftstermin, er wird groß, mit rotem Teppich, Champagner … Möchtest du mich begleiten? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Und danach … Ach!
Liebste Grüße von deiner Anna.
Jedenfalls wünschte er sich das. Was Anna wirklich schrieb, war:
Max, mein Lieber, ich hab da so einen Termin, aus dem ich mich vor prophylaktischer Langeweile am liebsten wieder davonstehlen würde. Kommst du mit? Wenigstens gibt es Champagner. Und vielleicht müssten wir auch noch das eine oder andere besprechen. Geht schlecht auf elektronischem Weg.
Gruß, Anna.
Natürlich ging er hin, und natürlich war es genau so, wie Anna versprochen hatte. Der Champagner war allerdings keiner, sondern der ungeschickte Prosecco-Versuch eines Off-Space-Off-Szene-Regisseurs, der von seinem Großvater einen kleinen Weinberg geerbt hatte. Zum Glück war die Veranstaltung, bei der sich Anna sehen lassen musste, schnell vorbei.
Dann waren sie allein.
»Und jetzt?«, fragte sie.
»Jetzt«, sagte er, nahm sie in den Arm und küsste sie.
Ihre Augen wanderten verwundert über sein Gesicht und wieder von ihm weg, hin und zurück, sie sagte nichts, dann sagte sie: »Okay.«
Und so begann eine Art von Beziehung. Oder die leidenschaftsloseste Langzeitaffäre, die Max bisher erlebt hatte. Zuerst war er begeistert, wie selbstverständlich Anna ihn in ihr Leben einließ, dass sie keinerlei Neigung zur Eifersucht zeigte, wenn er schon wieder mit einer Kollegin bis Mitternacht ein Klassenlager vorbereiten musste. Dass er mit ihr ein Wochenende verbringen konnte wie mit einer interesselosen Katze, weil sie ganz zufrieden in einem Sessel saß und las, während er sich durch einen Berg von Aufsätzen zum Thema »Was macht glücklicher? Mit oder ohne Geld geboren zu werden?« pflügte.
Sie konnten einander hervorragend in Ruhe lassen, seine Freunde beneideten ihn darum. Er fand das lange Zeit über großartig und enorm großzügig von Anna, der einzigen Frau der Welt, die keine Forderungen an ihren Partner stellte. Gut, beim Sex wäre er oft froh gewesen, sie hätte es getan. Hätte einfach mal seine Hand oder seinen Schwanz genommen und ihm den rechten Weg gezeigt. Aber irgendwann verlor er sein schlechtes Gewissen, irgendwann war es ihm egal, ob sie kam oder nicht oder ihren Orgasmus nur vortäuschte oder nicht, denn ihm selbst fiel seiner nicht schwer. Und es war mitten in einem seiner einsamen Orgasmen, als er dachte: Fuck! Fuck, fuck, fuck! Weil er sich selbst und seinen mit einfältigem Glück explodierenden Schwanz sah und unter ihm die nackte Anna, die irgendwas sagte, so eine richtige Pornosatz-Sequenz, so ein »Wow! Du! Fester! Stoß mich fester!«. Jedenfalls stellte er sich das so vor, in Wirklichkeit sagte Anna nichts und blickte verstohlen auf den Wecker und wünschte sich, es wäre vorbei, weil sie am nächsten Morgen gleich zu Beginn eine große Sitzung leiten musste.
Wie auch immer, Max sah sich als Teil einer Pornofilm-Sequenz und zwei Menschen waren daran beteiligt, teilnahmslos allerdings, mechanische Puppen in einem großen Bett. Und als ihm dies klar wurde und auch, dass sie beide nicht viel mehr als die Darsteller eines Beziehungsfragments waren, da begann er sich zu entlieben. Einigermaßen langsam. Und mit Phantomschmerzen. Denn er merkte, dass ihm gerade die nicht körperliche Seite ihrer Beziehung fehlen würde, dass er Anna vermissen würde beim sonntäglichen Heftekorrigieren, dass er es lustig fand, als ihr Begleiter in die unbeholfenen Veranstaltungen bedürftiger Kulturschaffender oder sozial gehemmter Behörden einzutauchen. Aber er wusste, dass das Ende unvermeidlich war, dass sie beide alles gegeben hatten, das Revival einer früher guten Freundschaft in den Sand zu setzen. Und zwar vollkommen. Und deshalb war er nicht nur froh, sondern geradezu übermütig, als eines Morgens eine junge, neue Kollegin ins Lehrerzimmer trat und sagte: »Hi, ich bin Sarah«, und er sich dabei fühlte, als wäre Sarah nicht einfach die Neue, sondern eine Oase mitten in der Sahara. Das war gestern gewesen. Und heute war er sich sicher, dass er sich von Anna entliebt hatte.
3
Mit Cédric hatte sie sich dann doch nicht für ein Entrecôte Café de Paris entschieden, sondern bloß für ein kleines Rindstatar. Mit Pommes Allumettes. Für sie und Cédric war dies ein echtes Diätmenü. Und jetzt konnte sie trotzdem nicht einschlafen, weil Foie gras plus Brioche plus Tatar plus Pommes Allumettes am Ende insgesamt eben doch so was wie ein üppiges französisches Mahl ergab. Anna versuchte es mit autogenem Training. Ihre Mutter hatte ihr das mal gezeigt, sie wandte es wie viele Frauen ihrer Generation gegen Schwangerschafts- und Menstruationsbeschwerden an. Anna atmete langsam ein und aus und sagte sich: »Ich bin gaaaanz schweeeer. Und gaaaanz warm. Mein Solarplexus sendet beruhigende Strahlen in meinen ganzen Körper aus, in meine Beine, sie werden gaaaanz schweeer.« Ihr Herz begann wie eine wütende, anti-esoterische kleine Eisenfaust gegen ihren Brustkorb zu hämmern. »Mein Herz ist gaaaanz schweeeer, gaaaanz warm.« Ihr Herz hämmerte schneller, in ihren Waden kündigte sich ein Krampf an. Sie wechselte zu einer Einschlafmethode, die sie selbst erfunden hatte, sie nannte sie »White Noise«. Das ging so: Sie stellte sich viele unzusammenhängende Dinge gleichzeitig vor und vermengte sie im Kopf, bis sie sich gegenseitig in einem weißen Rauschen auslöschten, einem erzähltechnischen Kurzschluss, einer Sendepause. Meistens schlief sie dann sofort ein. Nur der Anfang war aufwendig. Anna probierte:
Erstens: Wem geb ich morgen Fördergelder? Okay, mit Madeleine, Vivienne und Peter bin auf Facebook schon am längsten befreundet. Aber finde ich die Arbeit, die sie heute machen, noch genauso gut wie damals, als wir uns befreundeten? Nicht wirklich, oder? Eigentlich sind sie recht faul geworden. Und der neue Bühnenbildner von Vivienne ist kacke, schaut sich niemand gerne an, fertig. Wäre es karrieretechnisch nicht viel besser, dem arrivierten alten Sack mit seinen Shakespeare-Improvisationen und diesem süßen jungen Kollektiv, das immer irgendwas mit Hitler macht, Geld zu geben? Würde ich mich da nicht ganz wundervoll bei allen beliebt machen? Mögen die mich überhaupt, die Künstler?
Zweitens: Wieso bin ich schon wieder mit Max zusammen?
Drittens: Cédric sah heute wieder fantastisch aus. Ist das, weil Schwule einfach viel weniger Sorgen haben als Heteros? Und gilt das auch für Lesben? Wieso werden dann nicht alle Frauen mit einer geschädigten Selbstwahrnehmung lesbisch? Und was ist mit mir?
Viertens: Die Grashalm-Kellnerin …
Kombiniere erstens mit drittens: Wer von Madeleine, Vivienne und Peter ist eigentlich homo? Antwort: Ich weiß es nicht! Wieso nicht? Früher wusste ich so was! Red ich zu wenig mit Menschen? Find ich das auf ihrem Facebook-Profil? Gibts da den Identitäts-Status »Happy Homo«? Fänd ich lustig.
Kombiniere zweitens mit drittens: Wann haben sich Max und Cédric zum letzten Mal gesehen? Ach ja, an meinem Geburtstag, Cédric fand Max zu langweilig, Max fand Cédric zu schwul. Hab ich ihnen das eigentlich mal gesagt? Max fragte: »Wieso müssen Schwule immer so extratuntig tun?« – »Du hast doch auch Judith Butler gelesen«, sagte ich, »das ist eben Geschlecht als Performance und so. Ganz klassisch.« Aber wenn Geschlecht eh Performance ist: Könnte dann Cédric nicht zum Beispiel auch mit mir Geschlechtsverkehr performen? Nur so theoretisch. Nicht dass ich das wollen würde. Andererseits ist Butler auch schon sehr, sehr alt. Wie wir. Max, Cédric, Anna. Alt wie Anna. Wie lange muss ich eigentlich noch leben? Nochmals so lange?
Kombiniere Butler mit viertens: Bestimmt lebt die Grashalm-Kellnerin in einer Wohngemeinschaft und träumt davon, irgendwann süße Kinder zu kriegen. Na, hat sie sich aber geschnitten. Das wird eine Katastrophe, so ein Kind im Bauch eines so dünnen Mädchens. Und die Geburt erst, die wird sie zerreißen! Wird sie in der Mitte spalten wie diesen Skifahrer, dem es auf der Piste und vor allen Skifahren schauenden Fernsehnationen die Hüfte auseinanderriss, so, dass er einen Blutschweif hinterließ im Schnee. Wie hieß der?
Kombiniere erstes und zweites mit viertens: Wäre der Grashalm Schauspielerin: Ich würde sie sofort fördern. Meinetwegen kann sie sogar tanzen oder Pantomime machen. Muss ich jetzt nicht begründen. Wäre Max Regisseur: Nein. Max ist fürs Schülertheater super. Und fürs Lehrertheater. Exzellent sogar. Er hat ja zum Beispiel für sein Alter erst einen mittelgroßen Bauch und noch alle Haare. Kein schlechtes Gesicht. Klein ist er auch nicht, hat jedoch hässliche Beine, zu viel Fußball, zu ungeschickt dabei. Vermöbelt sehen sie aus, die Beine von Max. Stört ihn das eigentlich? Sicher nicht. Kriegsverletzungen. Und fertig. Verachte ich ihn eigentlich? Nur so das allerkleinste bisschen? Und wieso bin ich schon wieder mit ihm zusammen? Ah ja, wegen der Stabilität. Und der sozialen Funktion. Und weil wir früher so schön zusammen Pornos schauen konnten. Apropos Pornos …
An dieser Stelle musste sich Anna gestehen, dass »White Noise« heute gründlich versagte. Sie stand auf, holte sich ihren Vibrator aus der Nachttischschublade, zog in ihrem Arbeitszimmer die Vorhänge zu, setzte sich an den Computer, befolgte den guten Rat einer amerikanischen Pornodarstellerin, die gesagt hatte, es gäbe nichts Besseres als japanische Zeichentrickpornos, gab die Suchbegriffe »hentai«, »sex«, »actress« und »casting« ein, ließ erneut – und jetzt weit lieber – ihren Slip fallen und machte sich daran, die diversen Spannungen in ihrem Körper auf die effizienteste Art loszuwerden, die Mensch und Technik bisher erfunden hatten.
4
Wieder einmal stank es im Treppenhaus, als hätte eine ganze Mädchen-WG ihre Tampons in einer zehn Tage alten Kohlsuppe entsorgt. Gerne wäre Lilly ins Bistro zurückgegangen, hätte sich hinter den blanken Tresen gestellt und noch ein paar Stunden länger kleines Gebäck mit teuren Aufstrichen und französische Getränke verkauft. Aber es war schon beinah Mitternacht, und Jonas war da. Es konnte sich bei dem Gestank bloß um die ewig unaufgeräumte Tofuküche der Veganpunks im zweiten Stock handeln. Gewiss müffelten da diverse Töpfe mit Tofuwasser, mehrere selbstgeschreinerte Tofupressen aus Holz und Dutzende von feuchten Tüchern vor sich hin, und dies nicht erst seit ein paar Stunden, sondern seit mindestens fünf Tagen, und Lilly hoffte, dass sie diese Woche nicht schon wieder zum Essen eingeladen würde, weder zu einem Tofucurry noch zu einer Tofupizza. Und das, obwohl die süßen kleinen Veganpunks ihre ganze Freizeit in dieser Küche verbrachten und einen Aufwand betrieben für das weiße Zeugs, wie Lilly ihn sonst nur von Kokainisten kannte. Sie kaufte sich ihren Tofu lieber fein geräuchert oder vorfrittiert im Asia-Markt.
Sie quälte sich also in der Stinkwolke in den dritten Stock, öffnete die Wohnungstür, ging in die Küche, machte das Licht an und fluchte: »Fickt euch doch in eure doofen Panzer!« Denn im Schein der roten China-Laterne stoben sie auseinander, schwarze, trocken raschelnde Kakerlaken, und Lilly spürte, wie sie das letzte bisschen Kraft verließ. Wie sie das alles nicht mehr raffte. Aber sie blieb ruhig, wartete, bis all die blöden Tiere sich irgendwohin verkrochen hatten, in eine Müslipackung oder einen Laib Brot, oder an irgendeinen andern Ort, wo sie anfangen konnten, sich mit Lebensmittelmotten zu paaren und dumme kleine Mutantenschädlinge zu zeugen. Sie traute Kakerlaken und Lebensmittelmotten restlos jede Hinterfotzigkeit zu, erst recht, wenn sie so vertraut Packung an Packung lebten wie in der WG-Küche.
Dann holte sie Besen und Schaufel, wischte ein paar tote Kakerlaken zusammen und ging damit Richtung Klo. Und stieß dort auf Alex, der bei offener Tür pisste und sagte: »Also, ich wollte dir das schon lange mal sagen. Aber jetzt, wo ich Küchendienst habe, ist es irgendwie virulent. Ich finds eklig, wenn du die Butter am Morgen nicht direkt aufs Brot streichst, sondern immer zuerst auf einen Teller tust. Die Teller kleben danach so fies aneinander, und Fett ist einfach nicht so leicht abzukriegen.« Lilly dachte, mein Gott, du elende Sacknase! Und hatte sie Alex nicht schon hundertmal gesagt, dass sie es hasste, wenn er mit seinem gebrauchten Messer den schönen Butterklotz verunstaltete? Wenn er zuvor Essiggurken oder Käse geschnitten hatte und erst danach ein Stück Butter absäbelte? War ihm eigentlich klar, wie widerlich das war? Wenn dieser Hauch von Essiggurke durch ihren Zopf mit Butter und Honig drang? Störte dies Alex nicht? Nein, natürlich nicht, er pisste ja auch bei offener Tür. Aber sie sagte nichts, sie brauchte ihn, er war der Erste gewesen, der die Sache mit Jonas verstanden und eingewilligt hatte, ihm das kleine Zimmer für ein Jahr zu überlassen. Und Alex war ein Nerd, und Jonas brauchte einen Nerd. Lilly hatte keine Zeit, mit Jonas halbe Tage lang hinter zugezogenen Vorhängen abzutauchen. Für sie bestand das Internet aus Nützlichkeit, Kommunikation und Zerstreuung. Für Alex und Jonas fing es auf seltsamen Foren an, wurde immer verschlungener und dunkler, und irgendwann gelangten sie regelmäßig an den Punkt, wo man echte Waffen, Drogen, Mörder oder Kannibalen bestellen konnte. Jonas liebte das. Und Jonas liebte Alex dafür, dass sie gemeinsam diese echten Männerfreundschafts-Dinge machten.
»Das ist wie die beiden Ermittler in der Serie True Detective«, sagte er einmal zu Lilly.
»Aha«, antwortete sie, »Alex ist der Alte, und du bist der Schöne?« Jonas grinste selig.
Weil das alles so war mit Alex, Jonas und ihr, sagte Lilly nichts wegen der Butter, sondern beschränkte ihren Kommentar darauf, die toten Kakerlaken mit einem geschickten Schubs an Alex vorbei ins Klo zu befördern.
Jetzt stand sie vor dem kleinen Zimmer und öffnete leise die Tür. Auf ihrem alten Laptop flackerte schwarz-weiß »I want to die!«. Auf dem Bett lag Jonas, schmal, blass, es roch nach Jungmännerschweiß und nach Kleidern, die einen Tag zu lang getragen worden waren. Nicht schlimm, Lilly mochte diesen Kleidergeruch, er war seltsam weich und warm, von einer angenehm unklebrigen Körperlichkeit, und sie erinnerte sich an ein paar Begegnungen mit Männern und Frauen, die genau so gerochen hatten. Begegnungen in Bars, und zuverlässig hatte Lilly zu viel getrunken und sich fallen lassen in die Arme und Betten, die zu diesem Geruch gehörten, zu diesem Nestgeruch, der nichts Böses an sich hatte, bloß einen Hauch von zu viel Laisser-faire, und von einer liebenswerten Uneitelkeit. Hauskatzen rochen ähnlich.
Lilly griff in den schwarzen Kleiderklumpen auf dem Stuhl neben dem Bett und hielt sich ein T-Shirt vors Gesicht. Am liebsten hätte sie sich zu Jonas gelegt, hätte ihren zum Auseinanderbrechen müden Körper an ihn geschmiegt, und er hätte nach ihren Händen getastet, sie umklammert und festgehalten. Jonas und Lilly. Jonas mit seiner jungen Not, von der sie genau wusste, wie weh sie tat. Im Kopf, im Herz, im Körper.
Die Not, die Not, die macht dich tot, dachte sie und ging zurück in die Küche, um die Altware des Tages, die sie aus dem Bistro mit nach Hause genommen hatte, in den Kühlschrank zu räumen. Sie setzte sich mit einem Glas Wodka an den Tisch, über ihrem Kopf surrte die Birne in der roten Laterne ein paar Sekunden lang, dann war Schluss und dunkel. Auch das noch, dachte Lilly, nahm einen letzten Schluck Wodka und legte erschöpft den Kopf auf ihre Arme. Und die erste und letzte Liebkosung dieses Tages, die sie im Wegdämmern noch spürte, war das trockene, aber nicht unangenehme Kratzen von ein paar winzigen Kakerlaken-Füßchen auf ihren Handgelenken.
5
Exakt um 3:35 Uhr erwachte Anna. Wie jede Nacht mit einer vollen Blase. Sie hatte keine Ahnung, wie sie das in den Griff bekommen könnte, sicher war es das Alter. Egal, ob sie um 18 oder 23 Uhr zum letzten Mal etwas trank, um 3:35 Uhr musste sie mal. Auf dem Klo starrte sie auf ihre Oberschenkel, auf deren Vorderseite es nichts zu sehen gab, weder ein Tattoo noch irgendwelche deplatzierten Äderchen, und fragte sich, wieso nicht ihre ganzen Beine von der Beschaffenheit dieser Oberschenkel-Vorderseite sein konnten. An die Hinterseite, auf der sie gerade saß, dachte sie lieber nicht, da war ja bekanntlich alles verloren, da hatte nichts geholfen, was sie in den letzten Jahrzehnten versucht hatte. Auch nicht das Anti-Cellulite-Gel von Oprah Winfrey, das sie in einem banalen Moment im Internet bestellt hatte. Das Gel kam in zwei großen roten Tuben, und sie fragte sich, ob es sich dabei nicht einfach um verdünnten Klebstoff handelte. Das Blöde am Leben war ja dies: Alles ließ sich auswechseln, der Job, die Wohnung, der Mensch im Bett, nur dieser verdammte Körper war in seiner Grundsubstanz immer der gleiche.