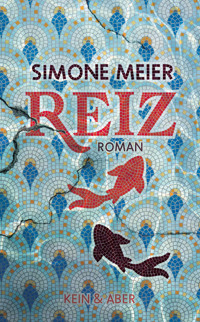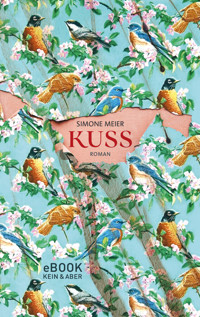
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerda und Yann sind urbane Thirtysomethings und gerade in ein heruntergekommenes altes Haus am Stadtrand gezogen. Gerda ist arbeitslos, investiert ihre ganze Energie ins Einrichten – und in eine fixe Idee: Sie leistet sich eine imaginäre Affäre. Diese ist erst nur ein Spiel, doch dann beginnt sie, Gerda mit aller Macht zu verzehren. Yann lernt ein rätselhaftes Mädchen voller Forderungen kennen. Und die Nachbarin Valerie, Anfang fünfzig und Journalistin, steht nach einem folgenreichen One-Night-Stand plötzlich vor der Frage, ob das Leben für sie ausgerechnet jetzt noch einmal neu beginnt. Von drei möglichen Liebesgeschichten finden mindestens eineinhalb nur in der Fantasie statt. Doch dann kommt alles zusammen, und aus einem Zufall wird ein Unfall.
Mit schonungslosem Blick, Witz und Melancholie seziert Simone Meier den schönen Schein moderner Existenzen und Beziehungen, bis nicht mehr nur die Fassaden bröckeln, sondern das ganze Fundament zu beben beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Simone Meier, geboren 1970, ist Autorin und Journalistin. Nach einem Studium der Germanistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte arbeitet sie als Kulturredakteurin, erst bei der Wochen Zeitung, dann beim Tages-Anzeiger, seit 2014 bei watson. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Ihr letzter Roman, Fleisch, erschien 2017 bei Kein & Aber. Simone Meier lebt und schreibt in Zürich.
ÜBER DAS BUCH
Was dem jungen Paar in seinem perfekt eingerichteten Haus widerfährt, ist nichts weniger als eine Heimsuchung: Überwunden geglaubte Rollenbilder entpuppen sich als überaus lebendig, und ungeahnte Leidenschaften brechen hervor. Eine eigenwillige Affäre nimmt ihren Lauf, und auch die Nachbarin entwickelt mit Anfang fünfzig eine ganz neue Anziehungskraft.
Schicht um Schicht demontiert Simone Meier die Fassaden moderner Existenzen und Beziehungen, bis nicht mehr nur die Mauern bröckeln, sondern das ganze Fundament zu beben beginnt. Schonungslos, witzig, melancholisch.
»Eines der Bücher, die man in einem Rutsch liest und dann gleich nochmals.«
Spiegel online zu Fleisch
Toi
Toujours toi
Rien que toi
Partout toi
Edith Piaf, »Je t’ai dans la peau«
1
Er starrte auf die Wand der Toilette. Sie war von einem appetitlichen Honig-Vanille-Gelb, und die Größe der einzelnen Kacheln erinnerte an quadratisch geschnittene Karamellbonbons. Bei einer Institutsfeier war er derart betrunken gewesen, dass er daran geleckt hatte, er erinnerte sich an den ätzenden Hauch von Putzmittel auf der Zunge. Jetzt war er nicht betrunken, nur erschöpft. Nicht zuletzt von der Frage, die sich seit Tagen in seinem Kopf festgekrallt hatte: Verwandelte sich etwa jede Hausfrau früher oder später aus Frust in eine perfektionistische Furie? Oder hatte er bloß zu viel schlechtes Fernsehen geschaut?
Yann und Gerda liebten Sendungen mit Auswanderern oder Hausfrauen. Sie liebten es, Menschen dabei zuzuschauen, wie sie ohne Geld, Sprachkenntnisse oder irgendeine andere Fähigkeit alles aufgaben, nur weil sie zu sehr träumten. Von einem Strand, einer eigenen Bar, endlich mehr Zeit, endlich neuen Tattoos. Meist war Mallorca ihr Ziel. Und nach ein paar Monaten mussten sie verschuldet, desillusioniert und tätowiert zurück in eine alte Heimat ohne weiteren Ausweg. Trotzdem hatten sie etwas gewagt. Wenn auch das Falsche.
Die Welt der Fernseh-Hausfrauen war traumlos und schlicht. Sie unterstützten ihre Töchter bei der Wahl des Hochzeitskleides oder verausgabten sich im Wettbewerb um die schönste Torte. Sie waren unausgefüllte Bestien der Biederkeit und entschädigten sich mit maßloser Pedanterie. Gerda war eine Hausfrau. Yann fragte sich, ob er daran schuld war. Ob er seine Unterschrift zu voreilig unter den Mietvertrag für das Haus gesetzt hatte. Ob er Gerda ins Hausfrauendasein hineingetrieben hatte. Schnell drückte er die Toilettenspülung und versuchte, die Frage zu entsorgen. Aber konnte man eine Frau, die nichts anderes tat, als sich mit dem eigenen Haus zu beschäftigen, etwa nicht als Hausfrau bezeichnen? Und wie kam er auf die Idee, Gerda sei frustriert? Vielleicht war sie ja glücklich.
Ihm war, als würden seine Gedanken Lärm machen. Sich durch die Tür der Toilette fräsen und kreischend in dem gelb gekachelten Raum kreisen. Sich im ganzen Institut verbreiten, bis alle wüssten: Yanns Frau macht keinen unbezahlten Urlaub, wie sie behauptet, Yanns Frau ist in Wirklichkeit arbeitslos, und weil sie für den Arbeitsmarkt nicht taugt, ist sie jetzt eben Hausfrau. Yanns Frau macht nichts, als seine Socken zu waschen, für ihn zu kochen, das Haus zu putzen, seinen Abfall und ihre Wünsche zu beseitigen. In Ermangelung von Sinnvollerem. Hoffentlich wird sie bald schwanger, würden sich seine Institutskollegen denken, dann hätte sie wenigstens ein Kind. Dann könnte sie sich wenigstens als Mutter und Hausfrau bezeichnen.
Und wenn sie es schon jetzt dachten? Egal. Er liebte Gerda. Keinen Tag hatte er in den drei Jahren ihrer Beziehung daran gezweifelt. Sie war noch immer die bezauberndste Frau, die sich jemals in sein Leben verirrt hatte, ein Rätsel, doch ein lichtes Rätsel, nicht ganz durchschaubar, aber grundsätzlich von dieser sonnigen Unbeschwertheit, die junge Floristinnen oder Cafébesitzerinnen in romantischen Filmen ausstrahlten. Er war überzeugt, dass ihre Erwerbslosigkeit bald vorübergehen würde, weil er sie für geschickt hielt, für kompetent, wenn er eine entsprechende Stelle zu vergeben hätte, Gerda würde sie bekommen. Und obwohl sie schon ohne Job gewesen war, als sie im Sommer aus der Innenstadt in das Haus am Stadtrand gezogen waren, hatte er daran geglaubt, dass ihr Glück nun wachsen könne. Ein Glück so groß wie ein Haus, hatte er sich vorgestellt, dabei hatte das Haus genauso viele Quadratmeter wie seine alte Wohnung, nämlich zweiundachtzig. Auf zwei Stockwerke verteilt. Ein süßes kleines Haus, das letzte in einer von zwölf Reihen mit je acht Häusern. Eins von sechsundneunzig Häusern also.
Wer zu Geld gekommen war, kaufte sich jetzt eins dieser alten Arbeiterhäuser, man konnte sich darin eins fühlen mit den Familien, die früher hier gewohnt hatten, den Fabrikarbeitern aus Italien, deren Kinder die Gärten und die gelben Kieswege belebt und mit Holzreifen und Bällen gespielt hatten. Jedenfalls stellte Yann sich dies gerne vor, denn das taten Arbeiterkinder doch immer auf alten Fotos. So ein Haus war eine Oase, nicht nur, weil das Grün und der Fluss nahe lagen, sondern auch eine Oase der Erinnerung an eine Zeit voller Genügsamkeit und Bescheidenheit. Die neuen Hausbesitzer richteten ihre Küchen mit handgefertigten Kacheln aus Portugal und Küchenzeilen aus England ein, und in den Gärten entstanden riesige Plateaus aus Echtholzbalken, schließlich konnte man einen dänischen Designerstuhl nicht einfach ins Gras stellen. In Gemüserabatten, die von Gartenarchitekten angelegt wurden, wuchsen ausschließlich vom Aussterben bedrohte Tomaten, weißbäuchige Auberginen und winzige, aromatische Kartoffeln, die aussahen wie altmodische Kommas.
Gerdas Komma-Kartoffeln würden gewiss die schönsten, obwohl sie das Beet selbst ausgesteckt und keine Ahnung von der gartentechnisch so unverzichtbaren Grundlagenforschung zur optimalen Sonneneinstrahlung hatte. Gerda war die virtuoseste Hausfrau, die er kannte. Als er am Morgen zur Arbeit aufgebrochen war, hatte sie im Wohnzimmer vor einer Ecke gestanden und gesagt: »Das ist ja nicht zum Aushalten!«
»Wie, nicht zum Aushalten?«, hatte er gefragt. »So Feng-Shui-mäßig?«
»Das vielleicht auch, aber die Raumproportionen stimmen nicht, da muss irgendwas hin, und zwar exakt auf dieser Höhe.« Sie zog mit ihrer Handkannte eine Linie von ihrem Schlüsselbein zur Wand.
»Ist das nicht zu tief für ein Bild?«
»Davon verstehst du nichts, geh Geld machen.«
Wenn er am Abend nach Hause kam, würde sich der Raum kaum wahrnehmbar verändert haben, sie hätte eine Wand leicht anders gestrichen, etwas aufgehängt, einen Tapetenstreifen geklebt, alles wäre stimmiger, anmutiger, aufregender. Und ohne es zu wollen, dachte er: Das also war es, was Großvater früher meinte, als er vom Feierabend schwärmte. Vom Heimkommen.
Trotzdem hätte er zu gern gewusst, was in ihr vorging, wenn sie sich stur vor eine Wand stellte oder wenn ihr über einem seiner vielen kleinen Häufchen – aus Zeitungsartikeln, Büchern, Sitzungspapieren – fast die Tränen kamen. Ob das vielleicht der Anfang einer Depression war? Er ließ sie dann lieber in Ruhe, sie dekorierte die Wand, verschob das Häufchen und wurde wieder zur normalen Gerda, die im Haus so viel Beschäftigung fand, dass sie sich keine Sorgen über ihre Lage machte. Wobei die Lage ja gar keine war. Er verdiente genug, und das Haus schien Gerdas Berufung zu sein. Es war bloß kein Modell, das man jetzt, nach rund einem Fünftel des einundzwanzigsten Jahrhunderts, noch zu vertreten wagte.
Er erinnerte sich sehr gut: Ein uralter Onkel hatte seiner Schwester zu ihrem achten Geburtstag einen Schal mit Ponys drauf geschenkt, die Schwester hatte sich gefreut und den Schal auseinander- und wieder zusammengefaltet, immer wieder, und der Onkel hatte gesagt: »Man muss den Weibern einfach was zum Aufräumen geben, damit sie zufrieden sind.«
Er hatte sich für den Onkel geschämt und sich neben seine Schwester gekniet und mit ihr den Schal minutenlang auf- und zugefaltet. Aber was, wenn der Onkel recht hatte? Nicht richtig recht natürlich, aber in Spurenelementen?
Yann war ein guter Mann, das nahm er für sich in Anspruch. Er war monogam, auch im Kopf, hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, bezahlte noch immer Kirchensteuer, um seiner Familie einen Gefallen zu tun, und unterstützte die Frauenquote. Er aß am liebsten Gerichte aus Ländern, die an Meere grenzten, schaute gerne skandinavische Serien und mochte alle Bücher von Haruki Murakami. Ikea fand er gut wegen der witzigen Werbung, H & M dagegen schlecht wegen der sexistischen Kampagnen und der Kinderarbeit. Trotz der gefährdeten Vögel befürwortete er die Windenergie. Die Vögel mussten sich eben wie jedes Lebewesen an die Windräder gewöhnen, die waren ja nicht dumm. Der Fortschritt kam schließlich auch ihnen zugute. Als Sohn eines Eisenwarenhändlers unterstützte er den Einzelhandel und das Handwerk. Er bewunderte Bauern und Bauarbeiter, aber nicht in einem konservativen Sinn. Viele dachten ähnlich wie er.
Yann war achtunddreißig. Er fühlte sich grundsätzlich unschuldig. Irgendwann wollte er Kinder. Doch diese Entscheidung würde am Ende nicht bei ihm liegen, sondern bei Gerda. Ein wenig hoffte er, dass sie den aktuellen Zeitpunkt für günstig hielt. Er wollte kein alter Vater werden. Aber wenn sie sich lieber in ihrem Job verwirklichte, würde er ihr nicht im Weg stehen. Falls sie denn wieder einen Job finden würde. Woran er nicht zweifelte. Die Notlüge mit Gerdas unbezahltem Urlaub war seinen Arbeitskolleginnen und -kollegen gegenüber unvermeidbar gewesen. Schließlich stand Yann für die Auflösung dessen, was Gerda gerade lebte. Eine Frau, vom Ernährer ausgehalten im Haushalt.
Vor Kurzem hatte er seine Eltern gefragt, was denn das Geheimnis ihrer stabilen, jahrzehntelangen Ehe sei. Der Vater hatte nichts geantwortet und zur Mutter geschaut, und diese hatte in einer ihrer blumigen Reden Zuflucht gesucht, bei denen Yann sich nie ganz sicher war, wie viel tatsächlich der gelebten Wahrheit und wie viel den Wünschen seiner Mutter entsprach.
»Eine Beziehung«, hatte sie gesagt, »ist wie eine Bibliothek voller Romane. Die einen sind Meisterwerke, die andern nicht, die einen sind leichter, die andern schwerer. Das sammelt und stapelt sich mit den Jahren, bei manchen hast du Lust, noch einmal darin zu blättern, und andere schmeißt du weg, weil du sie schon viel zu gut kennst und nicht mehr lesen magst.«
»Welchen hast du zuletzt weggeschmissen?«, wollte Yann wissen.
»Frag nicht«, sagte die Mutter und schwieg.
Natürlich hätte er es viel zu gerne gewusst. Was denn ein schlechter Roman zwischen zweien gewesen sein könnte, die seit so langer Zeit jeden Tag und jede Nacht miteinander verbrachten. Er versuchte sich zu erinnern, wann es in ihrer Ehe jemals eine Lücke gegeben hatte, in die etwas Störendes hätte eindringen können. Er wusste es nicht. Aber das Bild seiner Mutter gefiel ihm.
Er fragte sich, wie weit seine Beziehungsbibliothek in den drei Jahren mit Gerda schon gediehen war. Er sah einen riesigen Raum vor sich, mit hohen dunklen Regalen, die oben nach Art eines gotischen Kirchenfensters spitz zuliefen, und leer waren bis auf zwei schmale Bändchen, die er kaum finden konnte, weil sie sich zuunterst im hintersten Regal versteckten. Auf einem stand Gerda, auf dem andern Yann, und er fragte sich, ob darin die ineinander verschränkten Geschichten überhandnahmen oder eher die kurzen Einträge von zwei Menschen, die einander gegenseitig beobachteten. Er schüttelte auch diesen Gedanken ab, drückte sicherheitshalber noch einmal die Klospülung und dachte kurz an das viel zu teure Abendessen mit der Institutsleiterin vom Vortag, an all das Geld, das er schon die diversen Toiletten hinuntergespült hatte. Dann öffnete er die Tür und setzte ein unverfängliches Lächeln auf, das knapp vor einem starren Grinsen endete. Gerade rechtzeitig, bevor er sich selbst im Spiegel über dem Waschbecken begegnete.
2
Gerda hätte lieber Greta geheißen wie die Garbo. Greta klang imperial. Gerda dagegen mit diesem E, das zum Ä hin tendierte, war derb und erdig, es klang nach einer sehnigen norddeutschen Mittvierzigerin mit Schäferhund, aber das kam nun mal davon, wenn die Mutter ihre Tochter ums Verrecken nach dem Mädchen im Märchen von der Schneekönigin taufen musste. Das war der Unterschied zwischen ihr und Yann. Zwischen der Tochter einer alleinerziehenden diplomierten Skandinavistin und dem Sohn eines Eisenwarenhändlers. Sie hatte ihren Namen von Hans Christian Andersen, Yann hieß so, weil seine Eltern während ihrer Hochzeitsreise auf Kreta einen besonders netten Kellner namens Yannis kennengelernt hatten. »Das ist Griechisch für Hans«, hatte Yanns Vater ihr erklärt.
Es gab in Yanns Verwandtschaft bereits gefühlte einunddreißig Hansen. Gerda liebte jeden einzelnen von ihnen. Denn in Yanns Verwandtschaft kannte die Liebe keinen Preis. Es gab sie oder es gab sie nicht, aber sie war keine Verhandlungssache wie bei Gerdas Mutter. Da machten sich Funken von Liebe immer nur gegen sehr viel Bestätigung bemerkbar. Da gab es Liebe nur gegen Lob. Unmengen von Lob.
Sie wusste nicht, wie ihre Mutter dieses Lob eigentlich vor sich selbst rechtfertigte, schließlich war die Mutter nichts Besonderes und ihre Zuneigung keine warme, sondern eine äußerst kühle. Natürlich hielt sich Gerdas Mutter für sehr viel besonderer als die Eltern von Yann, sie hatte in ihrem Leben wenigstens ein Bildungsziel erreicht und Yanns Eltern nur eine kaufmännische Ausbildung, die es ihnen erlaubte, einen Laden zu führen. Und jetzt? Übersetzte sie schwedische Krimis. Aber nicht die großen Namen, sondern ein paar aus der dritten bis vierzehnten Reihe, all jene, auf die man nie von sich aus gekommen wäre, sondern die bei Amazon ganz zuletzt unter »Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch …« angepriesen wurden.
Gerda lud sich ab und zu einen davon auf ihren Kindle. Es waren entsetzlich billige Stieg-Larsson- und Jussi-Adler-Olsen-Verschnitte, in monotoner Regelmäßigkeit ging es um eine Industriellenfamilie mit irgendeinem Partikel von Nazivergangenheit, die versuchte, ein rebellisches, uneheliches Enkelkind in eine Villa an einer abgelegenen Bucht zu locken und dort aus dem Weg zu schaffen. Immer lag Schnee, und immer wurde großer Wert auf skandinavisches Design gelegt. Gerda las aus reiner Bösartigkeit in den Übersetzungen ihrer Mutter. Sie liebte die Telefongespräche, die sich daraus ergaben. Dieses »Hier Gerda! Ich wollte nur mal fragen, wies dir so geht, was du so machst?«.
»Letzte Woche ist meine Romqvist-Übersetzung erschienen. Jetzt sitz ich am neuen Sandholm.«
»Romqvist? Hab ich schon gelesen.«
»Oh! Und?«
Schweigen. Langes Schweigen. Lobverweigerung. Liebesentzug. Themenwechsel. Manchmal wusste Gerda nicht, wofür ihre Mutter und sie einander eigentlich bestraften. Aber sie machten es beide gerne und es tat immer wieder überraschend weh.
Wahrscheinlich freute sich die Mutter sogar heimlich, dass Gerda jetzt, mit zweiunddreißig, zum ersten Mal ihren Job verloren hatte. Dass sie auf der Straße stand und das tun musste, was ihre Mutter schon ihr ganzes Leben lang tat: kämpfen. Obwohl der Vergleich nicht stimmte, Gerdas Mutter hatte niemanden, Gerda hatte Yann. Einen lieben Mann. Nicht wie Gerdas Vater, ein finnischer Literaturprofessor, der die Mutter als blutjunge Studentin auf einer Tagung kennengelernt und geschwängert hatte. Der Professor war alt, verheiratet und überdies auch bald schon tot gewesen. Die Mutter hatte ihn nie wieder gesehen, er hatte gar nie erfahren, dass er in einer besoffenen Nacht in einem Land, das weit wärmer war als Finnland, ein kleines Leben gezeugt hatte.
Der Professor existierte einzig als winziges Schwarz-Weiß-Bild auf den Klappentexten wissenschaftlicher Bücher, ein älteres, aber klares, kantiges Gesicht mit Augen, die wirkten, als hätten sie gerne an nordischen Fjorden das Meer betrachtet. Er war kurz nach Gerdas Geburt gestorben. Als Kind wollte sie unbedingt ihre finnische Familie kennenlernen, sie stellte sich vor, wie sie mit ihren Stiefgeschwistern in einem hellen Holzhaus an einem See sitzen würde, es gäbe Fleisch vom selbst erlegten Elch und Heidelbeeren mit viel Sahne zu essen, auf dem Boden lägen bunte Flickenteppiche, und nach dem Essen gingen alle zusammen in die Sauna und würden sich danach mit Birkenruten abreiben.
Die Mutter hatte tausend Ausflüchte gefunden – zu weit weg, zu teuer, stell dir vor, die arme alte Witwe, die weiß doch gar nicht, dass ihr Mann sie betrogen hat, Elchfleisch ist zäh und schmeckt nach schmutziger Wäsche und so weiter. Die Wahrheit, da war sich Gerda bald sicher, war sowieso eine ganz andere. Die Wahrheit war vielleicht ein altes Foto, das sie eines Tages im Schreibtisch ihrer Mutter fand. Im Fach, wo die Mutter ihre Tagebücher aufbewahrte. Woraus die Mutter zu Recht schloss, dass Gerda in ihren Tagebüchern geblättert hatte. Ihre Mutter war in den Tagbüchern auch keine andere als in Wirklichkeit, genauso bitter, genauso langweilig. Sie hatte gehofft, etwas über Sehnsüchte oder Sex zu erfahren oder vielleicht ein paar liebe Worte über sich selbst, aber es waren bloß Notizen aus dem Unglück der Frau, mit der sie zusammenleben musste.
»Mit Gerda zur Kleiderbörse gegangen«, begann einer der Einträge, »was für den Winter gesucht und gefunden, erleichtert. Erschütternd, wie teuer so ein Kind ist.«
Oder: »Vater gefragt, ob er uns einen neuen Staubsauger zu Weihnachten schenkt. Verblüfft, wie viel das kostet. Vater hat Staubsauger versprochen. Sein Triumph, meine Demütigung.«
Die Mutter zitterte vor Wut, als Gerda das Foto auf den Tisch legte und ganz beiläufig fragte: »Wer ist das?«
»Woher hast du das?«
»Es lag auf dem Boden«, log sie, es war ihr egal.
Auf dem Foto waren zwei junge Menschen zu sehen, beide hatten lockiges Haar und trugen enge Jeans, die mittels Schnürtechnik und Farbbädern in stilbefreite Hippie-Batikhosen verwandelt worden waren. Der Mann war mager, die Frau trug keinen BH. Wirkten sie glücklich? Eher euphorisch verstrahlt. Sie sah, wie ihre Mutter auf die Zähne biss, als müsste sie die Wut über Gerda zermalmen, sah, wie sie sich in einer plötzlichen Traurigkeit entspannte und der Frau von früher ähnlich wurde.
»Eine alte Liebe«, antwortete sie schließlich, »schon lange tot, Überdosis.«
Seltsam, dachte Gerda, schon wieder ein Toter von früher. Wie viele gab es noch? Oder war der tote Professor nur eine Metapher für den toten Junkie? Eine Ersatzerzählung, weil sie sich nicht zu sagen getraute: »Hey, dein Vater ist übrigens auf einer stinkenden Matratze verreckt. Ein Glück, dass du gesund bist, ich dachte, du wirst schon im Mutterleib heroinsüchtig.«
Aber wenn es so gewesen war, wieso hatte sie dann nicht abgetrieben? Etwa, weil sie den toten Typen zu sehr liebte? Oder hatte sie Gerda mit Absicht herbeigeführt? Wollte sie nicht mehr allein sein in ihrem Kämpferinnenleben?
»War sicher auch hart für seine Familie«, tastete sich Gerda vor.
»Die? Die schmissen ihn raus, als er achtzehn wurde.«
Ach, wie praktisch, dachte Gerda, sonst könnte ich vielleicht liebevolle Großeltern haben und alles, was dazugehört! Und wir hätten Geld! So aber: nur die Mutter. Deren eigene Familie ein eigenes Elend war, dem man sich höchstens auf hundert Kilometer Distanz nähern sollte, das fand auch Gerda. Aber angenommen, sie war ein Wunschkind, wieso musste sie dann um jeden verdammten Krümel von Mutterliebe kämpfen? Wieso verweigerte ihr die Mutter mit aller Macht einen Vater? Wenn sie mich wenigstens lieben würde, dachte Gerda, wenn ich sie wenigstens lieben könnte. Sie beneidete die ganz normalen Durchschnittsfamilien. Die Abertausenden von Paaren, die sich nicht mehr füreinander interessierten und daher beschlossen, ihre ganze emotionale Energie auf ein Kind zu richten. Es quasi in den Brennstrahl ihrer aus dem Paarsein ausgelagerten Liebe zu stellen.
Yanns Familie mit all ihren Hansen fühlte sich daher für Gerda an wie ihre echte Heimat. Wie die Familie, von der sie als Kind geträumt hatte. Etwas Lebendiges, Lautes, wo Leute miteinander um große Tische saßen, redeten, lachten, und ab und zu griff ein echtes Schicksal mit fester Hand dazwischen, nicht nur eine neurotische Laune wie bei ihrer Mutter. Wenn das Schicksal derart zuschlug, fand man sich erstaunlich oft gemeinsam in einer Kirche wieder. Bei einer Beerdigung, einer Hochzeit, einer Taufe. Yann waren diese Begegnungen unangenehm, Gerda nicht. Und dies, obwohl ihr schon in früher Kindheit jegliche Regung in Richtung Religion ausgetrieben worden war.
In Yanns Familie war das Leben in jedem Moment greifbar, und es war Gerda egal, dass es weder urban noch intellektuell war. Im Gegenteil, sie wünschte sich Yanns Kindheit statt ihrer eigenen, sie sah sich als Mädchen in der Eisenwarenhandlung seiner Eltern stehen, sah sich Schrauben nach Größen sortieren und Schleifpapier nach Körnung, das grobe gelbe und das feinere kupferfarbene, sah sich neben gefährlichen Maschinen stehen, sie würde sie alle verstehen, den Winkelschleifer, die Kettensäge, all die Fräsen und Bohrer.
Hinzu kam, dass sie mit Yanns Mutter viel besser über Bücher, Filme und Serien reden konnte als mit ihrer eigenen. Weil Yanns Mutter unvoreingenommen war und nicht über den Dingen stand, sondern vor ihnen. Sie wusste, dass ihre Mutter nichts so sehr kränkte wie die Tatsache, dass ausgerechnet Yanns Mutter unter ihresgleichen als Literaturexpertin galt. Weil sie zweimal die Woche abends in der Dorfbibliothek aushalf und jede Neuanschaffung las oder zumindest durchblätterte. Über die Jahre hatte sie sich eine solide Kenntnis über die Gegenwartsliteratur und die Vorlieben der Bibliothekskundschaft erworben, und gerade deshalb wäre es ihr niemals in den Sinn gekommen, eins der fünftklassigen Bücher anzuschaffen, mit deren Übersetzung sich Gerdas Mutter ihren Lebensunterhalt sicherte. Es war eine der seltenen Kränkungen ihrer Mutter, an denen Gerda nicht oder nur indirekt schuld war.
Jetzt stand sie im Garten des kleinen Hauses, versuchte, das Röhren des vierspurigen Autobahnanschlusses am einen Ende der Siedlung auszublenden und sich auf die Bäume und den Fluss am andern Ende zu konzentrieren. Sie blickte über den niedrigen Zaun in den Garten der Nachbarin, einer Frau wie eine Krähe, mindestens zwanzig Jahre älter als sie und trotz ihres sichtbaren Alters mit diesen übertrieben schwarz gefärbten Haaren, die man sich in Gerdas Grafikerkreisen spätestens mit dreißig abgewöhnte und die sich sowieso nur mit einem japanisch akkuraten Schnitt tragen ließen. Die Nachbarin hingegen kleidete sich in schwarze Fetzen und trug ihre Haare als etwas, das in jungen Jahren eine Kaskade gewesen sein mochte, jetzt jedoch einer langsam austrocknenden Auenlandschaft mit sich schlapp dahinschlängelnden Rinnsalen glich. Zudem war sie Kettenraucherin und hatte die Nachbarschaft mit ihrem unappetitlichen Husten den ganzen Sommer über im Garten gestört. Und sie telefonierte laut. Wo Telefonieren doch derart Nullerjahre war! Gerda kannte niemanden mehr, der gerne telefonierte. Die Frau von nebenan telefonierte laut, bestimmt und viel zu gerne. Und wie Raucher das eben machten, telefonierte sie am liebsten draußen. Gerda sah drei mögliche Erklärungen für das Telefoniertemperament ihrer Nachbarin, die sich alle beliebig kombinieren ließen: Sie war irgendeine Chefin, einsam oder wahnsinnig.
Gerda hatte das leise Gefühl, dass sie die Frau kennen müsste, aus den Medien, von Facebook, aber seit sie im Haus wohnte, waren ihre Tage von so vielen leisen Gefühlen bestimmt, dass sie noch keinem nachgegangen war. Das nagendste von allen war die Sache mit Yanns Kinderwunsch. Er hatte noch nie zu ihr gesagt: »Ich will ein Kind von dir«, oder »Lass uns ein Kind zusammen machen«, trotzdem war seine Vorfreude auf das »Häuschen«, wie er es nannte, und die angrenzende »Natur«, auf all die »jungen Familien« in der Nachbarschaft, die Katzen, die er sich vorgestellt hatte, und das Singen der Vögel am Morgen alarmierend deutlich gewesen. Wann kam in einem Mann eigentlich zum ersten Mal der Kinderwunsch hoch? Wenn ihn sein Vater beim Fußballspiel anfeuerte? Wenn er zum ersten Mal Sex hatte? Wenn er glaubte, die Richtige gefunden zu haben? Hielt Yann sie für die Richtige? Und war er der Richtige für sie? Wie wusste man das?
Sie hasste die Konkretisierung solcher Fragen. Weil die Logik der Antwortführung viel zu klar war: Frau, zweiunddreißig, in Superbeziehung, in Supervorzeigehipstersiedlung, mit Supervorzeigehipsterjob, aktuell arbeitslos, pardon freischaffend und daher frei zur Verwirklichung von allerlei Lebensplänen, findet endlich zu dem, was bei Schauspielerinnen immer »ihre schönste Rolle« genannt wird. Gerda war dagegen. Nicht grundsätzlich gegen das Naturwunder oder die gesellschaftliche Maßnahme Kind, aber sicher nicht jetzt. Vielleicht in vier oder sieben Jahren. Oder auch nie. Und vielleicht ja auch nicht mit Yann. Oder doch? Und schon gar nicht in der Siedlung. Die breite Straße, der weite Fluss forderten quasi unausweichlich einen Kindstod. Sie sah eine kleine Kinderleiche auf den Grund des Flusses sinken, ein Kleidchen blähte sich im Wasser und leuchtete durch die Dunkelheit wie eine fluoreszierende Qualle. Sie sah winzig kleine, von Blut vollgesogene Wollhandschuhe auf der Straße liegen. Lebten in der Siedlung eigentlich Kinder oder nur Paare, die bald merken mussten, dass die teuren Mieten und die anstehenden Kosten für die Kindertagesstätten unvereinbar waren mit restlos allen anderen Träumen? Und dass es hier viel zu gefährlich war? Kinder belebten die Siedlung höchstens, wenn die beiden Airbnb-Häuser von Familien gemietet wurden.
Sie wusste wirklich nicht, was in seinem Kopf schiefgelaufen war, als er diesen Ort mit einem Kinderwunsch verknüpft hatte. Gut, mit einem bisher noch nicht geäußerten Kinderwunsch. Vielleicht wollte er ja gar keins? Ehrlich, man müsste mal reden. War das so schwer? War es. Weil es so viel angenehmer war, über Leichteres zu reden. Über die elfte Folge der siebten Staffel dieser HBO-Serie mit dieser Schauspielerin, die gerade auch auf Netflix was laufen hatte, zum Beispiel. Das waren die Gespräche, mit denen sie und Yann gern ihre Abende verbrachten. Gespräche über Meta-Realitäten. Oder sie besuchten gemeinsam eine Tagung an Yanns Institut. Diesem Thinktank, der die Welt auch nicht retten konnte. Da saßen sie dann und lauschten gemeinsam dem Vortrag eines amerikanischen oder asiatischen Experten über den Zusammenhang von Klima, Kapital und Katastrophe. Doch kaum waren sie zu Hause, schauten sie Hartz-IV-Fernsehen oder eine ihrer vielen Lieblingsserien und fanden dort alles sehr viel lebensnäher oder visionärer dargestellt als von irgendeinem Bitcoin-Philosophen. Aber Yann verdiente mit der Organisation und der Publikation derartiger Vorträge sein Geld. Und am Ende hing immer alles am Geld.
Eigentlich hatte sie ja erwartet, dass er zuerst arbeitslos sein würde. Weil ihr Job ein praktischer war und seiner irgendwie substanzlos. Weil sie sich nicht sicher war, ob Yann wirklich so klug war, wie sein Jobprofil es zu verlangen schien. Sie fand einige seiner Institutskollegen klüger als ihn. Etwa Alex, einen smarten, immer schwarz gekleideten Politologen. Eigentlich fand sie Alex auch schärfer als Yann. Aber das war ungerecht, Yann war ihr Mann, sie hatte sich für ihn entschieden, er war gut zu ihr und hatte die beste Familie, die man sich wünschen konnte. Sie hatten ein gutes Leben. Punkt. Oder gehabt. Bis sie ihren größten Auftrag verloren hatte, weil das Theater, für dessen grafische Corporate Identity sie zuständig gewesen war, plötzlich größere Subventionen erhielt und sich jetzt eine Angeber-Agentur leistete. Die Subventionen hatte das Haus nicht zuletzt deshalb erhalten, weil Gerdas letzte Plakatkampagne so publikumswirksam gewesen war. Sie hatte ein paar Studien über Cute Marketing gelesen, über den Einsatz von Tierbabys und Kleinkindern in der Werbung, und ohne weiter nachzudenken ein rotbraunes Eichhörnchen gezeichnet, das statt einer Nuss einen Totenkopf in den Pfoten hielt. Ein Hamlet-Eichhörnchen. Es war plakativ, naiv und ein Erfolg. Jetzt warb das Theater mit silberner Typografie auf anthrazitfarbigem Grund, und keiner schaute mehr hin. Die allgemeine Auftragslage ihrer Agentur schwächelte schon lang.
Eines Morgens, es war der Tag vor ihren Ferien, bestellte der Chef sie in sein Büro, und als sie es wieder verließ, fühlten sich ihre Beine an wie faule Bananen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Falsch, eigentlich hatte sie schon immer damit gerechnet, vom ersten Tag in ihrer ersten Anstellung an, schließlich war ihre Skepsis kerngesund, ja überaus blühend. Sie hatte sich schon oft ausgemalt, wie das berühmte Leben unter der Brücke wäre, wie sie in einem Verschlag aus feuchtem Karton hausen und versuchen würde, mit weggeschmissenen Feuerzeugen tote Ratten zu rösten. Wie sie zwischen Nacht und Morgen die sich leerenden Partymeilen der Stadt nach Bechern und Flaschen mit tröstlichen Alkoholresten absuchen würde. Und ab und zu würde sie gegen viel zu wenig Geld auf einem Parkplatz mit fremden Männern ficken. Einer von ihnen hieße Yann. Ein anderer Alex. Beide würden sie retten wollen, aber sie könnte sich nicht entscheiden. Das heißt, ihr Herz schlüge für Yann. Der Rest ihres Körpers möglicherweise für Alex. Und der Kopf, dieses mit sanftem Nachdruck berechnende Anhängsel ihres Gefühls- und Sexuallebens? Es wäre ein Dilemma. Weshalb sie sich in einer kalten Winternacht in den Fluss stürzen würde.
Sie sah das alles ganz genau vor sich, in schwarz-weißen Comicstrips, harte Konturen, schnelle Schraffuren, alles sehr dunkel. Sie war wirklich keine weltbewegende Grafikerin. Aber eine brauchbare. Eine, die immer eine Idee hatte und nie eine Deadline verpasste. Sie war höflich, hübsch und hatte sich bis eben noch für beliebt gehalten. Quasi für eine Cheerleaderin ihrer Agentur. Was natürlich Bullshit war, Zweiunddreißigjährige sollten sich nicht mit Cheerleaderinnen identifizieren. Hatte sie nicht eben der Praktikantin erklärt, dass der dreißigste Geburtstag den ersten richtigen Peak im Leben darstellte? Eine Plattform, auf der man sich stolz einmal um sich selbst drehen und das Erreichte mit einer gewissen Sicherheit betrachten konnte? Fuck Sicherheit! Andere hielten Gerda offenbar für einen Unsicherheitsfaktor im großen Getriebe des Erfolgsdrucks. Für die war sie verzichtbar. Sie hätte nicht erwartet, dass sich ein Rauswurf derart beschissen anfühlen würde. Sie war jetzt entwertet.
Grußlos verließ sie an jenem Tag die Agentur. Was sollten die andern schon zu einer Versagerin sagen? Was würde Yann jetzt von ihr denken? Draußen regnete es nicht, sie hätte zu gern ins Nasse hineingeschluchzt. Doch vor ihr lag die Stadt und räkelte sich genüsslich unter der schönsten Frühsommersonne.
Dann schrieb sie Yann eine SMS: »Bin gefeuert. Triff mich in der Bar. Schnell. Bitte. Küssdich.«
Yann schrieb zurück: »SHIT!!! Komme sofort. By the way: Wir haben das Haus! Küssdichzurück.«
3
Valerie hatte eine genaue Vorstellung davon, was einst auf ihrem Grabstein stehen sollte: »Dirty old woman«. Das hatte sie sich verdient. Sie war hart im Ton und hart im Nehmen. Und weil der Gedanke an ihre Grabinschrift unweigerlich ihre Laune hob, beschloss sie, auch gleich noch eine ihrer Lieblings-E-Mails zu schreiben. »Sehr geehrter Herr S.«, begann sie, »ich bin leider nicht in der Lage, Ihre gestrige Premiere zu besprechen. In den fünfundzwanzig Jahren meiner Karriere habe ich nämlich noch nie eine in jeder Sekunde derart miserable Inszenierung gesehen. Was auch eine Leistung ist.«
Oh, sie liebte es! Noch eine! »Sehr geehrte Frau F., ein Glas Ihres neuen Haselnuss-Brotaufstrichs hat sich auf meinen Schreibtisch verirrt. Gewiss möchten Sie ein Feedback? Nun, der Geschmack ist bitter, die Konsistenz erinnert an nassen Beton und verklebt einem auf höchst unangenehme Art den Mund. Was bezwecken Sie damit? Wollen Sie Menschen töten?«
Sie versicherte sich kurz, dass sie unbeobachtet war, und zog ihre Mundwinkel nach oben. Saß da, vor ihrem Computer, mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. Es war eine kosmetische Maßnahme. Vor ein paar Monaten hatte sie in den Spiegel geblickt und mit Entsetzen diese Angela-Merkel-Lefzen links und rechts von ihrem Mund entdeckt. Dieses traurige, hundeartige Gehänge. Und dann hatte sie mit Gesichts-Yoga begonnen. Wozu ihr wiederum jede Geduld fehlte, weshalb sie das Yoga auf intensives Lachen reduzierte. Es schien zu wirken, ein paar Muskeln im hängenden Garten ihres Gesichts erstarkten wieder. Fatalerweise vertieften sich dadurch die Fältchen um ihre Augen. Sie sollte wirklich nicht so oft in den Spiegel schauen. Knapp über fünfzig war sie jetzt, da war es einfach vorbei mit der Schönheit. Und mit dem guten Gehör offenbar auch, anders konnte sie sich nicht erklären, dass sie immer lauter wurde beim Reden. Und? Musste ihr das peinlich sein? Schließlich war ihre Stimme angenehm tief. Nichts war so schrecklich wie das ewige Girlie-Gepiepse reifer Frauen, deren einzige Sünde im Leben war, dass sie gelegentlich aus Versehen einen Tampon das Klo runterspülten.
Valeries Floristin war so. Eine naive Nervziege der Sonderklasse, die Dinge sagen konnte wie: »Tulpen sind die kleinen Kinder unter den Blumen. Wenn du einer Tulpe viel Wasser gibst, dann trinkt sie einfach immer alles aus, und danach ist ihr schlecht und sie beugt das Köpfchen über den Vasenrand, als ob sie sich übergeben müsste.«
Valerie hasste sie dafür. Trotzdem hatte sie sich breitschlagen lassen, was mit der Floristinnen-Tochter zu machen. Schließlich mussten sich jetzt alle bei der Zeitung verständnisvoll um die sogenannte Jugend kümmern, erstens wegen der Eroberung neuer Leserschichten, zweitens, weil der junge Mensch von heute Aufmerksamkeit für selbstverständlich hielt. Die Tochter der Floristin war ein Prototyp, eine dieser jungen Frauen mit Gehirnverschiebung, die ums Verrecken berühmt werden wollten. Sie konnte im Blumenladen ihrer Mutter stehen und sagen: »Mama, ich will Influencerin werden.«
Toller Titel für einen Artikel, dachte Valerie.
Und dann hatte sie die bescheuerte Idee gehabt, das Gör für die Zukunftsseite des Gesellschaftsteils zu interviewen. Sie hatte sich vorgestellt, dass sich aus der Idee der Influencerin etwas Kluges, Abstraktes entwickeln ließe über Visionen und Ängste einer Generation, mit der sie sonst nur in Berührung kam, wenn der achtzehnjährige Praktikant den Geschirrspüler ihres Großraumbüros ausräumte. Menschen unter zwanzig waren ihr sonst zuwider. Schon als sie selbst in diesem Alter gewesen war, hatte sie keine Ahnung gehabt, wie man mit ihnen umging. Sie war zu langsam im Kopf für die Witze der anderen, sie schrieb lieber als zu reden.
Doch seit sie Journalistin war und die andern sie lesen mussten, gehörte sie zur ersten Garde. Zumindest hatte sie mal dazugehört. Jetzt wunderte sie sich, dass die Reputation von früher sie überhaupt so weit getragen hatte. Jetzt wartete sie noch auf den Ruhestand und vielleicht auf einen Preis fürs Lebenswerk. So was stand ihr zu. Schließlich wurde sie immer häufiger von jüngeren Journalistinnen als »Role Model« und »Vorkämpferin« erwähnt. Dabei hatte sie gar nie gekämpft. Schon gar nicht für andere. Oder für »die Frauen«. Sie wollte einzig eine gute Zeit mit sich und den Geschichten der anderen haben. Denn das war ja das Großartige am Journalismus: Dass man seine berufliche Existenz auf einem ganz und gar parasitären Fundament aufbauen konnte.
Den Preis fürs Lebenswerk sah sie sehr plastisch vor sich, es wäre wie die Oscars, glitzernd und gehoben, mit viel Champagner und Fotografen, das People-Magazin des Fernsehens wäre dabei, Ex-Missen würden wie dekorative Pfauen aus der Menge stechen, es wäre ein Gottesdienst des Glamour, hohl und schön zugleich. Valerie hatte schon ewig den Traum, dass sich in derartigen Nächten Wunder vollziehen müssten und dass sie selbst zum Ereignis würde. Dabei wusste sie genau, dass sie sich schon beim Betreten des Saales fühlen würde wie immer: nichtig, unbedeutend und passé. Zudem zählte ein Journalistenpreis noch weniger als das schäbigste Gesellschaftsevent. Journalistenpreise wurden am späten Nachmittag in Mehrzweckhallen außerhalb der Stadt vergeben, ein paar Kleinindustrielle, Filialleiter von Banken und Menschen aus diffusen Verwaltungsräten versammelten sich für ein Zeitungsfoto mit dem Preisträger, der letztlich nur ein Vorwand war, um die eigene Großherzigkeit gegenüber dem kreativen Prekariat zu feiern. Zu trinken gab es sauren, warmen Weißwein, Fleischplatten färbten sich vor Müdigkeit langsam grau, der Preisträger schaute unter seiner Maske inniger Dankbarkeit immer trauriger, Valerie fühlte mit ihm.