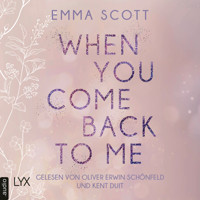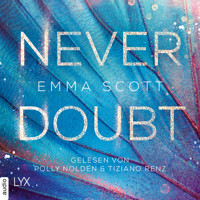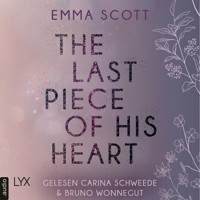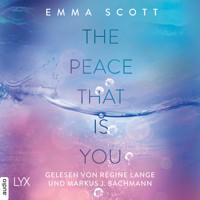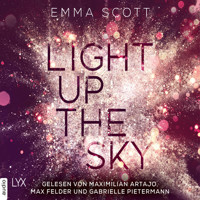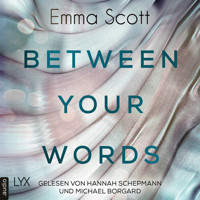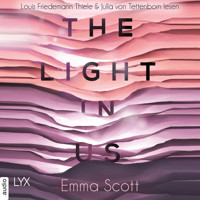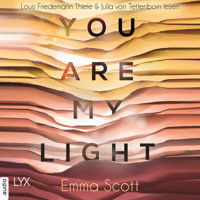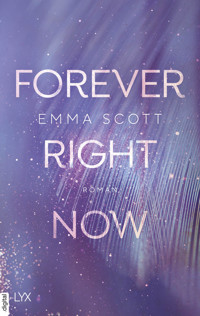
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Only Love
- Sprache: Deutsch
Kann ihre Liebe gegen die Schatten der Vergangenheit bestehen?
Darlene Montgomery will in Seattle ganz von vorn anfangen und sich auf ihre Karriere als Tänzerin konzentrieren, nachdem sie endlich ihre Drogenprobleme überwunden hat. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist in die Probleme ihres attraktiven Nachbarn Sawyer hineingezogen zu werden. Der junge Vater kämpft nicht nur darum, sein Jura-Examen zu schaffen, sondern auch um das Sorgerecht für seine Tochter. Aber bald schon kann Darlene sich ein Leben ohne ihn und die kleine Olivia nicht mehr vorstellen. Doch als ausgerechnet ihre eigene Vergangenheit Sawyers Aussichten bedroht, sein Kind behalten zu dürfen, wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt ...
"Emotional, brillant, wunderschön!" BEWARE OF THE READER
Band 2 der Only-Love-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Playlist
Widmung
Teil 1
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Teil 2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
Emma Scott
Forever Right Now
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
ZU DIESEM BUCH
Darlene Montgomery will ganz von vorn anfangen und sich endlich auf ihre Karriere als Tänzerin konzentrieren, nachdem sie ihre Drogenprobleme überwunden hat. Ihr Neustart in Seattle ist allerdings holprig und das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist in die Probleme ihres attraktiven Nachbarn Sawyer hineingezogen zu werden. Der Jurastudent kämpft nicht nur darum, sein Examen zu schaffen, während er sich um seine Tochter kümmert. Zu allem Überfluss machen ihm die Großeltern der Kleinen auch noch das Sorgerecht streitig. Obwohl Darlene sich geschworen hat, Männern erst einmal fernzubleiben, solange sie ihr eigenes Leben noch nicht im Griff hat, kann sie nicht mitansehen, wie Sawyer leidet, und greift ihm unter die Arme, wo sie nur kann. Bald schon sind er und die kleine Olivia ihr so sehr ans Herz gewachsen, dass sie sich ein Leben ohne die beiden nicht mehr vorstellen kann. Doch als ausgerechnet Darlenes eigene Vergangenheit Sawyers Aussichten bedroht, sein Kind behalten zu dürfen, wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt.
PLAYLIST
Marcy Playground: Sex and Candy
Marian Hill: Down
Linkin Park: One More Light
LP: Tightrope
Madonna: Open Your Heart
Big Bad Voodoo Daddy: You and Me and the Bottle Makes Three Tonight
Ella Fitzgerald: Cheek to Cheek
The Glenn Miller Band: In the Mood
The Cure: To Wish Impossible Things
LP: Muddy Waters
Kander and Ebb: Cell Block Tango: Chicago, the Musical
Mandy Moore: Only Hope
Für die, die heimliche Kämpfe kämpfen: Lasst euer Licht nicht ausgehen. Dieser Roman ist für euch.
TEIL 1
Coincidentia oppositorum (lat. für Zusammenfall der Gegensätze; Philos.): Die Offenbarung des Einsseins von Dingen, die man zunächst für verschieden hielt.
PROLOG
Sawyer
15. August, vor zehn Monaten
Ich hörte die Türklingel kaum, so laut waren die hämmernde Musik und das Lachen und Reden von etwa hundert meiner engsten Freunde. Jackson Smith, der auf der anderen Seite des Raums stand, deutete mit dem Kopf auf mich und grinste breit. Er hatte sich als Idris Elbas Roland, der Revolvermann, verkleidet, passend zu meinem Mann in Schwarz. Er blickte über die kostümierten Gäste – alle hatten sich wie ein Bösewicht aus einem Film oder Comic angezogen – und formte stumm die Worte Du bist dran.
Ich hob die Augenbrauen und neigte den Kopf zu der schönen Rothaarigen im Poison-Ivy-Kostüm neben mir. Sie war im zweiten Jahr am Hastings College und fragte mich aus, welche Dozenten im dritten Jahr, meinem Jahr, die strengsten waren, aber ich glaube nicht, dass sie zuhörte. Ihr Blick wanderte immer wieder zu meinem Mund.
Jackson schüttelte den Kopf, machte der hübschen Oberschwester Ratched neben ihm schöne Augen und hob dann mit einem übertriebenen Achselzucken die Hände.
Ich seufzte in Richtung meines besten Freundes und kratzte mich mit dem Mittelfinger am Auge.
»Ich geh kurz die Tür aufmachen«, sagte ich zu Poison Ivy. Ich glaube, sie hatte gesagt, dass sie Carly oder Marly hieß. Nicht, dass es wichtig war. Ihr Name war nicht, was mich an ihr interessierte. Ich warf ihr mein, wie meine Freunde es nannten, typisches Aufreißerlächeln zu. »Hältst du mir den Platz frei?«
Carly/Marly nickte, legte den Kopf schief und lächelte zurück. »Ich geh nirgendwo hin.«
»Gut«, sagte ich, und so, wie unsere Blicke sich trafen und einander nicht auswichen, war es, als hätten wir einen Pakt besiegelt.
Ich werd heute Nacht flachgelegt werden.
Ich warf Jackson ein triumphierendes Lächeln zu, woraufhin er scherzhaft salutierte. Ich lachte und bahnte mir einen Weg durch unsere Wohnung.
Jackson, zwei andere Typen und ich hatten in Upper Haight, San Francisco, ein viktorianisches Haus gemietet. Es gab keine Verbindungshäuser am Hastings College of the Law der University of California, also kam unser zweistöckiges Haus dem am nächsten. Unsere Partys waren berüchtigt, und ich freute mich zu sehen, dass diese keine Ausnahme werden würde. Die Gäste wippten zu »Sex and Candy« aus Jacksons hochmodernem Soundsystem. Sie lächelten mich an, klopften mir auf den Rücken oder beugten sich vor, um betrunken die Musik zu überschreien und festzustellen, dass diese Übeltäter-Party »die beste Party ever« sei. Ich lächelte einfach zurück und nickte.
Jede Party bei uns war »die beste Party ever«.
Ich öffnete die Tür, ein charmantes Lächeln und eine Entschuldigung auf den Lippen, falls es Nachbarn waren, die sich über den Lärm beschwerten. Mein Lächeln glitt mir vom Gesicht wie eine Maske, und ich starrte eine Frau an.
Die junge Frau, das dunkle Haar zu einem unordentlichen Pferdeschwanz gebunden, aus dem sich Strähnen lösten und ihr schmales Gesicht umrahmten, starrte zurück. Ihre Augen waren dunkel und rot gerändert. Sie trug ausgewaschene Jeans, ein fleckiges T-Shirt und mühte sich mit einer riesigen, schweren Tasche ab, die über ihrer Schulter hing. Alter Alkohol strömte aus ihren Poren – der Gestank von jemandem, der sich letzte Nacht die Kante gegeben hatte.
Was ich vor mir sah, kämpfte mit einer verschwommenen Erinnerung an dasselbe Mädchen, das neben mir an einer Bar stand und ausgelassen lachte, Drinks runterkippte wie Wasser, mich in einem Taxi küsste. Ich hatte wieder den Geschmack von Wodka Cranberry auf der Zunge und dann ihren Namen.
»Molly … Abbott?«
»Hi Sawyer«, sagte sie und verlagerte das Gewicht eines Babys in ihren Armen.
Ein Baby.
Mein Magen krampfte sich zusammen, und meine Eier versuchten, sich in meinen Bauchraum zurückzuziehen. Die verschwommene Erinnerung wurde grell und lebendig, war plötzlich von brutaler Klarheit.
Es war etwas über ein Jahr her. Ein Sommertrip nach Vegas. Der Kuss im Taxi hatte zu betrunkenem Gefummel auf Mollys Bett in ihrer winzigen Wohnung und der mit halbem Ohr gehörten Versicherung geführt, dass sie die Pille nähme. Und dann war ich ohne auch nur die geringste Sorge in ihr drin gewesen.
»Oh, Scheiße«, entfuhr es mir.
Molly lachte nervös und hängte sich die riesige, vollgestopfte Nylontasche über die andere Schulter. »Tja, nun, hier sind wir«, sagte sie und stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick über meine Schulter zu werfen. »Du feierst ’ne Party? Sieht cool aus. Tut mir leid, dass ich einfach so reinplatze, aber …«
Ich trat in die Diele und schloss die Tür zum Wohnbereich. Die Musik und das Lachen wurden abgeschnitten, schienen nun ferner. Mein Blick schoss zu dem Baby, das in eine ausgeblichene, schmutzige Decke mit gelben Teddybären gewickelt war. Mein Herz dröhnte in meiner Brust wie eine schwere Trommel.
»Was … was tust du hier?«
»Ich war in der Stadt«, sagte Molly, schluckte schwer, wich meinem Blick aus. »Ich wollte dich ihr vorstellen.«
»Ihr vorstellen …«
Molly schluckte wieder und sah mich an, als würde es sie Mühe kosten. »Kann ich reinkommen? Können wir … reden? Nur eine Minute. Ich will dir nicht die Party verderben.«
»Reden.«
Vor Schreck war ich wie blöd. Ich hatte für meinen Abschlussjahrgang an der Uni San Francisco die Rede gehalten, jetzt war ich ein Einser-Jurastudent am Hastings College, aber ich konnte nur wie ein Papagei wiederholen, was ich zuletzt gehört hatte. Mein Blick schoss wieder zu dem Baby, dessen Gesicht von mir abgewandt war.
Mich ihr vorstellen. Verdammte Scheiße.
Ich blinzelte, schüttelte den Kopf. »Ja, äh, klar, Komm rein.«
Als ich Molly die Tasche abnahm, wurde mein Arm von dem Gewicht regelrecht runtergezogen. Ich wuchtete sie mir über die Schulter und schob Molly zwischen den Übeltätern hindurch in mein Zimmer, das von der Küche abging. Der Raum war dunkel, und ich knipste die Lampe an. Molly blinzelte, sah sich um.
»Das ist ein schönes Zimmer«, sagte sie. Ihre Jeans war dreckig, und eine der Taschen war nach außen gestülpt. Ihr Kostüm war nicht böse Krankenschwester oder Hexe, sondern Obdachlose mit Baby.
»Das Haus ist toll. Riesig.« Sie setzte sich auf die Bettkante, hielt das Baby im Arm. »Und du siehst gut aus, Sawyer. Du studierst Jura, stimmt’s? Du wirst Anwalt werden?«
Ich nickte. »Ja.«
»Ich hab auf deiner Facebook-Seite gelesen, dass du für einen Bundesrichter arbeiten wirst, wenn du den Abschluss machst. Das ist was Besonderes, oder? Klingt wie ein richtig guter Job.«
»Ich hoffe es«, sagte ich. »Noch habe ich den Job nicht. Ich muss erst den Abschluss machen, die Zulassungsprüfung schaffen, und dann muss er mich noch auswählen.«
Ich stand jetzt schon wahnsinnig unter Druck. Mein Blick schoss wieder zu dem Baby, und mein Mund wurde trocken.
»Aber das klingt gut, Sawyer«, sagte Molly. »Scheint, als würde es gut laufen bei dir.«
»Es läuft ganz okay.« Ich holte Luft. »Molly …?«
»Sie heißt Olivia«, sagte sie und schob das Baby ein bisschen höher. »Das ist ein guter Name, oder? Ich wollte einen, der … klug klingt. Wie du.«
Mein Magen hatte sich fest verknotet, und meine Beine wollten, dass ich zur Tür hinausrannte, ohne mich noch einmal umzusehen … Stattdessen sank ich neben Molly aufs Bett, wie ein Magnet von dem Bündel auf ihrem Arm angezogen.
»Olivia«, murmelte ich.
»Ja. Und sie ist wirklich klug. Weit für ihr Alter. Sie kann schon den Kopf hochhalten und so.«
Molly schlug die Decke vom Gesicht des Babys zurück, und mir stockte der verfluchte Atem. Ich sah eine rundliche Wange, kleine, geschürzte Lippen und fest geschlossene Augen. In Mollys Atem lag Alkohol, genau wie in meinem, von dem »Spezialpunsch«, den einer meiner Mitbewohner gemacht hatte. Aber Olivia roch sauber, nach Puder und einem nicht definierbaren süßen Duft, der wahrscheinlich Babys vorbehalten war.
»Sie ist hübsch, nicht wahr?«, sagte Molly und sah mich nervös an. »Sie sieht aus wie du.«
»Wie ich …«
Vor meiner Tür dröhnte gedämpft die Party. Junge Leute lachten und tranken und knutschten wahrscheinlich … genau wie ich vor dreizehn Monaten.
»Bist du sicher, dass sie …?« Ich konnte die Worte nicht sagen.
Molly nickte ruckartig. »Sie ist von dir. Hundertprozentig.« Sie biss sich auf die Lippe. »Willst du sie mal halten?«
Verflucht, nein!
Meine Arme streckten sich aus, und Molly legte das Baby hinein.
Ich betrachtete Olivia, wünschte mir, in ihrem kleinen Gesicht etwas zu erkennen. Einen Hinweis, ein Raunen des Erbguts, dass sie wirklich von mir war. Aber sie sah überhaupt nicht wie Molly oder ich aus. Sie war einfach ein Baby.
Mein Baby?
Molly schniefte, und ich schaute auf und sah, wie sie Olivia und mich anlächelte. »Du bist ein Naturtalent«, sagte sie leise. »Das wusste ich.«
Ich blickte zu dem Baby hinunter und schluckte einen Kloß aus sämtlichen dem Menschen bekannten Gefühlen hinunter.
»W-wie alt ist sie?«
»Drei Monate«, sagte Molly. Sie stieß mich mit dem Ellbogen an. »Erinnerst du dich an die Nacht? War ziemlich wild, oder?«
Mein Kopf schoss nach oben. »Du hast gesagt, dass du die Pille nimmst.«
Sie zuckte zusammen und schob sich eine Locke hinters Ohr. »Hab ich auch. Hat nicht gewirkt. Das passiert manchmal.«
Ich sah sie ungläubig an, dann fiel mein Blick wieder auf das Baby in meinen Armen. Sie bewegte sich im Schlaf, strich sich mit der kleinen Faust übers Kinn. Eine Hälfte meines unbezwingbaren Herzens machte die Schotten dicht, als würde ein Sturm aufziehen, verbesserte die Abwehr, zog Mauern hoch, denn das hier ging nicht. Die andere Hälfte staunte über die winzigen Bewegungen dieses Babys, als wären es kleine Wunder. Mir war gleichzeitig zum Lachen, zum Weinen und zum Schreien zumute.
»Ich wäre fast nicht gekommen«, sagte Molly. »Ich wollte nur, dass du sie kennenlernst und … hier sind wir.«
»Bist du in der Stadt? Hast du eine Wohnung …?«
Ich fragte mich, ob Molly bei mir einziehen musste, und die Realität der Situation war wie ein Eimer Eiswasser. Es lagen noch neun Monate Jurastudium vor mir. Ich musste die Zulassungsprüfung machen und bestehen – und zwar beim ersten Mal –, wenn ich irgendeine Chance haben wollte, die Stelle als Assistent von Richter Miller zu bekommen. Sie war das Ticket zu meiner Traumkarriere als Bundesstaatsanwalt.
»Verdammt, Molly. Ich … ich kann kein Baby haben«, sagte ich und wurde lauter. »Ich bin verflucht noch mal erst dreiundzwanzig.«
Molly schniefte. »Ach ja?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Du kannst ein Baby haben, Sawyer. Wer vögeln kann, kann auch ein Baby haben. Und wir haben gevögelt.«
Ich knirschte mit den Zähnen, stieß jedes Wort langsam hervor: »Du hast gesagt, du würdest die Pille nehmen …«
Sie starrte mich an, und ich wusste, es war sinnlos. Die Worte immer wieder zu wiederholen würde das Baby in meinen Armen nicht wie von Zauberhand verschwinden lassen. Vielleicht hatte die Pille versagt, oder Molly hatte gelogen und sie gar nicht genommen, aber irgendwo in den verschwommenen, alkoholdurchtränkten Erinnerungen an diese Nacht gab es diesen Moment, in dem ich mir gesagt hatte, ich sollte ein Kondom benutzen – wie ich es mit Ausnahme dieses einen Mals immer tat.
»Scheiße«, flüsterte ich, und eine schreckliche Traurigkeit erfasste mich, als ich in Olivias kleines Gesicht starrte. Traurigkeit in Anbetracht der Angst und Beklommenheit, die mit ihr fest zu einem Bündel verschnürt waren. Ich atmete tief ein. »Okay. Was machen wir jetzt?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Molly, und die Hände in ihrem Schoß zuckten. »Ich … ich wollte dich nur sehen. Sehen, wie es dir geht, und dich wissen lassen, dass sie von dir ist. Ich habe viele Fehler gemacht im Leben. Mache ich immer noch.« Sie lächelte matt. »Aber du … du bist ein guter Typ, Sawyer. Das weiß ich.«
Ich runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf. »Das bin ich nicht. Gott, Molly …«
»Kann ich mal kurz dein Bad benutzen?«, fragte sie. »Es war ’ne lange Fahrt.«
»Klar«, sagte ich. »Den Gang runter, die erste Tür links.«
Sie atmete ein und beugte sich vor, um das Baby auf die Stirn zu küssen, dann stand sie rasch auf und ging.
Ich hielt Olivia und sah zu, wie sie aufwachte. Ihre Augen öffneten sich blinzelnd und sahen mich zum ersten Mal. Sie waren blau wie Mollys, nicht braun wie meine, aber ich spürte, wie sich etwas in mir veränderte. Es war wie ein winziger Riss in meinem Wesen, der erste von vielen, der irgendwann zu einer kompletten Auflösung meiner Person führen würde und zu der Neuerschaffung von jemandem, den ich kaum wiedererkannte.
»Hi«, flüsterte ich meiner Tochter zu.
Meine Tochter. Oh Gott …
Plötzlich bekam ich Panik. Ich hob den Kopf und sah mich hektisch im Zimmer um, blickte zu der großen Tasche am Boden, zu dem leeren Platz, wo Molly gesessen hatte. Mir stockte der Atem, als mein Gehirn langsam begriff, was passiert war.
Blitzschnell stand ich mit dem Baby im Arm auf und rannte in den Wohnbereich, wo die Party in vollem Gange war. Der Lärm machte Olivia Angst, und ihre Schreie wirkten auf die Party wie ein Feuerwehrschlauch, löschten alles, bis die Musik ausging. Gespräche und Lachen erstickten. Ich sah mich im Raum um, suchte nach Molly und traf nur auf entgeisterte Blicke und Kichern. Jackson starrte mich mit einer Million Fragen in den Augen an. Meine anderen Mitbewohner glotzten erstaunt. Carly/Marlys sexy Lächeln war Verwirrung und Mitleid gewichen. Ich nahm kaum etwas davon mehr wahr, als ich entdeckte, dass die Haustür leicht angelehnt war.
Oh mein Gott …
Zwischen Olivias lauter werdenden Schreien stieß jemand ein schnaubendes Lachen aus. »Diese Party ist so was von vorbei.«
1
Darlene
15. Juni, heute
Die Musik begann mit einem einsamen Klavier. Ein paar ergreifende Töne, dann die sanfte, klare Stimme einer Frau.
Ich begann auf dem Boden, barfuß in Leggings und einem T-Shirt. Nichts Professionelles, keine Choreografie. Ich hatte gar nicht die Absicht gehabt herzukommen, war nur zufällig auf der Straße vorbeigelaufen. Der Raum war frei gewesen, und ich hatte ihn für eine halbe Stunde gemietet, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Beim Bezahlen hatten meine Hände gezittert.
Ich schaltete die Gedanken ab, ließ meinen Körper der Musik zuhören. Ich war eingerostet, aus der Übung. Meine Muskeln waren befangen, meine Arme und Beine zögerten, bis der Beat einsetzte – ein blechernes Becken und ein unkomplizierter Elektro-Beat –, und dann ließ ich los.
Are you down …?
Are you down …?
Are you down, down, down …?
Ich ging in eine Rückbeuge, ließ mich fallen, wand mich mit kontrollierten Bewegungen – mein Körper eine Reihe fließender Formen, sich biegend, sich schlängelnd, sich wiegend im Rhythmus, der ruhiger wurde, sich wieder auf das Klavier und die Stimme der Sängerin reduzierte – eindringlich und einsam.
Are you down …?
Der Takt wurde wieder deutlicher, und ich stand auf, durchquerte im Zickzack das Studio, sprang, schleppte mich, machte drei Drehungen mit herumwirbelndem Kopf, streckte die Arme nach oben und dann seitwärts, griff nach etwas, um mich festzuhalten, und fand nur Luft.
Are you down …?
Meine Muskeln erwachten bei dem Tanz, schmerzten, klagten über die plötzliche Beanspruchung. Mein Atem ging schwer, Schweiß rann mir zwischen den Schulterblättern hinab.
Are you …?
Are you …?
Are you …?
Schweiß tropfte mir vom Kinn, als ich auf die Knie fiel wie eine Bettlerin.
… down?
Ich sog die Luft ein, und ein schwaches Lächeln ließ meine Lippen zucken. »Vielleicht nicht.«
In der U-Bahn zurück zu dem schäbigen Apartment in Brooklyn, wo ich mit meinem Freund wohnte, wurde mein Puls nicht langsamer. Unter meinem alten grauen Männersweatshirt klebte mir der Schweiß am Rücken. Ich hatte gerade getanzt. Zum ersten Mal seit so langer Zeit. Es war ein winziger und doch riesengroßer Schritt; er überwand eine so große Leere.
Heute trat ich in den feuchten Juni von New York City. Vor drei Jahren war ich nach einer dreimonatigen Haftstrafe wegen Drogenbesitzes aus dem Brooklyn Metropolitan Detention Center entlassen worden. Anderthalb Jahre später hatte ich bei einer Silvesterparty eine Überdosis genommen. Mein absoluter Tiefpunkt.
Und diese ganze Zeit hatte ich nicht getanzt – es fühlte sich falsch an, mir etwas zu erlauben, was ich liebte, nachdem ich meinen Körper und meinen Geist vergiftet hatte. Aber Roy Goodwin, der beste Bewährungshelfer der Welt, hatte mir geholfen, die notwendigen Schritte anzugehen, um meine Bewährung zu verkürzen. Ich würde noch ein weiteres Jahr verpflichtet sein, zu Meetings von Narcotics Anonymous zu gehen, aber ich konnte neu anfangen. Und ich war kurz davor, die Ausbildung zur Massagetherapeutin zu beenden.
Und heute hatte ich getanzt.
Alles würde gut werden. Ich kriegte meinen Kram auf die Reihe. Und Kyle … Ich konnte die Beziehung zu Kyle in Ordnung bringen. Wir hatten nur eine schwierige Phase, das war alles. Eine schwierige Phase, die schon zwei Monate andauerte.
Meine Hoffnungen schwanden mit einem Seufzer. Gerade heute Morgen hatte ich drei Versuche gebraucht, bis er auf seinen Namen reagiert hatte. In letzter Zeit war sein Lächeln voller Rechtfertigungen, und sein Blick hatte etwas Unverbindliches. Ich kannte das. Es würde kein großes Drama geben. Keinen Riesenkrach. Er würde einfach verschwinden. Vielleicht einen Brief oder eine Textnachricht hinterlassen.
Trotz der Hitze erschauderte ich, und ich ging schneller, als könnte ich vor meinen Gedanken weglaufen. Ich fragte mich – zum millionsten Mal –, ob ich versuchte, Kyle zu halten, weil ich ihn mochte oder weil ich den Gedanken nicht ertrug, dass mir noch eine Beziehung entglitt.
»Es ist noch nicht vorbei. Noch nicht«, sagte ich, als ich in meinen Kampfstiefeln unsere Straße entlangmarschierte.
Diesmal würde ich nicht versagen. Nicht schon wieder. Diesmal würde ich es richtig machen. Ich war seit über einem Jahr clean und noch länger mit Kyle zusammen. Meine bisher längste Beziehung. Ich war keine Versagerin. Nicht mehr. Ich würde einfach noch deutlicher an ihm festhalten, wenn das nötig war.
Im dritten Stock des heruntergekommenen Treppenhauses öffnete ich die Tür zu Wohnung 3C, trat ein … und wäre fast über die Reisetasche gestolpert. Kyles Reisetasche. Sie war so vollgestopft, der Reißverschluss sah aus, als würde er jeden Moment aufplatzen. Ich machte die Tür hinter mir zu und sah auf, blinzelte, als würde der Anblick so weniger wehtun.
Kyle stand an der kleinen Küchenarbeitsplatte und schrieb einen Brief. Als er mich sah, legte er den Stift hin. Langsam.
Einen Brief also, keine Textnachricht.
»Hey, Babe«, sagte er und sah mich kaum an. »Es tut mir leid, aber ich …«
»Nein«, sagte ich, »tu das nicht.« Ich umfasste meine Ellbogen. »Du wolltest es mir nicht einmal sagen?«
»Ich … ich wollte keine Szene.« Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durch das strubbelige blonde Haar. »Es tut mir leid, Darlene. Wirklich. Aber ich kann das nicht mehr.«
»Was kannst du nicht mehr?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, schon okay. Ich will es nicht hören. Nicht schon wieder.«
Schon wieder genüge ich nicht. Bin nicht gut genug. Nicht witzig oder hübsch oder sonst was genug.
»Habe nicht genug festgehalten«, murmelte ich.
»Darlene, ich mag dich, aber …«
»Es tut dir leid, aber. Du magst mich, aber.« Ich schüttelte den Kopf, Tränen schnürten mir die Kehle zu. »Geh, wenn du gehen willst, aber sag nicht noch mehr. Du machst es nur noch schlimmer.«
Er seufzte und sah mich flehend an. »Komm schon, Dar. Ich weiß, es liegt nicht nur an mir. Du fühlst es auch. Der Tank ist einfach leer. Wir rackern uns ab und hoffen, dass irgendetwas Funken schlägt und wieder Feuer fängt. Aber wir wissen beide, dass das nicht passieren wird.« Er seufzte und schüttelte den Kopf. »Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an mir. Es liegt an uns.«
Ich machte den Mund auf, um etwas zu sagen. Es zu leugnen. Zu schreien und zu fluchen und zu toben.
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte ich.
Kyle seufzte wieder, aber diesmal erleichtert. Er kam zu mir, und ich umarmte ihn, versuchte, das Gefühl seiner Arme um mich in mich aufzunehmen. Ich atmete seinen Geruch ein, hielt mich an ihm fest. Dann atmete ich aus, und er löste sich von mir.
Er ging zur Tür, und ich trat in unsere kleine Küche.
Kyle wuchtete sich die Tasche auf die Schulter. »Mach’s gut, Dar.«
Ich wandte den Blick ab, dann schloss ich die Augen beim Geräusch der sich schließenden Tür. Das Klicken war so laut wie eine Ohrfeige.
»Mach’s gut«, murmelte ich.
»Bist du sicher, dass du das willst?«, fragte Zelda. Ein quietschend in den Busbahnhof einfahrender Bus übertönte beinah ihre Worte, und ein leichter sommerlicher Regenschauer streute Diamanten in das lange dunkle Haar meiner Freundin.
Beckett, ihr Liebster und mein bester Freund, stand neben ihr und überragte sie. Instinktiv beugte er sich ein wenig vor, um sie vor den Elementen zu schützen. Ich glaube, er merkte es nicht einmal. Seine Mundwinkel waren herabgezogen, und er runzelte die Stirn. Vor Sorge waren seine blauen Augen wachsam.
»Ich bin sicher«, antwortete ich und schob mir den scheißschweren Rucksack höher auf die Schultern. Ein Gepäckträger kam, nahm mir die grüne Army-Reisetasche ab und verstaute sie unten im Bus. »Ob ich auch bereit dafür bin, ist eine andere Frage.«
»Und bist du bereit dafür?«, fragte Beckett mit einem leichten Lächeln.
Zelda stieß ihn mit dem Ellbogen in die Seite. »Sehr witzig.«
Mein Blick wanderte liebevoll und ein bisschen neidisch zwischen ihnen hin und her. Zelda und Beckett hatten ihr »glücklich bis an ihr Lebensende« gefunden, sie veröffentlichten ihre Graphic Novels und waren wahnsinnig verliebt. Ich war neidisch auf das, was sie hatten, eine Form der Liebe, die für jemanden mit meiner Vergangenheit nicht möglich schien. Aber ich verließ die Stadt gar nicht, um jemanden zu finden. Ich ließ jemanden zurück. Mein altes Ich.
Zelda und Beckett zurückzulassen war beängstigend, aber weil sie meine besten Freunde waren, wusste ich, sie würden nicht einfach aus meinem Leben verschwinden, wenn ich aus New York wegging.
»Verdammt, ich gehe weg aus New York.«
»Oh ja«, sagte Zelda. »Und du gehst nicht einfach nur aus New York weg, sondern gleich auf die andere Seite des Landes.« Sie schürzte die Lippen und sah mich mit ihren großen grünen Augen an. »Was war es noch gleich, was San Francisco hat und Brooklyn nicht?«
Die Chance, an einem Ort neu anzufangen, an dem niemand mich als ehemalige Drogensüchtige kennt.
»Einen Job, einen NA-Sponsor und einen Untermietvertrag für sechs Monate«, sagte ich und brachte ein Lächeln zustande. »Keine Angst, falls meine neue Stadt mich in Stücke reißt, bin ich Weihnachten wieder hier.«
»Es wird super laufen«, sagte Beckett und zog mich in seine Umarmung.
Ich hielt mich an ihm fest. »Danke.«
»Und ruf an, wenn du etwas brauchst. Jederzeit.«
Mein Lächeln gefror, und ich verbarg mein Gesicht an seiner Jacke. Mich rief nie jemand an, der Hilfe brauchte. Ich war die, die anrief, nicht die, die angerufen wurde.
Aber das kann ich ändern.
Zelda war jetzt dran mit ihrer Umarmung, die nach Zimt und Tinte roch. »Hab dich lieb, Dar.«
»Ich hab dich auch lieb, Zel. Und dich, Becks.«
»Pass auf dich auf«, sagte Beckett. Der Regen wurde hartnäckiger. Beckett hielt seine Jacke über Zelda.
»Haut ab, bevor ich anfange zu heulen«, sagte ich und scheuchte sie weg.
Sie gingen los, und als sie außer Sicht waren, stellte ich mich in den Regen und wandte mein Gesicht zum Himmel.
Nichts war wie der Regen in New York. Ich ließ mich ein letztes Mal davon taufen, bevor ich in den Bus stieg, und betete, in San Francisco sauber und neu wieder auszusteigen.
Leider hat eine dreitätige Busreise nichts Reinigendes an sich.
Fast fünftausend Kilometer später – die meiste Zeit hatte eine alte Dame an meiner Schulter geschnarcht – trat ich aus dem Greyhound-Bus in die klare Morgensonne von San Francisco. Sie war eher golden und metallisch, anders als das dunstige Gelb New Yorks, und ich reckte mich in ihrem Licht, hieß es willkommen. Ich ließ mich davon durchströmen, stellte mir vor, es sei ein goldener Lichtstrahl, der mich mit mentaler Stärke erfüllte, mit der Willenskraft, ein besserer Mensch zu werden. Die Wärme der Sonne verwandelte mich nicht durch Magie in eine von Zeldas Comic-Superheldinnen, aber sie fühlte sich trotzdem gut an.
Nachdem der Gepäckträger den Bauch des Busses geleert hatte, holte ich meine große Army-Tasche und hängte sie mir über die Schulter, zusätzlich zu meinem lila Rucksack. Ich trat hinaus auf den Platz vor dem Busbahnhof und suchte nach einem Linienplan, um den Weg in mein neues Viertel zu finden. Mein Blick fiel auf einen jungen Typen, der an einem Betonpfeiler lehnte und die Menge suchend musterte. Er sah gut aus nach Hollywood-Art, wie ein Schauspieler, der einen Rocker aus den 50ern spielte, mit zurückgegeltem blonden Haar und einem Kiefer wie gemeißelt. Er trug ein weißes T-Shirt, Jeans und schwarze Stiefel. Alles, was ihm noch fehlte, war eine hinters Ohr geklemmte Zigarette.
Er entdeckte mich und stieß sich mit der Schulter von dem Pfeiler ab. »Darlene Montgomery?«
Ich blieb stehen. »Ja? Wer …? Max Kaufman?«
»Ganz genau«, sagte er und bot mir seine Hand.
»Bist du nicht ein bisschen jung, um ein Sponsor zu sein?«, fragte ich, und mein Blick wanderte über seine breite, muskulöse Brust, dann hinauf zu seinem hübschen Gesicht und den durchdringenden blauen Augen.
Er ist viel zu heiß, um mein Sponsor zu sein. Gnade mir Gott.
»Die da oben schienen zu glauben, dass ich Erfahrung genug habe, um ein bisschen helfen zu können«, sagte Max. »Ich habe den Weg der Verderbtheit schon früh eingeschlagen.«
Ich grinste. »Fortgeschritten für dein Alter?«
Max grinste zurück. »Der Erste in der Klasse im Jugendknast.«
Ich lachte, dann stieß ich einen Seufzer aus. »Verdammt, du bist total süß.«
»Verzeihung?«
Ich stützte eine Hand auf die Hüfte und drohte ihm mit dem Finger. »Ich sag dir am besten gleich, dass ich geschworen habe, für ein Jahr nichts mit Männern anzufangen. Also egal was, es wird nichts zwischen uns passieren, verstanden? Wenn ich dich irgendwann mal nachts heulend und verzweifelt anrufe, musst du stark sein, okay?«
Max lachte ungläubig.
»Ich sag das nur halb im Scherz«, fuhr ich fort. »Ich will gar nicht so dreist sein und denken, dass du mit mir ins Bett wollen würdest, aber ich kann dir garantieren, dass ich mindestens eine einsame Nacht haben werde, und du siehst krass gut aus. Keine gute Kombi.«
Max lachte noch lauter. »Ich kann jetzt schon sagen, dass ich diese Aufgabe lieben werde. Aber deine Keuschheit ist nicht in Gefahr, Darlene, versprochen. Ich bin schwul.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Ich glaub dir kein Wort.«
»Großes Ehrenwort.«
»Super, okay«, sagte ich, »aber das heißt nicht, dass du diesen Telefonanruf nicht trotzdem kriegst. Ich sag’s ja nur.«
Max lachte leise und schüttelte den Kopf. »Ich denke, damit kann ich umgehen.« Er bot mir seinen Arm, und ich hakte mich unter. »Dann sehen wir uns mal deine neue Bude an.«
»Du bist mein offizielles San-Francisco-Willkommenskomitee?«
»Für dich persönlich organisiert von Narcotics Anonymous und der Justizbehörde.«
Ich räusperte mich. »Drei Treffen pro Woche sind übertrieben, oder? Ich bin seit anderthalb Jahren clean.«
»Nicht meine Entscheidung«, sagte Max. Er sah mich an. »Du weißt, dass du keins auslassen darfst, ja?«
»Mache ich nicht«, sagte ich. »Und selbst wenn ich vielleicht eine oder zehn einsame Nächte haben werde, heißt das noch lange nicht, dass ich wieder anfange. Mache ich nicht. Niemals.«
Max lächelte dünn. »Gut zu wissen.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte ich. »Du hast das alles schon tausendmal gehört.«
»Stimmt, aber es ist ein guter Anfang.«
Wir wandten uns San Francisco zu, und ich sah mich überall um, nahm meine neue Stadt in mich auf. Auf dem Straßenschild an der Ecke stand »Folsom and Beale«. Die Buchstaben waren schwarz auf weiß, nicht wie in New York weiß auf grün.
»Brandneu«, murmelte ich.
»Was meinst du?«, fragte Max.
»Nichts.«
Vom Busbahnhof führte Max mich unter die Erde, und wir nahmen eine Muni-Bahn – so hieß der öffentliche Nahverkehr in San Francisco – Richtung Stadtzentrum. Verglichen mit New Yorks U-Bahn-System wirkten die roten, grünen und gelben Linienverläufe auf dem Plan unkompliziert.
»Sieht gar nicht so schlimm aus.«
»Die Stadt misst nur etwa zwölf mal zwölf Kilometer«, sagte Max und hielt sich an der Stange über seinem Kopf fest, während die Bahn kreischend zu meiner Untermietwohnung in einem Viertel namens Duboce Triangle fuhr. »Groß genug, um sich wie eine richtige Stadt anzufühlen, aber nicht groß genug, um sich zu verlaufen.«
»Das ist gut«, sagte ich. »Ich bin nämlich nicht hier, um mich zu verlaufen.«
»Im Gegenteil«, sagte Max. »Du bist hier, um dich zu finden.«
»Wow, das ist tiefsinnig.«
Er zuckte mit einer Schulter. »Stimmt es denn nicht?«
Ich knuffte seinen Arm. »Bist du schon im Dienst?«
»Rund um die Uhr. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Ich weiß, wie schwer es ist, neu anzufangen.« Max kratzte sich am Kinn. »Oder auch nur einfach weiterzumachen, wenn man’s genau nimmt.«
Ich lächelte, da sich Wärme in meiner Brust ausbreitete. »Hattest du so jemanden wie dich als Sponsor während deiner Genesung? Ich hoffe, ja.«
Max’ klare blaue Augen trübten sich ein wenig, und sein Lächeln wurde angespannt. »Ja und nein.« Die Bahn kam kreischend zum Stehen. Wir waren wieder über der Erde, und der Tag war strahlend. »Hier müssen wir raus.«
Wir stiegen aus, und Max warf sich meine Army-Reisetasche über die Schulter, als wäre sie federleicht, während mein vollgestopfter Rucksack sich anfühlte, als würde er tausend Kilo wiegen.
»Ich hoffe, es ist nicht weit zu laufen«, sagte ich.
»Wie war noch gleich die Adresse?«
Ich sagte sie ihm, und er führte mich nach Westen die Duboce Street entlang.
»Dies ist ein gutes Viertel«, sagte Max. »Du hast hier etwas gefunden?«
»Meine Freundin meinte, es ist das letzte viktorianische Haus mit Mietpreisbindung in ganz San Francisco.«
»Deine Freundin hat wahrscheinlich recht«, sagte Max. »In den meisten Teilen der Stadt kriegen die Leute ungläubige Lachanfälle, wenn sie das Wort ›Mietpreisbindung‹ hören.« Er grinste. »Und dann fangen sie an zu weinen.«
»Dann erzähle ich dir nicht, was ich an Miete zahle.«
»Besten Dank.«
»Und was machst du so, wenn du nicht jede Minute des Tages damit verbringst, mein Sponsor zu sein?«, fragte ich.
»Ich bin Notfallpfleger an der Uniklinik hier.«
»Echt? Das war also kein Witz. Du rettest rund um die Uhr Leben.«
Er zuckte lässig mit den Schultern, aber sein Lächeln sagte mir, dass er das gern hörte. »Und was ist mit dir? Hast du einen Job in Aussicht?«
»Habe ich«, sagte ich. »Tagsüber Massagetherapeutin …«
»Ja?«, fragte Max in mein Schweigen hinein. »Normalerweise gibt es eine zweite Satzhälfte.«
»Ich habe mal getanzt«, sagte ich langsam. »In meinem alten Leben, wenn du weißt, was ich meine.«
»Tue ich«, sagte er. »Altes Leben, Drogenleben, neues Leben. Der Lebenszyklus der Genesung. Also hat das Tanzen das Drogenleben überlebt, um im neuen Leben wieder in Erscheinung zu treten?«
»Das muss sich erst zeigen«, sagte ich mit einem kleinen Lächeln. »Aber ich habe Hoffnung.«
Max nickte. »Manchmal braucht man nicht mehr.«
Wir gingen an einer langen Reihe viktorianischer Häuser entlang, eins neben dem anderen in einer Vielzahl von Farben. Ich sah auf den Zettel mit der Adresse, dann auf ein zweistöckiges cremefarbenes Haus zwischen einem kleineren beigen und einem in der Farbe von altem Backstein.
»Das ist es«, sagte ich und zeigte auf das cremefarbene Haus.
»Du machst Witze.« Max starrte mich an. »Da wirst du wohnen? Allein?«
»In einer Einzimmerwohnung im zweiten Stock«, sagte ich und rückte den Rucksack zurecht. »Es ist wirklich hübsch, oder?«
»Wirklich hübsch?« Max konnte sich gar nicht wieder einkriegen. »Dieses Haus hat eine Mietpreisbindung?«
»Schon wieder dieses Wort. Wirst du lachen oder weinen?«
»Weinen.« Er pfiff durch die Zähne. »Das hier ist wie ein Einhorn, das vierblättrige Kleeblätter frisst, während es regenbogenfarbene Haufen in Form der Lottozahlen scheißt.«
Ich lachte. »Nun, es ist nur für sechs Monate. Dann muss ich ausziehen und mir etwas Neues suchen.«
»Das wird richtig gemein werden«, sagte Max. »Nach diesem Paradies wird es dich schockieren, wie wir anderen kleinen Leute in San Francisco überleben.«
»Ach, ich zieh einfach zu dir.«
Er lachte. »Vielleicht. Aber ich könnte in ein paar Monaten weg sein. Vielleicht schon früher.«
Ich ließ die Schultern hängen. »Was? Neee. Sag das nicht. Ich mag dich jetzt schon viel zu gern.«
»Ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich habe einen Job in Seattle in Aussicht.« Max sah mich warmherzig aus seinen klaren blauen Augen an. »Ich mag dich auch. Ich glaub, ich hab mich noch nie so schnell mit jemandem angefreundet.«
»Ich verschwende nicht gern Zeit«, sagte ich grinsend. »Willst du mit reinkommen und dir mein Einhorn ansehen?«
»Damit ich noch neidischer bin? Ein andermal. Ich muss eigentlich …« Er zog sein Handy aus der Gesäßtasche seiner Jeans und sah nach, wie spät es war. »Oh, Mist, ich muss rennen. Meine Schicht fängt in zwanzig Minuten an«, sagte er. »Aber ich trag dir noch die Tasche hoch.«
»Nichts da, das schaff ich.« Ich nahm sie ihm von der Schulter und ließ sie auf den Bürgersteig fallen.
»Sicher?«
»Ich kann mein Zeug tragen, Mann.«
»Na gut.« Max hielt mir die Hand hin. »Hat mich gefreut, Darlene.«
Ich sah die Hand stirnrunzelnd an und umarmte ihn. Er legte die Arme um mich, und ich spürte, wie seine breite Brust beim Kichern vibrierte.
»Mmmh, du riechst nach Bus.«
»Eau de Greyhound.«
Er grinste noch, als er sich von mir löste. »Wir sehen uns Freitagabend. Im YMCA in der Buchanan Street, Raum 14. Pünktlich um neun.«
Ich verzog den Mund. »Freitagabend? Uh.«
»Enttäuscht?« Er hob die Hände und ging rückwärts zurück in Richtung Bahn. »Heul dich in deinem mietpreisgebundenen Penthouse aus.«
Ich lachte, wuchtete mir die Army-Tasche mit einem Grunzen auf die Schulter und ging zu dem Haus. Es war wirklich schön und sehr gut instand gehalten. Ich drehte den Schlüssel im Schloss und trat in eine kleine Diele.
Ich war keine Architektin, aber man sah, dass das Haus einmal ein Einfamilienhaus gewesen und jetzt in einzelne Wohnungen aufgeteilt war. Ich blickte hinter eine Wand, die kein zurechnungsfähiger Hausbesitzer in eine Diele eingezogen hätte, und entdeckte einen kleinen Raum mit einer Münzwaschmaschine und einem ebensolchen Trockner. Auf der anderen Seite der Diele war eine Tür mit einer 1 darauf. Eine Topfpflanze und eine Fußmatte in strahlenden Farben schmückten den Eingang. Gedämpft konnte ich spanisch klingende Musik hören und das Geräusch von Kinderlachen.
Ich schleppte meine Army-Tasche eine Treppe hinauf zu einem merkwürdigen Treppenabsatz – wieder eine neu gebaute Konstruktion, um den ersten Stock ein wenig abzutrennen. Auf der Tür in diesem Stockwerk stand eine 2, und davor gab es weder eine Fußmatte noch eine Pflanze oder sonst irgendeine Dekoration. Stille auf der anderen Seite.
Ich ging noch eine Treppe hoch. Die Decke war niedriger, und es gab eine Schräge, und Tür Nummer 3 öffnete sich zu einer kleinen Einzimmerwohnung. Bett, Tisch, Stuhl, Küche und ein briefmarkengroßes Bad. Die Freundin in New York, die mir den Untermietvertrag vermittelt hatte, hatte gemeint, die Hauptmieterin – eine Frau namens Rachel, die für Greenpeace arbeitete – hätte außer Bettwäsche, Handtüchern und Geschirr alles ausgeräumt. Es hätte nicht perfekter sein können; ich brauchte nicht viel.
Langsam breitete sich ein Lächeln auf meinen Lippen aus, und ich machte die Tür hinter mir zu. Ich ging zum Fenster, wo ich wegen der Dachschräge ein wenig den Kopf einziehen musste. Der Blick nahm mir den Atem. Die Reihen viktorianischer Häuser führten den Hügel hinauf, und jenseits ihrer Dächer lag die Stadt ausgebreitet vor mir. Es war eine andere Art Stadt als New York. Eine ruhigere Stadt, mit bunten alten Häusern, Hügeln, dem grünen Rechteck eines Parks, alles vom Blau der Bucht umrahmt.
Ich holte Luft und stieß sie mit aufgeblasenen Wangen aus.
»Ich werde das schaffen.«
Aber nach der dreitägigen Busfahrt war ich zu müde und überwältigt, um die Stadt gleich in diesem Moment erobern zu wollen. Ich ging zu meinem mitgemieteten Bett und ließ mich bäuchlings darauf fallen.
Der Schlaf griff sofort nach mir, und Musik schlich sich in meine auseinanderdriftenden Gedanken.
Ich tanzte.
Are you down …?
Are you d-d-d-down …?
Ich lächelte an meinem mitgemieteten Kissen. Es roch nach Waschmittel und der Person, die hier eigentlich lebte. Einer Fremden.
Bald würde es nach mir riechen.
Are you down, down, down …?
»Noch nicht«, murmelte ich und sank in den Schlaf.
2
Sawyer
In Lernsaal 2 des UC Hastings College of the Law war es still, abgesehen von Seiten, die umgeblättert wurden, und klackernden Tastaturen. Studierende saßen beieinander auf Sesseln, verbarrikadiert hinter Laptops und Kopfhörern.
Meine Lerngruppe, bestehend aus Beth, Andrew und Sanaa, saß auf Sofas und Sesseln im Kreis, beugte sich über die Arbeit, und niemand machte einen Witz oder eine spöttische Bemerkung. Ich vermisste Jackson, aber der Mistkerl hatte den Nerv besessen, den Abschluss ein Quartal vor mir zu machen.
Die erbarmungslosen Neonröhren an der Decke brannten mir in den müden Augen, und der Text auf der Seite vor mir verschwamm. Ich blinzelte, konzentrierte mich und machte im Geiste einen Schnappschuss von einem Paragraphen des kalifornischen Familienrechts. So mit dem Bild im Kopf schrieb ich mir in meinen eigenen Worten auf, was ich sah. Um es mir einzuprägen.
Als ich mir alles notiert hatte, lehnte ich mich im Sessel zurück und ließ die Augen zufallen.
»Hey Haas«, sagte Andrew eine Millisekunde später. Ich konnte sein selbstgefälliges Lächeln in den Worten hören. »Willst du den Rest der Stunde verschlafen?«
»Vielleicht mach ich das, wenn du die Klappe hältst«, sagte ich, ohne die Augen zu öffnen.
Er grunzte und schnaubte, ging aber nicht darauf ein. Jackson hätte eine scharfzüngige Erwiderung parat gehabt, und wir hätten uns einen kleinen Schlagabtausch geliefert, um herauszufinden, wer besser darin war, den anderen zu beleidigen. Andrew war nicht Jackson.
»Die Familienrechtsklausur wird mich umbringen«, jammerte Andrew. »Fragt mich jemand ab?«
»Paragraph 7602?«, fragte Beth.
»Äh … Scheiße.« Ich hörte, wie Andrew mit dem Stift auf den Tisch klopfte. »Es liegt mir auf der Zunge …«
Ich lächelte bei mir. Mein Schwerpunkt war Strafrecht, aber seit einer gewissen Übeltäter-Party vor zehn Monaten war Familienrecht mein inoffizielles Nebenfach.
Im Kopf blätterte ich mein Fotoalbum der Familiengesetzgebung durch bis zu Paragraph 7602 und rezitierte: »Das Eltern-Kind-Verhältnis gilt gleichermaßen für jedes Kind und jedes Elternteil, ungeachtet des Ehestands der Eltern.«
Schweigen. Ich machte ein Auge auf. »Sorry. Ist einer meiner Lieblingsparagraphen.«
»Schon klar«, schnaubte Andrew und nahm seinen Laptop auf den Schoß. »Okay, mal sehen, was du noch draufhast, Haas.«
Die anderen beugten sich interessiert vor. Was ich konnte, war neu. Nur sehr wenig entkam der Dunkelkammer in meinem Kopf. Namen und Gesichter, jahrealte Erinnerungen bis ins kleinste Detail; selbst ganze Textseiten kannte ich auswendig – Wort für Wort –, wenn ich sie oft genug gelesen hatte. Ich weiß nicht, wie ich an ein fotografisches Gedächtnis gekommen war, aber Gott sei Dank hatte ich es, sonst hätte ich die letzten zehn Monate nicht überlebt. Nicht mit nur drei oder vier Stunden Schlaf jede Nacht.
»Welcher andere Paragraph ist auf Paragraph 7603 anwendbar?«, fragte Andrew selbstgefällig. Er war irgendwie ein Arsch. Er glaubte, bei dem wahnsinnigen Stress des Jurastudiums ein besseres Gefühl zu haben, wenn ich ihm die Antwort schuldig blieb. Ich hatte nicht vor, ihm ein besseres Gefühl zu geben.
»Paragraph 3140«, sagte ich. Ich war auch irgendwie ein Arsch.
»Laut Paragraph 7604 kann ein Gericht während eines anhängigen Verfahrens eine einstweilige Sorge- und Umgangsanordnung treffen, wenn …?«
»… ein Eltern-Kind-Verhältnis laut Paragraph 7540 besteht und die Sorgerechts- und Umgangsanordnung zum Besten des Kindes ist.«
»Warum kommst du überhaupt her?«, jammerte Andrew und klappte seinen Laptop zu.
»Um dir die Antworten zu geben«, sagte ich.
Die Frauen kicherten, während Andrew den Kopf schüttelte und leise »arrogantes Arschloch« murmelte.
»Du verschwendest deine Zeit«, sagte Sanaa zu ihm. »Sawyers Gedächtnis ist unfehlbar.« Sie warf mir ein wissendes Lächeln zu. »Er könnte tagelang so weitermachen, und ich kann mir vorstellen, dass er auch sonst ein ziemliches Durchhaltevermögen hat.«
Mir entging weder die Zweideutigkeit ihrer Worte noch ihr einladender Blick. Mir wurde ganz warm, und mein Körper flehte mich an, meinen Entschluss noch einmal zu überdenken. Sanaa war schön und klug; sie war neu in der Gruppe, seit Jackson und noch ein Freund letztes Quartal den Abschluss gemacht hatten. Aber ich könnte ihr dasselbe sagen, was sie Andrew gesagt hatte. Sie verschwendete ihre Zeit. Die Tage, an denen ich irgendwelche Frauen abgeschleppt hatte, waren eindeutig VORBEI.
Beth war nicht entgangen, wie bewundernd Sanaa mich anlächelte. Sie sah uns alle an und verdrehte die Augen. »Diese Lerngruppe ist so was von gestört.« Sie blickte auf die Uhr. »Kommt. Wir müssen los.«
Wir sammelten unseren Kram zusammen, stopften Collegeblocks und Laptops zurück in unsere Taschen und warfen die leeren Kaffeebecher weg. Ich schlurfte meiner Lerngruppe hinterher aus dem Raum. Beth hatte recht. Selbst in Gedanken zählte ich diese Leute nicht zu meinen Freunden. Davon hatte ich ohnehin nicht mehr viele. Ich betrachtete Beth mit ihrem strengen Haarschnitt und Andrew, der sein Hemd bis zu den Ohren zugeknöpft hatte, und versuchte, sie mir bei einer unserer legendären Übeltäter-Partys vorzustellen. Ich versuchte, mir mich bei der nächsten Übeltäter-Party vorzustellen, und kriegte es nicht hin.
»Irgendwas nicht in Ordnung, Haas?«, fragte Andrew.
»Nope«, sagte ich und blinzelte, als wir in die stechende Sonne traten. »Erinnere mich nur gerade an ein Stück alte Geschichte.«
»Du kannst wahrscheinlich auch die Klassiker auswendig. Hast du irgendwas aus der Odyssee in deinem Superhirn?«
Ich begegnete unverwandt seinem Blick. »Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt … Klingt ganz nach dir, Andy.«
»Halt die Klappe. Und nenn mich nicht Andy.«
Sanaa verbarg ein Lächeln in ihrem Jackenkragen. »Wir sehen uns Montag«, sagte sie zu den anderen, dann stellte sie sich neben mich. »Du bist so gemein zu dem armen Andrew.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ich habe noch nie einen Typen getroffen, der so wenig Interesse daran hat, seine Schwächen zu verbergen.«
»Er ist nur neidisch. Er müht sich ab, um diese Sachen klarzukriegen, und dir fällt alles so leicht.«
Fast hätte ich darüber gelacht, wenn ich nicht so verdammt müde gewesen wäre.
»Also.« Sanaa warf ihr seidiges schwarzes Haar über die Schulter zurück. »Irgendwelche Pläne fürs Wochenende? Ich hab noch eine Karte für die Revivalists im Warfield morgen Abend.«
Ein paar lahme Ausreden kamen mir in den Sinn, aber ich war sogar zu müde, um irgendwelchen Quatsch zu erzählen. »Ich kann nicht. Bis zum Abschluss und der Zulassungsprüfung geh ich nicht aus.«
»Das klingt nicht sehr gesund.«
Ich zuckte noch einmal mit den Achseln und versuchte mich an einem Lächeln. »Trotzdem danke für das Angebot.«
»Okay«, sagte sie, und ihr eigenes Lächeln konnte die Enttäuschung kaum überspielen. »Dann bis Montag.«
»Jepp.«
Ich sah sie davongehen, und die Müdigkeit überwältigte mich.
Das tat sie manchmal, und es war wie ein Schlag in den Magen. Die langen Nächte und der Schlafmangel, Stress und Nervosität, das alles rammte mich mit voller Wucht. Kein Bier mit den Jungs. Keine Dates mit heißen Lernpartnerinnen. Kein Sex, keine Partys …
»Finde dich damit ab, Haas«, murmelte ich in den Wind, als ich losging. »Du hast es dir selbst eingebrockt.«
An der Muni-Haltestelle Civic Center stieg ich in eine Bahn der Linie J nach Duboce Triangle und sank auf dem Sitz zusammen. Der Zug war noch nicht so voll wie im Berufsverkehr während der Rushhour. Freitag war mein einziger früher Tag, keine Kurse am späten Nachmittag. Normalerweise war ich dann um vier zu Hause statt um fünf oder sechs.
Beim Rumpeln der Bahn fielen mir die müden Augen zu. Das Familiengesetz schien innen auf meine Lider projiziert zu werden – ein unangenehmer Nebeneffekt eines eidetischen Gedächtnisses. Je mehr ich mir etwas einprägte, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nie wieder loswurde.
… wenn ein Elternteil das Kind für die Zeitspanne eines Jahres in der Obhut und Sorge einer anderen Person lässt, ohne jede Zuwendung für den Lebensunterhalt des Kindes und ohne Nachricht, wird davon ausgegangen, dass dieser Elternteil das Kind verlassen hat …
Diese Worte würde ich niemals vergessen, und das sanfte Schlingern der Bahn beförderte mich in den August letzten Jahres zurück. Alte Geschichte. Damals war ich nicht müde. Noch nicht.
Das triste Gebäude mit dem Schild »Behörde für Jugend- und Familienhilfe« ragte auf der anderen Straßenseite in die Höhe. Der Himmel war bedeckt; ein kühler Wind traf mich, und ich packte das Bündel in meinen Armen fester. Es fühlte sich nicht wie Sommer an, sondern als würde ein kalter Winter einbrechen.
»Sag mir noch einmal, was passiert, wenn ich sie abgebe«, fragte ich.
Jackson warf mir einen argwöhnischen Seitenblick zu. »Sie werden versuchen, Molly ausfindig zu machen.«
»Das habe ich versucht und bin nicht weit gekommen.«
»Dann kommt das Kind in Pflege.«
»Pflege.« Ich betrachtete das schlafende Gesicht zwischen den Decken. Meine Arme wurden müde. Olivia war klein, aber sie in der Bahn und dann auf dem Weg über drei Querstraßen zu tragen, fiel mir schwerer als jedes Workout im Fitnessstudio des Hastings College. Ich hätte ein Uber genommen, aber ich hatte keinen Kindersitz.
Ich hatte gar nichts.
»Es ist das Beste«, sagte Jackson zum hundertsten Mal seit der Party vor sechs Tagen.
»Ja«, murmelte ich. »Das Beste.«
Er schenkte mir eine gedämpfte, mitfühlende Version seines Megawatt-Lächelns. »Los, komm. Es ist grün.«
Er stieß mich an, aber ich bewegte mich nicht. Ich blieb wie angewurzelt stehen.
Ich blickte über die belebten Straßen der Stadt. Der Wind pfiff zwischen den Betongebäuden hindurch, die überall um uns herum aufragten, kalt und glatt und grau. Ich versuchte, mir vorzustellen, in das Gebäude des Jugendamts zu gehen und das Baby irgendwelchen Fremden zu übergeben. Es wäre so leicht. Sie war so schwer, ich spürte das ganze Gewicht der Jahre, die vor mir lagen. Dabei musste ich sie nur abgeben und weggehen.
Aber Olivia fühlte sich schon an wie mit meinen Armen verschmolzen. Mit mir.
»Ich kann nicht.«
Das Lächeln meines Freundes erstarrte und erstarb dann. »Gott, Sawyer.«
»Molly hat sie mir anvertraut, Jax. Olivia ist mein Kind.«
Er starrte mich an. Dann schüttelte er den Kopf und drehte sich mit ausgebreiteten Armen an der Straßenecke um sich selbst. »Ich hab’s gewusst! Krieg ich keinen Preis dafür, Leute? Ich hab’s verdammt noch mal gewusst.«
Er blieb stehen und sah mich an.
»Ich hab es schon vor sechs Tagen gewusst. Nach der Party. Alle waren weg, und du hast auf der Couch zwischen Bierdosen und Plastikbechern gesessen und ihr ein Fläschchen gegeben, als gäbe es niemanden sonst auf der Welt. Du willst das wirklich tun? Sie großziehen? Du willst ein Baby großziehen, Sawyer?«
»Ich weiß es doch auch nicht, Jackson«, sagte ich. »Aber das hier fühlt sich falsch an. Hier zu sein fühlt sich verdammt falsch an.«
Jackson presste die Lippen zusammen. »Du behältst sie also? Wie? Mit welchem Geld?«
»Mein Stipendium …«
»Reicht gerade mal für die Uni und die Miete«, beendete Jackson den Satz. »Es ist nicht genug, um Kinderbetreuung zu bezahlen. Und so was ist teuer.«
»Ich krieg’s schon hin. Ich such mir einen Job.«
»Du willst dein Leben auf den Kopf stellen. Wofür?«
»Wofür? Für sie«, stieß ich hervor und beugte den Kopf zu dem Baby hinunter.
»Sie ist nicht …«
»Halt den Mund, Jax«, sagte ich scharf. »Molly hat sie verlassen, und, von jetzt an gerechnet, in einem Jahr wird das auch offiziell vor dem Gesetz so sein. Ich hab nachgeschlagen. Dann kann ich mich als Vater auf Olivias Geburtsurkunde eintragen lassen. Molly hätte das tun sollen, aber in einem Jahr ist es sowieso egal.«
Jackson sah mich lange an.
»Du musst einen Abschluss machen, Sawyer, und du musst die Zulassungsprüfung bestehen – und zwar beim ersten Mal, sonst kannst du dich von der Stelle bei Richter Miller verabschieden. Du wirst diesen Job verlieren und alles, wofür du gearbeitet hast.«
Ich biss die Zähne zusammen. Auch damit hatte er recht. Ich hatte alle Schritte meines Lebens so sorgfältig und konkret vorausgeplant. Das Jurastudium abschließen, die Zulassungsprüfung bestehen, die Stelle bei Richter Miller bekommen und dann meine eigene Karriere in der Strafverfolgung beginnen, vielleicht eine Kandidatur zum Bezirksstaatsanwalt. Wer wusste schon, wo ich von da aus hinkommen konnte? Ich blickte zu Olivia hinab und begriff, dass ich diese Dinge genauso sehr wollte wie zuvor.
Aber ich wollte auch sie.
Und außerdem würden meine Ziele einen Scheiß bedeuten, wenn ich sie erreichte, aber mir für immer und ewig den Kopf zerbrechen würde, was wohl aus ihr geworden war.
Jackson las das alles in meinen Augen. Er fuhr sich mit der Hand über das kurze Haar. »Sawyer, ich hab dich wirklich gern, Mann, und ich kapiere, dass du glaubst, das Richtige zu tun. Aber so hart du es dir auch vorstellst, es wird eine Million Mal härter werden.«
»Ich weiß.«
»Nein, ich glaube, das weißt du nicht. Meine Mutter hatte drei Jobs, je einen für mich und meine beiden Brüder. Drei Jobs, nur damit Essen für uns auf dem Tisch stand und wir ein Dach über dem Kopf hatten. So was wie ein Jurastudium kommt darin gar nicht vor.«
»Aber sie hat es geschafft, und jetzt beendet ihr jüngster Sohn sein Jurastudium«, sagte ich. »Sie ist stolz auf dich. Ich würde auch gern denken, dass meine Mom stolz auf mich wäre.«
»Das wäre sie, Mann«, sagte er leise. »Das weiß ich.«
Ich biss die Zähne zusammen gegen den alten Schmerz, verschloss ihn tief in mir. Ein betrunkener Fahrer hatte meine Mutter getötet, als ich acht gewesen war. Wenn ich alles zusammenzählte, was ihr meiner Meinung nach Grund geben könnte, stolz auf mich zu sein, war da außer meinem Vollstipendium für das Hastings College nicht viel.
Jackson seufzte, schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht.«
»Olivia ist mein Kind«, sagte ich. »Das weiß ich. Ich habe die Verantwortung, ich muss mich um sie kümmern.«
Jacksons Miene wurde weicher, und ein leises Lächeln ließ seine Mundwinkel zucken. »Fühlt sich an wie verkehrte Welt.«
»Frag mich mal«, sagte ich. Ich spürte, wie sich die Enge um mein Herz weitete und ich in einer Welle unbekannter starker Gefühle fast ertrank.
Meine Tochter.
»Und hilfst du mir jetzt oder was?«, fragte ich schroff. »Ich hab gehört, dieses Alleinerziehen soll total krass sein.«
»Und da zeigt sich wieder dein außergewöhnliches Gedächtnis.« Jackson grinste, dann verzog er das Gesicht. »Du wirst ausziehen müssen, das weißt du, oder? Die Jungs haben keinen Bock auf Drei Männer und ein Baby. Kevin hat jetzt schon Panik, wir könnten unsere Street Credibility verlieren.«
»Ich such mir was Neues.«
Jackson sah mich noch ein paar Sekunden länger an, dann blies er die Backen auf und lachte. Er nahm mir die Babytasche ab und hängte sie sich über die Schulter. »Mann, ist die schwer. Du hast echt nicht mehr alle Tassen im Schrank.«
Erleichtert stieß ich einen Seufzer aus. »Danke, Jax.«
»Schon gut, aber ruf mich nicht um zwei Uhr morgens an und frag nach Keuchhusten oder … wie heißen die noch … Fontanellen?«
Ich stieß ein Lachen aus, aber ein kalter San-Francisco-Windstoß trug es davon.
Ich verlagerte das Baby in meinen schmerzenden Armen, hielt sie dichter an mich gepresst. »Komm«, sagte ich zu ihr. »Gehen wir nach Hause.«
Ich schreckte aus dem Schlaf hoch, als das Kinn meine Brust berührte, und blinzelte benommen. Die Bahn hielt kreischend an der Haltestelle Duboce. Ich schulterte meine Tasche und stieg aus, ging die anderthalb Querstraßen zu dem cremefarbenen viktorianischen Haus, in dem ich eine Wohnung im ersten Stock gemietet hatte.
Ich ging an der Tür im Erdgeschoss vorbei, hinter der Elena Melendez wohnte, und warf ihr ein kleines Lächeln zu, dann schleifte ich meinen müden Arsch die Treppe hoch in den ersten Stock. In meiner Wohnung zog ich die Jacke aus, hängte sie an die Garderobe und warf meine Tasche darunter. Ich bog links direkt in die Küche ein, um einen Kaffee aufzusetzen, ging dann in den Wohnbereich zu meinem Schreibtisch am Fenster. Die Uhr zeigte 16:42. Theoretisch hatte ich noch achtzehn Minuten für mich.
Ich sackte auf dem Stuhl zusammen und schloss die Augen … dann öffnete ich sie wieder.
Ich wollte diese Minuten nicht, ich wollte mein Mädchen.
Ich nahm zwei Stufen auf einmal, als ich nach unten ging, und klopfte an Wohnung 1. Hector, Elenas fünfjähriger Sohn, öffnete die Tür.
»Hey, Hector«, sagte ich. »Kannst du deiner Mom sagen, dass ich hier bin?«
Er nickte, dass seine dunklen Haare flogen, und verschwand nach drinnen. »Sawyer?«, hörte ich, »Komm rein, Querido. Sie ist fertig.«
Ich trat in Elenas Wohnung, die nach Wärme, Gewürzen und Waschmittel roch. Es war eine Spur unaufgeräumt, aber nicht chaotisch. Heimelig. Hier wohnte eine Familie. Elena – eine füllige fünfundvierzigjährige Frau mit einem dicken dunklen Zopf, der ihr über den Rücken fiel, und großen, sanften Augen – beugte sich vor, um Olivia aus dem Laufstall zu heben.
Ich lächelte wie ein Idiot, als Olivias kleines Gesicht aufleuchtete, als sie mich sah. Ihre blauen Augen waren hell und klar, und ihre feinen dunklen Locken umrahmten ihre durch den Babyspeck eines dreizehn Monate alten Kindes rundlichen Bäckchen.
Sie streckte die Arme nach mir aus. »Daddy!«
Nicht Dada oder eine andere Verkürzung, sondern Daddy. Alle Buchstaben. Mein dummes Herz zog sich zusammen.
Elena übergab sie mir mit einem sanften Lächeln, und Olivia legte mir ihre Ärmchen um den Hals.
»Sie hatte einen schönen Tag. Hat das ganze Gemüse aufgegessen.«
»Wirklich? Warst du ein braves Mädchen?« Ich küsste Olivia auf die Wange und holte dann meine Brieftasche heraus. Olivia griff danach, und ich gab sie ihr, nachdem ich einen Scheck herausgeholt hatte. »Danke, Elena.«
»Immer gern, Sawyer«, sagte sie und steckte ihren Lohn für diese Woche ein. Sie umfasste Olivias kleines Handgelenk und schüttelte es leicht. »Wir sehen uns Montag, meine Süße.«
Ich nahm Olivia meine Brieftasche aus den Händen – und aus dem Mund – und hängte mir die Wickeltasche um. »Sag bye-bye.«
»Beibei«, sagte Olivia.
Elena verschränkte die Hände über ihrem Herzen. »Sie ist schon so klug, die Kleine. Wie ihr Daddy.«
Ich lächelte. »Komm, Livvie«, sagte ich. »Gehen wir nach Hause.«